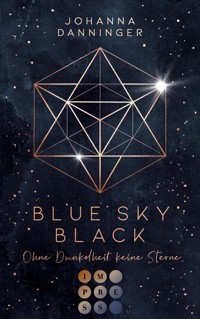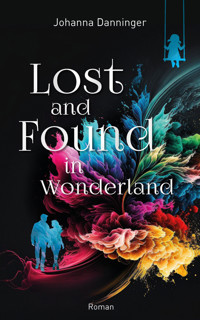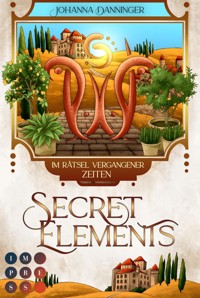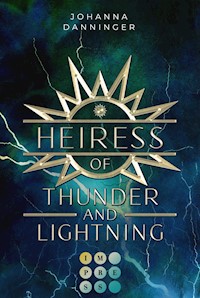5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Entdecke die Welt, die im Verborgenen liegt…** »Tiefgründig, gefühlvoll und absolut magisch.« (Magische Momente – Aly's Bücherblog) »Ein Must-Have für alle Fantasyliebhaber^^« (Fatma Saydam) Die 17-jährige Jay hält sich nur an ihre eigenen Regeln. Sie gilt als aufmüpfig und unkontrollierbar, versteckt ihr feuerrotes Haar und ihre blasse Haut unter schwarzen Klamotten und schlägt sich als Barkeeperin heimlich die Nächte um die Ohren. Bis ihr eine fremde Frau ein antikes Amulett überreicht, das kostbarste Geschenk, das sie je bekommen hat. Fatalerweise kann sie es, einmal angelegt, nicht mehr ablegen und befindet sich plötzlich in einem Geflecht aus übermenschlichen Agenten und magischen Bestimmungen. Dabei soll sie ausgerechnet der arrogante Lee, der Menschen grundsätzlich für schwach hält, beschützen. Wenn er nur nicht so unglaublich gut aussehen würde… //Textauszug: »Wir fliegen?«, schrie ich schrill. Lee bemerkte überheblich: »Aha, das kühne Menschenmädchen hat also Flugangst.« Mit zusammengekniffenen Augen musterte ich ihn. Sein schwarzes Haar glänzte wie das Gefieder eines Raben. Das Gesicht war so fein geschnitten, dass es etwas Edles an sich hatte. Unter anderen Umständen hätte ich Lee wahrscheinlich als attraktiv bezeichnet, würde nicht diese allumfassende Herablassung aus seinen dunkelblauen Augen sprechen. Er machte keinen Hehl daraus, was er von mir hielt, und das beruhte auf Gegenseitigkeit.// //Alle Bände der »Secret Elements«-Reihe: -- Secret Elements 0: Secret Darkness: Im Spiegel der Schatten (Die Vorgeschichte) -- Secret Elements 1: Im Dunkel der See -- Secret Elements 2: Im Bann der Erde -- Secret Elements 3: Im Auge des Orkans -- Secret Elements 4: Im Spiel der Flammen -- Secret Elements 5: Im Schatten endloser Welten -- Secret Elements 6: Im Hunger der Zerstörung -- Secret Elements 7: Im Rätsel vergangener Zeiten -- Secret Elements 8: Im Zeichen des Zorns -- Secret Elements 9: Im Licht göttlicher Mächte -- Die E-Box mit den Bänden 0-4 der magischen Bestseller-Reihe -- Die E-Box mit den Bänden 5-9 der magischen Bestseller-Reihe//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Johanna Danninger
Secret Elements 1: Im Dunkel der See
**Entdecke die Welt, die im Verborgenen liegt…**
Die 17-jährige Jay hält sich nur an ihre eigenen Regeln. Sie gilt als aufmüpfig und unkontrollierbar, versteckt ihr feuerrotes Haar und ihre blasse Haut unter schwarzen Klamotten und schlägt sich als Barkeeperin heimlich die Nächte um die Ohren. Bis ihr eine fremde Frau ein antikes Amulett überreicht, das kostbarste Geschenk, das sie je bekommen hat. Fatalerweise kann sie es, einmal angelegt, nicht mehr ablegen und befindet sich plötzlich in einem Geflecht aus übermenschlichen Agenten und magischen Bestimmungen. Dabei soll sie ausgerechnet der arrogante Lee, der Menschen grundsätzlich für schwach hält, beschützen. Wenn er nur nicht so unglaublich gut aussehen würde…
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Bonusgeschichte: Secret Scene
© privat
Johanna Danninger, geboren 1985, lebt als Krankenschwester mit ihrem Mann, einem Hund und zwei Katzen umringt von Wiesen und Feldern im schönen Niederbayern. Schon als Kind dachte sie sich in ihre eigenen Geschichten hinein. Seit sie 2013 den Schritt in das Autorenleben wagte, kann sie sich ein Leben ohne Tastatur und Textprogramm gar nicht mehr vorstellen. Und in ihrem Kopf schwirren noch zahlreiche weitere Ideen, die nur darauf warten endlich aufgeschrieben zu werden!
KAPITEL 1
Der Himmel war gespickt mit bauschigen Kuschelwölkchen. Wie eine Herde Lämmer tollten sie über den hellblauen Hintergrund. Unter ihnen wiegten sich Bäume mit jungem Blattwerk in einer sanften Brise und reckten sich der Frühlingssonne entgegen. Die Szenerie erstrahlte in perfekter Harmonie und Heiterkeit.
Und ich saß auf einem quietschenden Holzstuhl, der an Unbequemlichkeit kaum zu überbieten war, und durfte den beinahe kitschigen Anblick draußen durch eine mit fettigen Fingerabdrücken übersäte Fensterscheibe betrachten. Meine Hände strichen unablässig über die Tischkante vor mir. Der Lack hatte sich an den Ecken bereits gelöst und an einer Stelle sah es so aus, als hätte ich voller Frust in das Holz gebissen – was gar nicht so abwegig war.
»Jessica, könnten Sie bitte in eigenen Worten zusammenfassen, auf welchen Grundsätzen Georges Cuviers Evolutionstheorie beruht?«
Na toll, was soll das denn jetzt?, dachte ich genervt.
Ich blickte betont langsam auf. »Ja, das könnte ich.«
Der Typ war neu an der Schule und vertrat seit einigen Tagen unseren alten Biologielehrer, der sich beim Skifahren ein Bein gebrochen hatte.
Das war ein echtes Problem. Solche unerfahrenen Aushilfslehrer brauchten nämlich immer einige Zeit, bis sie herausgefunden hatten, dass alle Beteiligten hier ein glücklicheres Leben führen konnten, wenn sie mich einfach in Ruhe ließen. Außerdem war es im Allgemeinen nicht ratsam, mich mit meinem richtigen Namen anzusprechen. Ich hasste das.
»Also? Würden Sie uns freundlicherweise aufklären?«, fragte der Aushilfslehrer nach einer kurzen Pause.
Mir lag ein freches »Immer mit der Ruhe« auf der Zunge, doch ich seufzte nur gelangweilt.
»Cuvier war Verfechter des Katastrophismus«, erklärte ich. »Dieser Theorie nach vernichteten im Laufe der Erdgeschichte immer wieder riesige Katastrophen einen Großteil der Lebewesen und in den darauffolgenden Phasen entstand neues Leben. Cuvier glaubte angeblich, dass Gott die Welt nach jeder Katastrophe neu erschaffen habe, doch diese Behauptung lässt sich nicht in seinem Werk belegen.«
Der Lehrer forschte einen Moment nach Fehlern in meiner Zusammenfassung. Er war sichtlich überrascht, keine zu finden, und überspielte seine Enttäuschung mit einem dümmlichen Lächeln. »Die These der göttlichen Schöpfung lassen wir lieber außen vor. Schließlich brauchen meine theologischen Kollegen auch noch etwas, worüber sie unterrichten können.«
Unterstützendes Glucksen erklang aus den Reihen der Schleimer und Streber. Das taten sie immer, sobald sie glaubten, ein Lehrer hätte einen Witz gerissen. Wirklich armselig.
»Hey, Blacky«, flüsterte Gustav, der hinter mir saß, »ich hab auch eine Theorie – nämlich dass du von einem Raben abstammst.«
Ich kippte mit meinem knarrenden Holzstuhl zurück und antwortete leise: »Würde ich Gustav heißen, würde ich mich bezüglich Federvieh-Theorien lieber zurückhalten.«
Er verstummte. Vermutlich würde er eine Weile brauchen, bis er meine Anspielung auf die berühmte Gustav-Gans-Comicfigur überhaupt verstanden hatte. Zufrieden knarrte ich mit dem Stuhl wieder nach vorne.
Meine Finger fanden wie von selbst zurück an die Tischplatte und knibbelten an dem Lack herum. Das Schwarz meiner lackierten Nägel bildete dabei einen krassen Kontrast zu dem Weiß, das es zu beseitigen galt.
Eigentlich mochte ich Farben. Selbst das Kotzgrün, das irgendein Spinner für die Innentüren unserer Schule gewählt hatte. Trotzdem war ich schon vor Jahren dazu übergangen, mich ausschließlich in dunkle Klamotten zu hüllen. Vorwiegend schwarze. Inklusive schwarzer Mütze, unter der ich meine auffällig roten Haare verbarg. Wenn man nicht gerade vor dem knallig bunten Hundertwasserhaus stand, hatte diese Art von Kleidung nämlich einen entscheidenden Vorteil – man fiel nicht besonders auf. Und ich hatte gelernt, dass mein Leben dadurch um einiges leichter wurde.
Okay, das mit dem Unauffälligsein funktionierte bei mir nicht immer. In der neunten Klasse versenkte ich meinen Mitschüler Steffen Grübers mit dem Kopf voran in einer Mülltonne. Dass er eine Jahrgangsstufe über mir und noch dazu dreißig Zentimeter größer war als ich, spielte dabei keine Rolle. Dass er mir meine Mütze vom Kopf gerissen hatte, allerdings schon. Da hörte der Spaß nun mal auf.
Das Gute daran war, dass ab diesem Zeitpunkt die ganze Schule erkannte, dass man sich lieber nicht mit mir anlegen sollte. Das Schlechte – jeder kannte nun das schwarzgekleidete Mädchen mit den feuerroten Haaren und zerriss sich das Maul darüber.
Doch das Getratsche störte mich kaum. Es hatte durchaus Vorteile, dass ich als sozial gestörte Außenseiterin entlarvt worden war. So machten alle meist einen weitläufigen Bogen um mich und beschränkten sich auf dümmliche Kommentare à la Gustav Gans.
Im Großen und Ganzen hatte ich in der Schule also meine Ruhe. Die unverhohlenen Blicke, die mich ständig durch das Gebäude begleiteten, hatte ich zu ignorieren gelernt. Alle warteten mit Spannung darauf, eines Tages wieder einen totalen Ausraster von mir zu erleben, während sich gleichzeitig keiner traute, mich zu provozieren. Doch ich wollte den Sensationsgierigen sowieso keine Show mehr bieten. Ich konnte mir einen weiteren Fehltritt schlichtweg nicht erlauben. Besonders nach dem letzten Vorfall im Sportunterricht, bei dem ein Volleyball und die blutige Unterlippe von Veronika Glas eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hatten. Damals hatte der Direktor klare Worte an mich gerichtet: »Wenn ich Sie noch ein einziges Mal in mein Büro zitieren muss, fliegen Sie von der Schule!«
Eine Ansage, die mich durchaus schockierte. Jetzt von der Schule zu fliegen, hätte alles zerstört. Ich steckte mitten in der elften Klasse, das Abitur war in greifbarer Nähe – mein Fahrschein in die Zukunft. In ein Leben, in dem ausschließlich ich selbst bestimmen konnte, was ich mit ihm anstellen wollte.
Als Vollwaise hatte ich mich siebzehn Jahre lang den Entscheidungen von Sozialämtern und irgendwelchen Erziehern beugen müssen. Im kommenden Herbst würde ich endlich achtzehn werden. Der erste Schritt in die Unabhängigkeit. Aber bis zu meinem Schulabschluss durfte ich noch die staatliche Obhut des Waisenheims genießen. Das Angebot meiner Heimleitung, dass ich bis zum Abitur dort wohnen durfte, kam mir ganz recht. Ich konnte weiterhin Geld sparen und mich voll und ganz auf die Vorbereitungen für mein Studium konzentrieren.
Ich blickte wieder aus dem Fenster und betrachtete die kitschigen Schäfchenwolken, die über den Horizont tollten.
Nicht mehr lange und ich würde ebenso frei sein.
***
Mein Alltag war in der Regel unspektakulär. Auch an diesem Tag trottete ich nach der Schule artig zurück ins Heim, genoss das matschige Mittagessen, das aus mysteriösen Gründen immer nach Karotten schmeckte, und begab mich in die nachmittägliche Hausaufgabenbetreuung.
Wirklich betreut wurde hier selten jemand. Im ganzen Raum herrschte ein heilloses Durcheinander, das von einem bunt zusammengewürfelten Haufen Teenager veranstaltet wurde, die nicht im Mindesten an Hausaufgaben interessiert waren. Bis auf einige wenige, ich eingeschlossen. Und diese wenigen mussten zusehen, wie sie inmitten des Tohuwabohus klarkamen. In einer Ecke saß zwar durchaus eine Erzieherin, doch die betrachtete ihre Aufgabe bereits als zufriedenstellend erledigt, wenn niemand ernstlich verletzt wurde.
Vielleicht sollte ich erwähnen, dass ich in einem Heim für »schwierige Fälle« wohnte.
Schwierige Fälle waren so ein Mittelding zwischen »normal« und »schwer erziehbar«. Das Heim beherbergte also Jugendliche, die keiner haben wollte, die für die Justizvollzugsanstalt allerdings nicht genügend Straftaten begangen hatten. Dazu kamen noch die Kids aus sozialen Brennpunkten, die es hier bestimmt besser hatten als bei ihren drogensüchtigen Eltern, diesen Umstand jedoch noch nicht erkannten. Und die psychisch Gestörten, die es aus verschiedenen Gründen immer wieder schafften, einer Zwangseinweisung in die geschlossene Abteilung einer Klinik zu entgehen.
Ich selbst war wohl eine Mischung aus allem. Wobei ich nicht wusste, ob meine Eltern drogensüchtig waren, denn niemand kannte sie. Ich war ein sogenanntes Findelkind.
Früher hatte ich die romantische Vorstellung gehabt, in einem Weidenkorb einen Bach hinabgeschwommen zu sein. Hineingebettet von meiner Mutter, die mich vor einer großen Bedrohung schützen wollte und mir bittere Tränen nachweinte, während ich ins Ungewisse davontrieb.
Die nüchterne Wahrheit bestand allerdings darin, dass ich als Neugeborenes durch eine Babyklappe geschoben worden war, weil meine Mutter mich nicht haben wollte. Warum auch immer.
Ich fragte längst nicht mehr danach. Es konnte mir ja doch keiner eine Antwort darauf geben und inzwischen war ich mir sicher, dass ich die auch gar nicht wissen wollte. Immerhin war es besser, keine Familie zu haben, als eine wie die meiner Mitbewohner.
Ein Papierflieger traf auf meinen Kopf. Ohne von meinem Mathebuch aufzusehen, zerknüllte ich ihn mit einer Hand und ließ ihn zu Boden fallen. Gelächter ertönte neben mir, begleitet von einem »Sorry, Jay!«.
Ich akzeptierte die Entschuldigung, indem ich kurz meinen Mittelfinger hochstreckte, dann konzentrierte ich mich wieder auf mein Schulbuch.
Im Heim wurde ich nicht so sehr gemieden wie in der Schule. Die Jugendlichen hier waren keine verhätschelten Kinder aus wohlhabendem Haus, die Konflikte durch Petzen beim Lehrer austrugen. Sie fochten ihre Kämpfe selbst aus, verbal oder körperlich. Und meine Mitbewohner fürchteten sich nicht vor mir, sondern respektierten mich. Obwohl ich auch im Heim als Außenseiterin galt, weil ich grundsätzlich die Gesellschaft anderer mied, wurde ich von allen als ihresgleichen akzeptiert und als jemand, der in Auseinandersetzungen selten den Kürzeren zog.
Kaum hatte ich meine Hausaufgaben erledigt und in meinen abgewetzten Rucksack gepackt, sah ich im Augenwinkel Dennis zu mir herüberschlendern. Ich stöhnte leise.
Nicht der schon wieder!
Dennis war ein ganzes Jahr jünger als ich und er war der verqueren Meinung, der Justin Bieber unseres Heims zu sein. Tatsächlich himmelten die meisten Mädels ihn an und bettelten geradezu, auf seine sogenannte »Bitch-Liste« aufgenommen zu werden. Diese Liste gab es wirklich, und als wäre das nicht schon bescheuert genug, hatte es sich dieser Pseudo-Mini-Gangster vor einiger Zeit auch noch in den Kopf gesetzt, mir einen Ehrenplatz darauf einzuräumen. Was ich von seinem Plan hielt, hätte ihm spätestens nach dem blauen Auge klar werden müssen, das ich ihm vor kurzem verpasst hatte. Das Veilchen war kaum verheilt, und er hatte die Botschaft offensichtlich immer noch nicht verstanden.
Ich war gerade im Begriff, mich von meinem Lernplatz zu erheben, als Dennis auch schon neben mir stand und mir den Weg versperrte.
»Hey, du«, begrüßte er mich in gewohnt säuselndem Tonfall, der wohl erotisch klingen sollte. »Na? Bist du endlich fertig mit büffeln?«
»Wow!«, staunte ich. »Bist du da etwa selbst drauf gekommen? Ich bin beeindruckt.«
Mein Sarkasmus prallte wirkungslos an Dennis ab.
»Was machst du heute noch so?«, wollte er wissen.
»Nichts, was irgendwie mit dir zusammenhängen könnte.«
»Hm.« Er fuhr sich durch seine dunkelblonde Topfschnittfrisur. »Hast du vielleicht Bock, mit mir in die City zu gehen? Ich kenne da ein cooles Café, das …«
»Verzieh dich einfach«, unterbrach ich ihn und ballte demonstrativ eine Faust. »Oder muss ich es dir noch einmal erklären?«
»Komm schon, Jay. Wir hatten einen schlechten Start. Lass uns doch einfach noch mal von vorn anfangen.«
Unglaublich!
Ich stand auf und richtete mich zu meiner vollen Größe auf, so dass ich den säuselnden Wicht immerhin um eine Handbreit überragte. Mit zusammengekniffenen Augen fixierte ich sein Milchgesicht. »Wenn du mich noch einmal anquatschst, wird sich bei dir noch was ganz anderes blau färben als dein Auge.« Ich schulterte meinen Rucksack. »Und jetzt geh mir aus dem Weg, bevor ich dich noch aus Versehen ankotze.«
Sein Selbsterhaltungstrieb brachte ihn wohl dazu, zur Seite zu treten. Die anderen Triebe in seinem unterbelichteten Gehirn ließen ihn dämlich grinsen. »Glaub mir, Süße, du verpasst etwas ganz Gewaltiges.«
Der hat doch echt einen an der Klatsche!
Es war nie klug, eine Rauferei unter den Augen einer Erzieherin anzuzetteln. Immerhin waren die ausschließlich dafür verantwortlich, dass so etwas eben nicht passierte. Ich hielt mich daher lieber zurück und sparte meine Kräfte für ähnliche Situationen in den unbeobachteten Fluren des Gebäudes.
Statt Dennis also einen kräftigen Tritt in die Eier zu geben, wandte ich mich an eine seiner Verflossenen, die leider erst im Nachhinein von der »Bitch-Liste« erfahren hatte. »Kathrin, was sagst du dazu? Ist der denn wirklich so gewaltig, den der liebe Dennis da mit sich rumschleppen muss?«
»O ja! Mir sind beinahe die Tränen gekommen, so gewaltig klein war der!«
Perfekt. Die Gehässigkeit eines gebrochenen Herzens war eben nicht zu unterschätzen.
Alle Anwesenden gackerten lauthals los, während Dennis augenblicklich puterrot im Gesicht wurde. Mit einem hämischen Grinsen schritt ich an ihm vorbei und hörte das Gebrüll des darauffolgenden Streits noch weit durch den Flur hallen.
KAPITEL 2
Es war Samstag. Noch dazu ein wunderschöner. Der April machte ja bekanntlich, was er wollte, und an diesem Tag wollte er sich offenbar von seiner besten Seite zeigen.
Ich freute mich unbändig darüber, weil ich den stickigen Hallen des Heims bei dem herrlichen Wetter gut entkommen konnte. Pflichtbewusst hatte ich mich am Vormittag bei der Heimaufsicht abgemeldet, mit dem Versprechen, zum Abendessen wieder zurück zu sein. Nach einem Abstecher zur Stadtbibliothek war ich schließlich im botanischen Garten gelandet. Die große Parkanlage war schon immer mein persönlicher Zufluchtsort gewesen.
Ich hatte fast mein ganzes Leben in der Großstadt verbracht und hasste diesen abgasverseuchten Betondschungel. Der Geräuschpegel war konstant hoch, die Menschen ständig in Hast und an jeder Straßenecke stank es nach Pisse.
Inmitten des botanischen Gartens hatte ich das Gefühl, endlich wieder frei durchatmen zu können. Man hörte den Straßenverkehr zwar weiterhin, aber das Rauschen der hohen Bäume, die rund um den Park standen, ließ mich Motorenlärm und Hupkonzerte schnell vergessen. Gepflegte Fußwege durchzogen die gesamte Anlage. Gesäumt von duftenden Blumenrabatten und exotisch aussehenden Stauden, führten sie sternförmig zum Herzen des Parks, das ein wunderschöner Springbrunnen aus weißem Stein bildete.
Auf einer Bank vor dem Brunnen ließ ich mich im Schneidersitz nieder. Ich schloss für einen Moment genießerisch die Augen. Auch wenn ich nicht allein hier war, da das schöne Wetter viele Menschen in den Park lockte, wiegte mich das Plätschern des Wasserspiels und das Zwitschern der Vögel für einen Augenblick in wohltuender Ruhe. Alles erschien harmonisch und ausgewogen, so wie es nur die Natur zu Stande brachte. Mit tiefen Atemzügen sog ich die Luft ein. Sie schmeckte warm und erdig, ein wenig nach dem Sommer, der bereits an die Tür klopfte. Ich konnte das klare, frische Wasser des Brunnens förmlich riechen. Eine leichte Brise ließ eine Haarsträhne tanzen, die sich unter meiner Mütze hervorgestohlen hatte. Sie kitzelte mich an der Wange, doch ich gönnte ihr den kleinen Tanz mit dem Wind.
Mit einem Mal erschien mir mein Dasein weniger frustrierend. Solche glücklichen Momente im Park zeigten mir immer wieder, dass das Leben mehr zu bieten hatte.
Ich öffnete die Lider und gab ein leises Seufzen von mir. Dann holte ich meine neueste Errungenschaft aus der Bibliothek hervor und schlug sie in meinem Schoß auf. Keine Minute später war ich komplett in meine Lektüre vertieft.
Zwischen den Seiten eines interessanten Buches verlor man schnell jedes Zeitgefühl, darum konnte ich nicht sagen, wie lange es dauerte, ehe ich bemerkte, dass sich jemand neben mich gesetzt hatte – und mich auch noch ziemlich unverfroren anstarrte.
Mit grimmiger Miene wandte ich den Kopf zu dem ungebetenen Gast auf meiner Bank, doch meine Züge entspannten sich gleich darauf wieder. Neben mir saß kein Kerl, der mich anbaggern wollte, sondern nur eine harmlose alte Frau. Sie lächelte mich freundlich an und schien überhaupt nicht peinlich berührt zu sein, dass ich sie beim Beobachten erwischt hatte.
Ich erwiderte ihr Lächeln. Die Frau strahlte eine derartige Herzlichkeit aus, dass keine andere Reaktion möglich schien. Obwohl ich sie noch nie gesehen hatte, spürte ich sofort aufrichtige Sympathie für sie. Sogar mehr als das. Ich wusste ohne den geringsten Zweifel, dass ich dieser alten Frau vertrauen konnte. Und genau das erstaunte, ja erschreckte mich zutiefst. Denn wenn ich in meinem Leben etwas gelernt hatte, dann war es, dass man mit Vertrauen sparsam umgehen musste. Zu oft hatte man mir ebenjenes gebrochen, so dass ich inzwischen nur noch mir selbst vertraute.
Gewissermaßen durcheinander musterte ich die Frau, deren Lächeln kein bisschen nachließ. Bei genauerer Betrachtung wirkte sie gar nicht mehr so alt. Ihr schneeweißes Haar ließ zwar auf ein hohes Alter schließen, doch es wallte so dicht und kräftig über ihre Schultern, wie es bei über Siebzigjährigen wohl selten vorkam. Die helle Haut ihres runden Gesichtes war glatt und gleichzeitig von feinen Fältchen durchzogen. Vor allem ihre Mund- und ihre Augenpartie schienen von vielen, vielen Jahren des Lachens geprägt. Inmitten der Lachfältchen stachen ihre Augen ganz besonders hervor. Nie zuvor hatte ich solch durchdringend hellblaue Augen gesehen. Voller Kraft und Energie, wie das Leben selbst. Je länger ich die Frau betrachtete, umso weniger konnte ich ihr Alter schätzen. Es war äußerst merkwürdig.
»Eine seltsame Lektüre für eine solch junge Dame«, bemerkte die Frau.
Ich brauchte eine Sekunde, um mich zu sortieren.
»Ähm. Na ja, ich interessiere mich eben sehr für das Thema«, erklärte ich.
»Quantenfeldtheorie?«
»Ja. Überhaupt finde ich Teilchenphysik ungemein spannend.« Ich rutschte umständlich in eine andere Sitzposition. »Vor allem weil es immer noch so viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen.«
Die Fremde legte ihren Kopf leicht schräg. »Falls Gott die Welt geschaffen hat, war seine Hauptsorge sicher nicht, sie so zu machen, dass wir sie verstehen können.«
»Das ist ein Zitat von Albert Einstein!«, stellte ich überrascht fest.
Sie nickte bestätigend.
»Ich bewundere Einstein«, sagte ich. »Er ist so was wie mein Held. Ihn hätte ich unheimlich gerne einmal kennengelernt.«
»Ja, Einstein war ein bewundernswerter Mann«, bestätigte die Frau in einem Tonfall, als hätte sie den Physiker persönlich gekannt. »Die Menschheit hat ihm viel zu verdanken.«
»Allerdings.«
Die Fremde strich eine weiße Haarsträhne aus ihrer Stirn. »Wie heißt du, Liebes?«
Ich war kurz davor, ihr meinen verhassten richtigen Namen zu nennen, besann mich jedoch schnell eines Besseren.
»Jay.«
»Jay«, wiederholte sie. »Ein ungewöhnlicher Name.« Sie hielt mir eine Hand entgegen. »Mein Name ist Danu.«
»Auch ein ungewöhnlicher Name«, erwiderte ich schmunzelnd und ergriff die mir dargebotene Hand.
Bei der Berührung verspürte ich ein seltsames Kribbeln. Angenehme Wärme kroch von meinen Fingerspitzen den ganzen Arm hinauf. Verwundert sah ich Danu an, doch die lächelte nur weiter ihr unerschütterliches Lächeln und löste langsam ihre Hand aus meiner.
Was, bitte schön, war das denn gerade?
»Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen«, sagte Danu und stand auf. »Leider muss ich jetzt gehen, aber ich wünsche dir noch eine angenehme Zeit zwischen Teilchen und Materie.«
»Danke, die werde ich bestimmt haben«, antwortete ich höflich und beäugte ihre seltsame Kleidung, die mir bislang gar nicht aufgefallen war. Ihr Kleid sah so ähnlich aus wie ein Sari, das traditionelle Wickelgewand der Inderinnen. Nur nicht so reich verziert und bunt, sondern einzig aus schlichtem Leinen. Der Stoff reichte bis ganz zum Boden hinab, doch als Danu aufgestanden war, glaubte ich kurz, ihre nackten Füße gesehen zu haben.
Die Frau schien meine Verwunderung über ihr Outfit nicht zu bemerken. Sie winkte fröhlich und wandte sich zum Gehen.
Da erregte ein Glitzern neben mir meine Aufmerksamkeit. Auf der Sitzfläche der Bank lag eine silberne Kette. Hastig ergriff ich das Schmuckstück und sprang auf.
»Warten Sie!«, rief ich laut. »Sie haben etwas verloren!«
»O nein, ganz im Gegenteil«, antwortete Danu geheimnisvoll. Sie zwinkerte mir zu. »Das ist ein Geschenk für dich.«
Sprachlos starrte ich auf die Kette in meiner Hand. Ein rundes, antikes Amulett war daran befestigt. Es sah sehr alt aus. Das Material war nicht Silber, wie ich im ersten Augenblick gedacht hatte. Was es wirklich war, vermochte ich allerdings nicht zu sagen. Es war dunkelgrau und reflektierte mit einem samtigen Schimmern das Licht der Sonne.
Ich schüttelte den Kopf und hielt Danu die Kette hin. »Das kann ich nicht annehmen.«
»Wieso denn nicht?«
»Das Amulett ist bestimmt sehr wertvoll.«
»Nun, wertvoll ist es ganz sicher. Doch aus welchem Grund solltest du es nicht annehmen können?«
»Aber wir kennen uns doch gar nicht!«
Danu schnalzte tadelnd mit der Zunge. »Willst du etwa die Entscheidung einer alten Frau bezweifeln? Jetzt nimm es an und pass gut darauf auf.«
Wieder schüttelte ich den Kopf. »Aber …«
»Gern geschehen«, sagte Danu nachdrücklich. Dann überlegte sie kurz. »Im Übrigen hat Einstein auch einmal gesagt: ›Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.‹ Merk dir diesen Satz, meine Liebe, denn man kann wahrlich nicht alle Wunder dieser Erde mit mathematischen Formeln erklären. Mach’s gut, Jessica!«
Damit ließ sie mich stehen. Ein antikes Schmuckstück in der Hand und fassungslose Falten auf der Stirn. Und mit der aufkeimenden Frage, woher sie plötzlich meinen echten Namen wusste. Allerdings war Danu bereits hinter einer Wegbiegung verschwunden, ehe ich diese Tatsache überhaupt bemerkte.
»Danke«, flüsterte ich und schloss meine Finger um das sicher kostbarste Schmuckstück, das ich jemals besessen hatte.
***
Am Abend saß ich in meinem Zimmer und hatte das geheimnisvolle Amulett neben mir auf meine Bettdecke gelegt.
Meine Zimmergefährtin Birgit war bereits beim Abendessen. Besser gesagt, sie tat so, als würde sie essen. Birgit litt nämlich unter einer besorgniserregenden Essstörung. Ich war also allein in unserem Zimmer und völlig in den Anblick des Amuletts versunken.
Es hatte einen Durchmesser von ungefähr fünf Zentimetern. Vier verschiedene Symbole waren darin eingraviert. Sie erinnerten an Runen, wirkten dafür aber viel zu verschnörkelt. Filigrane Blütenblätter umgaben diese Symbole in symmetrischer Anordnung, was als Gesamtmotiv wie eine hübsche Blume aussah.
Fasziniert strich ich mit dem Zeigefinger über das fremdartige Metall. Obwohl ich mir inzwischen gar nicht mehr sicher war, ob es sich bei dem Material überhaupt um Metall handelte. Es fühlte sich eher wie eine Art Stein an. Prüfend wog ich das Schmuckstück in meiner Hand.
Nein, ein Stein dieser Größe wäre um einiges schwerer.
Vom Flur her drang schallendes Gelächter durch meine Zimmertür. Hastig steckte ich das Amulett in die Bauchtasche meines Pullovers und behielt es dort, bis sämtliche Geräusche um mich herum verstummt waren.
Danu hatte gesagt, ich solle gut auf das Schmuckstück aufpassen, und genau das wollte ich auch tun.
Wie praktisch, dass ich mir schon vor Jahren einen provisorischen Tresor geschaffen hatte, in dem ich mein mühsam erspartes Bargeld aufbewahrte. Er bestand aus einer alten Keksdose, die genau in ein Loch unter einer losen Fußbodendiele passte, auf der mein Nachtkästchen stand. Es war nicht leicht gewesen, diese Holzdiele ohne vernünftiges Werkzeug herauszuhebeln, und mit Sicherheit war es in gewissem Maße auch gesundheitsgefährdend, das staubige Etwas darunter herauszukratzen, das vor Jahrzehnten jemand mal als Isolierung bezeichnet hatte.
Die Mühe hatte sich definitiv ausgezahlt und das Amulett an diesem sicheren Ort zu wissen, ließ mich in aller Ruhe hinunter in den Speisesaal marschieren.
***
Nach dem Essen hatte ich leider keine weitere Gelegenheit, das Schmuckstück aus seinem Versteck hervorzuholen, denn Birgit machte keine Anstalten, unser Zimmer an diesem Abend wieder zu verlassen. Nicht einmal, um noch ein zweites Mal kotzen zu gehen. Dabei malträtierte sie sich schon wieder seit einer Weile selbst mit einem dieser abartigen Modemagazine, in denen kein Model auch nur annähernd vierzig Kilo wog.
»Warum schaust du dir diesen Schund immer wieder an?«, wollte ich von ihr wissen, während ich meine Jacke überstreifte. »Diese dürren Weiber sehen doch total beschissen aus.«
Birgit schürzte beleidigt die Lippen. »Entweder hast du keinen Sinn für Ästhetik oder du bist einfach nur neidisch.«
Na klar …
»Neidisch?« Ich schnaubte. »Auf diese Knochengerüste? Nee, wirklich nicht. Ich bin froh darüber, dass ich Brüste und einen Hintern hab. So erkennt man nämlich, dass ich eine Frau bin.«
Ich zog den Reißverschluss hoch, der in den oberen Regionen deutlich spannte, und deutete zum Beweis auf den entsprechenden Bereich. »Na, wo hast du denn deine versteckt?«
Okay, für jemanden, der sich meistens in Kleidung hüllte, die man gemeinhin als figurumspielend bezeichnete, klopfte ich gerade ganz gewaltige Sprüche.
»Halt die Schnauze, Jay«, zischte Birgit. »Sonst mach ich hinter dir heute einfach mal zu!«
»Du weißt, dass mich das nicht aufhalten würde«, meinte ich gelassen und öffnete das einzige Fenster im Raum. Kühle Nachtluft schlug mir entgegen. Ich setzte mich auf das Sims und schwang die Beine herum, so dass sie vom zweiten Stock herunterbaumelten.
»Ehrlich jetzt!«, beharrte Birgit wütend. »Ich hab keinen Bock, immer bei offenem Fenster zu schlafen, nur weil du illegal anschaffen gehst! Was, wenn hier mal ein Verbrecher einsteigt? Wenn du nicht bald damit aufhörst, erzähl ich es der Heimleitung!«
Genervt wandte ich mich nochmals zu ihr um. Es hatte schon beinahe etwas Nostalgisches, wie meine Bettnachbarin da im geblümten Nachthemd zwischen ihren Kissen zeterte, nur weil ich ein bisschen die Hausregeln brach.
»Erstens gehe ich nicht anschaffen, sondern arbeite einfach hinter einer Bar. Zweitens – wie du mir, so ich dir. Wenn du mich verpfeifst, wird mir wohl das Versteck deiner Abführmittel-Sammlung herausrutschen.«
Birgit öffnete den Mund.
»Spülkasten, dritte Toilette von links«, sagte ich nur, was sie augenblicklich von einer Erwiderung abhielt. »Und drittens … Was sollte ein Verbrecher denn von dir wollen? Du hast ja nicht einmal Titten.«
Mit diesen zugegebenermaßen ziemlich fiesen Abschiedsworten stieß ich mich mit einer routinierten Drehung vom Fenstersims ab und landete mit einem leisen »Dong« an der alten Regenrinne, die direkt neben unserem Fenster nach unten führte. Ich kletterte daran hinunter und erreichte schneller als über jede Treppe den Hinterhof des Heims. Diesen Ausgang hatte ich schon so oft benutzt, dass ich jeden Handgriff auswendig konnte. Wirklich praktisch, so ein Metallrohr.
Der hohe Maschendrahtzaun, der das Gelände des Jugendheims umgab, hielt mich nicht davon ab, unentdeckt in die nächtliche Stadt zu gelangen. Seit jemand einige Maschen des Zauns durchtrennt hatte, so dass er sich an dieser Stelle wie ein Vorhang auf- und zuklappen ließ, konnte man meinen geheimen Fluchtweg fast schon als komfortabel bezeichnen.
Das Lokal, in dem ich arbeitete, lag nicht weit vom Heim entfernt. Zumindest nicht, wenn man Schleichwege und Abkürzungen kannte, wie ich es tat. Sie führten über den Hinterhof einer Bäckerei, an den Garagen eines Wohnblocks entlang und durch zwei enge Nebengassen. Alles recht unangenehme Örtlichkeiten für eine Siebzehnjährige, die nachts allein durch einen Stadtteil unterwegs war, der in der Drogenszene als wichtiger Umschlagplatz galt. Doch ich fürchtete mich nicht, denn ich war davon überzeugt, mit allem und jedem fertigzuwerden. Außerdem war die Dose Pfefferspray in meiner Jackentasche auch nicht ganz zu verachten.
Nach meinem kurzen Fußmarsch erreichte ich das Green Goose. Birgit hatte nicht ganz Unrecht mit ihrer Behauptung, dass ich illegal dort arbeitete. Allerdings profitierten der Barbesitzer und ich gleichermaßen von diesem Arbeitsverhältnis, das durch keinerlei Vertrag festgehalten war. Ich konnte ihm verschweigen, dass ich noch minderjährig war, und er konnte verschweigen, dass er eigentlich für einen weiteren Angestellten Sozialversicherung löhnen müsste.
»Hi, Karl, alles klar?«, begrüßte ich den schwarz gekleideten Hünen neben der Eingangstür.
»Jay«, sagte er nur mit einem Kopfnicken.
Mehr war auch nicht zu erwarten. Karl war kein Mann der großen Worte. Seine Oberarme sprachen meist für sich.
Das Wummern von Bässen begrüßte mich im Flur neben der Garderobe. Ich bezweifelte, dass sich um diese Zeit schon Gäste hier befanden, darum war die Lautstärke extrem übertrieben. Wahrscheinlich hatten wir wieder einmal einen neuen DJ, der so aus dem Häuschen über seine heroische Aufgabe war, dass er jede Minute davon auskosten wollte.
Die Tür des vorderen Lagerraums schwang auf und eine große Pappschachtel quetschte sich durch den Rahmen. Dahinter kam der braune Lockenkopf meiner Ausschankkollegin Sina zum Vorschein. Sie mühte sich sichtlich mit dem großen Karton ab und ich eilte ihr schnell zu Hilfe.
»Danke, Jay«, schnaufte sie. »Das Zeug ist schwerer, als ich dachte.«
Mit vereinten Kräften schleppten wir den Karton in den Hauptraum und wuchteten ihn auf den Tresen.
»Was ist da drin?«, schrie ich. Die Musik war einfach abartig laut.
Sina holte erklärend eine Handvoll Bierdeckel aus der Schachtel hervor. Sie waren knallrot und wie ein Kussmund geformt, mit der Werbung eines neuen Alkopop-Getränks darauf.
»Das Zeug schmeckt total beschissen«, sagte ich.
»Was?«
»DAS ZEUG … ach, warte kurz.«
Ich stapfte quer über die Tanzfläche. Mein Ziel war das DJ-Pult, hinter dem wie vermutet ein mir unbekannter Jüngling hockte. Einer von der Sorte, die tagsüber ihre Ausbildung zum kaufmännischen Fachangestellten in der Küchenabteilung eines Möbelhauses absolvierten und nach Sonnenuntergang glaubten, sie könnten einen auf Turntable-Gottheit machen, um Weiber aufzureißen.
Der Bursche sah tatsächlich hocherfreut aus, dass sein erstes Groupie bereits im Anmarsch war. Allerdings wirkte er ziemlich entsetzt, als das Groupie an seinem erhöhten Podest vorbeimarschierte und mit einem Ruck den Stromstecker des Hauptverteilers herauszog.
»Ey! Was soll das?«, mokierte er sich durch die wohltuende Stille hindurch.
Vom Tresen erklang Sinas amüsiertes Kichern.
»Siehst du hier irgendwelche Gäste?«, fragte ich den Kerl, dem die pubertären Pickel noch überdeutlich auf der Stirn sprossen.
Er sah sich kurz um und schüttelte leicht den Kopf. »Noch nicht.«
»Dann hör gefälligst auf, uns dermaßen zu beschallen! Vor elf Uhr brauchst du ohnehin noch nicht auszuflippen. Wenn die Leute hier ankommen, wollen sie sich nämlich noch eine Weile unterhalten können. Also, dreh die verdammte Lautstärke runter!«
»Hättste ja auch normal sagen können.«
Ich ignorierte sein Gejammer und ging zurück zu Sina, um ihr beim Verteilen der neuen Untersetzer zu helfen. Als würde die hier jemals einer benutzen … Das Green Goose war keine Nobellounge und kein Szeneclub. Es war eine etwas groß geratene Kneipe, die zwar eine Tanzfläche besaß, in der man sich jedoch hauptsächlich gepflegt einen hinter die Binde kippte. Die Möbel waren abgenutzt und aus dunklem Holz. Ebenso dunkel war auch die schummrige Beleuchtung des Lokals.
»Wie ist denn deine Chemie-Arbeit gelaufen?«, wollte Sina wissen, während wir Kussmundhäufchen auf den Stehtischen platzierten.
Ich winkte ab. »Na ja, zwei Aufgaben hab ich sicher verpatzt. Ich könnte mich eh schon wieder in den Arsch beißen. Das waren reine Flüchtigkeitsfehler.«
»Sei nicht so streng mit dir. Es wird doch sowieso wieder eine Eins.« Sie grinste.
»Mal sehen.«
Sina war die Einzige im Lokal, die mein wahres Alter kannte. Und sie war auch die Einzige, die mehr über mich wusste als meinen bloßen Namen. Die Beziehung zwischen ihr und mir war etwas, das einer Freundschaft wohl ziemlich nahekam. Und das, obwohl wir uns noch nie außerhalb unseres Jobs getroffen hatten. Schon an meinem ersten Arbeitstag waren wir ins Gespräch gekommen und hatten uns sofort gut verstanden. Nicht nur weil Sina Physik studierte, also genau das tat, wovon ich selbst träumte, sondern auch weil wir einen ähnlichen Musik- und Filmgeschmack hatten und überhaupt ziemlich oft der gleichen Meinung waren. Spätestens als sie einmal einen aufdringlichen Gast am Kragen gepackt und ihm eine unsanfte Kopfwäsche mit Spülwasser verpasst hatte, war Sina mir sympathisch geworden.
Der Turntable-Gott des heutigen Abends hatte inzwischen den Stecker wieder in die Buchse gesteckt und hielt sich brav an meine Vorgaben bezüglich der Lautstärke.
»Okay, ich denke, das reicht fürs Erste«, sagte Sina, als wir etwa die Hälfte des Kartoninhalts verteilt hatten. Sie stopfte die Schachtel unter den Tresen und tauchte mit zwei Pilsflaschen wieder auf.
Der Chef sah es zwar überhaupt nicht gerne, wenn seine Bardamen sich seiner kostbaren Alkoholika bedienten, doch das war Sina und mir herzlich egal. Es war sogar zu einer Art Ritual für uns geworden. Immer vor Beginn des nächtlichen Chaos und nach seinem Ende, wenn Karl die letzten Partywütigen hinausverfrachtet hatte, machten wir es uns gemütlich und stießen an.
Mein Blick fiel auf die Tätowierung an Sinas rechtem Handgelenk. Sie hatte dieses Tattoo schon immer und ich kannte es längst. Ich hatte mich oft gefragt, ob es nicht extrem schmerzhaft war, sich die feine Haut über den Pulsadern derart misshandeln zu lassen. Doch an diesem Tag erregte das Motiv aus anderen Gründen meine Aufmerksamkeit. Das verschlungene Symbol mit den feinen Linien kam mir nämlich äußerst bekannt vor.
»Was ist das eigentlich für ein Tattoo?«, fragte ich, bevor ich einen Schluck von dem herben Bier nahm.
Sina blickte auf die Innenseite ihres Handgelenks, als müsste sie erst nachsehen, welches Tattoo ich denn meinte.
»Ach das.« Sie zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Das Zeichen hing beim Tattoo-Studio aus und hat mir einfach gefallen.«
»Hast du dich nie gefragt, was es bedeutet?«
»Nee. Wahrscheinlich ist es ein Eigenentwurf des Tätowierers.«
Ich wiegte den Kopf. »Oder es ist Tibetanisch und heißt übersetzt: ›Dumme Nuss‹.«
Sina lachte, während ich fast ein wenig enttäuscht war. Ich war mir nämlich ziemlich sicher, dass dieses Zeichen den Symbolen auf meinem Amulett ähnelte. Aber vielleicht hatte ich mich auch getäuscht.
Die restlichen Bardamen trudelten nach und nach ein und mit ihnen die ersten Gäste. Der Abend nahm seinen gewohnten Lauf und ließ mich nicht länger über fremde Zeichen und Symbole nachdenken. Eine ganz normale Samstagnacht im Green Goose begann.
KAPITEL 3
Am Sonntag wackelte ich nach nur drei Stunden Schlaf zum Frühstück hinunter, um anschließend sofort wieder in mein Bett zu fallen. Erst nach weiteren vier Stunden fühlte ich mich einigermaßen ausgeruht.
Ein Blick durch das Fenster offenbarte mir, dass ich nicht viel verpasst hatte. Der Frühling hatte sich von einem Tag auf den nächsten wieder zurück in den Winter verwandelt. Es war regnerisch trüb und wolkenverhangen. Das perfekte Wetter für Depressionen.
Bevor ich mich von dieser düsteren Stimmung mitreißen ließ, ging ich erst einmal duschen.
Im Heim wurden Jungs und Mädchen streng voneinander getrennt. Die Jungen wohnten im ersten und die Mädels im zweiten Stock. So als könnten ein paar Treppenstufen und zwei windige Glastüren diverse nächtliche Treffen unterbinden. Manchmal waren unsere Erzieherinnen wirklich sehr naiv.
Im Mädchenstockwerk gab es nur ein einziges Gemeinschaftsbad. Welche Probleme sich daraus ergaben, brauchte ich wohl nicht zu erwähnen.
Doch Sonntagmittag war einer der wenigen Zeitpunkte, in denen man die seltenen Momente genießen konnte, allein im Bad zu sein. Ohne das dumme Geschnatter über Schminktipps und Verführungskünste oder das Gezicke, wer denn jetzt zuerst den neuen Föhn benutzen durfte, machte das Duschen doch gleich noch viel mehr Spaß.
Nachdem der beschlagene Spiegel wieder klar wurde, stand mir plötzlich eine fremde Person gegenüber. So kam es mir jedes Mal vor, wenn ich mich selbst ohne mein übliches Make-up sah. Ich fühlte mich seltsam nackt und schutzlos.
Wie alle Rothaarigen hatte ich einen hellen Teint. Porzellanfarben würden die Romantiker dazu sagen, käseweiß nannte ich es. Wobei ich mich damit eigentlich gut arrangieren konnte, solange ich nicht zu viele Stunden in der Sonne verbrachte. Ich bekam zwar nicht übermäßig schnell einen Sonnenbrand, dafür aber so richtig viele Sommersprossen auf der Nase. Manche fanden das süß. Ich persönlich wollte grundsätzlich nicht für süß befunden werden.
Meine Augenfarbe mochte ich hingegen sehr gerne. Sie war von einem richtig satten Grün, das man eher selten sah. Wenn man mir direkt in die Augen blickte, konnte man vereinzelte blaue Sprenkel darin erkennen. Wirklich hübsch.
Während ich meine Haare trocken föhnte, überlegte ich wie schon so oft, ob ich sie mir nicht doch einfach färben sollte. Vielleicht ein neutrales Braun oder so was. Prinzipiell mochte ich aber meine Haare so, wie sie waren. Sie waren dicht und gesund und reichten bis über meine Schulterblätter hinab. Das kräftige Rot war ein eher dunkles Kupfer, welches die dumme Angewohnheit hatte, im Sonnenlicht regelrecht aufzuflammen – und dadurch unliebsame Blicke auf sich zu ziehen.