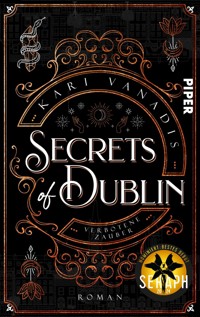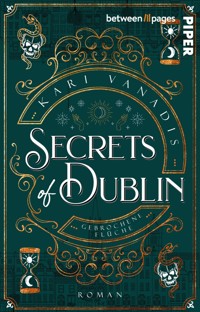
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: between pages by Piper
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Unkonventionelle Charaktere, gefährliche Flüche und eine Liebe wider Willen: Packende Urban Fantasy für Fans von Ben Aaronovitch und Benedict Jacka Die Hexe Ciara setzt alles daran, eine erfolgreiche Reporterin zu werden, und endlich zahlt sich ihre Mühe aus: Sie darf ihr Idol, einen berühmten Duellmagier, interviewen. Als er Hilfe sucht, weil eine Banshee seiner Familie den Tod ankündigt, wendet Ciara sich an ihre Freundin Leslie und den Privatdetektiv Victor. Gemeinsam sollen sie den Todesfall aufklären und verhindern – nur wie löst man einen Fall, bevor er eintritt? Insbesondere, wenn zeitgleich schwarzmagische Kräfte Dublin bedrohen – und Leslie aufgrund ihrer düsteren Vergangenheit zwischen die Fronten gerät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Secrets of Dublin: Gebrochene Flüche« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Sprachredaktion: Michaela Retetzki
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Emily Bähr, www.emilybaehr.de
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com und Freepik.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Triggerwarnung
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8 – Ciara
Kapitel 9
Kapitel 10 – Ciara
Kapitel 11 – Ciara
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15 – Ciara
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19 – Ciara
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22 – Ciara
Kapitel 23
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Triggerwarnung
Dieser Text enthält Themen, die triggernd wirken können, eine Aufzählung findet sich im Folgenden.
Wir wünschen ein bestmögliches Leseerlebnis.
Verlust von engen Familienangehörigen
Trauer und Trauerverarbeitung
Physische Gewalt und Mord, Blut
Bandenkriminalität, krimineller Untergrund
Rassismus und rassistische Äußerungen
Mobbing und Diskriminierung
Für alle, die anders sind.
Auch wenn ihr manchen Menschen zu laut,zu engagiert, zu emotional seid – überfordert sie.
Denn wir brauchen euch, die ihr nicht stillsteht,in einer Welt der Unterwältigung.
Kapitel 1
»Naoki Kobayashi darf dieses Duell auf keinen Fall verlieren!«
Ciara sprach diese Worte voll Inbrunst aus, während sie aufgeregt durch die Tabellen scrollte. Immer wieder hielt sie inne und checkte einen Namen, murmelte »Hör dir das an, Leslie« und ratterte die Ergebnisse vergangener Magierduelle runter, als hätte sie diese auswendig gelernt. Was mich bei ihr nicht einmal wundern würde.
Ich hatte die Pause im Pot of Gold eigentlich mit meinen eigenen Recherchen verbringen wollen – mindestens ebenso ermüdend und spekulativ wie Ciaras Nachforschungen –, packte mein Smartphone aber wieder weg und streckte mich ausgiebig mit beiden Armen nach oben über die knautschige Lehne des Sessels. Nathaniel rückte interessiert näher an Ciara heran. Beide saßen mir gegenüber auf dem altehrwürdigen Sofa unserer Sitzecke.
Ich schnalzte mit der Zunge. »Sag mal, hast du nicht irgendetwas zu tun, Nathaniel? In deinen eigenen vier Wänden beispielsweise?« Eigentlich hatte ich mich um einen scherzhaften Ton bemüht, doch jedes Mal, wenn ich mit dem Dämon sprach, rutschte er letztlich doch ins Grimmige ab. Dabei ertrug ich es inzwischen sogar, wenn er sich hier unten im Laden aufhielt. Meistens jedenfalls. Wenn Ciara dabei war. Und ich keine Kunden hatte. Und unter der Woche nur zu bestimmten Zeiten.
Nathaniel verzog die Lippen und entblößte seine spitzen Dämonenzähne. Auch wenn er es inzwischen echt draufhatte, sich wie ein ganz normaler Sechzehnjähriger zu geben, und Ciara ihn mit einem aufwendigen Tarnzauber ausgestattet hatte, gebunden an den kleinen silbernen Ring, den er am rechten Ohr trug, waren manche dämonischen Merkmale doch schwer zu übersehen, wenn man einmal um sie wusste. »Ist ja nicht meine Schuld, dass ihr die letzte Absteige ausgesucht habt«, zischte er.
»Du hast aber mitbekommen, wie die Mietpreise in Dublin aktuell aussehen? Da kannst du wohl eher froh sein, dass die Schublade in meinem Schrank nicht dein neues Zuhause geworden ist.« Ich verdrehte die Augen und streckte jetzt auch die Beine nach vorn aus. Damit lag er uns seit zwei Wochen in den Ohren. Genau genommen, seitdem wir endlich eine Möglichkeit gefunden hatten, ihn auf passende Art und Weise unterzubringen. Wie sich herausgestellt hatte, war es nicht nur unmöglich, dass Nathaniel selbst einen Mietvertrag unterschrieb, weil er keinerlei Papiere besaß, er musste sich außerdem in meinem Besitz befinden. Wozu eine von ihm gemietete Wohnung nicht zählte. Dass er sich bei dem Versuch, sich heimlich mit gefälschten Papieren in ein Apartment in Sandyford einzumieten, zurück in seine Ursprungsform als Ouija-Brett verwandelt hatte, rieb ich ihm jetzt noch unter die Nase, wenn er zu vorwitzig wurde. Das geschah häufig genug, um nicht mehr originell zu sein, allerdings sprang er immer noch darauf an.
Auch jetzt kniff er den Mund bei der Erinnerung daran zusammen, sodass es fast so aussah, als würde er schmollen. »Wart es nur ab, bald ist mein Zimmer mehr wert als der ganze Laden hier.«
»Oh, du meinst den ganzen Kram, den du auf meinen Namen an die Adresse, die auf mich läuft, bestellst? Schön, wie ambitioniert du meinen Besitz vergrößerst.«
Wir hatten uns letztlich dafür entschieden, dass ich ein Selfstorage mietete und Ciara uns eine magische Tür vom Covens Place besorgte, die wir dann auf dem Flur zwischen Küche und Badezimmer angebracht hatten. Sie war mit einem lokal begrenzten Portalzauber ausgestattet, wodurch sich der Lagerraum in der Nähe unseres Apartments befinden musste. Eigentlich hätten wir sie gar nicht ohne die Genehmigung unserer Vermieterin anbringen dürfen, und an den Raum selbst stellten sich unzählige Anforderungen, unter anderem, dass er fortan durch keinen weiteren Zugang mehr betreten werden durfte. So hatten wir unser Zweizimmerapartment um einen weiteren Raum ergänzt. Wenn man die Kammer, die eigentlich zu Lagerzwecken vermietet wurde, denn so nennen konnte. Als ich das letzte Mal einen Blick durch die Tür erhascht hatte, war es eigentlich ganz gemütlich eingerichtet gewesen. Wenn vielleicht auch etwas dunkel.
Meine ironischen Fragen brachten Ciara dazu, von ihrem Smartphone aufzusehen. Sie rückte ihre goldumrandete Brille zurecht und sah mich an wie eine Lehrerin, die mit ihrer Klasse ein ernstes Gespräch über Mobbing führen musste. Deshalb wusste ich auch, was nun auf mich zukam. »Leslie, waren wir uns nicht einig, dass es nur Vorteile hat, Nathaniels irdisches Leben zu unterstützen? Weil die Alternative … na ja, dämonisches Verderben bedeutet?«
Zu dem Schluss war sie gekommen, um seinem eigentlichen Vermächtnis als Nachkomme eines bösen Dämonenkönigs entgegenzuwirken. Ausgelöst hatte das Ganze unser unfreiwilliges gemeinsames Stelldichein mit Jacob, infolgedessen selbst ich eingesehen hatte, dass Nathaniel nicht zwangsläufig seiner dämonischen Natur entsprechen musste. Vor allem, wenn das hieß, dass er mich nicht in meinen eigenen Tod trieb. Allerdings machte er es mir immer noch außerordentlich schwer, ihm irgendeine Form von Zuneigung entgegenzubringen. Obwohl ich zugeben musste, dass ich Gefallen an unseren gegenseitigen Sticheleien gefunden hatte. Jetzt, da es nicht mehr um Leben und Tod ging.
Ergeben hob ich die Hände. »Schön, ich bin ja froh, dass er nicht mehr ständig in deinem Zimmer hockt.« Dass Nathaniel nicht nur Bad und Küche weiterhin mitbenutzte, sondern trotzdem oft genug bei Ciara rumhing, ließ ich großzügig außen vor. Ich freute mich ja für sie, dass sie endlich jemanden gefunden hatte, der diese ganzen Serien voller Drama und Intrigen gern mit ihr ansah.
Zwei gegensätzliche Mienen blickten mir entgegen. Ciara strahlend, weil die Lehrerin in ihr stolz darauf war, mich langsam zu einem angemessenen Verhalten zu bekehren. Nathaniel gehässig, weil er meine Worte nachäffte. Da aber auch er keine Lust auf einen Eintrag ins Hausaufgabenheft hatte, wandte er sich lieber an Ciara und stupste sie an. »Also, was ist jetzt mit Naoki Kobayashi?«
»Oh«, machte sie und hielt sich das Smartphone wieder vor die Nase, wobei sie die weiß-pink geschminkten Lippen schürzte. »Das sind Tabellen, die zeigen, gegen wen Naoki als Nächstes antreten muss auf seinem Weg zur Meisterschaft.« Ihre Miene hellte sich auf. »Es ist einfach so spannend! Siehst du, in dem Duell morgen stehen sich Mei Zhou und Maya Feldmann gegenüber. Zhou verfügt über eine wirklich unglaubliche Reaktionsgeschwindigkeit, das hat sie während ihres Duells in Peking bewiesen. Jeder hat gedacht, ihr Gegner wäre ihr mit seiner Zauberkraft überlegen, aber sie führt ihre Magie so schnell aus, dass er keine Chance gehabt hat. Feldmann dagegen kennt jeden Kniff, weil ihr Trainer selbst mal Champion gewesen ist. Sie ist auf Beschwörungen spezialisiert.«
»Und wenn du sagen müsstest, wer von beiden das Duell gewinnt?«, unterbrach Nathaniel ihren Redeschwall.
Ciara verzog kurz nachdenklich den Mund, bevor sie antwortete: »Eher Maya Feldmann. Auf jeden Fall steht die Gewinnerin im Halbfinale Naoki gegenüber. Und wenn er dieses Duell für sich entscheidet, zieht er ins Finale um den Titel als Champion.« Ihre Augen leuchteten so sehr, dass selbst ich schmunzeln musste. Ciara bewunderte und schwärmte für den Duellmagier schon seit seinen Anfängen.
»Gehst du hin und siehst dir das Finale an?«, wollte ich wissen.
Sie nickte eifrig. »Ja, ich will versuchen, ob ich über die Redaktion Tickets und vielleicht sogar ein Interview mit Naoki bekommen kann.« Was vor wenigen Wochen noch unmöglich gewesen wäre, nahm nun endlich seinen rechtmäßigen Lauf der Dinge. Mit ihrer Enthüllungsstory um den Mord an Timothy Murphy hatte sich Ciara einen Platz ganz oben im Eternity Weekly erkämpft. Brian war, nachdem sich mehrere Mitarbeiterinnen gegen ihn und seinen misogynen Umgangston ausgesprochen hatten, gekündigt worden, und nun bekam Ciara die besten Storys.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis sein Name bei der nächsten Zeitung auftauchen würde. Ich bezweifelte, dass die ganze Geschichte seine Karriere wirklich beendet hatte, weil es genug Redaktionen mit einem Herz für gekränkte Männeregos gab. Doch ich gönnte Ciara den Erfolg von Herzen, liebte es, mit wie viel positiver Energie sie nun von ihrer Arbeit sprach, und behielt meine Befürchtungen ausnahmsweise für mich.
»Willst du mitkommen?«
»Hm?« Mit einem Blinzeln versuchte ich zu überspielen, dass meine Gedanken kurz abgeschweift waren.
»Ich könnte dir auch Tickets besorgen.«
Eigentlich interessierte es mich nicht sonderlich, wie sich zwei Andersweltler ihre Magie um die Ohren schleuderten, als wüssten sie nichts Besseres damit anzufangen. Doch als Nathaniel den Mund öffnete, sagte ich schnell: »Nur wenn Nathaniel nicht mitkommt.«
»Und was ist mit mir?«, sprach er gleichzeitig aus, was ich befürchtet hatte. Er verbrachte bereits so viel Zeit mit meiner besten Freundin, dass ich mir gern das Recht herausnahm, sie für mich zu beanspruchen.
»Du kannst dir doch bestimmt selbst ein Ticket kaufen.« Und trotz Ciaras mahnendem Blick fügte ich hinzu: »Für einen Platz irgendwo weit weg von unseren.«
»Also ich will wirklich nicht …«, setzte Ciara an, hielt aber plötzlich inne. »Oh, hi, Victor.«
War ja klar, dass sich der Mistkerl wieder mal anschlich, während ich das Geschehen im Laden ausblendete. Das wohlige Kribbeln, das mir den Nacken entlang hinunterlief, weil ich ganz genau wusste, dass er in diesem Moment über die Lehne hinweg auf mich herabsah, strafte meine harschen Gedanken Lügen. Mein verräterisches Herz machte einen kleinen Satz, als ich in meinem Sessel herumfuhr. Viel zu schnell, Leslie, wie peinlich.
Da stand er, eine Hand auf der Sessellehne, in seinem schwarzen Trenchcoat und einem roten Rollkragenpullover, benetzt vom Nieselregen. Sein schwarzes Haar war geordnet, doch eine Strähne hing ihm vorwitzig in die Stirn. Der Blick seiner stahlblauen Augen schweifte nur kurz zu Ciara, um die Begrüßung zu erwidern, zu Nathaniel, verfinsterte sich, bevor er sich wieder auf mich richtete. Und trotz der Eindringlichkeit etwas Weiches bekam.
»Sollen wir euch lieber allein lassen, oder wollt ihr euer Ding einfach vor uns durchziehen?«, spottete Nathaniel.
Mein Magen verkrampfte sich kurz. Ich hatte Ciara gebeten, ihm gegenüber nicht über Victor und mich ins Detail zu gehen, und natürlich waren ihre Lippen versiegelt geblieben. Nur tauchte der Halbvampir viel zu oft hier im Pot of Gold auf – bei mir –, als dass der Ouija-Boy sich nicht schon selbst etwas zusammengereimt hätte. Was das war, wollte ich gar nicht so genau wissen.
Victor öffnete den Mund und schloss ihn auf mein kaum merkliches Kopfschütteln wieder. Lässig stand ich auf, drehte mich zu meiner besten Freundin und dem unverschämten Dämon um. »Sorry, Nathaniel, die Show steigt ohne dich.« Und weil dieser Satz, der mir unter anderen Umständen unbedarft von den Lippen gekommen wäre, meine Verlegenheit nur steigerte, trat ich dabei bereits um den Sessel herum und von der Sitzgruppe weg. »Warte nicht auf mich, Ciara, falls du schon hochgehen willst. War bestimmt ein langer Tag.«
Im Gegensatz zu Nathaniel wusste sie ganz genau, was hier lief. Ihr besorgtes Stirnrunzeln machte es nur nicht besser. Ich winkte ein letztes Mal, dann schritt ich an Victor vorbei zur Ladentheke.
Mittlerweile erkannte ich die Anzeichen auf den ersten Blick, ohne dass er mir erst verraten musste, warum er diesmal hier war. Nicht, um mich zu fragen, wie hoch ich den Wert einer antiquarischen Sammlung von Pub-Schildern schätzte. Oder mir einen magischen Gegenstand in die Hand zu drücken, den er an einem Tatort oder bei einem Verdächtigen gefunden hatte. Er würde auch nicht einfach nur im Laden rumhängen, während er von irgendwelchen Fällen plauderte und ich ihn auf Details hinwies, die er ohnehin schon bedacht hatte. Dass seine Haut noch blasser als sonst war und ihn seine Schattenmagie nur träge umgab, verlangte nach etwas anderem: dem Hinterzimmer.
Marc hinter der Theke beendete gerade ein Kundengespräch und sah mir mit in die Hüfte gestemmten Händen entgegen. »Leslie, ist deine Pause nicht vorbei?« Er wusste, dass er mir nichts vorschreiben konnte, weshalb die Frage eher resigniert als forsch klang. Erst recht, weil Victor mir wie ein Schatten folgte. Seit dem kleinen Missverständnis, bei dem der Privatdetektiv ihn etwas ruppig behandelt hatte, reagierte Marc nicht besonders gut auf seine Besuche.
»Dauert nicht lange, darfst dann gleich früher gehen und ich mach den Laden heute allein dicht«, bot ich großzügig an. Wir beide wussten wieso: damit er das hier für sich behielt.
Marc murmelte etwas Unverständliches. Ich beachtete ihn nicht, sondern öffnete die Tür, die in den Mitarbeiterraum führte. Mit dem frisch erneuerten Schlüssel verriegelte ich sie. Und dann war ich mit Victor allein.
Als ich mich dem Raum zuwandte, stiegen die unterschiedlichsten Empfindungen in mir auf, alle genährt von den Ereignissen, die sich hier abgespielt hatten. Das hatte so weit geführt, dass Eve, unsere andere Mitarbeiterin, mich einmal während der Kaffeepause gefragt hatte, warum mein Gesicht plötzlich so rot geworden sei. Seitdem betrat ich den Mitarbeiterraum außerhalb von Victors Besuchen nicht mehr. Immerhin hatte das Ganze den Vorteil, dass diese Empfindungen an genau diesem Ort blieben und mich anderswo verschonten. Nun, meistens jedenfalls.
»Wie geht es dir?«
Wirklich? Diese Frage? Victors sonore Stimme stieß sachte gegen die Barriere, die ich sorgsam um mich herum errichtet hatte. »Wow, du hattest den ganzen Weg hierher Zeit, dir was Geistreiches zur Begrüßung zu überlegen, und das ist dabei rausgekommen?« Keine Chance auf Durchkommen.
Sein Mundwinkel hob sich unmerklich. »Wenn es jemals was gebracht hätte, mir Worte für dich zurechtzulegen, dann wären wir jetzt wohl nicht hier.«
Es kribbelte wohlig in meinem Bauch. »Du meinst, weil ich nie deinen Erwartungen entspreche?«, witzelte ich, um es zu überspielen.
»Wohl eher, weil du jedes zurechtgelegte Wort auseinandernimmst.«
Ich schnaubte leise und nutzte meine plötzliche Unruhe, um zu dem kleinen Kaffeetisch zu gehen. Bei dessen Anblick Hitze in mir aufstieg. Ich setzte mich auf die Tischkante, nur noch mit einem Fuß in Bodenkontakt. »Vielleicht bist du auch einfach nicht besonders gut darin, dir irgendwas zurechtzulegen.« Ich nestelte an den Knöpfen meines Hemdärmels.
Unmerklich kam Victor näher. »Vielleicht«, gab er leise zu. »Ich möchte trotzdem wissen, wie es dir geht.«
»Mir geht es bestens«, antwortete ich eine Spur schärfer als beabsichtigt. »Was man von dir nicht gerade behaupten kann.«
Er stutzte, versteifte sich. »Mir fehlt nichts.«
Sein verfluchter Ernst? Ich brauchte nicht einmal seine Fähigkeiten, um die Lüge zu durchschauen. »Und ob dir etwas fehlt. Ich sehe Auren, Victor. Sollen wir es wieder darauf ankommen lassen und ich beweise dir, wie es dir gerade wirklich geht?« Das Gespräch nahm eine Wendung, die nun eher Wut in mir hochkochen ließ. Was fing er auch immer wieder mit diesem Thema an?
»Denkst du, ich weiß nicht, warum du seit fast einer Woche nicht hier gewesen bist, obwohl du sonst fast jeden Tag kommst? Du wolltest nicht, dass ich sehe, wie schwach du bist, also bist du dem Pot of Gold absichtlich ferngeblieben.« Ich musterte ihn von oben bis unten. »Du hast dich doch wohl nicht etwa mit den Vampiren angelegt?«
Seine Miene hatte sich schlagartig verdüstert, doch die Schatten waren zu schwach, um sein Antlitz bedrohlich einzuhüllen. »Habe ich nicht«, knurrte er. »Sie versperren mir ohnehin jeden Weg zum Blutmarkt. Denkst du, ich weiß nicht, was ich tue?«
»Jup, manchmal denke ich genau das.« Beispielsweise, wenn er es sich während wichtiger Ermittlungen mit der Vampirlobby verscherzte. Oder sich der Garda auslieferte, statt mit mir zusammen zu fliehen. Oder sich zum Verdächtigen in einem Mordfall machte.
»Ich habe nach anderen Möglichkeiten Ausschau gehalten. Anderen … Personen, außerhalb der Lobby«, sprach er weiter, meine Bemerkung ignorierend.
Ich hielt in dem Versuch inne, diesen verfluchten Knopf durch das Loch zu ziehen. »Ach, bin ich dir plötzlich nicht mehr gut genug?« Es sollte höhnisch klingen, vor Sarkasmus triefend. Es hätte mir nichts ausmachen sollen. Nur tat es das, auf eine seltsame Art und Weise, die mir unangenehm war. Nachdem alles irgendwie Schlag auf Schlag passiert war und wir uns definitiv nicht genug Zeit genommen hatten, ließen wir es gerade langsam angehen. So langsam, dass wir manchmal immer noch auf der Stelle traten.
Oder ich jedes Mal einen Schritt zurückwich, wenn Victor einen auf mich zu machte. Er wirkte ebenso überrascht von meinen Worten wie ich.
»Ach, vergiss es«, winkte ich ab, als ich die Stille schon nach wenigen Sekunden nicht mehr aushielt. »Mach, was du willst. Wenn du mein Blut nicht mehr brauchst, musst du ja auch nicht mehr …«
Mit zwei Schritten war er bei mir. Vielleicht besser so, wenn ich bedachte, wie mein Satz geendet hätte – was vermutlich auch sein Gedanke gewesen war. Vorsichtig legte er seine Hände über meine, noch kalt vom regnerischen Herbstwetter, das draußen herrschte, oder einfach kalt, weil sie nie warm wurden. Ich ließ zu, dass er mir half, den Knopf zu lösen, um den Ärmel nach oben zu schieben und mein Handgelenk freizulegen. Victor hielt es in meinem Schoß fest und streichelte sanft darüber.
»Du weißt, dass es nicht so ist«, sprach er mit dunkler Stimme und suchte meinen Blick. Meine Kehle schnürte sich zu. »Leslie, du wirkst während der vergangenen Wochen abwesend, kränklich und verheimlichst ganz offensichtlich irgendetwas.«
»Ist das nicht eher so ein Ding als Privatdetektiv, überall Geheimnisse zu wittern?«, startete ich einen schwachen Versuch, das Ruder herumzureißen.
»Wenn der Blutverlust dafür verantwortlich ist …«
»Das hat damit überhaupt nichts zu tun«, unterbrach ich ihn hastig. Und hoffte darauf, dass er die Wahrheit dahinter erkannte. Sollte er seine Fähigkeiten doch ausnahmsweise mal für was Sinnvolles benutzen.
Seine Augen verengten sich unmerklich, er hielt inne und drückte mein Handgelenk stärker. »Womit dann?«
Ich hielt seinem Blick stand. »Ich schlafe momentan einfach schlecht.« Auch das war nicht gelogen. Bitte, belasse es einfach dabei. Lass das Thema ruhen. Ich würde nicht mehr lange gegen seine Nähe ankommen, und wir hatten noch das ganze restliche Prozedere vor uns.
Als würden Victor ganz ähnliche Gedanken durch den Kopf gehen, haderte er sichtlich mit sich. Was auch immer ihn dazu bewog – sah ich wirklich so fertig aus?! –, er traf die falsche Entscheidung. »Ist es wegen dem, was mit Jacob passiert ist? Oder wegen des Dämons, der immer noch an deinen Namen gebunden ist? Wenn ich irgendetwas …«
Wieder ließ ich ihn nicht zu Ende reden, was mich an seiner Stelle so richtig wütend gemacht hätte. »Nein, Victor, es ist nicht wegen der Geschichte. Fuck, ich hab schon Schlimmeres verarbeitet.« Damit meinte ich nicht zwangsläufig Marys Tod, von dem er wusste, sondern eher meine Zeit im schwarzmagischen Untergrund. Nur hatte ich ihm bisher nie davon erzählt. Ich seufzte gequält auf. »Lassen wir das einfach, in Ordnung? Kann mir nicht leisten, einen Stammkunden wie dich zu verlieren, auch wenn du echt schlecht zahlst.« Der Spruch klang selbst in meinen Ohren hohl, aber war jetzt auch nicht das Schlimmste, was ich jemals rausgehauen hatte. Solides Mittelfeld.
Einen Moment starrte er mich noch an, runzelte die Stirn, als hätte er die Andeutung nicht verstanden. Was echt schade wäre, nur würde ich sicher nicht damit anfangen, meine Witze zu erklären. Dann atmete er kaum merklich aus und sackte dabei ein Stück in sich zusammen. Sehr schön, er gab auf, zumindest für diesen Moment.
Als er bereits Anstalten machte, mein Handgelenk zu sich heranzuziehen, hob ich den Finger der anderen Hand. »Allerdings will ich, dass du damit aufhörst, mich zu meiden, wenn deine Kräfte schwinden. Du hältst dich ohnehin schon total zurück und nimmst so wenig wie möglich, und ich merke selbst, wenn es mich beeinträchtigt. Ich habe dir angeboten, von meinem Blut zu trinken, bis sich das mit den Vampiren geklärt hat, also trau mir das verdammt noch mal auch zu!« Ich wollte nicht wütend auf ihn sein, vor allem, wenn er sich dadurch abgewiesen fühlte und mich mied. Nur machte ich mir mindestens genauso große Sorgen um ihn wie darum, dass es ihm doch noch gelingen würde, meine Barrieren niederzureißen.
Er funkelte mich an, ganz der mürrische Privatdetektiv, den ich kennengelernt hatte, und knurrte: »Schon verstanden.«
Erleichtert hob ich mein Handgelenk an Victors Lippen und bedeutete ihm mit einem Nicken, anzufangen. Die Routine während der vergangenen Wochen hatte den Rausch erträglicher gemacht. Ich war danach nicht mehr zu nichts mehr zu gebrauchen. Trotzdem sackte ich immer noch jedes Mal mit flatternden Lidern gegen Victor. Er stand dicht genug bei mir, um mich zu stützen, während ich mich an seine Brust lehnte und mich mit der freien Hand Halt suchend in seinen Trenchcoat klammerte. Seine Lippen auf meiner Haut …
Und schon war der Spuk wieder vorbei und der peinliche Moment danach brach an. Mich trunken an Victor ranzuschmeißen, der noch mit dem bitteren Geschmack meines Blutes kämpfte, war keine Option, weshalb ich meistens einfach die Flucht nach vorn antrat. Im Laden konnten wir uns wie zivilisierte Menschen unterhalten und vergessen, was wir hier hinten getan hatten. Auch diesmal rutschte ich von der Tischkante, stand einen Moment dicht vor Victor, bevor er sicher war, dass ich mich auf den Beinen halten konnte und mich losließ.
»Wollen wir noch was zusammen essen gehen?«
Die Frage traf mich so unvermittelt, dass ich auf dem Weg zur Tür beinahe gestolpert wäre. Ich beglückwünschte mich dafür, dass ich es sicher bis zur Klinke schaffte, um mich daran festzuhalten und lässig über die Schulter zu erwidern: »Hm? Ja klar, du musst nur warten, bis ich den Laden schließen kann.« Als wäre es das Normalste auf der Welt und keine völlig absurde Idee. Beinahe hätte ich laut und vollkommen unnatürlich aufgelacht.
Wenn meine Mom nicht hinter der Tür gelauert hätte.
Kapitel 2
Es gab einen Grund dafür, dass ich neue Schlüssel für den Mitarbeiterraum hatte anfertigen lassen. Die alten waren irgendwann mal abhandengekommen, was niemanden gestört hatte. Es ergab sich selten eine Notwendigkeit, die Tür abzuschließen, und da sie sich hinter der Theke befand, stolperte auch kein Kunde versehentlich hinein. Manchmal zog sich Marc hierher zurück, um mit seinem Fae-Ehemann auf Probe, den er an Lughnasadh geheiratet hatte, zu telefonieren. Oder Eve gönnte sich ein paar Minuten Ruhe, nachdem es im Laden hektisch geworden war. Und auch ich hatte nicht weiter darüber nachgedacht, Victors und meine Historie in diesem Raum fortzusetzen.
Bis Mom mal mittendrin reingeplatzt war. Mir wäre es weniger unangenehm gewesen, wenn sie mich bei Intimitäten mit dem Privatdetektiv erwischt hätte. Es war zwei Wochen nach der Sache mit Jacob gewesen, sie noch in Alarmbereitschaft, ihre Tochter vor dem nächsten Killer zu bewahren, und überhaupt war es die schlimmstmögliche Art und Weise, wie die beiden sich hätten kennenlernen können. Natürlich hatte sie sofort ihre Magie entfesselt, mit der sie sonst Artefakte reparierte oder restaurierte. Victor war so klug gewesen, sich von mir zu entfernen, mein Blut noch an seinen Zähnen, und in Verteidigungsstellung zu verharren, bis ich die Situation im Griff gehabt hatte. Was lange genug gedauert hatte, weil ich noch viel zu benommen von dem Rausch gewesen war. Als ich mich schließlich zwischen ihn und Mom geschoben hatte, war die immerhin dazu übergegangen, mich zur Rede zu stellen.
Die Details dieser Auseinandersetzung hätte ich ihm lieber erspart. Mom hatte zwar letztlich verstanden, dass er ein Freund in Not war, dem ich etwas schuldete – so hatte ich das zumindest ausgedrückt –, wenn es jedoch nach ihr gegangen wäre, hätte mich der Dhampir mit keinem Zahn mehr angerührt. Ein weiterer Grund, warum er zögerlicher geworden war, mich um Hilfe zu fragen. Vermutlich wäre es klug gewesen, die Treffen an einen anderen Ort zu verlegen, aber im Pot of Gold verbrachte ich nun mal den Großteil meiner Zeit, und dafür, Victor mit nach oben in unsere Wohnung zu nehmen, war ich noch nicht bereit.
Eigentlich hätte Mom heute auch nicht mehr hier sein sollen … Moment, wo war Marc? Bevor ich darüber nachdenken konnte, ob vielleicht er mich verpfiffen hatte, verschränkte sie die Arme vor der Brust und verengte die Augen. »Guten Abend, Mr Raković.«
Victor trat einen Schritt vor, wobei er meinen Arm streifte. »Mrs Delwood.« Er nickte.
Konnte das noch irgendwie unangenehmer für alle Beteiligten werden? Ich winkte in die Runde. »Und Leslie!« Jap, konnte es.
Mom griff mit einer Hand an die Lederkette, an der eine Feder baumelte, und fuhr sich mit der anderen durch das rote Haar. Sie rang sichtlich mit sich, ob nach Worten oder um Fassung.
»Mom, was machst du hier?« Gut, sie war immer noch die Inhaberin dieses Ladens, und vielleicht hätte ich das etwas charmanter formulieren können, doch ich war mir sicher gewesen, dass sie heute Abend irgendeine Veranstaltung besuchen wollte.
»Schätzchen, wir waren verabredet.« Als sie merkte, dass sich nichts in meinem Gesicht tat – bis auf ein zuckendes Augenlid bei dem Wort Schätzchen –, seufzte sie. »Du hast es vergessen, nicht wahr? Die Auktion, zu der du mich begleiten wolltest?«
Oh! Ja! Sie hatte tatsächlich etwas vorgehabt. Mit mir. Ich begleitete sie in letzter Zeit wieder öfter zu Terminen mit Kunden und zu Versteigerungen.
Hätte ich lieber gemütlich den Laden geschlossen und noch ein wenig mit Victor geplaudert? Definitiv. Hatte ich mich auf die Einladung zum Essen gefreut? Vielleicht. Würde ich Mom deshalb versetzen, damit sie noch einen Grund mehr hatte, ihn nicht zu mögen? Definitiv nicht. Dafür war ich ihr viel zu dankbar, dass sie meine Entscheidungen und Grenzen in dieser Angelegenheit respektierte. Sie akzeptierte Victor vielleicht nicht als meinen … was auch immer, stellte aber auch keine sinnlosen Verbote auf. Die ich eh umgangen hätte, was ihr vermutlich ebenso bewusst war wie mir.
»Tut mir leid«, wandte ich mich also an Victor. »Das mit dem Essen müssen wir dann verschieben.«
»Natürlich«, erwiderte er steif. Ich wusste nicht, ob er ernsthaft darüber enttäuscht oder es einfach nur seine übliche distanzierte Art war, in die er verfiel, sobald wir nicht mehr allein waren.
Mom räusperte sich. »Oh, ihr wolltet … essen gehen?« Sie bemühte sich um einen interessiert-freundlichen Tonfall, doch ihre Augenbrauen schnellten dabei nach oben.
Ich konnte mir denken, was in ihr vorging. »Klar. Victor kennt da einen Laden mit Spezialitäten, die quasi körperwarm auf den Teller … äh, im Glas serviert werden. Wenn man die Ware nicht direkt anzapfen will.« Ich gab mir nicht mal Mühe, den Sarkasmus in meiner Stimme zu verbergen.
»Leslie?«, knurrte Victor warnend.
»Leslie!« Mom starrte mich an.
»Das bin ich!« Vielleicht hatte ich unterschätzt, wie angespannt diese Situation war. Ergeben verdrehte ich die Augen. »Gott, das war ein Scherz. Ganz normales Essen, Mom. Du weißt schon, Blut für den Geist und das belegte Brötchen für den Körper.« So hatte Victor es mir zumindest mal erklärt. Und um sie zu beruhigen, hatte ich Mom zumindest in die Hintergründe seiner Identität als Dhampir eingeweiht. Nach dem unschönen ersten Kennenlernen hatte sie alle Vorurteile ausgepackt, die es in der Anderswelt so über Vampire gab. Meine Mom, die nie ein schlechtes Wort über jemanden verlor, sofern er ihr keinen Grund dafür gegeben hatte. Die selbst über Brians Motive mutmaßte, als würde ein guter Mensch in ihm stecken, wenn Ciara und ich über ihn lästerten.
So ungewöhnlich das für sie auch gewesen war, so sehr hatte ich gewusst, dass sie recht hatte. Selbst unter den schwarzmagischen Gangs stieß man selten auf einzelne Vampire. Wollten sie unter sich bleiben, taten sie das in ihren übertrieben düsteren Behausungen, die ohnehin jeden abschreckten. Und war ihnen nach Gesellschaft, suchten sie die unter anderen Vampiren. Oder unter potenziellen Opfern und Blutsklaven, die sie durch Verführung, Drohung oder andere Mittel an sich banden.
Natürlich war ihre erste Vermutung gewesen, dass ich einer dieser Möglichkeiten erlegen war. Was mich ziemlich gekränkt hatte, da ich mir einbildete, ganz gut auf mich selbst aufpassen zu können. Es würde mich nicht wundern, wenn sie wie Victor – und vielleicht auch Ciara? – annahm, dass meine gesundheitlichen Defizite von dem Blutverlust herrührten.
»Über so etwas scherzt man nicht, Leslie«, wies mich Mom schärfer zurecht, als sie es normalerweise getan hätte. Vielleicht wollte sie ihre erzieherischen Fähigkeiten ja mal vor Victor demonstrieren. Als hätte der nicht schon längst kapiert, dass ich ein verzogenes, undankbares Gör war. Liebevoll gesprochen.
Beschwichtigend hob ich die Hände. »Schon gut, ich werd’s mir merken.« Nathaniel hätte den Witz sicher zu schätzen gewusst. »Ich gehe mich noch schnell umziehen, in Ordnung?« Mom hatte ihr übliches Boho-Outfit um einen eleganten Blazer ergänzt.
Sie nickte. »Ich mach hier alles fertig, damit wir danach loskönnen.« Demonstrativ wandte sich Mom der Kasse zu, nicht ohne ein »Auf Wiedersehen, Mr Raković« zu murmeln.
Ein Nicken im Vorbeigehen, und ich hätte am liebsten das Gesicht in den Händen begraben, um das nicht mehr mitansehen zu müssen. »Mrs Delwood.«
Ich schnappte mir meinen Parka vom Haken hinter der Ladentheke, hakte mich entschieden bei Victor unter und führte ihn durch den inzwischen menschenleeren Laden, vorbei an einem Sammelsurium aus antiquarischem Mobiliar und Vitrinen voller kleinerer und größerer Kostbarkeiten. Mom hatte das Schild bereits auf geschlossen gestellt.
Gemeinsam traten wir von der Heimeligkeit des Antiquitätenladens hinaus in den kalten Oktoberabend. Statt warmorangem Licht und dunklem Holz umgaben uns nun dämmriger Abend und nasser Asphalt. Noch waren fast alle Ladenfronten in der Francis Street erleuchtet, bald würde nur noch aus den Pubs und Bars Leben dringen. Es nieselte immer noch, weshalb ich beabsichtigte, mich so schnell wie möglich von Victor zu verabschieden und nach oben in unsere Wohnung zu eilen.
»Also … war mir ein Vergnügen und so. Hoffe, meine Mom hat dich nicht verschreckt, sie macht sich irgendwie nur ständig Sorgen.« Ich zuckte mit den Achseln. »Vielleicht mag sie dich auch nicht.«
So wie sich Victors Gesicht verfinsterte, war es nicht unbedingt das gewesen, was er hatte hören wollen. »Ist es dir wichtig, was sie über … mich denkt?«
Uns. Das Wort hatte bereits greifbar in der Luft gehangen, bevor Victor es durch ein anderes ersetzt hatte. Und so eindringlich, wie er mich ansah, war er mehr an der Antwort auf die unausgesprochene Variante interessiert. Jetzt zog ich die Kapuze des Parkas doch über. »Mieses Timing. Ich bin selten einer Meinung mit Mom und mache eh, was ich will. Trotzdem ist sie mir wichtig.«
Victor nickte, als wäre seine Frage damit beantwortet, nur dass ich mich genau darum gedrückt hatte – um eine Antwort. Leider gab seine ausdruckslose Miene keinen Hinweis darauf, zu welchem Schluss er gekommen war. »Ich verstehe.«
»O nein, ich denke nicht, dass du das tust«, erwiderte ich grimmig. »Allerdings muss ich jetzt echt los. Also …« Ich ließ alle guten Vorsätze fallen und tat das Einzige, was mir noch einfiel, um diese Situation in aller Kürze zu retten. Etwas, was ich schon die ganze Zeit über hatte tun wollen. Mit einem halben Schritt überbrückte ich den Abstand zwischen uns und zog Victor in einen Kuss. Er verschwendete keine Sekunde damit, überrascht zu sein. Er fuhr mit der Hand unter meine Kapuze, an meine Wange und in mein kinnlanges Haar. Ich taumelte kurz, als seine geballte Nähe meine Sinne überrollte, drängte mich atemlos näher an ihn. Gott, warum war das nur so gut. Ich konnte gar nicht genug von ihm bekommen. Es hätten Minuten oder auch Stunden vergangen sein können, als ich unseren Kuss wieder löste.
»Du verstehst es nicht, klar?«, flüsterte ich gegen seine Lippen, bevor ich mich wieder von ihm zurückzog.
Einen Moment reckte sich Victor mir noch entgegen, als würde er mich nicht gehen lassen wollen. Dann richtete er sich auf. »Dann werde ich warten, bis du es mir erklärst.«
Mom sah davon ab, mich während unseres Ausflugs auf Victor anzusprechen. Zu Recht vermutete sie wohl, dass ich sonst sehr schnell das Weite gesucht hätte. Wir fuhren in ihrem Transporter, der mit dem Leprechaun-Logo des Pot of Gold bedruckt war, durch den Feierabendverkehr. Träge beobachtete ich, den Ellenbogen am Fenster aufgestützt, wie die gespenstisch kahlen Bäume der Allee in der Cuffe Street an uns vorbeizogen. Mom war die entspannteste Autofahrerin der Welt, und das in der Kombination mit Wish You Were Here von Pink Floyd, das aus dem Lautsprecher floss, ließ mich beinahe wegnicken.
Moms Stimme riss mich aus meinem Dämmerzustand. »Ich habe überlegt, dass du mich zum nächsten Treffen des Komitees der magischen Kunst- und Antiquitätenhändler begleiten könntest.«
Ich blinzelte in ihre Richtung, während mein Hirn ihre Worte zu verarbeiten versuchte. »Weiß nicht, die Vorsitzende ist das letzte Mal nicht so begeistert davon gewesen, dass du eine nichtmagische Eingeweihte mitgebracht hast, oder?« Ich setzte diese Bezeichnung bewusst in Anführungszeichen, denn das war nur, was ich der magischen Welt gegenüber vorgab zu sein, um meine wahre Identität als Paktkind zu verschleiern. Sie war auch der Grund, weshalb Mom mich gern zu Auktionen der Unwissenden mitnahm. Es kam immer wieder vor, dass sich magische Gegenstände unter die normalen Antiquitäten schlichen, und es bedurfte lediglich einer Berührung meinerseits, um diese herauszupicken.
Mom verfiel in einen Monolog, der sich größtenteils den Vorurteilen von Andersweltlern gegenüber Eingeweihten widmete und warum es wichtig war, ein Zeichen zu setzen. Nahtlos ging sie dazu über, vom letzten Treffen des Komitees zu berichten, was meine Müdigkeit nur förderte. Erst als ein mir nur allzu bekannter Name fiel, horchte ich auf.
»… Bob Terrys Antrag auf Wiederaufnahme ist aber zum Glück abgelehnt worden.«
»Bob?«, hakte ich nach. »Bob Terry von Terrys Treasures?«
Moms Nicken wurde von einem Gesichtsausdruck begleitet, als wäre ihr gerade etwas ausgesprochen Übelriechendes über den Weg gelaufen. Bob gehörte zu den wenigen Menschen, die sie nicht ausstehen konnte. Trotzdem hatte sie sich damals besorgt über die Neuigkeit gezeigt, dass der Händler als vermisst galt. Tot, wie ich angenommen hatte.
»Dann ist er wieder aufgetaucht?«
»Ja, die Vorsitzende hat davon erzählt. Er ist eines Morgens einfach in eine Wache der Garda gestolpert und in einem fürchterlichen Zustand gewesen. Dort hat er dann berichtet, dass eine Gang aus dem schwarzmagischen Untergrund ihn festgehalten, gefoltert und ausgefragt hat. Er soll völlig fertig gewesen sein.«
»Eine schwarzmagische Gang?«, wiederholte ich neugierig, woraufhin Mom mir einen nervösen Seitenblick schenkte. Was damals geschehen war, hatte sie ebenso traumatisiert wie mich. »Was hat er denn mit denen zu schaffen gehabt?«
Falls sie sich wunderte, warum mich das interessierte, versuchte sie es zumindest erst gar nicht mit Nachfragen. »Angeblich wollten sie Informationen über ein Artefakt, an dessen Verkauf er beteiligt gewesen ist. Die Vorsitzende vermutet, dass er in illegale Geschäfte verwickelt gewesen ist. Er hat versucht, wieder ins Komitee aufgenommen zu werden, ist aber abgelehnt worden.« Mom hüstelte vielsagend, und ich wusste, dass sie froh darüber war. Bob war ihr gegenüber schon immer unerträglich aufdringlich gewesen.
Unter anderen Umständen hätte ich sie jetzt damit aufgezogen oder einen schlechten Witz über den Schwarzmarkt und Händler, die sich auf die Gangs einließen, gerissen. Stattdessen hatte ich an Moms Worten zu knabbern. Nach der ganzen Geschichte mit Jacob und dem Druidenzirkel der Awen war ich fest davon ausgegangen, dass Amergin selbst dafür verantwortlich gewesen war, dass Bobs Laden verwüstet und er selbst verschwunden war. Dass es nun eine schwarzmagische Gang gewesen sein sollte, die – ganz offensichtlich – nach Dagdas Kessel aus dem Síd gefragt hatte, passte auf den ersten Blick ins Bild. Warum sollte nur ich davon Wind bekommen und Bob aufgesucht haben? Vielleicht waren sie ebenso wie Áine an dem Artefakt interessiert gewesen.
Allerdings ließ keine Gang ihr entführtes Opfer im Nachhinein laufen, damit es in die nächste Polizeiwache spazierte. Zumindest keine, die ich kannte. Und ich bezweifelte, dass Bob es aus eigener Kraft da rausgeschafft hatte. Wenn sie von ihm genauso angewidert gewesen waren wie jeder Mensch mit ein wenig Verstand, dann hätten sie ihn eher umgebracht.
Gedanklich notierte ich mir Bob einen Besuch abstatten. Direkt neben Nachforschungen über die vier Heiligtümer Irlands anstellen und Áine Informationen entlocken, ohne dass sie mich dabei zum Teufel jagt. Keiner dieser Punkte versprach, sonderlich spaßig zu werden, und mit nichts davon müsste ich mich auseinandersetzen, wenn ich vor inzwischen fast drei Monaten nicht diesen verdammten Holzkasten geöffnet hätte. Oder Dinge ruhen lassen könnte, aus denen ich mich besser raushalten sollte. Tja, da färbte Victor wohl doch noch auf mich ab.
»Na ja, wenn die Vorsitzende so wenig angetan von verbotenen Artefakten ist, dann ist das wohl ein Grund mehr, mich lieber nicht mit ins Komitee zu schleifen«, nahm ich den Faden vom Anfang des Gesprächs wieder auf, vor allem um mich von meinen eigenen Gedanken abzulenken.
Mom setzte den Blinker und steuerte gemächlich in eine Parklücke vor dem Auktionshaus. »Das ist eine einmalige Geschichte gewesen, in die du unbeabsichtigt hineingeraten bist«, erklärte sie entschieden, als müsste sie auch sich selbst davon überzeugen.
Ich grinste amüsiert. »Oh, lass mich raten – ich bin mit der Geschichte um Timothy Murphys Mörder bereits Gesprächsthema Nummer eins in eurem hübschen Komitee gewesen, nicht wahr?« Immerhin hatte Ciara im Eternity Weekly darüber berichtet, und noch dazu verbreiteten sich Gerüchte ohnehin schneller als alles andere. »Darüber müssen sie sich ja das Maul zerrissen haben.«
Mom zog die Handbremse an und musterte mich streng, wobei sie das Funkeln in ihren Augen kaum verbergen konnte. »Sagen wir, ich konnte ihnen glaubhaft versichern, dass dir die schwarze Magie in dem mittlerweile zerstörten Ouija-Brett entgangen ist und man dir als Eingeweihte keinen Vorwurf machen kann.«
»O ja«, pflichtete ich ihr ironisch bei. »So ohne magische Fähigkeiten ist das Leben nicht leicht.«
Mom blinzelte mich an. »Der Überzeugung war die Vorsitzende auch, und dass es zwischen all den magischen Artefakten und Andersweltlern sicher manchmal beängstigend für dich sein muss.«
»Ich fürchte täglich um mein Leben«, erwiderte ich trocken. Kurz darauf brachen wir in leises Lachen aus, bei dem ein warmes Gefühl in meiner Brust wuchs.
Kapitel 3
Am nächsten Morgen schloss ich den Laden auf und schlüpfte erleichtert ins Warme. Da ich erst ein paar Waren zur Abholung vorbereiten musste, was ich gestern Abend nicht mehr geschafft hatte, drehte ich den Schlüssel von innen wieder in die andere Richtung. Normalerweise hätte ich alles und jeden dafür verflucht, früher als nötig aufstehen zu müssen, und wäre erst nach dem dritten Espresso ansprechbar gewesen. Doch da ich im Moment kaum Ruhe fand, wenn ich in meinem Bett lag, war ich sogar fast froh gewesen, es früher zu verlassen.
Ich blinzelte gegen das Licht an, das die herbstliche Dunkelheit aus dem Laden vertrieb, und rieb mir übers Gesicht. Hier zu sein, machte es nicht besser. Normalerweise tat es das immer. Jeder Winkel war mir so vertraut und erfüllt von Erinnerungen, jedes antiquarische Stück ein Schatz in zweifacher Hinsicht. Es sollte mir nichts ausmachen, allein hier zu sein, trotzdem vermied ich das seit Wochen. Etwas lastete düster und schwer über dem Pot of Gold und mir, und die gestrige Leichtigkeit zwischen Mom und mir ließ es nur schwerer wiegen. Tief atmete ich durch. Ich weigerte mich mit aller Macht, mich aus meinem Zuhause vertreiben zu lassen.
Die dunklen Dielen knarrten, als ich in meinen Boots zur Ladentheke schritt. Die vom Ticken unzähliger Uhren und Knistern des Staubs angefüllte Stille hatte etwas Beruhigendes. Sie war mir vertraut. Trotzdem ertappte ich mich dabei, wie ich in ihr auf etwas lauerte.
»Fuck«, sprach ich einmal laut in den Raum hinein. Prüfend, und um mich selbst dazu zu bringen, mich zusammenzureißen.
Zwei runde Augen, die mich aus einem Regal zwischen ledergebundenen Büchern anstarrten, blinzelten als Antwort.
»Oh, Sekel, hab dich gar nicht gesehen.« Eine fette graublaue Katze plumpste vom Regalbrett auf den Tisch zwischen die Glasschalen. Ich hatte keine Ahnung, wie der Púca es schaffte, sich so unelegant wie ein Elefant durch den Laden zu bewegen und das Porzellan dabei unangetastet zu lassen. Vermutlich hatte es etwas damit zu tun, dass er das ganze Inventar als seinen Besitz betrachtete, den er besser hütete als ein Kerberos die Unterwelt.
»Na, wie war die Nacht? Irgendetwas vorgefallen?« Und weil ich es hasste, wie unsicher ich dabei klang, und mir selbst bescheuert dabei vorkam, fügte ich hinzu: »Den Weg zum Klo hast du gefunden?«
Sekels Schwanz schlug gereizt hin und her.
Gott, Leslie, du bist echt nicht in Form. Ich starrte den Púca noch einen Moment an, dann seufzte ich. Was hatte ich auch erwartet?
Nachdem ich meinen Parka abgelegt hatte, schnappte ich mir den Ordner, um den Papierkram zu erledigen. Viel zu enthusiastisch. Verräterisch enthusiastisch. Ich zwang mich, eine finstere Miene aufzusetzen und den Kopf beim Schreiben gelangweilt auf einen Arm zu stützen. So weit kam es noch, dass ich froh war, mich hiermit ablenken zu können!
Mr Sullivans Gehilfe würde den Federkiel abholen, dessen geschriebene Nachrichten für jeden außer dem ausgewiesenen Empfänger als Lügen erschienen. Bezahlt war er bereits. Wir hatten ihn zurückgelegt, also würde ich ihn aus dem hinteren Lager holen und für den Transport vorbereiten müssen.
Eine Spiegelung huschte durch die Messingwaage, die zu Dekorationszwecken neben der Kasse stand. Ich markierte mir die Stelle, wo der Lieferant unterschreiben würde, dann blätterte ich zum nächsten Schein.
Ach ja! Wir waren endlich dieses lästige Musikkästchen losgeworden, das eine einschläfernde Melodie spielte. Normalerweise kein Problem, wenn man es nicht öffnete, doch ein Defekt hatte dazu geführt, dass es ständig aufgesprungen war und losgespielt hatte. Nicht mal eine magische Sicherung hatte geholfen. Inzwischen war es dank Mom repariert und würde von einem jungen Ehepaar abgeholt werden. Ich hinterfragte mal nicht, mit welchen Methoden andere Leute ihre Kinder zum Einschlafen brachten.
Ein Geräusch wie von vielen kleinen Kugeln, die die Wände entlangklackerten, schwoll an. Meine Nackenhaare stellten sich auf. Mit zusammengekniffenen Augen widmete ich mich dem dritten Blatt Papier. Das Klackern wurde langsamer und ebbte ab.
Hier hatte jemand über unser Onlinesortiment auf hExbuy einen Ring ersteigert, in den nachweislich eines der vierhundert Augen der Seeschlange Suileach eingefasst sein sollte. Ein nettes Sammlerstück, aber selbst ich fand das irgendwie eklig, vor allem, weil der Ring ansonsten keinerlei Kräfte besaß. Ich sollte wohl froh sein, dass …
Sekels Grollen, viel zu tief für das einer Katze, ließ mich ruckartig aufsehen. Er saß immer noch auf dem Tisch und starrte mich böse an.
»Was?«, fauchte ich. »Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin?«
Seine Augen verengten sich, sodass sie jetzt beinahe etwas Katzenartiges hatten.
»Starr mich nicht so an!«
»Lesliiie!« Das Flüstern, vielleicht nur der Wind, der das Herbstlaub auf dem Gehweg vor sich hertrieb, kroch in mein Ohr und setzte sich als klebrige Masse in meinem Kopf fest.
Mein Puls schnellte in die Höhe. »Scheiße, sie ist wieder dahinten, oder?« Oft half es, wenn ich ihre Provokationen ignorierte. Oft, aber nicht immer. Sie würden schlimmer werden, häufiger, deutlicher und lauter, wenn ich nicht reagierte.
Sekels Blick wanderte zum dunklen Vorhang, der den magischen vom normalen Ladenteil abgrenzte, und wieder zurück zu mir. Tu etwas!, verlangte er.
»Ich weiß nicht was, okay?« Ich pfefferte den Kugelschreiber neben die Kasse. Fuck, warum gerade heute, nachdem gestern emotional genug gewesen war? Irgendwo in mir kannte ich die Antwort: Genau heute, weil ich mich angreifbar gemacht hatte. Sie nutzte alles aus, was ich ihr gab, und verschlang es unersättlich.
Sekel sprang vom Tisch auf den Boden und trottete zum Durchgang, der in diesem Moment unheilvoll wie nie zuvor auf mich wirkte. Dort blieb er stehen und sah zu mir zurück. Dass ausgerechnet der verfluchte Púca zu meinem einzigen Verbündeten in dieser Sache geworden war, hatte einen bittersüßen Beigeschmack. Welch Ironie! Niemand sonst nahm die gespiegelten Grimassen und gehässigen Einflüsterungen wahr, spürte es plötzlich kälter werden oder wurde von einer heranrückenden Dunkelheit ergriffen. Ohnehin kam sie mit Vorliebe dann heraus, wenn ich allein im Laden war. Mit Sekel. Ob es daran lag, dass er auf so besondere Weise mit dem Pot of Gold verbunden war, wusste ich nicht. Vielleicht besaß er auch katzenartige Sinne, obwohl er ja eigentlich …
Kaum waren wir auf der anderen Seite des Vorhangs, streckte sich Sekel nach vorn über den Boden. Eine Schlange glitt mir nun voraus und verschwand im nächsten Gang. Ich brauchte den Kobold nicht, um zu wissen, wohin ich musste. Das Prickeln, das mich sonst inmitten der mit Magie angefüllten Luft erfasste, ähnelte eher einer Gänsehaut. Ich durchschritt die Landschaft aus Schätzen aller Art und blieb schließlich vor etwas stehen, das mit einem weißen Tuch abgedeckt und größer als ich selbst war.
Die Stille bewies mir, dass sie auf mich wartete.
Ich sah zu Sekel, der seinen Schlangenkörper neben mir zusammenrollte, sich aufrichtete und leise zischelte. Dass er bei mir war, hatte etwas Tröstliches. Wir konnten uns noch immer nicht ausstehen, und obwohl ich mir sicher war, dass der Púca mir die Schuld an der ganzen Geschichte mit Jacob und dem verwüsteten Laden gab, schweißte uns das hier zusammen. Wir wollten beide, dass sie so schnell wie möglich aus dem Pot of Gold verschwand.
Mit einem letzten tiefen Atemzug griff ich nach dem Tuch. Es glitt vom Spiegel. Und der Geist von Mabel Redmond grinste mir entgegen. »Ich habe auf dich gewartet, Leslie.«
»Was du nicht sagst.«
Nach der Aufräumaktion hatten wir die größten Schäden beseitigt. Mittlerweile sah man der hinteren Ladenhälfte nicht mehr an, dass hier ein Kampf stattgefunden hatte. Nur der Spiegel, mit dessen hundertfachen Reflexionen ich auf Jacob eingeschlagen hatte, war defekt geblieben. Mom hatte ihn mehrmals untersucht und versucht, ihn zu reparieren. Weder hatte er Abbilder in den Raum geworfen noch hatte sie sich selbst darin gespiegelt. Er war blank und leer geblieben, bis sie es schließlich aufgegeben hatte.
Als Mabel mir dann das erste Mal erschienen war, in der Spiegelung meines Wasserglases, das ich daraufhin beinahe Marc an den Kopf geworfen hätte, hatte ich es noch nicht begriffen. Auch nicht, als sie mir während eines Kundengesprächs Drohungen ins Ohr geflüstert hatte, bis ich den Mann angefahren hatte und er entrüstet verschwunden war. Erst als Sekel mich trotz all meiner Verwünschungen hierhergeschleift hatte, war es mir klar geworden.
Die Wraith, der böse Teil von Mabels Seele, der zurückgeblieben war, um Rache an ihrem Mörder zu nehmen, war nicht mit Jacobs Festnahme verschwunden. Sie existierte weiter, hier in diesem Spiegel, in unzähligen kleinen Reflexionen, die sich nach Belieben im ganzen Laden ausbreiteten.
Der Spiegel war nicht kaputt. Er war verflucht.
Und sein Fluch galt mir.
In den Nächten, die ich schlaflos zubrachte, hatte ich lange über die Gründe dafür gegrübelt. Eine mögliche Erklärung war, dass Jacob erst sterben musste, bevor Mabel zufrieden war, und sie mich solang einfach terrorisierte, weil Nathaniel immer noch an mich gebunden war. Es war auch nicht unwahrscheinlich, dass sich die Magie an diesem Tag einfach zu einem wilden Chaos gebündelt hatte und das dabei herausgekommen war. Allerdings konnte ich mir nicht erklären, warum niemand sonst etwas bemerkte, nicht einmal Nathaniel, den ich unauffällig beobachtet und nach Spuren eines Geistes befragt hatte.
Das ergab noch eine dritte Möglichkeit, vor der mich allein Sekel schützte – was vielleicht das Schlimmste an der ganzen Geschichte war: Ich verlor den Verstand.
Die lange Seite von Mabels Sidecut verdeckte die eine Hälfte ihres Gesichtes. Von der anderen blickte mir ein pupillenloses Auge entgegen. Unter ihrer Haut lag ein silberblaues Leuchten. Und die gepiercten Lippen verzogen sich zu einem bitteren Grinsen.
Beim letzten Mal war ich total ausgeflippt, und das hatte die Wraith köstlich amüsiert. Obwohl ich innerlich bebte, musste ich diesmal ruhig bleiben. »Was willst du, Mabel?«, knurrte ich und verschränkte die Arme. »Lass mich endlich in Ruhe.«
»Ruhe«, echote es, als würden viele kleine Mabels dieses Wort wiederholen. Es kratzte unangenehm über meine Nervenenden. »Ruhe habe ich mir auch gewünscht. Sieh nur, was ich bekommen habe. Niemand ist mehr da.«
Ich verzog abschätzig das Gesicht. »Das ist nicht mein Problem. Also mach es auch nicht zu meinem.«
Auf der anderen Seite des Spiegels wirkte es, als würde sie dem Glas näher kommen. »Meine Probleme sind die deinen, Leslie. Du bist wie ich. Wir sind gleich.«
»Sind wir nicht«, presste ich hervor. Schon wieder dieses Thema. Ständig stellte sie Parallelen zwischen uns auf. Vollkommen absurd. »Ich zum Beispiel bin sehr lebendig und gehöre hierher, während du schon lange tot bist und verschwinden solltest.«
Mabels Erscheinung flackerte. Von einer Sekunde auf die andere presste sie ihr Gesicht, zu einer grotesken Maske verzogen, gegen die Innenseite des Spiegels. Sie sah wieder so aus, wie sie gestorben war, zerfetzt von den Dornen, die sich von innen durch ihren Körper gebohrt hatten. Ihr Mund war ein blutiger Schlund, und ihre Augen quollen hervor. »Wenn ich verschwinde, dann verschwindest du mit mir!«
Ihr Kreischen fuhr schmerzhaft durch meinen Schädel. Ich fasste mir an die Stirn und kniff die Augen zusammen. Als ich sie wieder öffnete, stand Mabel in ihrer Geistergestalt wie vorher im Spiegel. Sekel hatte sich in ein schwarzes … Etwas mit roten Augen verwandelt. Irgendeine Mischung aus Katze und Schlange mit den Hörnern einer Ziege, die sich vor mich gestellt hatte und sich drohend gegen Mabel erhob, sodass die Lichter des Ladens flackerten. Sie beachtete ihn nicht, hatte sie nie, als würde sie nur mich sehen.
»Du bekommst deine Ruhe. Bald sind alle weg. Niemand wird noch da sein, weil sie dich alle hassen. Mach deine Probleme nicht zu ihren, dann machen sie ihre auch nicht zu deinen.«
»Lass das!«, zischte ich. Meine lässige Fassade bröckelte mit jedem ihrer Worte, obwohl ich ganz genau wusste, dass sie genau diesem Zweck dienten. »Du kennst mich nicht!«
»Und von allen hasst du dich selbst am meisten.«
»Was für eine abgefuckte Scheiße! Du willst mich das nur glauben lassen. Woher willst du das wissen?«
Mabel legte den Kopf schief, bis ihr Sidecut weit genug zur Seite rutschte, um auch das andere seelenlose Auge freizulegen. »Weil ich es auch getan habe.«
»Ich. Bin. Nicht. Du.« Wort für Wort sprach ich klar und deutlich aus, als würde ich mich selbst davon überzeugen müssen. Als könnte ich leugnen, dass sie recht hatte.
Wenn Mabel lachte, klang es, als würde etwas entzweigerissen werden. »Wer bist du dann? Die Tochter deiner Mutter, dazu verdammt, sie immer wieder zu enttäuschen? Denn das wirst du, du weißt es. Die beste Freundin, die zu eigensüchtig ist, um sich mehr als um sich selbst zu kümmern? Das merkst du nicht einmal. Oder«, Mabel kam wieder näher, »die verschmähte Geliebte, weil du wirklich denkst, irgendetwas empfinden zu können? Warte, bis er sieht, wer du wirklich bist.«
Unbewusst hatte ich die Hände zu Fäusten geballt. Mühsam blinzelte ich die Gesichter der Personen weg, die mir alles bedeuteten. Ich durfte ihr keine Angriffsfläche bieten, ihr nicht zeigen, wie tief es mich wirklich traf. Sekel hatte sich inzwischen für eine gehörnte Riesenschlange entschieden und stieß angriffslustig gegen das Spiegelglas.
»Leere Worte«, sagte ich tonlos und schnappte mir den Überwurf. »Bist du dann fertig mit deiner Shitshow? Für das nächste Mal verzichte ich auf die Einladung, such dir vielleicht mal anderes Publikum.« Oder besser nicht, wenn ich es mir genau überlegte.
»Versuch ruhig, mich verschwinden zu lassen.« Mabel griff mit einer Hand nach vorn, und einen Moment fühlte es sich so an, als würde sie die Finger um meine Kehle schließen. Nur der Hauch einer Berührung, trotzdem atmete ich instinktiv schwerer ein und aus. »Aber ich bin immer da.«
»Ist mir nicht entgangen«, erwiderte ich knapp und machte mich daran, den Spiegel wieder mit dem Tuch zu verdecken. Mabel wehrte sich nicht. Inzwischen hatte ich herausgefunden, dass sie sich dort schubweise manifestierte und mich zu sich lockte, während ihre Präsenz ansonsten schwächer war. Mir würden hoffentlich einige Tage Ruhe vergönnt sein, bevor sich die Erscheinungen wieder häuften.
Sekel musterte mich unzufrieden. Sieh zu, dass du sie loswirst!, schien er sagen zu wollen – fing ich wirklich schon an, mir einzubilden, wie der Púca mit mir redete? Ich verbrachte eindeutig zu viel Zeit mit ihm allein.
»Schon gut, ich lass mir was einfallen!« Na toll, dass ich ihm antwortete, war ja sogar noch schlimmer. Erneut flackerten die Lichter bedrohlich, und ich sah alarmiert von den Lampen zu Sekel. »Das allerdings bringt uns auch nicht weiter. Hast du nicht irgendwelche Tricks auf Lager, um sie auszutreiben oder so?«