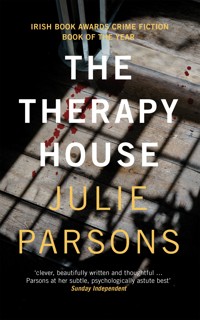Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wer Vergebung sucht, beschwört das Verderben herauf: der psychologische Thriller »Seelengrund« von Julie Parsons jetzt als eBook bei dotbooks. Sie ist wohlhabend, hoch angesehen – und schrecklich allein. Vor 25 Jahren hat Lydia Beauchamp den größten Fehler ihres Lebens begangen: Als ihre Tochter zu ihr kam, schwanger und verzweifelt, hat sie Grace nicht mit offenen Armen empfangen, sondern davongejagt. Diese Schuld lastet schwer auf Lydias Seele. Ist es nun, am Ende ihres Lebens, zu spät, um Grace zu suchen? Als Lydia dem charmanten Adam begegnet, schöpft sie Hoffnung: Der junge Mann wird Grace für sie finden und ihre Tochter endlich nach Hause bringen! Lydia ahnt nicht, welche Abgründe Adam hinter seinem freundlichen Lächeln verbirgt – und was für einem eiskalten Psychopathen sie ihr Vertrauen geschenkt hat … Drei Menschen, drei Leben und ein grausames Geheimnis: »Das fesselnde, alles durchdringende Gefühl der Bedrohung macht diesen Thriller zu etwas Besonderem.« Irish Independent Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Eiskönigin« von Julie Parsons, der irischen Königin der Psycho-Spannung. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie ist wohlhabend, hoch angesehen – und schrecklich allein. Vor 25 Jahren hat Lydia Beauchamp den größten Fehler ihres Lebens begangen: Als ihre Tochter zu ihr kam, schwanger und verzweifelt, hat sie Grace nicht mit offenen Armen empfangen, sondern davongejagt. Diese Schuld lastet schwer auf Lydias Seele. Ist es nun, am Ende ihres Lebens, zu spät, um Grace zu suchen? Als Lydia dem charmanten Adam begegnet, schöpft sie Hoffnung: Der junge Mann wird Grace für sie finden und ihre Tochter endlich nach Hause bringen! Lydia ahnt nicht, welche Abgründe Adam hinter seinem freundlichen Lächeln verbirgt – und was für einem eiskalten Psychopathen sie ihr Vertrauen geschenkt hat …
Drei Menschen, drei Leben und ein grausames Geheimnis: »Das fesselnde, alles durchdringende Gefühl der Bedrohung macht diesen Thriller zu etwas Besonderem.« Irish Independent
Über die Autorin:
Julie Parsons wurde 1951 als Tochter irischer Eltern in Neuseeland geboren. Sie war noch ein Kind, als ihr Vater unter ungeklärten Umständen auf hoher See verschwand – ein Trauma, das sie nie loslassen sollte: »Ich werde niemals herausfinden, was mit meinem Vater geschehen ist, und vielleicht erzähle ich auch deswegen Geschichten, in deren Mittelpunkt Geheimnisse stehen – um sie selbst aufklären zu können.« Julie Parsons studierte in Dublin und arbeitete später als Radio- und TV-Produzentin, bevor sie als Schriftstellerin erfolgreich wurde. Ihr Debüt »Mörderspiel«, auch bekannt unter dem Titel »Mary, Mary«, wurde in 17 Sprachen übersetzt und ein internationaler Bestseller. Julie Parsons lebt heute in der irischen Hafenstadt Dun Laoghaire.
Die Autorin im Internet: www.julieparsons.com
Bei dotbooks veröffentlichte Julie Parsons ihre psychologischen Thriller »Mörderspiel«, »Todeskälte«, »Giftstachel«, »Eiskönigin«, »Seelengrund« und »Sündenherz«.
***
eBook-Neuausgabe August 2019
Die englische Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel The Hourglass bei Macmillan, London. Die deutsche Erstausgabe erschien 2006 unter dem Titel Zähl die dunklen Stunden nur im Droemer Verlag.
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Julie Parsons
Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2006 bei Droemer Verlag. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co.KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Dudarev, Evdokimov Maxim und GIGASHOTS
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-405-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Seelengrund an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Julie Parsons
Seelengrund
Thriller
Aus dem Englischen von Doris Styron
dotbooks.
Meinem Vater Andy Parsons gewidmet.Ruhe in Frieden, wo immer du auch seist.
Mit der Dämmerung kam das Licht. Und mit dem Licht kam der Schmerz. Das Licht schien ins Haus. Der Schmerz pochte in ihrem Körper. Das Licht ließ das getrocknete Blut an Händen und Gesicht heller erscheinen. Es fiel auf ihre geschwollenen Augen, ließ sie zusammenzucken, und ihre Lider schlossen sich ohne ihr Zutun. Sie versuchte sich aufzusetzen, irgendwie zum Fenster zu kommen, um die Vorhänge gegen das Licht vorzuziehen, aber sie konnte ihre Beine nicht heben. Nicht einmal auf allen vieren konnte sie über die glänzenden Dielenbretter kriechen. Sie konnte überhaupt nichts tun, um sich zu schützen. Um sich zu retten. Nichts, außer ruhig dazuliegen und so still zu sein, wie sie nur konnte. Und zu hoffen, dass er jetzt zufrieden war, gegangen war.
Sie schlang die Arme um ihren Leib und horchte. Im Haus war es still. Vielleicht konnte sie ein paar Minuten schlafen. Und wenn sie dann aufwachte, würde sie sich besser fühlen. Stärker und tapferer. Und sie würde aufstehen und auf Zehenspitzen zur Tür gehen, die Tür aufmachen und auf den Treppenabsatz hinausschleichen. Und horchen. Lange auf das Geräusch von Schritten unten in der Diele horchen. Auf das Geräusch seiner Faust. Auf seine Stimme. Und wenn sie ruhig abgewartet und nichts gehört hatte, dann konnte sie eine Hand auf das Treppengeländer legen und langsam nach unten gehen. Vielleicht würde er dann nicht mehr da sein. Vielleicht hätte er beschlossen, dass es für einen Tag genug war. Dass er alles bekommen hatte, was zu kriegen war. Und er würde sie und ihre Tochter in Ruhe lassen.
Aber als sie da auf dem Boden lag, hörte sie ihn. Nicht seine Faust, auch nicht seine Schritte. Nur seine Stimme. Er schrie. Sie hob den Kopf und hielt ihn aufrecht, versuchte, sich zur Tür umzudrehen, aber ihr Hals war so steif und gezerrt, dass sie ihn nicht bewegen konnte. Sie legte den Kopf wieder ab. Tränen rannen aus ihren verquollenen Augen. Es brannte, als sie über die wunden Stellen auf ihrem Gesicht herunterliefen. Sie hörte, was er sagte.
»Ich hab das Stundenglas, Lydia. Und du weißt, was das heißt. Ich habe alle Zeit der Welt. Die Zeit zählt nicht mehr, für dich bedeutet sie gar nichts mehr, für mich aber alles.«
Doch es war egal, was er sagte. Nur wie er es sagte war wichtig. Und was er tun würde. Und sie wusste es von dem Beben, das durch das Haus lief Sie wusste, was er tun würde. Er würde wieder zu ihr zurückkommen. Und diesmal würde es kein Entrinnen geben.
Kapitel 1
Zum ersten Mal sah Adam das Haus vom Fluss aus. Er kam nach zwei Tagen draußen beim Fastnet Rock vom Fischen zurück. Das Wetter war dabei umzuschlagen. Unwetter und Sturm waren vorhergesagt. Sie fuhren flussaufwärts auf ihren sicheren Liegeplatz zu. Er entwirrte die Netze und räumte das Deck auf. Aber der Anblick des Hauses ließ ihn innehalten. Während sie vorbeiglitten, lehnte er sich an das Steuerhaus, schob die Mütze hoch und starrte auf das Ziegeldach und die hohen, durch die Bäume gerade noch sichtbaren Fenster.
»Schön, was?« Pat Jordan, der Schiffer, grinste ihm zu. »Ganz hübsches Häuschen, was meinst du?«
Und er konnte nur nicken und seinerseits grinsen.
Später, als sie die Fischbehälter ausgewaschen und das Boot am Pier festgemacht hatten und mit einem Bier vor einem Teller Käse- und Schinkenbrote im Pub am Tresen saßen, fragte er Pat nach dem Haus.
»Das ist Trawbawn. Wo die alte Beauchamp wohnt.«
»Beauchamp«, Adam sprach den Namen langsam und genießerisch aus. »Komisch. Würde man hier gar nicht erwarten. Ist wohl 'ne Reingeschneite? Wie ich?«
Und Pat lachte, während er sein Bier trank.
»Das könnte man sagen. Oder eher Kuckuckskinder in einem fremden Nest, diese Lydia und ihr nichtsnutziger Mann. Haben das Haus gekriegt, als Daniel Chamberlain starb. Das ist«, er hielt inne und zog an seiner Zigarette, »vielleicht 'ne Geschichte.«
»Ach ja? Na, erzähl doch mal.«
Aber Pat lächelte nur, schüttelte den Kopf und bestellte noch eine Runde. Draußen begann der Regen gegen die Fenster zu peitschen, und der Wind brüllte wie ein wütender Stier.
Später, als sich der Sturm gelegt, der Himmel aufgeklärt hatte und die Sonne herausgekommen war und ihr glänzendes Licht über die frisch gewaschene Landschaft breitete, fuhr er im Auto auf der Straße am Fluss entlang. Es gab mehr Tore, als er zuvor bemerkt hatte. Die ersten zwei, die er ausprobierte, führten zu Gehöften mit modernen Häusern, die man neben den baufälligen Hütten errichtet hatte. Traktoren standen neben großen Misthaufen, und Hunde bellten so böse, dass er keine Lust hatte auszusteigen. Durch das nächste Tor kam er auf eine kleine Zubringerstraße, neben der zwei flache Flusskähne an Liegeplätzen festgemacht waren und ein Haufen Netze und Hummerfässer lagen. Doch eine halbe Meile weiter, wo die Straße nach einer Kurve wieder gerade weiterführte, kam er an zwei hohe, schmiedeeiserne Tore in einer von Efeu überwucherten Steinmauer, die mit einem Stück darumgelegter Kette gesichert waren.
Er bremste und hielt auf dem Grasstreifen an, stieg aus und drückte das Gesicht ans Gitter. Eine lange Kieseinfahrt erstreckte sich vor ihm, die auf beiden Seiten von Bäumen mit glatten grauen Stämmen gesäumt und von deren Zweigen überdacht war. Er bückte sich, um die Kette und das Vorhängeschloss zu betrachten. Das Schloss war offen und die Kette lose, so dass man leicht hineinfassen, den rostigen Riegel hochheben und das Tor aufstoßen konnte. Er trat zurück, um einen genaueren Blick auf die Mauer zu werfen. Dann bemerkte er an einer Seite die schief in den Scharnieren hängende, halb offene Tür, von der jemand achtlos den Efeu weggezogen hatte. Er schaute sich um. Niemand war zu sehen, nur von jenseits des Hügels kam das leise Brummen eines Traktors, und als sich das Geräusch eines vorbeifahrenden Autos verloren hatte, herrschte plötzlich Stille. Nur der frische Wind raschelte in den steifen Efeublättern.
Adam stieß die Tür auf und ging langsam die Einfahrt entlang. Unter seinen Schuhen stiegen von dem Kies kleine Staubwölkchen auf. Es war so still hier. Nur das sanfte Murmeln der Blätter in den Eschen. Und der jähe, schrille Schrei einer Möwe, die über ihm schwebte. Er folgte dem weiten Bogen der Einfahrt, und da stand das Haus vor ihm. Es war nicht besonders groß oder prunkvoll. Auch nicht respekteinflößend. Kein Haus, vor dem einem der Atem stocken, vor dem man zurückweichen oder dessen Pracht man bestaunen würde. Es war einfach nur sehr schön. Drei Stockwerke mit jeweils einem geschwungenen Erker vom Dach bis zum Boden. Alle Fenster waren perfekt proportioniert. Ein mit blauem und grauem Schiefer gedecktes Dach. Hohe Schornsteine. Eine Haustür mit einem eleganten Oberlicht darüber. Und als er auf dem Rasen stand, der das Haus von drei Seiten umgab, konnte er durch die Fenster sehen, dass auch die Zimmer sehr schön geschnitten waren.
Die Haustür war offen. Davor stand auf dem breiten, an die Treppe anschließenden Vorplatz ein Liegestuhl, und ein Buch lag mit den aufgeschlagenen Seiten nach unten auf der Sitzfläche. Daneben stand ein halb volles Glas. Er hob es hoch und roch daran. Gin, vermutete er und hielt das Glas ans Licht. Am Rand war ein tiefroter, klebriger Abdruck. Er schwenkte den Inhalt herum. Eiswürfel klirrten leise. Er tauchte einen Finger hinein und leckte ihn behutsam ab. Es war wirklich Gin. Er legte den Mund auf den roten Abdruck und nahm einen Schluck. Die kalte Flüssigkeit rann über seine Zunge und brannte ihm in der Kehle. Er beugte sich hinunter und stellte das Glas wieder hin, richtete sich auf und ging langsam weiter.
Colm hatte ihm von dem Haus erzählt, hatte ihm vom Fluss, von der Bucht, den Inseln, dem Meer, den Felsen, den Vögeln und Fischen erzählt. Er hatte auf seiner Schlafstelle gelegen und endlos geredet. Ganze Nächte lang, wenn das Licht auf dem Treppenabsatz durch ihre Augenlider drang und die Geräusche im Gefängnis sie fortwährend in Alarmbereitschaft hielten.
»Geh hin, wenn du hier rauskommst. Es ist ein guter Ort. Dort gibt es jede Menge Möglichkeiten, seinen Unterhalt zu verdienen. Beim Fischfang, auf einer Farm oder auf dem Bau gibt es immer was zu tun. Und in den Lokalen findet sich auch genug Arbeit für einen Jungen wie dich. Für einen, der Köpfchen hat und sich nicht ziert. Stimmt doch, Adam, oder?« Und dabei griff er hinauf, nahm Adams Hand und führte sie an sein Gesicht, hielt sie fest, streichelte die feste junge Haut, drehte sie um und presste seine Lippen auf die weiche Handfläche.
Jetzt ging Adam über den Rasen und betrachtete das Haus, während er sich davon entfernte. Von hier aus schienen die Fenster schwarz und leer. Kein Lebenszeichen von drinnen. Als er die Bäume erreichte, wandte er sich ab. Er folgte dem Weg, der sich durch den Wald wand, zum Flussufer hinunter. Es war Ebbe. Bis zum träge fließenden Fluss erstreckte sich klebriger schwarzer Schlamm, in dem sich die Rinnsale des trüben Wassers in alle Richtungen verloren. Er stützte sich auf die niedrige Mauer, die sich warm anfühlte. Über ihm schwebte eine Möwe, ließ sich treiben, schlug mit den weißen Flügeln, ging in die Kurve und segelte weiter. Er begann dem Rand der Uferböschung zu folgen und fuhr mit der Hand leicht auf der Mauer entlang. Der Geruch von salzigem Schlamm stieg ihm in die Nase. Hier war Flachs gepflanzt, der zwischen den Dornbüschen und Brombeeren, dem Farn und den gekrümmten Zweigen einer wilden Rose fehl am Platz wirkte. Zwischen den Bäumen öffnete sich eine Lichtung. Grabsteine – manche umgefallen und verstreut, andere standen noch. Es waren behauene und verzierte Blöcke aus Kalkstein. Er blieb stehen und beugte sich vor, um die Namen zu lesen. Thomas, Rebecca, William, Judith, Margaret, Jane, David und Daniel. Einfache, nüchterne Vornamen, alle mit dem gleichen Familiennamen, Chamberlain. Außer dem neuesten. Alexander Beauchamp. Geboren 1933, gestorben 1995. Unser geliebter Mann und Vater. Ruhe in Frieden. Er beugte sich über den glatten grauen Stein und fuhr mit dem Zeigefinger über die eingemeißelten Buchstaben. Der Stein fühlte sich warm an. Er stieg auf die Grabplatte, drehte sich um, streckte sich lang darauf aus und spürte sie hart an Schulterblättern, Rippen und Hüftknochen. Hart und unnachgiebig wie der Boden der Strafzelle. Aber wenn er hier die Augen weit öffnete und nach oben blickte, war der Himmel so blau wie die Augen eines Säuglings, und der Geruch von Meer und Erde war um ihn, nicht der Gestank des randvollen Eimers in der Ecke.
Er holte Atem, zog die Luft tief in die Lunge und spürte, wie sie sich in seiner Brust ausbreitete. Er war hungrig und fühlte sich leer. Als er den Kopf hob, um zum Fluss hinüberzublicken, wurde ihm von der Bewegung übel. Er hatte sich noch nicht ganz an die unregelmäßigen Mahlzeiten gewöhnt. Sieben Jahre pünktlich um halb neun, halb eins und halb sechs zu essen hatte seinen Körper trainiert, so dass er das Essen jetzt erwartete und Bedürfnisse hatte, die gestillt werden mussten. Aber es war ja nicht mehr so. Jetzt konnte er essen, wann immer ihm danach war, und oft war ihm überhaupt nicht danach. Jetzt allerdings schon. Er wollte etwas zu essen. Und zwar schnell.
Er schwang die Beine zur Seite und stand auf. Es war kühler als vorher, die Sonne fing an, am jenseitigen Flussufer hinter den Bäumen zu verschwinden. Er entfernte sich von dem kleinen Friedhof und ging wieder den Weg entlang. Der Bewuchs war hier dichter. Rhododendronbüsche überragten ihn und drängten sich von der Seite an ihn heran. Er erkannte ihre riesigen, glatten Blätter, die so leuchtend glänzten, dass sie fast so aussahen, als könne man sie essen. Der Boden unter seinen Schuhen war dick mit Laub vom Vorjahr bedeckt. Er watete durch die Blätter und fragte sich einen Augenblick, was wohl darunter sein mochte. Einen Moment lang hatte er das Gefühl, er müsse sich übergeben, und spürte, wie seine Zehen sich von der dicken Gummisohle seiner Schuhe zurückzuziehen versuchten. Denn er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass eine Maus oder Ratte sich irgendwo verstecken, ihn beobachten und darauf warten könnte, dass er ausrutschte und hinfiel. Dann erinnerte er sich an das, was Colm ihm einmal gesagt hatte, an einem Sonntagnachmittag, als sie zusammen eingeschlossen waren und er aus einem Alptraum erwacht war, dem gleichen, den er immer wieder hatte. Die Ratten liefen über ihn hinweg, und ihre Schwänze zuckten über seinen Mund. Die Angst, dass er sich durch sie anstecken könnte. Die Scham, jemand könnte erfahren, dass eine Ratte auf seiner Brust gesessen, mit ihrer zierlichen kleinen Pfote ausgeholt und sein Kinn, seine Wange berührt hatte und hochgekrabbelt war, um ihn auf die Lippen zu küssen. Er erwachte mit einem Schrei, Schweiß troff ihm von Gesicht, Rücken und Brust, und er spürte den warmen Urin an seinen Beinen hinunterrinnen. Und dann der Geruch, dieser süße, widerwärtige Geruch.
Aber Colm war bei ihm. Er hielt ihn fest, beruhigte ihn, sprach mit ihm in einer Sprache, die er nicht verstand. Mo chroí, mo chroí, a ghrá, a ghrá, immer wieder, bis sein Herzschlag langsamer wurde und seine Schluchzer aufhörten. Und Colm zog ihn aus und wusch ihn, wickelte ihn in eine trockene Decke und tröstete ihn:
»Beachte die Ratten doch gar nicht. Sie haben doch vor dir noch größere Angst als du vor ihnen. Die wollen dir mehr aus dem Weg gehen als du ihnen. Bestimmt, das weißt du doch, oder? Du bist ja ein großer, starker Junge, der auf sich aufpassen kann. Oder, Adam? Das bist du doch?«
Aber obwohl er Colms Worte und seine Stimme hörte, ging er immer schneller, bis er fast rannte und vor sich den von der Mauer umgebenen Garten sah. Das Holztor war geschlossen, hatte aber einen Griff mit einem Strick daran, mit dem sich der Riegel öffnen ließ. Und hier war alles sicher. Viele Gemüsesorten waren in ordentlichen Reihen angepflanzt, und entlang der nachmittags von der Sonne erwärmten Mauer stand ein Treibhaus voll exotischer Blumen, große herunterhängende Trompeten in Gelb und Orange, Töpfe mit Tomaten, die noch nicht reif waren, Gurken und Paprika und über seinem Kopf auch eine Rebe mit kleinen, runden, grünen Trauben, die man noch nicht essen konnte.
Aber die Himbeersträucher trugen üppige rote Früchte, der Saft tropfte ihm von den Fingern, als er die kegelförmigen Beeren von den Zweigen streifte und nur den spitzen weißen Stumpf stehen ließ, an dem sie saßen. Und er wühlte in der Strohunterlage der Erdbeeren, die süßer als die Himbeeren waren, und spürte die Samenkörnchen der Früchte, als er sie mit der Zunge an den Gaumen drückte. Dann drehte er den Wasserhahn neben dem Kompost an und wusch sich das Gesicht mit dem kalten Wasser, hielt den Mund darunter und spürte es auf sein T-Shirt hinuntertropfen, während er mit geschlossenen Augen fühlte, wie die klebrige, eklige Süßigkeit von dem scharfen kalten Wasserstrahl weggespült wurde. Er hatte die Augen noch geschlossen, deshalb sah er weder die Hand, die nach dem Hahn griff und ihn zudrehte, noch hörte er die schnellen Schritte auf dem gepflasterten Weg hinter sich. Er hörte und sah nichts, bis die Stimme langsam, ruhig und furchtlos sagte:
»Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Wieso zum Teufel glauben Sie, Sie könnten einfach in meinen Garten spazieren und sich mein Obst nehmen? Antworten Sie mir, hören Sie, bevor ich Sie rausschmeiße. Antworten Sie!«
Kapitel 2
Lydia hatte seinen Schopf gesehen, sein helles Haar, das in der Nachmittagssonne fast golden glänzte. Während er sich jetzt am Wasserhahn das Gesicht wusch und das Wasser auf seine Kleider tropfte, sah sein Haar allerdings stumpf und eher braun aus, denn in dem umfriedeten Garten war es plötzlich schattig geworden. Aber als er mit Überraschung und Beklemmung auf seinen Zügen zu ihr aufsah, schnell vor ihr zurückwich und dann genau in einem Sonnenfleck stand, sah sie, wie es wieder glänzte. Fein, makellos und gelb. Das Haar ihrer Tochter. Graces Haar. Und ein Lächeln, das dazu passte. Ein Lächeln, das sie innehalten und den zornigen Wortschwall aus ihrem Mund stocken ließ. So standen sich die alte Frau und der junge Mann in der Stille gegenüber, bis plötzlich ein Vogel sehr laut zu singen begann.
Sie war im oberen Stockwerk gewesen, als sie ihn zuerst erblickte. Das Klingeln des Telefons hatte sie von ihrem Stuhl, ihrem Drink und dem Buch weggerufen, und als sie in die Diele eilte, um abzunehmen, hatte sie plötzlich das Gefühl, es sei dringend. Aber es war nichts Wichtiges. Eine Anfrage von einem Hotel aus der Umgebung, wann der Garten für die Öffentlichkeit zugänglich sei. Man habe dort ein amerikanisches Paar unter den Gästen, das von der Sammlung empfindlicher Staudengewächse der Beauchamps gehört hatte. In einer im Flugzeug ausliegenden Zeitschrift hatten sie die Fotos gesehen.
»Morgen«, sagte sie. »Morgen früh. Sagen Sie ihnen, sie sollen um elf kommen. Dann biete ich nach der Führung Kaffee und frisch gebackene Scones an.«
Aber als sie mit dem Telefon in der Hand in der Diele stand und auf die Stimme am anderen Ende horchte, ergriff sie eine so schmerzliche Einsamkeit, ein solches Gefühl des Verlassenseins, dass sie nach dem Anruf schnell die Treppe hinauf und in ihr Schlafzimmer im vorderen Teil des Hauses lief, sich einen Moment auf einen Stuhl am Fenster setzte und sich in dem hohen Spiegel mit dem Goldrahmen am anderen Ende des Zimmers betrachtete. Sie wollte sich nur vergewissern, dass sie noch die Frau war, die sie immer schon gewesen war. Klein, geschmeidig und stark. Das Haar war früher schwarz gewesen, jetzt mischten sich graue Strähnen dazwischen, aber es legte sich immer noch dick und lockig über der Stirn nach hinten. Das war noch ihr eigenes Gesicht, das waren die vertrauten Züge unter der das Alter verratenden Haut. Und sie hatte noch die vollen Lippen ihrer jungen Jahre. Als sie aufstand, den Lippenstift von der Frisierkommode nahm und damit ihren Mund betupfte, um die Farbe aufzufrischen, dann die Lippen fest zusammenpresste, schweifte ihr Blick von ihrem Spiegelbild über die Baumwipfel hin über den Fluss dahinter und den Himmel darüber, und sie sah dort unten eine Bewegung, irgendeine ungewohnte Bewegung. Und als sie ans Fenster trat, um besser sehen zu können, entdeckte sie den Kopf, blond und hell, der sich zwischen den Bäumen und Büschen vom Haus fortbewegte.
Und der Gedanke stahl sich in ihr Bewusstsein, der freudige Gedanke, dass der blonde Schopf, der durch den Garten huschte, der von Grace sein könnte. Von ihrer schönen Grace, ihrer Tochter Grace.
Sie presste die Hände gegen die Fensterscheibe und lehnte auch den Kopf daran. Ihr Atem beschlug das Glas, und sie trat zurück und wischte es ab. Jetzt hatte sie den Kopf aus den Augen verloren. Wer immer es war, war aus ihrem Blickfeld geraten und hinter den höchsten Bäumen verschwunden, den Buchen, die in einem dichten Gehölz zwischen dem Haus und dem Ufer standen.
Sie ging zur Tür. Der Treppenabsatz war von der hellen Nachmittagssonne beschienen. Die Türen zu den anderen Räumen standen offen wie immer Sie ging daran vorbei, ihr Schritt war noch leicht und schnell, obwohl sie das Gefühl hatte, sie müsste sich an die Wand lehnen, um Luft zu bekommen, so stark war der Schmerz, der sie durchzuckte, als sie nach rechts und links auf die Zimmer blickte, wo die Betten gemacht waren, die Böden sauber, die Regale abgestaubt. Bereit für die, die sie erwarteten.
Draußen war es noch warm. Sie beugte sich hinunter, um ihr Glas zu nehmen. Das Eis war geschmolzen. Sie neigte den Kopf, hob es an den Mund und trank. Dann stand sie mit dem Glas in der Hand einen Augenblick da und sah über den Rasen zu den Bäumen hin, die zwischen dem Haus und dem Fluss standen. Sie sah Grace die Araukarie hochklettern, deren schuppige Äste ihre nackten Beine zerkratzten. Und Alex breitete die Arme aus, um sie aufzufangen, als sie sprang. Seine Hände strichen über ihre Oberschenkel. Alex mit seinem von der Sommersonne gebleichten Haar, dem breiten Lächeln und seinen hellen blauen Augen, um die sich Fältchen legten, wenn er ins Licht sah. Sie schloss die Lider vor dieser Erinnerung, öffnete sie wieder und dachte: Alex ist tot, Grace ist fort. Nur ich bin noch hier, ganz allein. Sie breitete die knorrigen Hände mit den Altersflecken aus, die faltig und gerötet waren. Und drehte sie um, betrachtete die dicken blauen Adern, die an den Handgelenken entlangliefen, und die Falten, die sich tief in ihre Handflächen eingegraben hatten. Sie ballte die Hände zu Fäusten, entfernte sich vom Haus und ging den Weg entlang auf einen kleinen Schuppen zu, der etwas abseits stand. Sie trat hinein, nahm einen Spaten und schwang ihn hin und her, als sie wieder zurück über den Rasen und zwischen den Bäumen hindurchging.
Und dann sah sie den jungen Mann wieder, der in ihren Garten eingedrungen war. Er machte keinen Versuch, sich zu verstecken, sondern ging mit sicheren, leichten Schritten vor ihr her. Sie blieb zurück und beobachtete ihn, sah ihn in dem kleinen Gräberfeld, wie er sich auf das Grab ihres Mannes legte. Sie wartete ab, was er als Nächstes tun würde, und bemerkte, als er weiterging, in seinen Bewegungen eine Dringlichkeit und Unruhe, eine plötzliche Spannung, der jetzt alle Sorglosigkeit fehlte, so wie er die Schultern hochzog und die Fäuste ballte. Sie blieb zurück und sah zu, wie er das Tor zum Küchengarten aufstieß. Und sie beobachtete, wie er sich zwischen die Himbeersträucher drängte, seine Hände und das Gesicht rot vom Saft wurden und er auf Händen und Knien nach Erdbeeren suchte. Und dann wurde ihr klar, dass er sie an jemanden erinnerte – nur an wen, oder an was? Sein Haar war wie das von Grace, aber er hatte noch etwas anderes an sich. Eine Art nobler Heiterkeit, mit der er den Garten durchstreifte. An wen erinnerte sie das? Sie konnte es nicht benennen oder ein Gesicht damit in Verbindung bringen. Aber irgendwo in ihrer Erinnerung war es präsent.
Als sie mit dem Spaten auf den Boden schlug, hörte er sie nicht. Sie sah zu, wie er die Hand auf den Wasserhahn legte und ihn aufdrehte. Sie wartete zwei Minuten, nur, bis er genug getrunken hatte, dann begann sie so schnell sie konnte auf dem Plattenweg auf ihn zuzugehen; sie straffte die Schultern, atmete tief ein, und ein gerechter Zorn erfüllte sie. Bis sie bei ihm war, war sie so weit, dass sie laut rief:
»Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Wieso zum Teufel glauben Sie, Sie könnten einfach in meinen Garten spazieren und sich mein Obst nehmen? Antworten Sie mir, hören Sie, bevor ich Sie rausschmeiße. Antworten Sie!«
Sie sah die plötzliche Panik auf seinem Gesicht – und dann das Lächeln, diese langsame Bewegung seines Mundes, die ihre Worte ausbremste, sie abstellte, so dass sie stumm war, genauso stumm wie er selbst.
Sie saßen in der großen Küche im Kellergeschoss, wo sie Tee aus einer geblümten Porzellankanne eingoss und Kekse anbot, die halb mit dunkler Schokolade überzogen waren. Er nahm einen, und als sie darauf bestand, auch einen zweiten. Eine kleine getigerte Katze döste auf ihrem Schoß. Er hätte auch gerne geschlafen, hätte gern seinen Kopf auf den Tisch gelegt und sich treiben lassen.
Er hatte sein Lächeln eingesetzt. Seine Oma hatte immer gesagt: Vergiss dein Lächeln nicht. Es ist dein größter Vorzug. Und sie hatte recht gehabt. Wie mit so vielem. Er hatte der alten Dame mit dem wirren schwarzgrauen Haar, die den Spaten wie eine Waffe in der Hand hielt, zugelächelt, und sie hatte sein Lächeln erwidert, stellte dann den Spaten an die Wand und wandte den Blick ab.
Er hob entschuldigend die Hand und sagte: »Tut mir leid, wenn ich Sie beunruhigt habe. Das war nicht meine Absicht. Ich hatte nicht vor, in Ihr Eigentum einzubrechen. Aber dieser Ort hier«, er wies auf alles um ihn herum, »er ist so schön.« Und wieder lächelte er und sagte: »Ich heiße Adam, Adam Smyth.«
Sie lächelte ihm ebenfalls zu und nahm seine Hand. Ihr Händedruck war fest, die Handfläche kühl und der Klang ihrer Stimme klar und kräftig.
»Und mein Name ist Lydia Beauchamp. Sehr angenehm.« Hier im Halbschatten war es kühl, aber nicht kalt. Er rutschte auf seinem Stuhl zur Seite, und die Stuhlbeine kratzten auf dem gefliesten Boden. Er grinste bedauernd. Sie nickte, sagte aber nichts. Eine Uhr schlug irgendwo im Haus. Es war ein hübscher, melodischer Klang. Er trank von seinem Tee und aß noch einen Keks. Sie beobachtete ihn genau. Er hatte ganz merkwürdige Augen. Das linke war von einem kalten Grünblau, wie Wasser unter Eis, und das rechte leicht haselnussbraun mit dunklen Pünktchen wie ein Stück russischer Bernstein. Er erwiderte ihren Blick. Sie bot ihm die Schale mit Schokoladenkeksen an. Ihre Hände hatten immer noch eine gewisse Eleganz. Sie trug einen Ring mit einem dunkelroten Siegel am linken kleinen Finger. Am Ringfinger saß ein Ehering, ein breiter Reif aus buttergelbem Gold. Als sie ihre Hand bewegte, rutschte er bis zum Fingergelenk hoch und dann wieder zurück. Am Handgelenk trug sie einen einfachen Goldreif und um den faltigen Hals eine schwere Kette vom gleichen Farbton und der gleichen Qualität wie ihr Ehering.
»Wie haben Sie uns denn gefunden? Zufällig?«
Die erste Lüge. »Zufall, richtig. Ganz zufällig. Ich sah das Haus vom Fluss aus und wollte es mir genauer anschauen. Tut mir leid, dass ich einfach eingedrungen bin, aber ich konnte einfach nicht widerstehen.« Er lächelte ihr zu und aß noch einen Keks.
»Sie können Versuchungen nicht widerstehen, was?«
»Stimmt«, nickte er. »Überhaupt nicht. Ich war in der Schule immer in Schwierigkeiten. Hab dauernd Unfug getrieben, wurde immer mit 'nem Zettel nach Haus geschickt, hab meine Mutter zum Wahnsinn getrieben.«
»Und Mädchen?«
»Mädchen, Spaß, Partys, Pferde, Hunde, Autos – alles Mögliche.«
»Und jetzt, wie steht's jetzt? Wie alt sind Sie denn jetzt?«
»Achtundzwanzig. Noch keine Drei vorne dran.«
»Die große Drei mit der Null – das ist ja gar nichts. Da sind Sie ja kaum aus den Kinderschuhen heraus. Warten Sie mal ab, bis Sie so alt sind wie ich.«
»Und das wäre?«
Sie lächelte und zeigte ihre Zähne, die noch weiß und gerade waren und vorn in der Mitte eine kleine Lücke hatten.
»Das wüssten Sie wohl gerne, was? Hat man Ihnen nie gesagt, dass es ungezogen ist, eine Dame nach ihrem Alter zu fragen?«
»Das meine ich ja.« Er nahm noch einen Keks. »Ich kann einfach nicht widerstehen, das zu tun, was man mir verboten hat. Ich kann nicht widerstehen.«
Die Uhr in der Diele begann zu schlagen. Es war sechs. Sie erhob sich, und er wollte ebenfalls aufstehen.
»Nein, nein, bleiben Sie, wo Sie sind, ich bekomme nicht oft die Gelegenheit, einen so jungen, gut aussehenden Mann zu bewirten, selbst wenn Sie ein Einbrecher und Dieb sind.« Sie lächelte ihm wieder zu, um den Worten die Schärfe zu nehmen. »Lassen Sie uns etwas trinken. Ich nehme um sechs immer einen Drink. Und das ist mal was anderes, wenn ich nicht allein trinke.« Sie griff in einen Schrank und nahm eine Flasche heraus. »Gin, geht das in Ordnung?«
Der Gedanke daran brannte ihm in der Kehle, und er spürte wieder den klebrigen Lippenstift am Glas.
»Eigentlich ist Gin wohl nicht Ihre Sorte Drink, oder?«, sagte sie. »Junge Männer mögen ja all diese neumodischen Biersorten. Einfach aus der Flasche, so ist es doch?«
»Ich nicht, ich mag am liebsten Wein. Aber Gin ist auch ganz gut.«
Die zweite Lüge. Nur eine kleine, nicht so groß wie die erste. Sie rutschte einem so leicht heraus und lag nun zwischen ihnen auf dem Küchentisch, während sein Blick zu dem Kasten mit Leergut an der Hintertür und dem Regal mit den vollen Flaschen in der Ecke schweifte.
»Wein, aha. Das ist ein gutes Laster, das kann man pflegen. Mein Mann, mein verstorbener Mann, trank Wein. Er glaubte eine Zeit lang, dass wir hier vielleicht Trauben anbauen und unseren eigenen Wein keltern könnten. Aber das Wetter, wissen Sie, zu unberechenbar.« Sie hielt inne. Der Gin plätscherte in die Gläser.
»Ihr Mann, wann ist er gestorben?«
Sie blickte ihn an, hob ihr Glas und trank. Dann stellte sie das Glas auf den Tisch zurück.
»Das wissen Sie ja«, sagte sie. »Sie haben doch sein Grab gesehen, oder?«
»Sein Grab? Das dort ...«
»Das dort, ja. Das letzte. Das mit seinem Namen drauf. Alexander Beauchamp. Das, welches Sie unten beim Fluss gesehen haben.« Ihr Lächeln war verschwunden.
»Natürlich«, er begann zu stottern, »natürlich, natürlich, Ihr Mann.« Er spürte wieder den kalten Stein am Rücken, der hart gegen Rippen, Hüften und Hinterkopf drückte.
»Es war also reiner Zufall, ja?« Sie hob wieder das Glas und trank es aus, stand auf und ging zum Kühlschrank, machte die Tür auf und nahm die Schale mit Eiswürfeln und die Flasche Tonic heraus. Sie wandte ihm den Rücken zu und goss sich selbst noch einmal ein. »Ich bin mir nie ganz sicher in Bezug auf Schicksal, Zufall, Vorsehung, Glücksfall, nennen Sie es, wie Sie wollen. Ich bin nie sicher, dass es da nicht irgendwo doch irgendjemanden gibt, der Würfel spielt oder dem goldenen Faden seinen Lauf lässt, dann die Schere ansetzt und ihn einfach so«, sie machte eine Geste mit der rechten Hand, »abschneidet. Und so beginnt alles, oder andernfalls endet es so. Es hängt davon ab, wie man es betrachtet.« Sie wandte sich ihm zu und streckte die Hand aus, um sein Glas zu nehmen. Er hob es hoch, trank es aus und gab es ihr. Sie wandte sich wieder ab, und er hörte das Klirren von Eis, den Schuss Gin, das Zischen des Tonics. Sie ging auf ihn zu und fasste ihn mit dem Zeigefinger unter dem Kinn. Ihr Knochen lag an seinem. Er spürte die scharfe Spitze ihres Fingernagels, die sich in seine Haut bohrte, als sie ihn zwang, zu ihr aufzusehen. Er wollte sein Gesicht mit einem Ruck abwenden, aber irgendwie schaffte er es nicht, versuchte wegzusehen, konnte aber nicht entkommen.
»Also«, sie hob mit der freien Hand ihr Glas. »Was soll's sein, Adam? Zufall oder Schicksal? Wofür entscheiden Sie sich?«
Er lächelte wieder, aber diesmal schien das nicht die gleiche Wirkung zu haben. Sie wich nicht vor ihm zurück. Er hob den Arm und packte sie schnell, bevor sie reagieren konnte, am Handgelenk. Er spürte, wie zerbrechlich sie war, wie wenig Gewebe ihre Knochen umgab. Er hielt sie sanft fest und schob ihre Hand behutsam von seinem Gesicht weg.
»Ich würde mich für das Schicksal entscheiden. Das heißt, wenn ich die Wahl hätte«, sagte er und hob sein Glas, leerte es, stellte es auf den Tisch zurück und stand auf. Er grüßte sie, indem er mit dem Zeigefinger kurz an seine Schläfe tippte, dann wandte er sich ab und ging den Flur entlang, die Treppe hoch und durch die Diele in den Abendsonnenschein hinaus.
Kapitel 3
Es war still auf der Station im obersten Stock des Krankenhauses. So still, dass es Johnny Bradshaw, der am Bett seiner Mutter saß, vorkam, als seien er und sie die einzigen Menschen im Gebäude. Es gab andere. Aber sie waren alle unheilbar krank, genau wie seine Mutter. Hier herrschte weder die Geschäftigkeit noch der Lärm, der sonst auf Krankenstationen üblich ist. Keine Rollwagen mit Medikamenten ratterten, Tabletts mit Essen stießen nicht klappernd aneinander, und es gab keine Besucher mit protzigen Blumensträußen oder Pralinenschachteln. Auf den Nachttischen standen keine Genesungskarten. Es herrschte nur eine Atmosphäre stiller Resignation und Gelassenheit.
Jedenfalls erschien es Johnny so. Er wusste nicht, was seine Mutter dachte oder fühlte. Sie lag in einem tiefen Koma, und das schon seit zwei Tagen. Ein erneuter Schlaganfall hatte sie in unerreichbare Ferne entrückt. Jetzt lag sie bewegungslos, blass und schweigend da. Ihr Atem ging unregelmäßig. Manchmal schien es, als hätte er ganz aufgehört. Aber wenn Johnny sich vorbeugte, um Mund und Nase genauer zu betrachten, atmete sie doch wieder und zog plötzlich tief die Luft ein, als wollte sie ihm sagen, sie sei noch mit ihm zusammen im Zimmer.
Von Zeit zu Zeit kam eine Krankenschwester herein, legte die Finger auf das Handgelenk seiner Mutter und überprüfte mit einem Blick auf ihre Uhr den Puls. Dann lächelte sie, nickte und ließ ihn mit ihr allein. Es machte ihm nichts aus. Er war gern hier bei seiner Mutter. Sie war immer eine stille Frau gewesen. Niemand, der brillante Konversation und schlagfertigen Witz versprühte. Sie behielt ihre Meinung für sich und sprach nur, wenn sie etwas Wichtiges zu sagen hatte. Als sein Vater noch lebte, hatte sie das Reden meistens ihm überlassen. Und nachdem er vor drei Jahren gestorben war, wurde sie immer stiller. Manchmal rief sie Johnny an, und wenn er abnahm und Hallo sagte, antwortete niemand. Dann erzählte er ihr von seinem Tag, wie es ihm mit seiner Abiturklasse ging, welche Filme er mit seiner Freundin gesehen hatte. Er plauderte immer weiter, bis er sie seufzen hörte. Und dann hängte sie auf.
Und deshalb war er so überrascht, als sie ihn anrief und sagte, sie wolle mit ihm reden. Es war zwei Wochen, nachdem sie den ersten Schlaganfall erlitten hatte. Eine Lähmung ließ ihr Gesicht auf der einen Seite schlaff herunterhängen, und sie konnte nur undeutlich sprechen. Sie wohnte noch zu Hause und kam mit der Hilfe einiger netter Nachbarn über die Runden, aber als er ihr Tee machte und mit ihr im Wohnzimmer saß, sah er, dass sie sich nicht mehr selbst versorgen konnte.
»Johnny«, sagte sie und hielt dann inne.
»Ja?« Er wartete.
»Du weißt doch, nicht wahr, dass du ein Adoptivkind bist?«
»Ja, du und Dad, ihr habt es mir gesagt, als ich noch klein war.«
»Ja, das haben wir getan, nicht wahr?« Sie sah zu ihm auf und lächelte, so gut es mit ihrem armen verzerrten Gesicht ging.
Er konnte sich nicht erinnern, wann oder wie sie es ihm gesagt hatten. Er wusste es einfach. Er hatte es immer gewusst. Es hatte ihm nichts ausgemacht. In der Schule hatte er sogar damit angegeben. Es gefiel ihm, dass er sich dadurch von den anderen unterschied. Und manchmal passte es ihm ganz gut in den Kram. Wenn er seine Mutter und seinen Vater betrachtete und sah, dass sie älter waren als die Eltern der anderen Kinder, dass sie sich nichts aus Geld, Besitz oder Pauschalreisen nach Spanien machten und dass sie mit ihrem staubigen alten Antiquariat in einer kleinen Straße in Chichester zufrieden waren, dann konnte er mit einem Abwinken über sie hinweggehen. Jetzt hatte er Schuldgefühle, wenn er daran dachte.
»Also, es gibt da etwas, das du haben sollst. Es ist oben auf dem Dachboden, und ich kann jetzt nicht mehr die Treppe raufgehen, um es zu holen. Geh du bitte für mich rauf. Gleich links von der Falltür steht eine Tasche. Man nannte so was einen Kosmetikkoffer. Bring ihn mir, ja?« Erschöpft richtete sie sich von ihren Kissen gestützt auf, und Tasse und Untertasse auf ihren Knien klirrten.
Der Koffer war da, wo sie gesagt hatte. Als er letztes Mal oben gewesen war, hatte er ihn bemerkt. Das war, als er endlich in eine eigene Wohnung hatte ziehen wollen und all den alten Ramsch aus seinem Zimmer zusammenpackte. Schulbücher und Bilder, die er im Kunstunterricht gemalt und früher für so gut gehalten hatte, dass er sie an die Wand hängte. Seine Sammlung von Flugzeug- und Schlachtschiffmodellen und die kleinen Silberpokale, die er beim Schwimmen gewonnen hatte. Er hatte gefunden, dass der Koffer irgendwie unangebracht aussah, nicht wie etwas, das seine Mutter oder sein Vater besitzen würde. Jetzt stellte er ihn auf ihren Schoß und setzte sich wieder. Sie drückte mit ihrer gesunden Hand auf das goldglänzende Schloss.
»Hier«, sie winkte ihn heran. »Nimm du ihn. Schau mal, was drin ist.«
Er beugte sich vor und zog ihn zu sich heran, fasste hinein, und seine Finger spürten etwas Wollenes, Weiches. Er sah darauf hinunter. Es war ein Babyjäckchen. Weiß mit einer Borte von blauen Segelbooten. Er blickte zu seiner Mutter auf. Tränen rannen ihr über die Wangen.
»Das hast du getragen, als wir dich bekamen. Da ist auch noch eine kleine Mütze und Schuhchen. Sie sind selbst gestrickt. Deine Mutter hat sie für dich gemacht.«
»Meine Mutter? Du bist meine Mutter«, seine Stimme brach, als er das sagte.
»Nein, mein Lieber. Eigentlich nicht. Ich werde nicht mehr lange hier sein. Das weiß ich. Du wirst jemanden brauchen. Du solltest nach ihr suchen.«
Er sah auf die winzigen Kleidungsstücke hinunter.
»Nein«, sagte er. »Sie hat mich zur Adoption freigegeben. Du und Dad, ihr habt für mich gesorgt. Du bist meine Mutter. Du wirst immer meine Mutter sein. Nicht irgendeine Frau, die ich nicht kenne und die mich nicht kennt.«
»Johnny, hör zu.« Sie beugte sich vor. »Ich weiß, dass du jetzt so empfindest, aber wenn ich nicht mehr da bin, ist es vielleicht anders. Sie war sehr jung, als sie dich zur Welt brachte. Eigentlich war sie selbst noch ein Kind. Sie war aus Irland. Die Dinge waren dort damals anders. Sie muss dich lieb gehabt haben, dass sie dir diese Kleider machte. Nimm sie und heb sie auf. Und wenn du es dir anders überlegst, denk dran, dass du meinen Segen hast.« Sie sank auf ihre Kissen zurück und schloss die Augen. Er nahm ihr die Tasse ab.
»Ist schon gut, Mum, wirklich. Es ist in Ordnung«, sagte er und küsste sie auf die Wange.
Aber es war nicht in Ordnung. Eine Woche später hatte sie einen weiteren Schlaganfall und dann noch einen. Er fuhr mit ihr im Krankenwagen in die Klinik. Und saß da und sah zu, wie sie immer weiter wegdriftete. Und jeden Abend, wenn er nach Hause kam, machte er den kleinen Koffer mit dem herzförmigen Spiegel an der Innenseite des Deckels auf und betrachtete das winzige weiße Jäckchen. Es war mit blauen Segelbooten verziert, und das blaue Mützchen und die kleinen Schuhe passten dazu. Und er wurde nachdenklich, wenn er im Spiegel sein dichtes, lockiges schwarzes Haar und seine dunkelbraunen Augen, seinen kleinen geschmeidigen Körper, seine Hände mit den kantigen Fingern, die kräftigen Daumen und die Lücke zwischen seinen Vorderzähnen sah. Und als seine Mutter starb, als er den letzten Atemzug gehört hatte, der tief aus ihrer Brust kam, und die letzten Spuren von Wärme aus ihrem Körper weichen spürte, erinnerte er sich daran, was sie gesagt hatte.
»Du wirst jemanden brauchen. Du solltest nach ihr suchen.«
Kapitel 4
Adam fand, an ein solches Leben könnte er sich gewöhnen. Es war das reinste Schlaraffenland. Er lag in dem großen Bett des nagelneuen Ferienhauses neben der hübschen Blondine, die er drei Abende vorher im Hotel des Ortes kennen gelernt hatte. Sie schnarchte in regelmäßigen Abständen, wobei ihren vollen Lippen kleine, mit Alkohol angereicherte Atemstöße entwichen. Er stützte sich auf den Ellbogen und sah auf sie hinunter. Mit dem Zeigefinger fuhr er in den Spalt zwischen ihren großen weißen Brüsten.
Colm hatte recht gehabt, dachte er. Hier bot sich einem cleveren Jungen wie ihm allerhand. Zunächst mal war das Wetter toll. Der Fischfang lief gut. Auf verschiedenen Schiffen kriegte er so viel Arbeit, wie er wollte. Da war Pat, der Schleppnetzfischer, der alle drei oder vier Tage am Fastnet vorbei hinausfuhr. Er war immer froh, Adam dabeizuhaben. »Du bist ein Glücksjunge«, sagte er zu ihm und kniff ihn mit seiner öligen Hand in die Wange. »Wirklich ein Glücksjunge.«
Und wenn er keine Lust auf eine Fahrt hatte, bei der kein Land mehr in Sicht war, gab es auf den Muschelbänken vor der Insel etwas für ihn zu tun. Es war Erntezeit und harte Arbeit, wenn sie im Flusskahn stehend mit dem Außenbordmotor im Leerlauf die Seile mit den Schalentieren ins Boot zogen. Aber wenn die größte Anstrengung vorbei war, fuhren sie zur Insel zurück und tranken ein paar Gläser Bier. Manchmal blieb Adam über Nacht und suchte sich einen Fußboden, ein warmes Bett oder ein Paar noch wärmere Arme. Das waren tolle Nächte. Es schien kaum jemals dunkel zu werden. Der Himmel blieb noch lange hell, nachdem der orangerote Sonnenball hinter dem Horizont versunken war. War es wirklich noch hell?, fragte er sich und fand, man konnte es eigentlich nicht als Helligkeit bezeichnen, eher als Abwesenheit von Dunkelheit. Es war eine Art Zwischenstadium, weder das eine noch das andere. Aber was immer es sein mochte, es war verdammt schön, ein wunderbares Schauspiel. Er hatte nie gewusst, dass Leute so viel trinken können. Und es gab Drogen für jede Gelegenheit. Hauptsächlich Joints, Hasch, aber für die Wochenenden auch Ecstasy, und man hörte, dass mit dem Fortschreiten der Sommersaison, wenn immer mehr Besucher aus Dublin und London und, so hatte man ihm erzählt, selbst aus den Gegenden im Westen kamen, es auch Koks geben würde.
Anything you want, You got it. Anything you need, You got it. Anything at all. You got it. Baby!
Ungefähr so wie in dem Song. Er seufzte und rollte sich auf den Rücken. Die Sonnenstrahlen fielen schräg durch das Oberlicht über seinem Kopf und schienen ihm in die Augen. Bald war es Zeit zu gehen. Er rutschte zur Seite, und das Bett knarrte unter ihm. Die Frau, die neben ihm lag, hatte die Arme über dem Kopf ausgestreckt, stöhnte und wandte sich vom Licht ab.
»Wie spät ist es?«, flüsterte sie.
»Zeit für mich zu gehen, Maria, so spät ist es.« Er setzte sich auf und lehnte sich einen Augenblick an die Wand hinter ihm.
»Herrgott«, ihre Stimme war heiser. »Was haben wir denn letzte Nacht getrieben?«
»Zu viel von allem, das haben wir getrieben.«
»O Gott«, sie griff nach dem Glas Wasser auf dem Schränkchen neben dem Bett und stürzte es gierig hinunter, dann tastete sie nach ihrer Uhr unter dem Häufchen Schmuck, den sie abgelegt hatte. Sie strich sich das Haar aus den Augen und warf einen blinzelnden Blick auf das Zifferblatt. »O Gott, in weniger als vier Stunden sind sie da. Wie soll ich mich da aufrappeln?«
»Gute Frage.« Er schwang die Beine aus dem Bett. Sie streckte die Hand aus und berührte die Tätowierung auf seinem Schulterblatt. Die Haut unter ihrer Fingerspitze war wellig und warf kleine Fältchen.
»Ich mag das«, sagte sie. »Wo hast du das machen lassen? Ich würde auch gern eins haben.«
Er gab keine Antwort, sondern stand auf, bückte sich, zog Unterhose und Jeans an und nahm sein Hemd und seine Jacke vom Stuhl bei der Tür. Dann vergewisserte er sich mit einem Griff in die Taschen, dass sein Portemonnaie und seine Schlüssel da waren.
»He«, sie setzte sich auf.
Er machte mit dem Rücken zu ihr die Tür auf.
»He, wann seh ich dich wieder?«
Er antwortete nicht. Es war nicht nötig. Er war überrascht, dass sie diese Frage überhaupt stellte. Er ging vom Schlafzimmer auf den Treppenabsatz hinaus und nahm auf der Holztreppe immer zwei Stufen auf einmal. In der Diele blieb er stehen. Licht fiel durch die riesigen Panoramafenster herein. Der Blick aufs Meer war überwältigend. Die schimmernde, glitzernde Bläue reichte von Wand zu Wand. Er schmeckte Salz auf seinen Lippen. Er stieg über einen Haufen Spielzeug auf dem Boden. Ihr Name war Maria Grimes. Sie war fünfunddreißig. Sie hatte ihm von ihrer Familie, ihrem Mann und ihren drei Kindern erzählt. Irgendwann am Nachmittag sollten sie eintreffen. Sie war ein paar Tage zuvor aus Dublin heruntergekommen, um nach dem Winter das Haus herzurichten.
»Das mach ich immer«, hatte sie ihm am ersten Abend in der Bar erzählt, nachdem sie sich vorgestellt hatte. »Ich lass die Kinder mit dem Au-pair-Mädchen zu Haus und komme runter und organisiere alles. Mein Mann nimmt's ziemlich genau. Ich mache sauber und lüfte und gehe einkaufen und bereite alles vor.«
»Und er hilft dir nicht dabei?«
»Nein«, sie schüttelte langsam den Kopf. »Nein, er hat viel zu tun, du weißt ja, wie es ist. Er lädt immer gern Kollegen aus seiner Firma ein, die über Nacht bleiben. Das gehört zu dem ganzen Geschäft dazu. Es ärgert mich. Ich kann mich nie ausruhen. Sobald er und die Kinder ankommen, heißt es nur noch Arbeit, Arbeit und noch mal Arbeit. Alles muss perfekt klappen. Essen und Getränke müssen jederzeit aufgefahren werden, für diesen oder jenen Chef und manchmal auch für die verflixten Frauen der Chefs. Deshalb«, sie trank mit einem großen Schluck ihr Glas aus, »habe ich eigentlich diese Zeit für mich allein verdient. Ich hab so wenig davon. Und manchmal kann ich sie auch gut nutzen.« Sie wies auf sein Glas. »Noch ein Bier?«
»Warte«, er hörte jetzt ihre bloßen Füße in dem Zimmer über sich. »Warte, warte doch, nur einen Moment.«
Er nahm ein Schlüsselbund vom Tisch in der Diele und schloss damit die Haustür auf, trat in die frühe Morgensonne hinaus und schloss leise die Tür hinter sich. Schnell ging er zu seinem Lieferwagen. Sie würde nicht herauskommen, denn sie würde ihre Nachbarn nicht aufmerksam machen wollen. Er steckte die Schlüssel in die Jackentasche. Nur für den Fall, dass er sie wieder besuchen wollte. Dann nahm er sein Telefon heraus und gab eine Nummer ein.
»He, Pat, wie steht's? Ja, das wär super. Ich seh dich in 'n paar Minuten. Wie lange bleiben wir draußen? Gut, prima. Bis dann, Kumpel.«
Genau das, was er brauchte. Ein paar Tage fischen. Da wäre er weit weg von unangenehmen Szenen. Und wenn er zurückkam, würde er Geld in der Tasche haben. Und sie ihren Mann und ihre Kinder, die ihr genug zu tun gaben. Und er wäre sie los.
Kapitel 5
Der Junge namens Adam erinnerte Lydia so sehr an Grace. Es war dumm, schalt sie sich selbst. Du bist eine dumme alte Frau. Du phantasierst, bist ein Opfer von Wunschträumen. Er ist einfach ein netter Kerl. Ein Junge, der glaubt, er sei ein Mann. Mit golden glänzendem Haar und diesen ungleichen Augen.
Und was war Grace? Sie grübelte über diese Frage nach, während sie in der Mittagssonne in dem umfriedeten Garten saß. Ein Schmetterling, ein Distelfalter, flatterte an ihr vorbei, stand still in der warmen Luft, schwebte dann weiter zu einer Stelle mit Nesseln, wo er die Schwingen träge öffnete und schloss, die Wärme, das Licht und die Kraft aufnahm. Lydia sah ihm zu, hielt ihm die Hand hin und fragte sich, ob sein Vertrauen oder seine Dummheit groß genug sein würde, dass er ihren Finger für einen Zweig oder Ast hielt und sich mit seinem leichten Körper auf ihrer faltigen Haut niederlassen würde.
Aber natürlich tat er das nicht. Er landete sanft auf ein paar Nesseln, und als sich ein leichter Windhauch regte, stieg er auf und flatterte davon. Sie sah ihm nach und erinnerte sich. Es war ein Schmetterling gewesen, wahrscheinlich auch ein Distelfalter, hinter dem Grace vor vielen Jahren herrannte und dann genau hier auf diesem Plattenweg hinfiel. Eine Dreijährige, die lieber schon dreizehn gewesen wäre. Dickköpfig, aggressiv und laut. Sie rannte vor ihnen her, ihre Sandalen klapperten laut in der Nachmittagsstille. Und da stolperte sie und fiel unsanft auf ihre nackten Knie, hob mit weit aufgerissenem Mund den Kopf. Dann zunächst Stille, die eine Ewigkeit anzuhalten schien, und darauf ein Schmerzens- und Wutschrei, ihre Wangen röteten sich plötzlich, und eine Tränenflut stürzte aus ihren Augen.
Und wer hatte sie aufgehoben? Nachdem er sich unsicher von der gleichen Holzbank erhoben hatte, auf der sie jetzt auch saß, und mit einer Hand seinen Stock umfasst hielt, wer streckte da dem Kind die Hand hin? Daniel Chamberlain.
Sie hatten allerlei Geschichten über ihn gehört, seit sie Dublin verlassen hatten und hier unten lebten. Im besten Fall war er ein Exzentriker, im schlimmsten ein Verrückter. Sein einziger Sohn war bei einem Bootsunfall vor Jahren umgekommen. Ihres Kindes beraubt und trauernd hatten Daniel und seine Frau sich mit ihrem Garten getröstet. Und als sie an Krebs erkrankte, hatte er sie allein zu Hause gepflegt und nicht erlaubt, dass sie in die Klinik ging. Jetzt lebte er allein in dem Haus. Und das Haus? Die Leute hoben den Blick gen Himmel, wenn die Rede darauf kam. In welchem Zustand es war. Das Dach undicht. Im Keller stand das Wasser. Er lässt es einfach um sich herum zerfallen. Und was ist mit dem Rest der Familie? Die Cousins, die Cousins zweiten Grades, die Kinder von Cousins oder Cousinen, die in der Nähe wohnen? Er hasst sie, habt ihr das nicht gehört? Er hat geschworen, sie würden das Anwesen nie bekommen, er werde es eher im Meer versinken lassen, ehe er ihnen auch nur einen Grashalm oder einen einzigen Backstein vermache.
Aber da war er nun, beugte sich vor, bückte sich, hielt Grace seine freie Hand hin. In den dünnen weißen Fingern hielt er eine in Zellophan verpackte Zuckerstange, auf deren glatter Oberfläche, um die eine Spirale lief, die Sonne schimmerte. Und aus irgendeinem Grund hörte Grace auf zu weinen, hatte sich an seiner verschossenen Flanellhose hochgezogen und zeigte auf ihr wundes, blutiges Knie. Er beugte sich mit seinem schon fast kahlen Kopf mit den Altersflecken über ihre seidigen, hellen Locken und flüsterte etwas. Da stand sie still, streckte die Hand nach der Zuckerstange aus, wartete geduldig, bis er sie aus dem Zellophanpapier gewickelt hatte, nahm sie ihm aus der Hand und steckte sie in den Mund.
Hatte alles so angefangen, an dem hellen Frühlingstag im Garten? Der alte Mann und das Kind, die die Köpfe über der Zuckerstange und dem blutigen Knie zusammensteckten? Wenn Grace nun nicht gefallen wäre, wenn sie nicht geweint hätte. Wenn Alex nicht gesagt hätte, dass er den Garten und das Haus sehen wolle und dass seine Mutter einmal vor Jahren dort gewesen sei. Dass sie ihm erzählt hatte von den Fischerbooten mit den Gaffelsegeln, die den Fluss befuhren. Er sei sicher, dass dies derselbe Ort sei, und er wolle das Haus suchen, obwohl Grace geschmollt und gequengelt hatte und sagte, sie wolle eine Sandburg bauen und Paddelboot fahren.
»Und du hast es versprochen, Mummy, du hast gesagt, wir würden es tun, und jetzt sagt er, wir sollen zu einem Haus und einem Garten, ich hasse ihn.« Die Röte stieg ihr ins Gesicht, und ihre Unterlippe zitterte. Zugleich versuchte Lydia, Grace, ihre Tochter, zu beruhigen und Alex, ihren Mann, mit dem sie noch nicht lange verheiratet war, zu unterstützen und beide glücklich zu machen. Aber auch wenn sie für Grace Partei ergriffen hätte und sie an diesem Tag zum Strand gegangen wären – sie hätten Daniel trotzdem kennen gelernt. Lydia war sich sicher. Daniel Chamberlain wäre auf jeden Fall ein Teil ihrer Welt geworden. Wäre es nicht an jenem Sonntag gewesen, dann eben am nächsten oder am übernächsten.
Jetzt stand sie auf. Sie war fast so wackelig auf den Beinen wie Daniel damals vor so vielen Jahren. Er war am Stock gegangen. Sie wollte das nicht. Es geht schon, ich komme zurecht, sagte sie allen, die ihr helfen oder sich ihrer Meinung nach einmischen wollten. Sie stützte sich ab und begann dann langsam den Plattenweg auf die Blumenrabatte zuzugehen. Sie machte einen Strauß. Sie pflückte blaue und weiße Glockenblumen mit hohen Stängeln, die gelben, margeritenähnlichen Blütenstände des Sonnenhuts und Stockrosen, größer als sie selbst, in blassem Rosa und Weiß. Sie schnitt einen geschwungenen Zweig vom falschen Jasmin, dessen cremefarbene Blüten schwer und süß nach Orangeneis dufteten. Es erinnerte sie an die Lollys aus Wassereis, die Grace als Kind lutschte, wobei farbige Rinnsale an ihrem Kinn herunterliefen. Daniel hatte ihr gesagt, der falsche Jasmin sei die Lieblingsblume seiner Frau gewesen. Meine liebe Elsie, hatte er sie genannt. Immer meine liebe Elsie. Der lange Esstisch aus Mahagoni wurde immer für zwei gedeckt, obwohl sie seit Jahren tot war. Bis Lydia, Alex und Grace gekommen waren und hier wohnten, zuerst im Pförtner- und dann im großen Haus. Nach dem ersten Nachmittag, als sie sich im Garten kennen gelernt hatten, er mit ihnen zum Bootshaus gegangen war und ihnen gezeigt hatte, was von den verrotteten Rümpfen der Fischerboote noch da war. Und er und Alex hatten dort gestanden und geredet, während Lydia und Grace zusammen durch den Garten streiften. Und als sie sich verabschieden wollten, um zu ihrem feuchten, gemieteten Häuschen zurückzukehren, dessen Toilette draußen im Freien war, hatte Daniel gefragt, ob Alex Arbeit brauche. Und Lydias Herz stockte, während sie wartete und glaubte, Alex werde so tun, als habe er schon eine Stelle, Geld sei kein Problem, und er werde sein freundliches Lächeln aufsetzen und den Kopf schütteln, um all seine Ängste zu verbergen.
Aber er tat das nicht. Er sagte die Wahrheit. Dass er mit seiner Frau und seiner Stieftochter Grace mittellos aus Dublin gekommen war.
Eine Wolke zog vor die Sonne, und einen Augenblick wurde es dunkel. Da erinnerte sie sich an den ersten Winter, den sie in Trawbawn verbracht hatten. Sie wohnten in dem Pförtnerhäuschen am Ende der langen Einfahrt. Alex arbeitete im Garten, Lydia erledigte die Hausarbeit. Sie waren dankbar, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und am Abend des ersten Sturms, den sie dort erlebten, änderte sich plötzlich ihre Beziehung zu Daniel. Über dem Haus hatten sich Donnerschläge entladen, die klangen, als würden riesengroße Hände kolossale Papiertüten zerknallen. Dann kam ein plötzlicher Blitz, der noch heller erschien, weil alle Lampen im Haus zugleich ausgingen. Kerzen verbreiteten einen weichen gelben Schein in der Küche und beleuchteten Graces kleines Gesicht, die fragte, ob sie einen der Lichtstöcke, wie sie sie nannte, halten dürfe. Und als sie sich um den Herdofen scharten, um sich warm zu halten, entstand plötzlich Fröhlichkeit, und Daniel tastete sich zum Weinschrank unter der Treppe vor und kam mit einer Flasche in jeder Hand und Spinnweben im Haar wieder heraus. Und er beharrte auf seiner Bitte:
»Ihr bleibt alle hier und esst heute Abend mit mir.«
Sie erinnerte sich so deutlich an jenen Abend in der Küche, als das Licht ausging. Sie tranken den Wein, und dann ging Daniel noch einmal zum Schrank, brachte Calvados, sie machte Kaffee, und Grace stand auf einem Stuhl und rührte die Eiercreme auf dem Herd. Und sie aßen sie heiß, mit dem Apfelkuchen, den sie im Backofen aufgewärmt hatten.
Und Alex sang alle seine Lieblingslieder. »The Foggy Dew«, »The Mountains of Mourne«, »Trotting to the Fair« und »My Bonnie Lies Over the Ocean«. Und Daniel erzählte Geistergeschichten, und Grace schlief auf seinem Schoß ein. Und als Lydia das Geschirr gespült und alles für den nächsten Morgen gerichtet hatte und sie Grace in eine Decke wickeln wollten, um mit ihr in das Unwetter hinaus und die Einfahrt hoch zum Häuschen zu gehen, sagte Daniel bestimmt:
»Ihr bleibt hier im Haus. Mach die Zimmer oben fertig, Lydia. Ihr geht in dem Wetter nicht raus.«
Das war das erste Mal, dass sie dort schliefen.
Und am nächsten Tag sagte er zu ihr: »Ich möchte, dass ihr hier einzieht. Es ist zu groß für mich. Ich kann ja unmöglich diesen ganzen Platz nutzen. Macht mir nur Schuldgefühle. Und bitte, ihr werdet mit mir essen, nicht wahr? Meine liebe Elsie würde das auch wollen. Ich bin ganz sicher.«
Und er zeigte Grace, wo das Silberbesteck aufbewahrt wurde, und gab ihr das Putzmittel und einen Lappen.
»Einen Penny für jedes Stück, Schätzchen. Es ist jetzt deine Aufgabe, sie sauber zu halten.«
Die Wolke zog weiter, und der Garten lag wieder im Sonnenlicht. Lydia band die Blumen mit einer Plastikschnur zusammen, dann ging sie schnell am geschwungenen Rand des Teichs entlang auf das Wäldchen am Fluss zu. Sie stieß das rostige Türchen auf und war in dem kleinen Friedhof. Heute war der letzte Tag im Juli, der Tag, an dem Daniel gestorben war. Sie legte die Blumen auf seinen Grabstein und stand einen Moment mit gesenktem Kopf davor. Dann öffnete sie die Augen und trat vom Grab zurück. Ein Schatten fiel auf das Gras. Sie schaute hoch. Ein Reiher flog mit majestätischen Schlägen seiner riesigen Flügel über ihren Kopf hinweg auf den Fluss zu. Sie blieb stehen und beobachtete seinen langsamen, eleganten Flug. Er sah urtümlich aus, der lange Hals ganz ausgestreckt, mit den dünnen Beinen in der Luft paddelnd. Sie hatten gemeinsam die Reiher beobachtet, sie und Daniel, an jenen langen Tagen, als er im Bett lag und zu schwach war, um aufzustehen, und sie bei ihm saß und ihn umsorgte.
»Sie sehen aus wie ich, findest du nicht, Lydia?«, hatte er gesagt.
»Nein«, wandte sie ein, schob ihre Finger unter sein Handgelenk und tastete nach dem Puls. »Natürlich nicht.«
Aber sie lächelte, als sie es sagte, und schaute auf die lange, schnabelähnliche Nase und das hagere Gesicht, in dem die weiße Haut gerade so die bloßen Knochen bedeckte.
Der letzte Julitag, der Tag, an dem Daniel gestorben war. Es war frühmorgens gewesen. Um vier Uhr achtunddreißig, um genau zu sein. Lydia hörte den Atem aus seinem Mund und danach nur noch die Stille. Sie wartete, setzte sich neben ihn und nahm seine Hand, die warm, geschmeidig und weich war. Sie küsste sie und hielt sie an ihre Wange.
»Adieu, Daniel«, flüsterte sie, »adieu und danke.«