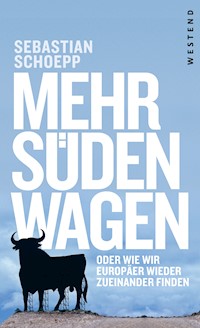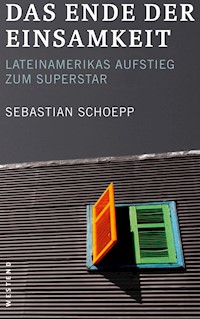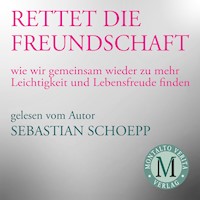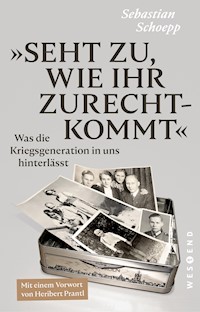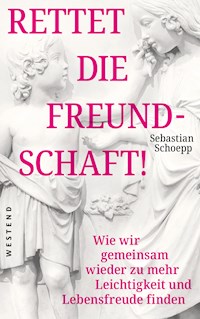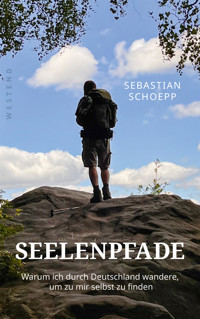
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Als Journalist jettete Sebastian Schoepp zwei Jahrzehnte lang rastlos durch die Welt. Bis er eine Depression in sich hochkriechen spürt und sich fragt: Brauche ich das? Geht es nicht auch langsamer? Er beginnt, Deutschland zu Fuß zu erkunden und findet auf den einsamen Höhen der Mittelgebirge, abseits der touristischen Hotspots, nicht nur seine Seelenpfade - sondern im Vorbeigehen auch die Antwort auf allerlei Fragen: Wer hat das Wandern erfunden? Wie entstehen eigentlich Pfade? Warum tut Wandern so gut in Zeiten des Beschleunigungsdiktats? Und ist langsames Gehen gar ein subversiver Akt, eine Art stiller Protest gegen das Immermehr, das unseren Planeten an den Rand des Kollapses gebracht hat? So wird aus dem schrulligen Hobby der erste Schritt in ein neues, bewussteres Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ebook Edition
Sebastian Schoepp
Seelenpfade
Warum ich durch Deutschland wandere, um zu mir selbst zu finden
Impressum
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN: 978-3-98791-086-9
1. Auflage 2025
© Westend Verlag GmbH, Waldstr. 12 a, 63263 Neu-Isenburg
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Cover-Foto: © Erkan Uysal
Satz: Publikations Atelier, Weiterstadt
Inhalt
Cover
Prolog: Was Wandern kann
Wo liegt eigentlich Darmstadt?
Wie lange noch?
Die Süße des deutschen Weingartens
Ein unwiederholbarer Augenblick
Träume und Taten
Gräber ohne Steine
Flashback in der Waldschenke
Die Reise ins Innere
Das Glück auf halber Höhe
Unter Denkmalschutz
Schubs für die Infrastruktur
Seelische Verortung
Geliebt werden
Lehren aus der Pandemie
Delicious Solitude
Ein Rucksack voller Träume
Training für die Alpenüberquerung
Geborgen im Verfassungspatriotismus
»Der letzte Fußgänger«
Natürlicher Adel
Auf der Flucht vor der Pilzsoße
Wohltaten eines Flusses
Am Limes
Die Nomadin in uns
Der Weg zum Glück?
Schritt für Schritt
Weg mit den Superlativen
Die Kunst des Schlenderns
Ins Offene treten
Dem Süden so nah
Genussweg par excellence
Zwiespältige Gefühle
Die Lüge der Romantik
»Fern der Zumutungen der Moderne«
Sich finden unter Linden
Durchs Felsenland nach Frankreich
Gehen ohne Grenzen
Wo wir gehen
Von wegen Freiheit
Wandern vs. Wildnis
Genug ist nicht genug
Ist der Weg das Ziel?
»Die Moderne gehend unterlaufen«
Seelenkunde zu Fuß
Eine andere Form von Arbeit
Wahnsinn Wandern
Rettendes Funkloch
Idylle und Schrecken
Reisen mit kleinem Fußabdruck
Auf der Suche nach der Alblinse
Dörfliche Diversität
Auf Zimmerreise
Neue Freiheit
Partypizza
Zweimal Hohenzollern
»Den Glücklichen ziemt es, zu Hause zu bleiben«
Mehr Langsamkeit wagen
Akt der Zärtlichkeit
Der Weg des Philosophen
Gut leben oder besser leben?
No method
Raus aus der Rüstung
Ritter oder Narr?
Bier aus dem Bach
Eine unerwartete Nachricht
Rückkehr zum Rheinsteig
Abtauchen in den Wald
Der große Schlaf
Über die Königsetappe
Surfen nach Bielefeld
Wald ohne Bäume
Unter Hermanns Fuchtel
Wandern mit Max Weber
Lob der Provinz
Grenzgang
Unter Dampf gen Osten
Von horní nach dolní
In der Stinkebaude
»Heimrt«
Bei den Hutzelmännern
Bei den steinernen Riesen
Vorwärts in die Vergangenheit?
Nachwort: Vom kleinen großen Abenteuer
Literatur
Anmerkungen
Orientierungspunkte
Cover
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Was Wandern kann
Kürzlich, auf einer Tour im Bayerischen Wald, da ist es wieder passiert. Ich bin alleine losgelaufen, was ich inzwischen ganz gern tue, weil ich da meinem eigenen Rhythmus folgen, vor mich hin trödeln und alle möglichen Schlenker einbauen kann, die mir in den Sinn kommen. Tatsächlich bin ich bald von der markierten Route des Goldsteigs abgewichen und auf dem alten, kaum noch auffindbaren Grenzweg vom Gipfel des Osser zum Zwercheck gelaufen, im Slalom durch die Grenzpfosten sozusagen, was ein ganz eigenes Gefühl der Freiheit erzeugt. Man wandelt hier auf luftiger Höhe zwischen Böhmen und Bayern. Die Felsen glitzern in der Sonne, denn der Berg ist aus Glimmerschiefer und Quarzit gemacht1, einst Rohstoff für die Glasbläser, die hier ihre längst verschwundenen Hütten unterhielten. Ich habe mich ganz dem Sog des Weges überlassen, der mich bis zum Gipfel gezogen hat. Dort habe ich mich auf einem der funkelnden Felsen niedergelassen, die Aussicht bis hinab zum Rachel und zum Falkenstein genossen, und da habe ich es gespürt: Ich bin gerade auf einem Seelenpfad unterwegs.
Seelenpfade, das sind Wege, auf denen wir gehen und uns dabei ganz im Einklang mit uns selbst fühlen, auf denen Körper und Geist zu einem harmonischen Rhythmus finden, der uns vorwärtsträgt. Auf einem Seelenpfad fühlen wir uns zu Hause, solange wir auf ihm gehen. Wir befinden uns ganz im Hier und Jetzt und haben das Gefühl, bei uns selbst angekommen zu sein. Seelenpfade können sich überall eröffnen – in fernen Ländern oder in unmittelbarer Nachbarschaft. Manche müssen tausend Kilometer durch die Wildnis laufen, um sie zu finden, andere brauchen einen Pilgerpfad mit spiritueller Bedeutung, wieder anderen reicht der Weg zur nächsten Waldwirtschaft. Man spürt jedoch instinktiv, wenn man einen Seelenpfad gefunden hat – sofern man bereit ist, ein wenig auf sein Inneres zu hören.
Ich habe meine Seelenpfade da entdeckt, wo ich sie zunächst am wenigsten vermutet hätte: in deutschen Mittelgebirgen. Auf ihren meist einsamen Wegen, zwischen sanft dahinrollenden Hügeln und in verschwiegenen Bachtälern habe ich das gefunden, wonach meine Seele anscheinend am meisten dürstete: Ruhe in der Bewegung.
Bei meiner Rast auf dem Glitzerfelsen im Bayerischen Wald bin ich dann wohl kurz eingenickt, und als ich aufwache, denke ich darüber nach, warum ich hier bin, und mir fallen spontan eine Menge Gründe ein: Wandern ist gesund, es kann eine wunderbare Abwechslung vom Alltag bieten, es rüttelt die Gedanken zurecht. Das löst noch keine Probleme, kann aber helfen, sich nicht in ihnen zu verzetteln. Sich für eine Route entschieden zu haben, stattet uns für die Zeit, in der wir unterwegs sind, mit einer klaren Orientierung aus. Das befreit uns von einer der schlimmsten Geißeln unserer Epoche: dem dauernden Sich-entscheiden-Müssen.
Wie oft beim Wandern habe ich auch diesmal eine in jeder Hinsicht nicht zu schwere Lektüre dabei, die ich nun, bei meiner Rast auf dem Zwercheck, aus dem Rucksack krame. Es ist Adalbert Stifters Waldsteig, ein Büchlein des großen Erzählers des Böhmerwalds, in dem sein Held, ein Hypochonder und Misanthrop, auf dem Pfad zu sich selbst zurückfindet, »alle Kräfte, die von seinen Ältern und Lehrern niedergedrückt waren, standen nach und nach auf«, schreibt Stifter, »alle seine Kinderstimmen redeten wieder«.2 Sogar sein »unterentwickeltes Lieben und Hoffen regte sich«, mit dem Ergebnis, dass Stifters Wanderer sich in eine Zufallsbegegnung am Wegesrand verliebt, eine Erdbeersammlerin.
Wandern schafft Zufälle. Wir begegnen am Weg, wem wir eben begegnen. Was wir daraus machen, bleibt uns überlassen.
Erdbeersammlerinnen sind gerade keine in Sicht am Zwercheck, also genieße ich den Moment des Alleinseins, kaue meine mitgebrachte Brotzeit, trinke einen Schluck Zitronenwasser und ruckele den Rucksack zurecht, den ich als Kopfkissen benutze. Eines der schönsten Dinge beim Wandern ist, dass man sich auf seine Grundbedürfnisse besinnt, auf das, was man mit sich tragen kann, überflüssigen Ballast lässt man besser zurück, eine gute Lehre fürs Leben. Der griechische Philosoph Epikur behauptete, je weniger man brauche, um Unlust in Lust zu verwandeln, desto besser.3 Ich finde diese Behauptung in diesem Moment vollends bestätigt und überlege dann, ob Wandern auf heimischen Pfaden in diesen Zeiten des Überflusses nicht sogar eine Art subversiver Akt sein kann, ein stiller Protest gegen das Diktat des »Immer mehr«, das unseren Planeten an den Rand des Kollapses gebracht hat.
Die vielen längeren und kürzeren Touren, die ich in den letzten Jahren durch Deutschland unternommen habe, waren jedenfalls eine gute Übung in Genügsamkeit. In deutschen Dörfern hat man selten die Wahl, wenn es um Übernachtung und Verpflegung geht. Manchmal gibt es das schnuckelige Romantikhotel mit Wellnessbereich, regionalen Spezialitäten und feinen Weinen. Manchmal aber nur Pension Ilse mit 1970er Jahre-Möbeln und Filterkaffee zum Frühstück. Muss ich dazu sagen, dass nicht immer garantiert ist, wo ich besser schlafe?
Auch diesmal verbringe ich die Nacht in einem einfachen Landgasthof, geschmacklich nicht ganz das, was mir zusagt, aber ich bin halt Fußgänger, und da nimmt man, was kommt. Die Wirtin stellt mir ein schönes Osser-Hell hin, das hier im Dorf aus Felsquellwasser gebraut wird. Ich bin der einzige Gast auf der Terrasse, wie so oft. Zu essen gibt es Wiener Würstchen mit Senf. Das Tal, das sich vor mir ausbreitet, ist in ein goldenes Licht gehüllt. An den Sträuchern prangen die reifen Herbsthimbeeren, aus den Blüten der wilden Rosen sind längst pralle, rote Hagebutten geworden; die Obstbäume beginnen, die Blätter abzuwerfen, knallrot leuchten die reifen Äpfel an den kahlen Zweigen. Ob sie jemand erntet?
Gegenüber schält sich der markante Kopf des Großen Arber aus dem blauvioletten Abendhimmel. Man sieht die Sendeanlagen aus der Zeit des Kalten Krieges, trotz seiner Hässlichkeit zieht der höchste Berg des Bayerischen Waldes immer noch massenhaft Ausflügler an. Hier im Lamer Winkel herrscht jedoch Ruhe, nur unterbrochen vom leisen Brummen des Mähroboters, der auf dem Grundstück Grashalme vertilgt. Die Wohnhäuser ringsum strahlen balkendicke bayerische Solidität aus, auf den meisten Dächern sind Solaranlagen montiert, vor den Toren hängen Autos mit Elektroantrieb an der Wallbox. Der Bayerische Wald hat sich gemacht, zumindest auf den ersten Blick ist keine Spur mehr von der Armut und Rückständigkeit früherer Epochen zu erkennen.
Ich denke daran, wie ich in den 1980er Jahren Zivildienst in einem Erziehungsheim bei München ableistete, dort arbeitete ich mit einem Hausmeister zusammen, der aus dieser Gegend kam. Herr Baumgartner war ein knorriger, freundlicher Mann, der einst Wagner gelernt hatte, also das Herstellen hölzerner Wagenräder. Sein Handwerk war damals schon lange ausgestorben, wie viele andere Waldler mit traditionellen Berufen – Glasbläser, Holzknechte, Küfner – ging er nach München, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Ich mache es nun auf gewisse Weise umgekehrt.
Die Wirtin hat sich ein wenig gewundert, was ich hier tue, allein an einem Montag mitten im September.
»Ich arbeite«, sage ich.
»Was machen Sie denn?«
»Ich schreibe ein Wanderbuch«, antworte ich.
»Dann sind Sie sozusagen Schriftsteller?«
»Ja, sozusagen«, bestätige ich, und füge hinzu, was ich in solchen Momenten immer sage, um meiner Tätigkeit einen institutionellen Anstrich zu geben, den ich wohl noch zur inneren und äußeren Legitimation brauche: »Als solcher bin ich beim Finanzamt gemeldet.«
Schriftsteller, das hört sich gar nicht mehr so absurd an wie noch vor drei Jahren, als ich meine feste Stellung bei der Zeitung aufgab und damit auch auf die monatliche Gehaltsüberweisung verzichtete, um nach fast 30 Jahren Festanstellung in das Abenteuer einer neuen Existenz zu starten.
»Und davon kann man leben?«, schiebt die Wirtin nun skeptisch nach.
Der Satz kommt eigentlich immer, und ich warte nur noch auf die Ergänzung, die in solchen Momenten ebenfalls selten ausbleibt: Das sei aber mutig.
»Mutig«, das ist im Deutschen leider immer noch ein Synonym für unvernünftig.
Aber ist es nicht sogar äußerst vernünftig, erdrückenden Hierarchien, Arbeitsstress und gehetzter Daueraufgeregtheit zu entkommen, ein Leben zu verändern, das krank macht? Sicher, Rio und Buenos Aires sind nun vorläufig unerreichbar, überteuerte Münchner In-Lokale auch. Dafür kann ich am Montagabend im Lamer Winkel ein schönes Osser-Hell zischen.
Dazu kommt etwas anderes, woran ich bei meinem Ausstieg noch gar nicht gedacht hatte: Auch der Beruf, den ich einst nach dem Zivildienst gelernt habe, könnte bald verschwinden. Viele Tätigkeiten, die ich in der Redaktion ausgeübt habe, also Material für Artikel sichten und zusammenstellen, Themen formulieren, Reportagen redigieren, Seiten layouten, fremdsprachige Presse lesen und auswerten, kann sogenannte Künstliche Intelligenz (KI) schon bald billiger erledigen. Wird der Beruf des Zeitungsredakteurs aussterben wie einst der des Wagners? Und wie lange wird es noch Schriftsteller geben in Zeiten von ChatGPT und Co.? Nun, ich bin da zuversichtlich. Jazz-Musiker gibt es ja auch noch, trotz Synthesizer. Zumindest dieses Buch ist gänzlich ohne Zuhilfenahme von KI entstanden, so wie ein handgemachtes Musikstück oder ein hölzernes Wagenrad.
Am nächsten Morgen nehme ich den steilen Pfad, der erst durch den Wald und dann über Granitfelsen zum Osserhaus führt, dort esse ich Apfelkuchen, dann marschiere ich weiter. Auf dem Grenzsteig kommt mir ein tschechisches Pärchen entgegen, keine Ahnung woher, denn die meisten Wege hinab ins Nachbarland sind gesperrt, aus Naturschutzgründen, wie es heißt, ich habe eher die Jagdlobby in Verdacht. Sie ist eine auffallend schöne Frau, der Begleiter ein älterer Herr, der mit etwas bangem Blick auf Deutsch fragt: »Gaststätte geöffnet?«
»Ja«, sage ich, in der Annahme, dass sie das Osser-Haus meinen. Sie danken und gehen sichtbar beruhigt weiter.
Wie lange würde ich wohl brauchen, um eine solche Frage auf Tschechisch zu stellen? Ich beschließe, es demnächst mal zu versuchen.
Vom Zwercheck laufe ich auf meinem Seelenpfad hinab ins Tal und komme über ein Brückchen, das über einen der schwarzen Bäche führt, die der Humus der Moorböden eingefärbt hat. Ich lasse mich am Ufer nieder, ziehe Wanderstiefel und Socken aus, klettere in den Bach und stütze mich auf meine Teleskopstöcke. Das Wasser ist, wie erwartet, eiskalt. Vom Gedanken an ein Vollbad nehme ich Abschied. Dafür betrachte ich eine Zeit lang versunken meine Beine, wie sie da knietief im sprudelnden Wasser auf den Flusskieseln stehen. Die Strömung ist stark, doch sie kann mir nichts anhaben.
Wo liegt eigentlich Darmstadt?
Vom Beginn einer Leidenschaft: Auf dem Burgensteig nach Heidelberg
Wer nach 14 Stunden Flug über den Atlantik an einem lateinamerikanischen Airport schlaftrunken seine verrenkten Glieder auseinanderfaltet und ins Gedränge auf die Gangway stolpert, hat es noch lange nicht geschafft. Das Neonlicht im grauen Flughafenlabyrinth blendet die übermüdeten Augen, man entziffert mühsam den Schriftzug salida, Ausgang. Nichts wie raus!, funkt das Gehirn. Doch nach ein paar Sprints über Rolltreppen rumpele ich unvermittelt in das nächste Hindernis hinein – in eine Wand aus Rücken, es ist die Menschenschlange, die sich vor der Passkontrolle staut. Ich muss eine weitere quälende Stunde lang anstehen, bis ich von einer schlecht gelaunten Uniformierten unter Neonlicht nach dem Zweck meines Besuches gefragt werde.
»Trabajo«, sage ich, Arbeit, stets ein wenig nervös, denn eigentlich bräuchte man dafür ein spezielles Visum, das ich nicht habe, weil es mal wieder schnell gehen musste mit der Dienstreise.
Aber die Beamtin lässt es gut sein und hämmert den Stempel in den Reisepass.
Dann hinaus in die tropische Nacht, die mir wie ein warmer, nasser Schwamm ins Gesicht klatscht. Zunächst gilt es, ein vertrauenswürdig aussehendes Taxi zu suchen, dessen Fahrer mich nicht betrügt oder entführt, sondern durch dieselgeschwärzte Straßenschluchten in das Hotel fährt, das der knappe Redaktionsetat hergibt. Ich bumpere an die Tür, bis der Nachtportier aufwacht, der Geruch nach Kakerlakenspray weht mir entgegen. Dann ein Bier aus der Minibar, und schnell ins Bett, denn am nächsten Morgen warten ja schon die Termine bei Ministern, Aktivistinnen, Wirtschaftsbossen, Kokabauern, Entwicklungshelferinnen.
Und stets die Redaktion im Nacken.
Wann kannst du liefern?
Jetlag? Bemerkt man kaum, weil man ihn eigentlich ständig hat.
Wie lange noch?
Zu Beginn der 2010er Jahre steuerte ich auf den Höhepunkt meiner Laufbahn als außenpolitischer Redakteur einer großen deutschen Tageszeitung zu. Ich flog, so oft es der Dienstplan erlaubte, nach Buenos Aires, Rio oder Panama. In den Hauptstädten brodelte es, mutige Staatschefinnen wie Michelle Bachelet, Cristina Kirchner oder Dilma Rousseff bastelten an einem ökonomischen Umbau ihrer Länder. Die Mittelschicht sollte gestärkt, die Armut verringert werden – was erbitterten Widerstand der alten Eliten hervorrief. Indigene kämpften um ihre Rechte, frühere Militärdiktatoren wurden abgeurteilt. Drogenbarone implantierten dafür eine ganz neue Form von Alltagsterror.
Es gab also allerhand zu tun, und meistens genoss ich das Unterwegssein wie einen Rausch. Es winkte sogar ein Korrespondentenplatz in Argentinien. Und doch schlichen sich, eher unterbewusst, erste Zweifel ein: Wie lange wollte ich noch durch Favelas streifen oder mich in Bananenplantagen von Dengue-Mücken abfieseln lassen? Ich begann, mir die Menschen auf meinen Reisen bewusster anzusehen: atemlos unterwegs, von einer Destination zur nächsten, graue, müde Gesichter, gespenstisch beleuchtet vom geöffneten Laptop, das Mobiltelefon in der einen, ein halb gemampftes Sandwich aus der Airportbar in der anderen Hand. Globalisierungsproletariat, digitale Nomaden. Ich blickte beim Zähneputzen in den Spiegel des Flughafen-Waschraums. Sah ich genauso aus?
2010 kam Südamerika ausnahmsweise mal zu mir. Argentinien war Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Ich nahm den Zug dorthin, stieg auf dem Weg in Heidelberg aus, zog meinen Rollkoffer durch die Vorstadt, um einen argentinischen Schriftsteller zu treffen, der dort logierte. Nach dem Interview trottete ich zurück zum Bahnhof, um nach Frankfurt weiterzufahren. Eigentlich ganz angenehm, so ohne Gates und Passkontrolle, dachte ich. Ich stieg in den Zug, das Abteil war aufgeheizt von der Herbstsonne, und vom monotonen Rattern der Räder döste ich ein. Wenige Kilometer später wachte ich auf, weil mein Kopf in Kreiselbewegungen auf die Brust sank. Ich guckte aus dem Fenster. Fachwerkstädtchen rasten vorbei, links fläzte die Rheinebene im Dunst, das Laub war golden gefärbt. Rechts von der Strecke schob sich bald ein mir unbekannter Höhenzug ins Bild, er sah aus wie eine Kissenlandschaft aus Laub. Reben kletterten die Hänge empor. Jetzt einen kühlen Weißen!
Mir gegenüber im Abteil hatte inzwischen eine Dreiergruppe Platz genommen, zwei Männer und eine Frau, nur unwesentlich älter als ich. Sie plauderten in einem mir unverständlichen Dialekt. Ich fragte sie, was das sei, und deutete auf die Hügel. Sie sahen mich etwas überrascht an.
Das sei der »Oudewaald!«, sagte einer.
Er trug Wanderkleidung und einen kleinen, feldgrauen Rucksack mit ledernen Riemchen. Sie kämen gerade von einer Wanderung, immer oben an der Hangkante entlang, berichtete er, und deutete nach draußen, wo jetzt ein Bergfried am Zugfenster vorbeisauste. Schöne Sache, solle ich auch mal machen, schlug der Wanderer vor und lachte. Ich sah wohl nicht so aus wie einer, der einfach mal so wandern ging.
In Darmstadt stieg ich um in einen Zug zum Frankfurter Flughafen und quartierte mich dort in einem Hotel ein, Intercity, Marriott, Holiday Inn, Sheraton, ich weiß es nicht mehr. Schon am frühen Morgen lärmten die Flugzeuge, ich latschte in einen Frühstücksraum voll austauschbarer Welt-Ästhetik. Das Personal redete mich auf Englisch an und geleitete mich zu einem Einzelplatz. Menschen um mich herum nahmen ihr industriell gefertigtes Müsli ein und schlürften ihren Latte aus Plastikbechern. Man hörte Russisch, Brasilianisch, Französisch, Amerikanisch. Die gleiche Kleidung allenthalben, der gleiche Habitus.
Ich musste an meinen alten Vater denken, der gerade nach einer OP im Krankenhaus lag. Er hatte auf Wanderungen auch immer so ausgesehen wie das Trio am Vortag im Zug. Jetzt war er 87, und wandern würde er nicht mehr können. Wie viel Zeit hatte man selbst eigentlich noch? Und was wollte man damit anfangen?
Ich nahm den Shuttlebus zur Buchmesse, durchwanderte riesige Hallen, hakte meine ersten beiden Interviewtermine ab, schüttete Automaten-Kaffee in mich hinein – bis mich der Anruf der Redaktion ereilte. Mario Vargas Llosa solle den Nobelpreis erhalten. Unhörbar schwang der Vorwurf mit, dass ich mich nicht von selber gemeldet habe. Ich sei doch auf der Buchmesse, oder? Diese Nachricht habe ich doch wohl mitgekriegt?
Hatte ich nicht.
Ich sagte zwei Termine ab, deren Vorbereitung mich viel Zeit gekostet hatte, hackte im Pressezentrum einen Artikel über Vargas Llosa in die Tastatur und sah den Kolleginnen und Kollegen zu, die links und rechts von mir an den Rechnern in der gleichen Absicht Reuters-Meldungen und Wikipedia scannten.
Dann machte ich mich auf den Weg zu meinem letzten Gesprächspartner. Es war ein junger Argentinier, der in Buenos Aires als Poolreiniger arbeitete, in seiner Freizeit aber einen ambitionierten Roman über die Nachwehen der Diktatur geschrieben hatte. In Frankfurt sollte er dafür den Anna-Seghers-Preis bekommen. Unter einem riesenhaften Porträt von Jorge Luis Borges im Argentinien-Pavillon fragte ich ihn, wie er sich auf der Buchmesse fühle?
Als habe ihn ein Schnellzug gestreift, sagte er.
Als ich am nächsten Morgen auf der Rückfahrt im ICE saß und aus dem Fenster in die vorbeirasende Landschaft glotzte, dachte ich über seine Worte nach. In München wartete der übliche Strudel an Arbeit auf mich. War es nicht allmählich Zeit für etwas mehr Langsamkeit?
Kurz nach meiner Rückkehr folgte ich einem Impuls. Ich rief meinen alten Wanderkumpel Christoph an. Zusammen hatten wir allerlei Touren in den Münchner Hausbergen absolviert und darüber hinaus das Schweizer Jura-Gebirge der Länge nach durchmessen, eine wenig beachtete Destination, sehr abgelegen, sehr eigentümlich. Ich hatte das Gefühl, dass Christoph der richtige Begleiter sein könnte für das, was mir vorschwebte.
»Hast du Lust, mal was völlig Absurdes zu machen?«
»Was denn?«
»Wir könnten zu Fuß von Darmstadt nach Heidelberg gehen.«
Stille in der Leitung.
Ich las aus dem Internet vor: »›Die Route des Burgensteigs folgt dem Verlauf einer alten Handelsstraße, welche die Römer bauten und strata montana1, deutsch: Bergstraße, nannten.‹ Da stehen massenhaft Burgen am Weg, es geht immer auf und ab, Höhenmeter gibt es also genug. Und man kann mit dem Zug hinfahren.«
»Wie lang dauert das?«
»Vier Tagesmärsche«, sagte ich und fand, das klang nach Postkutschenzeitalter, nach Wandervogelromantik, nach dem Leben eines Taugenichts.
»Gern«, sagte Christoph nach einer Pause. »Aber wo liegt eigentlich Darmstadt?«
Die Süße des deutschen Weingartens
Dass Bielefeld angeblich nicht existiert, ist eine uralte Internet-Schote, die es als »Bielefeld-Verschwörung« sogar zu einem Wikipedia-Eintrag gebracht hat.2 Das trug viel dazu bei, dass Bielefeld inzwischen richtig bekannt ist. Aber Darmstadt? Die Geografie des eigenen Landes stellt für viele Deutsche ein Rätsel dar – sie wissen aufgrund ihrer hohen Reisefrequenz bestens Bescheid über New York und Barcelona, manche kennen jede Raststätte zwischen Brenner und Modena, der Flughafen Dubai ist ihnen vertrautes Territorium. Im eigenen Land aber sind sie geografisch hilflos. Christoph ist als Fernsehjournalist ein weitgereister Mann, und ich vermute, hätte ich ein Ziel in der Mongolei oder der Baja California vorgeschlagen, so hätte er gleich gewusst, was ich meinte. Inzwischen kennen wir uns auch in Darmstadt aus. Wir waren dort.
Es ist Mitte Mai, als wir mit unseren Rucksäcken im Zug sitzen, die Sonne kämpft sich durch den Dunst, Hügelchen erwachen im Morgenlicht, Kirchtürme grüßen herüber, ein sandiges Sträßlein verliert sich im Wald. Christoph döst in seinem Sitzpolster. Ein Bild des Friedens. Am Ziel staunen wir, wie schnell die Fahrt vergangen ist. Wir haben noch fast den ganzen Tag Zeit! Die Route steht grob fest: von Ruine zu Ruine. Übernachten wollen wir, wo sich etwas findet. Und muss es nicht überall am Weg romantische Gasthöfe mit leckerem regionalem Essen, herzlichen Bedienungen und frisch duftenden Betten geben? Wir kennen die deutsche Provinz noch nicht.
Zunächst zuckeln wir mit der Straßenbahn zum Friedhof, wo der Burgensteig beginnen soll – doch wir verirren uns erstmal zwischen den Grabsteinen. Es ist ein seltsames Gefühl, wenn man sich für welterfahren hält und dann nicht mal aus einem städtischen Friedhof herausfindet. Erst nach mehreren Runden entdecken wir das blaue »B«, das unseren Steig kennzeichnet, und mit ihm den Pfad, der in einem Eibengestrüpp verschwindet. Sieht so das Tor zur Freiheit aus?
Wir sind noch skeptisch, als wir dem kurvigen Pfad folgen, doch mit jedem Meter wächst die Zuversicht – und als ein hölzerner Pfeil eine »Himmelsleiter« ankündigt, die steil bergauf führt, sind wir sicher, auf dem richtigen Weg zu sein. Wir kraxeln hoch und gelangen nach 256 Treppenstufen auf die Feste Frankenstein, unsere erste Burg! Dort steigen wir auf eine Turmruine und blicken auf eine Ebene, in der sich die Silhouette einer Großstadt aus dem Dunst schält wie eine Fata Morgana.
»Ist das Frankfurt?«
»Ja, das ist wohl Frankfurt«, sage ich und atme aus, geplättet von dem Panorama. »So ähnlich muss sich Vasco Núñez de Balboa gefühlt haben.«
»Wer?«, fragt Christoph.
»Das ist der Spanier, der als erster Europäer den Pazifik gesehen hat, von einem Berg in Panama aus.«
Christoph lacht: »Na ja, wenn du meinst! Lateinamerika lässt dich ja anscheinend nicht los.«
Natürlich weiß ich, dass der Vergleich absurd ist. Aber irgendwie fühle ich eine vergessene Entdeckerfreude in mir erwachen, ein ganz ähnliches Gefühl wie damals, als ich das erste Mal nach Buenos Aires flog und der schachbrettartige Grundriss der Stadt unter mir auftauchte wie eine Verheißung. Nun eben Frankfurt. Na und?
Vielleicht muss man ja überall gewesen sein, um das schätzen zu können. Aber wer mal die weggeworfenen Plastiktüten an den Dornenbüschen der patagonischen Wüste gezählt, wer auf einem peruanischen Andenpass auf 5 000 Metern Höhe nach Luft gejapst oder im Schlick einer ecuadorianischen Ölbohrstelle herumgestapft ist, der wird anfällig für die Süße des deutschen Weingartens.
Übermütig gestimmt wandern wir weiter, und gleich hinter der Burg machen wir einen Fehler. Wir entscheiden uns für eine Abzweigung, die vom Höhenrücken wegführt und uns tief hinab in den Buchenwald lenkt, dessen Stämme kerzengerade in die Höhe schießen. Das Sonnenlicht blinzelt durch die Baumkronen, die Szenerie wirkt kathedralenhaft. Das spornt uns an, und so folgen wir dem Pfad etwas leichtsinnig, denn eigentlich wissen wir ja, dass es der falsche Weg ist, der uns immer tiefer in die Hügel hineinführen wird anstatt an der Hangkante entlang gen Süden. Aber ist das nicht die Freiheit? Einfach mal dahin laufen, wo einen die Nase hinlenkt?
Das ist besonders dann attraktiv, wenn das Alltagsleben gerade nicht viel Bewegungsspielraum bietet. Christoph ist beruflich stark eingespannt, während der Tour klingelt unaufhörlich sein Handy, immer wieder muss er anhalten, um Sendetermine und Drehgenehmigungen abzusprechen. Zwischendurch ist seine ungehaltene Freundin dran, mit der offenbar ein Streit schwelt. Sie spricht sehr laut, und ich schnappe auf, wie sie fragt, ob es uns denn gefalle auf unserer Männertour durch den »Hodenwald«. Auch bei mir ist privat einiges geboten: Meine betagten Eltern bauen gesundheitlich schwer ab, gleichzeitig will meine Freundin ein Kind. Soll ich mich darauf einlassen? Christoph und ich haben allerhand Gesprächsstoff.
So fliegen die Kilometer vorbei, und da wir so viel reden, verfransen wir uns in unseren Wanderkarten mit ihrer hieroglyphischen Symbolik aus Kennzeichnungen und farbigen Linien, bis wir schließlich etwas überrascht in einem eiszeitlichen Felsenmeer voller riesiger, rundgeschliffener Quarzblöcke stehen, einer Art steinernem Labyrinth, was ganz gut zu unserer Lebenssituation passt. Die fahler werdende Nachmittagssonne, die sich durch die Baumwipfel tastet, taucht die Szenerie in ein kühl-grünliches Licht. Wir sausen halb hüpfend, halb kletternd hinab durch die versteinerte Gletscherzunge und landen schließlich auf einer sich endlos ziehenden Forstpiste. Bisher hat es Spaß gemacht, doch jetzt geben die Batterien auf. Missmutig trotten wir dahin wie müde Soldaten mit unseren Tornistern.
Zum Glück tut sich bald diese parkähnliche Schein-Wildnis auf, eine Art idealer Landschaft mit riesigen Bäumen, Bächlein und Zierpavillons, alles auf anregendste Art halbverwildert, durch die ein rotsandiger Pfad bergab führt. Wir folgen ihm, ohne recht zu wissen, oder wissen zu wollen, wo es hingeht.
Und dann liegt es vor uns: ein kleines Schlösschen im französischen Stil, die Fenster aus rotem Buntsandstein, taubenblaue Läden davor, Schirmchen und Tische einladend vor der Tür drapiert. Dahinter sind die Umrisse einer Art Gutshof zu erkennen, ein komponiertes Ensemble mit einem Uhrentürmchen und einem weiß getünchten Herrenhaus, dazu ein Wirtschaftsgebäude mit weißen Schindeln und bemoosten Dachziegeln, umstanden von knorrigen Platanen. Eine linde Dämmerung legt sich über die Hügel.
»Das wär’ doch was?«, sage ich zu Christoph und zeige auf das Anwesen.
»Wollen wir mal fragen?«
»Ich weiß nicht recht. Sieht irgendwie museal aus. Haben die überhaupt Zimmer?«
»Wir müssen leider fragen, ich kann keinen Schritt weiter.«
»Na gut.«
Wir treten durch die Tür, ein belebend kühles Ambiente empfängt uns, der Raum ist mit antiken Stilmöbeln vollgestellt. Wir fühlen uns als das, was wir sind: zwei Typen, die aus dem Wald kommen.
»Guten Abend, haben Sie Zimmer?«, keuche ich mit der Forschheit des Erschöpften.
Die Dame am Empfang betrachtet erst mich, dann die staubigen Stapfen, die ich auf dem Fußboden hinterlassen habe.
»Ja, aber nur ein Doppelzimmer«, fügt sie mit Blick auf meinen nicht minder schmutzigen Begleiter hinzu.
Ich sehe Christoph an. Seine Behauptung, ich würde schnarchen, ist ein Dauerthema bei unseren Wanderungen.
»Sei nicht so eine Diva«, sage ich.
»Na schön«, brummt er.
»Wir nehmen das Zimmer. Gibt es bei Ihnen auch was zu essen?«
»Wir können Ihnen ein Menü anbieten.«
»Na fein, danke!«
Wir trampeln über frisch gebohnertes Parkett auf einem gewundenen Treppchen in den ersten Stock empor und wundern uns über die altmodische Einrichtung in dem blau getünchten Zimmer, über dem Bett schwebt ein Baldachin.
»Sieh mal, sieht aus wie die Hochzeitssuite«, sage ich.
»Wehe, du schnarchst wieder!«, schnaubt Christoph.
Wir waschen unsere mit Salzrändern verkrustete Wäsche, zum Glück kann man aus dem Fenster auf ein Vordach klettern, wo wir unsere nassen Shirts aufhängen. Wanderer sind der Horror jedes Zimmermädchens.
In Badeschlappen laufen wir die Treppe hinunter und hocken uns auf die Bank vor dem Haus. Ein Kellner kommt, sieht uns milde lächelnd an und sagt, es gebe Zander.
Zander, na ja. Etwas Kernigeres wäre uns lieber gewesen nach mehr als 30 Kilometern Marsch an einem Nachmittag, aber als Fußgänger muss man nehmen, was kommt. Also zweimal Zander.
Ich zeige auf den kleinen Monopteros am Hang gegenüber, auf dem »Aus kindlicher Liebe« geschrieben steht. Wie für das Ambiente arrangiert, huschen Kinder um das Tempelchen herum, in eierschalenfarbene Kleidchen gehüllt. Dazwischen tänzelt eine Frau in Weiß umher.
»Irgendwie unwirklich, oder?«
»Passt schon«, sagt Christoph, der allgemein nicht viele Worte macht, und kippt sein Bier. Ich nippe am Weißwein und freue mich über seine Nüchternheit, die mich immer wieder erdet.
Als Pragmatiker hat Christoph längst den Pfad auf der gegenüberliegenden Seite im Blick. »Da müssen wir morgen rauf.«
Zunächst spüre ich beim Blick auf den Steig, der sich den Hügel emporwindet, einen Schwall von Vorfreude, ein lang vermisstes Gefühl. Zu diesem Zeitpunkt ahne ich noch nicht, dass der Moment vor dem Schlösschen an der Bergstraße eine Art Wendepunkt in meinem Leben markieren wird, die leise Andeutung einer Wandlung. Ich spüre, dass die Glasscheibe, die sich in den hektischen Berufsjahren zwischen mich und die Welt geschoben hat, und die Dr. B. als Symptom einer Depression diagnostiziert, ein Stück zur Seite rutscht. Der Geruch von frischem Gras, von Wiesenblumen und Abenteuer steigt in meine Nase. Ich kann die Welt an diesem Wiesenhang wieder riechen. Und sie riecht gut.
Ein unwiederholbarer Augenblick
Viele Jahre später werden Freunde von mir dieselbe Wanderung unternehmen, und natürlich empfehle ich ihnen, in dem Herrenhaus zu übernachten. Doch nach ihrer Rückkehr werden sie mir vorwurfsvoll mitteilen: »Das ist gar kein Hotel. Wir mussten noch ewig weit bis Bensheim laufen.«
»Wie, aber ich habe doch dort geschlafen!?«
Ich neige manchmal zu Traumphantasien, aber da Christoph dabei gewesen ist, gibt es in diesem Fall keinen Grund, an meinem Verstand zu zweifeln. Ich google erst jetzt den Ort, an dem wir damals gewesen sind, und lese: Es handelt sich um das Fürstenlager, die um 1790 angelegte Sommerfrische der Landgrafen und Großherzöge von Hessen-Darmstadt.3 Aber von einem Hotel steht da tatsächlich nichts – nur, dass es die Möglichkeit gebe, das Schlösschen für Hochzeiten zu mieten.
Christoph und ich sind also anscheinend an jenem Tag im Mai in den Vorabend einer Trauung hineingestolpert. Warum hat uns die Rezeptionistin ein Zimmer gegeben, offenbar vor einem Anlass, bei dem man als Gastronomin ja andere Sorgen hat, als Wanderer zu beherbergen? Hat sie uns für Festgäste gehalten? Wohl kaum. Vielleicht hat sie uns drollig gefunden. Vielleicht hat sie Mitleid gehabt. Tatsache ist, dass mir so was nur beim Fernwandern passiert. Ein Augenblick, weder plan- noch wiederholbar, und genau deshalb so wertvoll. Die Erinnerung daran kommt mir außerdem vor wie ein Relikt der internetfreien Epoche. Denn die Wanderung haben wir 2011 unternommen, in der digitalen Steinzeit also, und wir waren ausgestattet mit Nokias, deren Akkus locker vier Tage ohne Aufladen durchhielten, die dafür aber nicht internetfähig waren. Zum Glück. Hätten wir vorher im Netz nachgesehen, dann hätten wir in dem Schlösschen gar nicht erst nach einem Zimmer gefragt.
Träume und Taten
Nach einer erholsamen Nacht unter dem Baldachin stapfen wir den Pfad neben dem Monopteros bergauf. Schnell steht uns der Schweiß auf der Stirn. »Das soll hier Deutschlands wärmste Region sein«, sage ich.
»Halte ich im Moment für nicht unwahrscheinlich«, keucht Christoph hinter mir.
Wir laufen durch die Weinberge und erreichen den Kirchberg hoch über Bensheim. Der Biergarten hat leider geschlossen. Wir setzen uns auf die verwaisten Bänke und genießen die Aussicht auf die Ebene und einen fernen Höhenzug. Das muss wohl die Pfalz sein, wie ich meiner Landkarte entnehme. Alles Neuland für uns.
Am Fuße des Hügels, auf dem wir stehen, führt eine Bahnlinie entlang. »Da bin ich letztes Jahr nach Frankfurt gefahren und hab’ mir gedacht: Hier müsste man mal wandern.«
»Tja, und schon stehen wir hier oben«, sagt Christoph.
»Tut gut, wenn man seine Träume in die Tat umsetzt.«
»Sollte man vielleicht öfter mal machen«, schlägt er vor – und das klingt fast schon wie eine Abmachung.
Bensheim an der Bergstraße empfängt uns mit der Geschäftigkeit eines Markttages. Fachwerk, Gemüsestände und – hurra! – ein Backshop. Der deutsche Backshop ist oft die letzte Rettung des Fernwanderers in einem Land, in dem Biergärten und Ausflugslokale rätselhafte Öffnungszeiten haben. Wenn man abgekämpft in einen Ort torkelt, ist die Unkompliziertheit des Backshops ein Labsal. In einem richtigen Café würde man mit Rucksack und Stöcken die Gäste anrempeln, der schlechte Geruch der Wandersachen würde sich womöglich über den Kuchentellern ausbreiten. In einem Backshop hingegen hält sich niemand lange auf. Man kann sich die Hände waschen, Proviant einkaufen, und sich, wenn es regnet, aufwärmen. Heute aber lacht die Sonne. Wir wuchten unser Zeug zwischen die Stühle im Freien und gönnen uns ein zweites Frühstück. Ein Glücksmoment des Fernwanderns.
Doch dieser währt nur kurz: Wer durch Deutschland wandert, muss Orte durchqueren, und wer Orte durchquert, geht auf Asphalt. Man passiert Siedlungsbrei, Schottergärten, Carports, Baumarktödnis, die man zu Fuß genauer in Augenschein nehmen muss, als einem lieb ist. Immer wieder eindrucksvoll der Eifer deutscher Gartenbesitzer, mithilfe eines Arsenals motorgetriebener Gerätschaften möglichst alles von ihrer Scholle zu tilgen, was nach Natur aussieht. Hinter Bensheim hört der Asphalt auf, dafür flirrt die Hitze über den Äckern, wir trotten einen Schotterweg entlang, der nicht enden will, und rasten im dürftigen Schatten eines Apfelbaums. Ein Reh sieht uns aus der Ferne zu. Über uns kreist ein Milan.
»Wenigstens kein Geier«, sagt Christoph trocken.
Wir lernen nun ein weiteres Charakteristikum der Mittelgebirge kennen: das stetige Auf und Ab. Erst geht es runter ins nächste Dorf, dann wieder steil hoch zur Starkenburg.
»Müssen wir wirklich jede Burg mitnehmen?«, nörgele ich.
»Fang nicht schon jetzt an zu jammern«, sagt Christoph und klopft sich aufs Gesäß, »das gibt einen knackigen Hintern.«
Die brasilianische Bedienung im Burgcafé beeindruckt das wenig. Dafür plaudert sie mit mir ein bisschen auf Brasilianisch. So klein ist die Welt.
Christoph unterbricht unseren Plausch und zeigt fuchtelnd auf die drohenden dunkelblauen Wolken, die von Westen heranjagen. Wir rasen den Burgberg hinab, der dem Gewitter eine wunderbare Gelegenheit bietet, seine nasse Ladung abzulassen, schön fett auf diese beiden Wanderer, die nun nach Heppenheim hineinhasten und sich am Marktplatz unterstellen.
»Irgendjemand Bekanntes kommt von hier«, überlegt Christoph.
»Ich glaube, es ist ein Rennfahrer.«
»Formel 1 ist das sicher nicht, was wir hier machen.«
»Ich fühle mich eher wie ein überbreiter Schwertransport.«
»Wenigstens könnte es mal aufhören zu schütten!«
»Seien Sie froh, dass es regnet, sonst halten Sie die Hitze im Weinberg gar nicht aus«, mischt sich ein älterer Herr mit Schirm ein, der sich neben uns gestellt hat.
Wir beschließen, uns die Empfehlung des weisen Einheimischen zu Herzen zu nehmen und den Regen zu mögen. Bald kommt eh wieder die Sonne durch, schwüle Hitze steigt auf. Schwitzend traben wir einen Saumpfad entlang, an dem Kirschbäume Spalier stehen.
»Guck mal, die Kirschen sind reif, schon Ende Mai!«
Sie wachsen uns förmlich in den Mund, immer wieder halten wir an, um die saftigen roten Früchte von den herabhängenden Ästen zu naschen.
Bei uns zu Hause gibt es fast nur noch Kirschen aus der Türkei oder Griechenland zu kaufen, Obstbäume werden Baugebieten geopfert, man vergisst beinah, was der heimische Garten so alles hergeben könnte. Was läuft da falsch? Warum schätzen wir das Eigene so gering? Vielleicht, weil wir es gewohnt sind, unser Land nur als Einnahmequelle und Produktivstandort zu sehen? Dazu passt die Aussicht, die Christoph gerade erspäht hat. Er deutet auf die rauchenden Schlote, die fern und noch winzig klein in der Ebene vor uns auftauchen.
»Schätze, das ist Ludwigshafen, die BASF.«
Ist das Bild abstoßend? Nun, ich denke, wir sind Teil der Zivilisation, und der Weg, auf dem wir gehen, ist es ebenfalls. Außerdem mag ich es eigentlich, dieses Nebeneinander von Schön und Hässlich, das deutsche Landschaften kennzeichnet: Kirschbäume und Chemiewerk, in einer Aussicht vereint. Dichter wie Ludwig Tieck predigten zu Zeiten der Industrialisierung im 19. Jahrhundert die Abkehr von der Zivilisation, die Suche nach dem Selbst im Wald, die Weltflucht. Doch kann man der Realität entkommen? Vielleicht besser, man arrangiert sich mit ihr, sucht das Schöne, wo man es nicht vermutet hätte, und nimmt das Hässliche als unvermeidbar hin.
Gräber ohne Steine
Kurz vor Hemsbach schlage ich vor, ein Nachtquartier zu suchen. »Wir finden was!«, sagt Christoph in bewährter Zuversicht, die leider verfrüht kommt. Wir stoßen nicht auf kuschelige Landgasthöfe mit Weinausschank, nur eine Eisdiele hat auf. Was nun? Während wir hektisch in unseren Landkarten blättern, spricht uns ein Familienvater an, der seinen Kindern gerade ein Eis gekauft hat. Ob er helfen könne? Weitere Gäste kommen hinzu, und bald beteiligt sich gefühlt das halbe Dorf an der Herbergssuche für diese zwei abgekämpften Herren mittleren Alters. Es wird debattiert und hin- und hertelefoniert.
»Die Frau Sowieso, die vermietet doch? Ich ruf’ mal an.«
»Ach, belegt, Monteure«, schade.
Einige Telefonate später findet sich doch noch etwas, und seitdem weiß ich: Neben dem Backshop ist die Rettung des deutschen Fernwanderers die Handwerkerunterkunft. Wir bekommen zwei Einzelzimmer bei einer fidelen Witwe. In den 30 Euro ist die Wohnzimmernutzung inbegriffen, uns lächeln braune Polster, rosa Lampen, blauer Teppichboden, Häkeldeckchen und Plastikblumen an, an den Fenstern schirmen dicke Gardinen nachbarliche Blicke ab. Eine Puppe im Prinzessinnenkleid präsidiert diese Mischung aus Kinder- und Alte-Damen-Zimmer. Es riecht nach Sauberkeit, Teppichpflege und Provinz, nebenan duscht schon ein anderer Hausgast, ein Handwerker. Wir tun es ihm gleich, und in den Monteursbetten schlafen wir tief und fest. Die Einrichtung ist uns sowieso egal nach einem langen Wandertag.
Am nächsten Morgen serviert die Wirtin ein monumentales Frühstück, sogar mit Nutella.
»Wo gehen Sie denn heute hin?«
»Richtung Weinheim.«
»Na, denn gehense doch über de Judefriedhoff!«
»Den was?« Es dauert einen Augenblick, bis ich mir das Wort übersetze.
»Ah, klar! Gern. Wo ist der?«