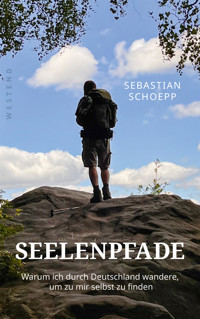18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit der Pandemie und der Reduzierung sozialer Kontakte hat das Problem der Einsamkeit vieler Menschen in unserer Gesellschaft einen starken Schub bekommen. Sebastian Schoepp stellt sich dieser Entwicklung mit einem starken Plädoyer zur Rettung der Freundschaft entgegen. In einem weiten Spannungsbogen von der Antike bis in unsere Gegenwart beschreibt er die Freundschaft als soziales Konstrukt und betonstarkes Gefühl einer oft lebenslangen Verbindung mit einem hohen Stellenwert für die Gesellschaft, das soziale Leben und die psychische Gesundheit des Einzelnen. Und nicht zuletzt und auch am schönsten ist Freundschaft ja oft dann, wenn sie ihre subversiven Seiten entfaltet. Anhand legendärer Freundschaften und mit vielen vorbildlichen Beispielen ermutigt uns Schoepp, uns für Freundschaften bedingungslos zu öffnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ebook Edition
Sebastian Schoepp
Rettet die Freundschaft!
Wie wir gemeinsam wieder zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude finden
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-364-3
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2022
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Lektorat: Philipp Hadermann
Satz: Publikations Atelier, Dreieich
Druck und Bindung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Printed in Germany
Inhalt
Titel
Light my fire
Rettet die Freundschaft!
Aneignung der Welt
Gemeinsam anders
Let’s start a band
Die Bestätigung der Welt
Umarmen verboten
Etwas verändert sich
Schubs ins Leben
Weil sie es war, weil ich es war
Ein verzwicktes Verhältnis
Warum der Chef nicht dein Freund sein kann
Eine Frage der Priorität
Auf der Suche nach der Wahlfamilie
Freiheit, Gleichheit, Freundschaft
Allein zu Haus
Triumph der Kleinfamilie
Das große UND
Der kleine Hoplit
Neue Freunde
Schwarze Schwäne und Seeschlangen
Ein höherer Seinszustand
Ein perfektes Paar
»Nur« gute Freunde?
Zweifelhafte Absichten
Wo Freundschaft an Grenzen stößt
Sex mit Christus
Von Angesicht zu Angesicht
Als Freundschaft männlich war
Mehr Weiblichkeit wagen
80 Jahre Freundschaft
»Lass sie nie fallen«
Deutschland – England 1:1
Best Man
Saludos amigos
Geschäfte auf Gegenseitigkeit
Freundschaft und Subversion
Wenn Freundschaft Geschichte schreibt
Die verborgene Dimension
Am Wühltisch der Sozialbeziehungen
Freundschaft als Ware
Demokratisierung der Freundschaft
Der Mensch, ein haptisches Wesen
Mein Freund, der Avatar
Der Pakt vom Brückenfischer
Reif und süß
Der Pakt
Epikurs Garten
Epilog
Sylvie
Erkan
Mick
Lukas
Literatur
Anmerkungen
Orientierungspunkte
Titel
Inhalt
Light my fire
»Und so wollen wir an unsre Sternen-Freundschaft glauben«
Friedrich Nietzsche – Die fröhliche Wissenschaft § 279
Der Hafen von Porto Santo Stefano war Ende der 1980er-Jahre ein wenig gastlicher Ort. Die Hitze flimmerte über dem Asphalt, es roch nach vergammeltem Fisch, im Hafenbecken schwappte öliges Wasser an die von Algenresten verklebten Kaimauern. Oli und ich saßen auf der Motorhaube eines silberfarbenen VW Golfs, der meiner Mutter gehörte, und sahen der Fähre auf die Insel Giglio beim Ablegen zu. Auf dem Schiff saßen alle unsere Freunde. Unter ihnen K., in die ich verliebt war, die aber auf A. stand, der ebenfalls an Bord war. Es war klar, was das bedeutete. Ich zog an einer MS, morte sicura, sicherer Tod1.
In Florenz war noch alles harmonisch verlaufen auf unserem Abi-Urlaub. Alle hatten sich am Campingplatz hoch über der Stadt getroffen, der halbe Jahrgang war angereist. Wir hatten die Autos zu einer Art Wagenburg geparkt, in deren Mitte getrunken, gegrillt und geflirtet wurde. Um Geld für den Rotwein zu verdienen, hatten wir eine kleine Feuerspuckshow mit Duftpetroleum an der Piazza della Signoria veranstaltet und Flammenfontänen in die toskanische Nacht gespien. Passanten warfen Hundert-Lire-Stücke in eine Glaskaraffe, die wir aufgestellt hatten. Nach dieser Nacht sollte es weiter nach Süden gehen, ans Meer.
Am Morgen fuhren wir ziemlich verkatert los. Die Führung übernahm Peter in seinem roten Simca, bei dem die Fahrertür nicht aufging und man über den Beifahrersitz rutschen musste, um ans Steuer zu gelangen. Dahinter Thomas mit dem Bulli voller Mädchen. Am Ende Oli und ich in Mutters Golf. Wir beide hatten nicht wirklich eine Ahnung, wo es hinging. Aber spielte das eine Rolle, war das nicht die Freiheit?
Sie währte nur bis zum Hafen von Porto Santo Stefano. Dort war es zum Streit wegen der Überfahrt gekommen. Eines der Autos war überflüssig auf der Insel – nach einhelliger Meinung Mutters Golf, den sie mir nur widerwillig und auf das Versprechen hin geliehen hatte, gut auf den Wagen aufzupassen. »Lass den doch einfach hier stehen«, sagten die anderen, die das Geld für die Überfahrt sparen wollten; die Passage für die beiden anderen Autos sei ja schließlich schon teuer genug. Ich sah mich um. Hier den Golf mehrere Nächte lang unbewacht parken? Lungerten da nicht überall zwielichtige Gestalten herum? Mutter hätte der Schlag getroffen. Ich weigerte mich. Es hatte einen kurzen Disput gegeben. Dann waren die anderen weg. Oli blieb da. Das rechne ich ihm heute noch hoch an.
Als das Schiff außer Sicht war, fuhren wir ins Zentrum der kleinen toskanischen Hafenstadt. Die Junihitze lag schwer über den Gassen. In einer offenen Lagerhalle standen riesige Fässer, davor ein älterer Mann ohne Hemd.
»Aqua?«, startete ich einen Versuch. So hieß das auf Lateinisch, das hatten wir in der Schule gehabt. Musste auf Italienisch doch ähnlich lauten, oder?
»Aqua?!«, lachte der Mann und machte eine Bewegung, als würde er sich den nackten Oberkörper waschen. Er nahm eine leere Literflasche, hielt sie unter eines seiner riesigen Fässer, drehte am Verschluss und ließ einen Strahl schwarzen Weins in die Flasche laufen. Er hob vier Finger in die Höhe. Ich gab ihm vierhundert Lire.
Wir stiegen zurück ins Auto und fuhren los. Im Kassettenrekorder liefen die Doors, bei uns liefen immer die Doors.
Change your weather, change your luck, and then I’ll teach how to f … – Jim Morrison ließ eine Pause,wir grölten das fehlende Wort mit. Dann sang er zensurgerecht weiter: …ind yourself.2
Haha!
Am Ortsausgang standen zwei Mädchen, die per Anhalter fuhren. Wir stoppten.
»Orbetello?«, fragte eine.
»Why not?«, sagte ich.
Come on baby, light my fire.
»Jim Morrison, I like«, sagte sie. Weiter reichte ihr Englisch nicht; und ich konnte außer »Aqua« nichts auf Italienisch sagen.
In Orbetello stiegen die Mädchen wieder aus. Wie sollte man jemanden anbaggern ohne Sprachkenntnisse?
People are strange when you’re a stranger.3
Die Landschaft flog dahin, und allmählich besserte sich die Stimmung. An einer Ampel fingerte Oli den Zettel vom Armaturenbrett, den Lukas uns in Florenz dagelassen hatte. »Ich mache ein Feuer am Strand von Chiarone, wer Lust hat, kommt nach«, hatte er geschrieben.
Lukas, der war anders.
Gemeinsame Unternehmungen waren nicht so sein Ding. Er war zwar zur Party am Campingplatz in Florenz gekommen, doch damit war sein Bedarf an Gruppendynamik offenbar gestillt. Dann war er eines Morgens davongebraust in seinem metallicbraunen Kombi, ganz alleine, doch voller Zuversicht, gen Süden. Ich fand das sehr mutig und bewunderte ihn. Ich hätte mich das nicht getraut.
Aber so war Lukas eben.
Lukas war von einem anderen Gymnasium zu uns gekommen. Angeblich eine Drogensache.
»Wer is’n der Typ in der abgeschabten Lederjacke?«
»Weiß nicht, heißt wohl Lukas.«
»Und warum ist der jetzt bei uns an der Schule?«
»Wohl strafversetzt.«
Von einem Drogenproblem habe ich damals nichts bemerkt. Lukas hat nie versucht, mich zum Kiffen zu überreden, da gab es ganz andere, die auf jeder Party meinten, sie müssten einen für ihre Welt des dumpfen Grinsens gewinnen. Lukas hat nicht gegrinst, er hat gelächelt. So ein immerwährendes, strahlendes Lächeln, das die Mädchen mochten. Wir Jungs mochten Lukas auch – trotzdem. Eigentlich erstaunlich.
Wenn er auf dem Parkplatz vor der Schule seinen Kombi startete, saßen immer Mädchen mit drin. Manchmal auch einer von uns, vielleicht deswegen. Lukas blickte einen dann durch seine John-Lennon-Brille im Rückspiegel an, schüttelte die lockige Mähne und sagte: »Dann braucht ihr nicht S-Bahn zu fahren. Ich muss ja eh in die Richtung.« Er nahm gern Leute mit, nicht widerwillig wie andere, bei denen die Eltern Stress machten wegen Chipsresten oder Tabakkrümeln auf den Autositzen. Bei Lukas konnte man rauchen und krümeln, so viel man wollte.
Bald fuhr ich mal mit zu ihm nach Hause, stieg in sein Zimmer hinauf, von wo aus man Birken und Moor sah. Es lief immer Musik, Stevie Wonder und die Commodores, Soul-Musik hatte ich bis dahin nicht gemocht. Bei Lukas war das anders, da hörte ich gerne mal hin. Wir liehen einander Platten und Tapes, redeten über Bands, Mädchen, Lehrkräfte, Politik. Lukas wirkte dabei immer wie einer, der einen Schritt zurücktrat und die Welt mit Abstand betrachtete. Seine Empfindsamkeit hatte ihm eine Aura von Unangepasstheit verliehen, in der er sich wahrscheinlich manchmal etwas einsam fühlte. Wenn es im April geschneit hatte und alle »Scheißwinter« fluchten, sagte er Sachen wie: »Die Landschaft ist verzaubert.« Darüber ließ sich nachdenken. So wurden wir Freunde.
Ich habe nur ein einziges Foto von ihm, da sitzt Lukas in weißer Sommerhose, geringeltem T-Shirt und ausgelatschten Ledersandalen an der offenen Schiebetür des Bulli im Staub von Camping Firenze, wenige Zentimeter ihm gegenüber leuchtet das Gesicht eines blonden Mädchens, das später einen ganz anderen heiraten sollte. Aber in dem Moment lachen sie sich an, als seien sie füreinander gemacht.
Wären wir heute noch Freunde? Manche Menschen sind weg von dieser Welt, bevor die Freundschaft mit ihnen wirklich dauerhaft werden kann. Doch sie hinterlassen etwas in uns – durch die Art und Weise, wie sie die Welt betrachtet, wie sie die Dinge angegangen, wie sie ihren Weg gewählt haben. Das hat auf uns abgestrahlt, wie ein Licht. Manchmal müssen viele Jahre vergehen, bis man das Licht wieder sieht; bei Lukas sind es mehr als dreißig gewesen. Gemessen an diesem Zeitraum kannten wir uns kaum länger als einen Moment. Aber es war einer dieser Augenblicke, in denen die Seele einen Spalt weit offen steht, um Licht hereinzulassen. Es strahlte aus ihm heraus, absichtslos und wärmend, und direkt in mich hinein. Dort strahlt es weiter, auch wenn sein Ursprung längst verloschen ist. Wie bei einem Stern.
*
»’Ne Ahnung, wo dieses Chiarone liegt?«, fragte Oli jetzt und blickte auf Lukas’ Zettel aus Florenz. Ich stoppte den Golf und sah auf der zerknitterten Landkarte nach, die es als Flecken in der Maremma auswies, die etwas südlich von Porto Santo Stefano lag. Wir bogen ab von der vierspurigen Via Aurelia, die nach Rom führte, und fuhren durch eine flache, weite Sumpflandschaft mit Kanälen, auf der weiße Rinder mit riesigen Hörnern grasten. Die Hitze wehte durch die offenen Fenster herein und wirbelte die Staubschicht auf dem Armaturenbrett auf. Über die Weiden ritten Männer mit breitkrempigen Hüten auf schlanken Pferden. Das sah aus wie in den Western von Sergio Leone. Schon mal nicht schlecht.
Chiarone bestand im Wesentlichen aus einem Bahnhof und einem Campingplatz. Hier musste Lukas irgendwo sein. Wir stiegen aus und checkten den Platz. Es gab Stehklos und Duschen mit den ersten Solaranlagen, die ich sah. Aber wer wollte schon duschen?
War da vorne nicht das Meer?
Wir ließen das Auto stehen und betraten eine Art Hippie-Zeltdorf, in dem junge Leute mit langen Haaren vor Esbitkochern hockten und Tütensuppen aus dem Campingshop warm machten, Gitarre spielten oder auf bunten Matten in der Sonne fläzten. Dazwischen saß Lukas. Wir fanden ihn, wie man damals jemanden fand, intuitiv, weil man ihn eben finden wollte.
»Hey, super, dass ihr da seid, wir wollten gerade einen Ausflug machen«, sagte er, als er uns antraben sah. Spontanität war schon damals nicht meine Stärke, und auf einen Ausflug hatte ich überhaupt keine Lust. Wir waren ja gerade erst angekommen. Aber irgendetwas in mir sagte: Fahr mit!
Lukas und Oli stiegen in seinen Wagen, auf den Rücksitzen saßen zwei Mädchen in Batikkleidern, ich kletterte in den Kofferraum des Kombis, durch dessen Hecktür ich nach draußen sah.
Lukas hatte Michael Jackson eingelegt. Ich fand Michael Jackson scheiße, aber es war ja sein Auto. Und den Mädchen gefiel es.
Die ockerfarbene Sommerlandschaft flog vorbei und entfaltete ihre Schönheit, die ich bis dahin nicht recht wahrgenommen hatte, und die nun zusammen mit der Sonne wie durch einen neu geöffneten Spalt in mich hineinfiel: Weinreben kletterten die Hänge empor, auf den Wiesen standen alte Eichen mit mächtigen, schattenspendenden Kronen, Obstgärten dösten hinter Steinmäuerchen. Ich blickte aus dem Heckfenster, hinter mir spulte sich das schwarze, wellige Band der Straße ab, die nach Asphalt und Hitze roch. Lukas zeigte mal auf dieses oder jenes mittelalterliche Dorf, das auf einer Hügelkuppe thronte; in einem, das Magliano hieß, hielt er an, grüßte die alten Frauen, die auf einer Treppe saßen, und fragte: »Scusi signora, dov’è Saturnia?« Er wirkte sehr souverän dabei.
Eine Frau deutete in eine Richtung und lachte. Lukas sagte »grazie« und lachte zurück.
»Du kannst Italienisch? Das hatten wir doch gar nicht im Unterricht?!«
Und selbst wenn – Fremdsprachen wurden an einem bayerischen Gymnasium in jener Zeit nicht in einer Weise gelehrt, dass man sie auch hätte sprechen können. Ausgerechnet Lukas, der sich mit Ach und Krach durchs Abitur gemogelt hatte, konnte sich in so einer exotischen Sprache verständigen?
»Ach, ein paar Sätze genügen für den Anfang«, sagte er, »und der Rest kommt, wenn man mit den Leuten spricht. Macht Riesenspaß.«
Sprachen und Spaß? Diese Botschaft war neu, wie so oft bei Lukas. Und es steckte noch mehr darin: Lukas redete fröhlich mit Leuten, die wir anderen in unserer inneren Wagenburg stets als ausbeuterische Eingeborene wahrgenommen hatten, die uns nur das Geld aus der Tasche ziehen wollten mit ihren Wucherpreisen für Pizza und Zeltplatz.
»Ihr seid ja krass drauf«, sagte Lukas. Darüber musste ich nachdenken.
Irgendetwas ist auf dieser Fahrt passiert, etwas, das man nicht so leicht benennen kann. War es die Abnabelung von der Clique, mit der ich die halbe Schulzeit verbracht hatte und die nun auf einer Insel saß? War es, weil ich die ganze Fahrt nach Saturnia nicht ein einziges Mal an K. dachte, die wahrscheinlich gerade in der untergehenden Sonne mit A. vögelte? War es, weil Lukas die Welt und ihre Menschen in sein Herz hineinließ, anstatt sie abzuwehren? Wohl von allem ein bisschen.
Oli hat mir viel später gesagt, die Thermen von Saturnia seien ihm damals vorgekommen wie ein verzauberter Ort, der außerhalb dieser Welt liege: Ein sprudelnder, schwefelhaltiger Fluss stürzt dort über Kaskaden in die Tiefe, ein riesiger Strahl herrlich nach faulen Eiern riechenden, warmen Wassers, das den ockerfarbenen Tuffstein zu natürlichen Steinwannen ausgewaschen hat, so als hätten bacchantisch gesinnte Götter Badetröge anlegen lassen, den Menschen zum Wohlgefallen. Dunstschwaden teilten das gleißende toskanische Sommersonnenlicht in tausend kleine Strahlen, wie auf einem Kirchengemälde, in dessen Mitte friedlich dösende Menschen im Wasser saßen, knutschende Pärchen, alte Frauen, die auf Heilung von Arthrose hofften, Hippies mit langen Haaren, vor ihren Mündern qualmten Joints. Oben am Wasserfall gab es eine Grotte, verborgen von Schilf, in die konnte man hineinklettern; dort hockten drei alte Männer im Schwefeldunst, die lachten und sagten: »Come Dante, il inferno, sai?«4 Für mich fühlte sich dieser Ort eher an wie das Paradies.
Lukas war nicht zu sehen, eines der Mädchen auch nicht. Oli und ich legten uns in die Steinwannen, ließen die kraftvolle Kaskade über unsere Rücken rauschen und öffneten die Flasche schwarzen Weins, den wir aus Porto Santo Stefano mitgebracht hatten. Und während von oben das köperwarme Schwefelwasser über uns hinwegfloss, die Sonne strahlte und der Wein nach innen plätscherte, dachte ich, der ich bis dahin nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte, was ich nach dem Abitur anfangen sollte: »In Italien studieren, das wär’ doch was?!«
Rettet die Freundschaft!
Plädoyer für eine unterschätzte Sozialbeziehung
»Cause if my baby don’t love me no more I know her sister will«
Jimi Hendrix – Red House
Wer über die Freundschaft nachdenkt, stößt schnell auf große Worte. Seit Jahrtausenden ist sie scheinbar über jeden Zweifel erhaben. Griechen und Römer priesen sie als großes Gefühl, etwas für Recken, Helden, Dichter und Staatsmänner. Für Aristoteles war sie eine Tugend, ein moralisches Können1 – und ein Weg zur Selbsterkenntnis. Cicero verortete in der amicitia die »Grundlage jeder Form der Gemeinschaft«.2 Der römische Denker schrieb: »Ich selbst kann euch nur zureden, der Freundschaft vor allen anderen menschlichen Dingen den Vorzug zu geben.« Nichts sei der menschlichen Natur so angemessen.3 An dem hohen gesellschaftlichen Stellenwert der Freundschaft hat sich seitdem scheinbar nichts geändert. Laut einer Allensbach-Erhebung vom August 2020 halten 85,4 Prozent der Deutschen gute Freunde und die Beziehung zu anderen Menschen für besonders wichtig, es ist für sie der höchste Wert von allen, noch vor der Familie. Psychologen sehen die Freundschaft als Bollwerk und Gegenmittel gegen Tiefs und Depressionen, »in diesen Beziehungen werden wir lebendig und finden einen Lebenssinn«4, behauptet der Psychiater Bodo Unkelbach, sie seien der »Weg zum guten Leben«. Und waren unsere Freunde nicht stets unsere besten Therapeuten? Ein Freund könne uns »leicht Dinge über uns erzählen, von denen wir keine Ahnung haben«5, schrieb C.G. Jung. Im besten Fall können sie uns einen Schubs in ein neues Leben verpassen, wie es Lukas bei mir getan hatte.
Soziologen sprechen der Freundschaft sogar die Fähigkeit zu, Triebkraft für sozialen Wandel zu sein. Die Feministin Marilyn Friedman schrieb: »Freundschaft stellt in unserer Kultur die unumstrittenste, beständigste und befriedigendste aller engen persönlichen Bindungen«6 dar. Gesellschaftlich wird ihr besondere Bedeutung für Menschen zugesprochen, die nicht in die normierten Strukturen passen – entweder weil sie nicht wollen oder weil sie aufgrund biografischer, vielleicht traumatischer Kindheits- und Familienerfahrung nicht können. Seit den 1980er-Jahren wird diskutiert, ob die Wahlfamilie ein Instrument emotionaler und materieller Absicherung in Konkurrenz zur biologischen Familie sein kann, dieser Ansatz hat es Ende 2021 sogar ins Regierungsprogramm geschafft. So wichtig ist die Freundschaft scheinbar den Menschen, dass Facebook aus ihr eines der erfolgreichsten Geschäftsmodelle der Postmoderne machen konnte.
Und auch in der Kultur hat sie ihren festen Platz. Goethe und Schiller, Karoline von Günderode und Bettina von Arnim, Rosa Luxemburg und Clara Zetkin, Butch Cassidy und The Sundance Kid, Thelma und Louise, Dick & Doof: Es wimmelt nur so von Freundschaften in Literatur und Film, sie wird uns darin vorgeführt als eine erfüllende, tugendhafte, heroische, erfolgversprechende, spaßige, schicksalhafte, gemeinschaftsstiftende, glücksbringende, ja staatstragende Angelegenheit. Millionen haben im Film »Ziemlich beste Freunde« mitgefiebert beim Gelingen der auf den ersten Blick so unwahrscheinlichen Freundschaft zwischen dem gelähmten französischen Geschäftsmann und seinem senegalesischen Pfleger. Der Hollywood-Klassiker »Casablanca« hat sie als Trostmittel besungen, wenn Humphrey Bogart als Cafébesitzer Rick im Zweiten Weltkrieg seine große Liebe mit einem anderen davonfliegen sieht, aber dafür den »Beginn einer wunderbaren Freundschaft« mit dem französischen Kommandanten Louis Renault feiern kann, der ihn vor den Nazis rettet.
Alles bestens also? Mitnichten. Schaut man hinter die Kulissen, muss man feststellen, dass die Freundschaft sich in einer Krise befindet, ja vielleicht der tiefsten, die sie je durchlaufen hat. Und das liegt nicht nur an Corona und den Maßnahmen gegen die Pandemie, die uns auf die kalte Welt der Zoompartys verwiesen und die Pflege der Freundschaft durch Nähe und Begegnung unmöglich gemacht haben. Schon vorher gaben die meisten Zeitgenossen bei genauerem Nachfragen zu, dass es in ihrem Alltag nicht weit her sei mit der Freundschaft, ja dass sie eigentlich kaum Freunde hätten – keine jedenfalls, mit denen sie über alles reden könnten, schon gar keine Freundschaften nach antikem Ideal, die den ganzen Menschen einschlossen, und die sich nicht auf Fußballgucken, Kaffeetrinken oder Computerspielen beschränkten. Je jünger die Menschen, desto krisenhafter anscheinend die Lage: Bei einer You-Gov-Umfrage in den USA gaben im Jahr 2019 immerhin 22 Prozent der Befragten zwischen 23 und 38 Jahren an, sie hätten »überhaupt keine Freunde«. 30 Prozent sagten, sie fühlten sich einsam, trotz ununterbrochener Kommunikation auf Handy, Tablet, Bildschirm und hunderten Facebook-»Freundschaften«. Sind uns vor lauter digitalen Kontakten die Freunde abhandengekommen?
Die moderne Welt mit ihren Zwängen, ihrer Zeittaktung, ihren Lebenskorsetts, ihrem Narzissmus und ihrer Leistungsorientierung macht die Freundschaftspflege in der Tat schwer. Der Alltag habe sie profanisiert, schreibt Erika Alleweldt,7 also entheiligt. Freundschaften seien »in der Regel nicht mehr eingebettet in größere Lebenszusammenhänge«8, schließt die Soziologin aus ihrer wissenschaftlichen Studie, sie beschränkten sich auf kleinste Schnittmengen. Verkäuferinnen berichten da, dass sie außerhalb von Arbeit und Familie praktisch für nichts Zeit hätten – schon gar nicht für Freundschaften, obwohl gerade sie das Gespräch mit Freundinnen wirklich vermissten, weil sie da offener reden könnten als in Beziehung und Familie. Journalistinnen und Sozialarbeiterinnen sind laut Alleweldts Studie über Frauenfreundschaften besser dran, aber bei solchen Berufsgruppen gehört die Interaktion zum Beruf, die Grenze zwischen Netzwerk und Freundschaft ist fließend; viele der befragten Frauen klagen sogar über die Masse der Kontakte, die sie abarbeiten müssten. Schon sprechen Soziologen vom »Kontaktinfarkt«9. Ist Freundschaft also nur noch ein weiterer, lästiger Termin im Kalender?
Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann stellte 1994 nüchtern fest: Der moderne, individualisierte Mensch sei angesichts seiner Alltagsanforderungen überhaupt nicht mehr zur Freundschaft fähig. Im Wettstreit der Beziehungen habe die Liebe das Rennen gemacht und den »Code für Intimität bestimmt«10. Der Soziologe Ulrich Beck schrieb in etwa zur gleichen Zeit, die Liebe sei zu einer Art irdischer Ersatzreligion11 geworden, sie solle für alles entschädigen, womit uns der Alltag belastet. Wo passt da noch die Freundschaft hinein?
In der Tat wirft sie ja eine Reihe kniffliger Fragen auf, deren Beantwortung Mühe und Zeit kostet, sie macht also Arbeit. Die Freundschaft sei, so behaupten die Fachleute, das Resultat sozialer Interessensbildung.12 Was aber, wenn sich die Interessen wandeln oder auseinanderklaffen? Was, wenn ich in eine andere Stadt ziehe oder eine Partnerin heirate, der meine Freundschaften missfallen? Kann, ja darf ich mich auf meine Freunde verlassen, wenn es mir schlecht geht? Darf mein guter Freund in elementaren Dingen anderer Meinung sein? Kann ich mit der Ex befreundet bleiben? Kann Freundschaft einen Familienersatz bilden? Lohnt es sich überhaupt, kriselnde Freundschaften neu auszuhandeln?
Mancher mag da Zweifel anmelden, denn eins ist klar: Die großen Entscheidungen des Lebens werden im Job und in der Familie gefällt. Man schottet sich ab in mühsam ausgehandelten Beziehungs- und Berufsarrangements, schließt sich ein in jenen »Kerker des Alltags«13, vor dem schon Epikur graute, und in dem strategische Kommunikation und vertaktete Zeitplanung den Ton angeben. Alle nicht dringend überlebensnotwendigen Kontakte hingegen hat die Wachstums- und Leistungsgesellschaft in einem Folder angelegt, in dem sich die schönen Überflüssigkeiten stapeln. Der moderne »homo oeconomicus« sei ein »konsequenter Egoist«, ein »reiner Privatmensch, ohne soziale Einbindung, ohne Erziehung, ohne Vertrauen«, schrieb Fritz Reheis14. Haben wir Privatmenschen einfach zu viel zu verbergen, um noch echte, die Seele öffnende Freundschaften unterhalten zu können, wie der Soziologe Georg Simmel schon im 19. Jahrhundert mutmaßte?15
Die zunehmende Ausdifferenzierung der Gesellschaft in Meinungsgruppen und Filterbubbles hat den von Simmel beschriebenen Trend extrem verstärkt. Freundschaft, so stellt der Psychiater Unkelbach fest, erhebe »den Freund über das Ziel«16. Er sei »wichtiger als die Sache«. Doch die Entwicklung verläuft in die entgegengesetzte Richtung: Freundschaften zerbrechen schon an den kleinsten Meinungsverschiedenheiten über korrekte Lebensführung und politische Sachfragen, was vor allem die Coronakrise mit Macht gezeigt hat. Wo aber die Sache über dem Menschen steht, da wird Freundschaft unmöglich17.
Das alles hat zu einer paradoxen Entwicklung geführt: Einerseits ertrinken wir in »Kontakten«, andererseits grassiert die Einsamkeit. »Forscher und Ärzte sprechen längst von einer Epidemie«, schreiben Diana Kinnert und Marc Bielefeld in ihrem Buch über die Einsamkeit, das nicht umsonst im Jahr 2021 auf den Bestsellerlisten gestanden hat. Die Ansprüche an perfektes Funktionieren und Flexibilität in der kapitalistischen Maschinerie ließen jedes außerfamiliäre Bindungsversprechen wie ein »Stottern im Getriebe«18 erscheinen, das den reibungslosen Ablauf des Erwerbslebens störe. Wir laufen durch die Städte, als trügen wir einen digitalen Käfig mit uns herum, stürzen uns in Konsum, der für Bindungslosigkeit entschädigen soll. Wir kommunizieren mit digitalen Androiden und Avataren anstatt mit lebenden Wesen.
Die Vereinzelung des modernen Massenmenschen wirkt manchmal wie ein Zerrbild des Individualismus. Man kann das morgens und abends in jedem x-beliebigen Fitnessstudio in jeder x-beliebigen deutschen Stadt beobachten: Menschen trainieren wie besessen, um ihre körperliche Leistung den Anforderungen von Beruf und Alltag anzupassen. Doch es redet kaum jemand miteinander. Anstatt auf andere zuzugehen, sammeln wir Highscores in der Health-App, buchen die Zoomsitzung über Mindfulness, ordern das nächste Selbsthilfebuch bei Amazon, laden die Achtsamkeits-App herunter oder jaulen in einer Social-Media-Bubble mit. Anstatt Passanten nach dem Weg zu fragen, tippen wir auf dem Smartphone herum. Wir verbringen Stunden in Warteschleifen am Telefon, haben für unsere Lieblingsmenschen aber gerade noch eine WhatsApp-Nachricht übrig.
Die Folgen sind drastisch: Kinnert und Bielefeld zitieren Umfragen, wonach sich in Deutschland 14 Millionen Menschen isoliert, verlassen und ohne nennenswerte Kontakte zu ihrer Umwelt fühlten19. Fast 18 Millionen Deutsche leben in Singlehaushalten. Für sie wären Freundschaften besonders wichtig. Aber wer bringt nach einem langen Tag voller Meetings und Termine noch die Energie dafür auf?
Vielleicht liegt die Krisenhaftigkeit auch darin begründet, dass wir unsere Erwartungen an die Freundschaft den ökonomischen Trends unserer Zeit angepasst haben. Sie werde als eine Art »Geschäft auf Gegenseitigkeit« aufgefasst, diagnostiziert der Philologe Björn Vedder.20 Es gehe vor allem darum, »vom Freund zuverlässig unterstützt und nicht ausgenutzt zu werden«, das heißt, alles, was wir für ihn tun, sollte »auch vergolten« werden.
Beim »Investieren« in Sozialbeziehungen sind wir geizig, in unseren Erwartungen jedoch anspruchsvoll. Freundinnen und Freunde sollen ehrlich sein und freigiebig, sie sollen beim Umzug helfen und sich zum tausendsten Mal unseren Liebeskummer anhören. Sie sollen in der Flüchtlingspolitik und beim Klimaschutz unserer Meinung sein, sie sollen trösten und aufmuntern und sofort zum Telefon greifen, wenn wir anrufen; sie sollen mit uns ausgehen, in den Urlaub fahren – und vielleicht sogar, wenn wir keine Familie haben, im Alter und in der Not für uns da sein. Doch wenn wir selbst gefragt sind, heißt es meist: Sorry, zu viel Stress gerade, lieber ein andermal. Freundschaftsforscherinnen und Soziologen konstatieren, »selbstverstärkende Teufelskreise wechselseitiger Enttäuschung« seien da programmiert21.
Sind unsere Erwartungen also zu hoch? Der Essayist Daniel Schreiber behauptet in seinem Buch über das Alleinsein, Freundschaft sei kein »Ersatzglück« und kein »Trostpreis«, sie rette nicht vor der Einsamkeit. Und in einem hat er sicher recht: Freundschaft kann Liebe und Familie nicht ersetzen. Trotzdem erscheint mir Schreibers Einschätzung als zu pessimistisch. Sind wir nicht auch in unseren Liebesbeziehungen manchmal einsam? Sind Freundinnen und Freunde nicht in vielen Aspekten die besseren Ratgeber, weil sie mehr Abstand zu unserem Alltagsleben haben als Partnerinnen und Partner? Schreiber selbst schwärmt ja an anderer Stelle von jenen großen Momenten des »gegenseitigen Wiedererkennens in emotionalen Gesprächen, im Austausch von Gedanken und Vorstellungen von der Welt«, eines Wiedererkennens in der Freundin, im Freund, das rauschhafte Züge annehmen könne22. Gewiss: Freundinnen und Freunde können uns die großen Entscheidungen nicht abnehmen. Aber sie können dazu beitragen, unsere Resilienz zu kräftigen, damit wir diese Entscheidungen mit größerer innerer Stärke treffen. Freundeskreise bilden ein Umfeld, das unserer Kerneigenschaft als soziale Wesen entspricht.
Dass Freundschaftspflege anstrengend sein kann, wird kaum jemand in Abrede stellen. Schon Thomas Bernhard hat das in seinem anrührenden Buch über seinen Freund Paul Wittgenstein beschrieben: Das sei eine Freundschaft gewesen, »die wir nicht einfach gefunden und dann gehabt haben, sondern die wir uns die ganze Zeit auf das Mühevollste haben erarbeiten müssen«.23 Aber sich kümmern, nachfragen, zuhören, für andere da sein – sind es nicht gerade diese Dinge, die unsere Leben am Ende mit Sinn erfüllen?
Denkerinnen und Denker haben durch die Jahrhunderte nicht umsonst die vitale Relevanz der Freundschaft beschrieben. Clive Staples Lewis war so einer: Der 1898 in Belfast geborene Literaturwissenschaftler, Kinderbuchautor und Radiosprecher darf als ein sicherlich leicht verschrobener britischer Gentleman gelten. Er gab Lebenstipps, schrieb Bücher, in denen er philosophischen Gehalt in Alltagssprache kleidete. Während des Zweiten Weltkriegs waren C.S. Lewis’ Ansprachen und christlich geprägten Debattenbeiträge im Rundfunk vielen Menschen Trost und Stütze. Er lebte also in einer Epoche, die von noch erheblich größeren Herausforderungen gekennzeichnet war als unsere, doch er hatte andere Mittel gegen den Stress: Lewis pflegte Freundschaften intensiv, in einem fast klassischen Sinne, er suchte und fand in schwerer Zeit seelischen Halt in der Leichtigkeit des gelehrten Gesprächs, bewegte sich in literarischen Kreisen, zu seinen Freunden zählte J.R.R. Tolkien, Autor von Herr der Ringe.
In seinem Buch The Four Loves verglich C.S. Lewis Freundschaft mit Eros. Freundschaft, so behauptete er darin, biete nicht nur Zerstreuung und Geselligkeit – nein, sie sei es, die den Menschen erst heraushebe aus dem Überlebensnotwendigen, dem Drang nach Fortpflanzung und dem Zwang zur Existenzsicherung. Für den britischen Schriftsteller war die Freundschaft der höchste Ausdruck menschlicher Individualität24, in der Spiegelung im Freunde werde das Individuum sich seiner Einzigartigkeit bewusst. Die Freundschaft habe unter allen Liebesformen »am wenigsten mit unseren Instinkten, unserer organischen und biologischen Struktur, unserem Herdentrieb zu tun«25, stellte er fest. Ihr Wesen sei die Freiwilligkeit26 – anders als die erotische Liebe, die ja vom Trieb gesteuert werde. »We are not the masters of our falling in or out of love«27, wusste schon Shakespeare.
Für C.S. Lewis war das Schließen von Freundschaft deshalb eine Fähigkeit, die den Menschen erst zum Menschen macht, ihn letztendlich also vom Tier unterscheidet. Natürlich, so räumte er ein, sei die Freundschaft eigentlich völlig unnötig: So »unnötig wie die Philosophie, wie die Kunst, wie das Universum selbst«28. Sie besitze keinen Wert für den »Lebenskampf«, aber genau deswegen gehöre sie zu jenen Dingen, die das Leben lebenswert machten.29 Allerdings, so räumte er ein, sei auf die Freundschaft nicht immer Verlass, sie sei »durchdrungen von köstlicher Willkür«30.
Mir kommt die Freundschaft deshalb manchmal so vor wie eine kleine, wilde Schwester der Liebe. Wer um sie buhlt, wird sie verlieren. Freundschaft entsteht – oder eben nicht. Man kann sie weder herbeireden noch erkaufen. Freundschaft entzieht sich der Normierung, ihr unverbindlicher Charakter setzt ihr Grenzen, verleiht ihr genau deshalb aber auch das Potenzial, nicht nur ein Quell für mehr Leichtigkeit im Leben, sondern auch eine lustvoll-anarchische, freche, beinah subversive Widerstandsform gegen Sachzwänge und blinden Gehorsam zu sein. Diktatoren und Autokraten war sie daher stets suspekt, denn Freundeskreise können zu Keimzellen religiöser und politischer Reformen heranreifen, wie die frühen Christen, die demokratischen Revolutionäre des Vormärz im Deutschland des 19. Jahrhunderts, die französischen Kommunarden, die Weiße Rose, die Sandinisten in Nicaragua oder die Bürgergruppen in der DDR 1989.
Schon der antiken Philosophie galt die Freundschaft als Kulturtechnik, als Schule der Entscheidungsfreiheit und als Übung in Sozialkompetenz. Von Aristoteles bis Derrida haben Denkerinnen und Denker hervorgehoben, wie sie Sensibilität und Empathie fördert, wie sie das Einhalten der Balance von Geben und Nehmen schult, die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis trainiert. Sich um den Freund zu sorgen, verlangt zugleich, sich um sich selbst zu sorgen, wusste Platon.31 Gesellschaftlich relevante Freundschaften haben durch die Jahrhunderte gezeigt, wie Freundinnen und Freunde aneinander wachsen und ihr Potenzial entfalten, ganz im Sinne von Nietzsches legendärem Aufruf an den von Religion, Stand und Herkunft entkleideten Menschen am Ausgang des 19. Jahrhunderts: »Werde, der du bist!«
Eine segensreiche Beziehung in diesem Sinne führten Hannah Arendt und Mary McCarthy, die sich 1944 in einer Bar in Manhattan kennenlernten, einen literarisch bedeutsamen Briefwechsel führten und bis zum Tode Hannah Arendts 1975 eng befreundet blieben. Intensiv diskutierten die beiden Schriftstellerinnen die kulturelle und politische Entwicklung ihrer bewegten Epoche. »Die Zeiten sind lausig und wir sollten näher beieinander sein«, schrieb Arendt 1968 an McCarthy.32 Die Philosophin fügte hinzu, in ihr erwecke Freundschaft das Gefühl, sich »gegen eine Welt von Feinden berauscht zu fühlen«33. Gemeinsam hätten sich die beiden auf diese kreative Weise die Welt angeeignet, befindet die Soziologin Alleweldt; ihr Ziel sei es gewesen, »sich einander in der jeweiligen Entwicklung zu steigern und durch die Freundschaft etwas Neues in sich und dem anderen entstehen zu lassen«34.
Sollte man also den großen Idealen nacheifern, wenn es um die Pflege unserer Freundschaften geht? Oder setzen wir damit die Messlatte zu hoch an? Vielleicht ist es ja besser, bei den eigenen Erlebnissen anzufangen, jenen »unzähligen kleinen Erzählungen«35, von denen Daniel Schreiber spricht, die zusammengenommen unser Leben ausmachen. Welche Rolle Freundinnen und Freunde darin gespielt haben, lässt sich oft erst im Rückblick ermessen, wenn wir uns in einem ruhigen Moment der Impulse gewahr werden, die sie uns gegeben haben. Vielleicht sind diese ja vergleichbar mit dem Schmetterlingseffekt, von dem der Meteorologe Edward N. Lorenz 1972 in einem Vortrag vor der American Association for the Advancement of Science erstmalig berichtete.36 »Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen?«, fragte damals der Wissenschaftler. Er illustrierte damit ein Phänomen der Lehre von der sogenannten nichtlinearen Dynamik, wonach beliebig kleine Änderungen der Anfangsbedingungen langfristig gewaltige Auswirkungen auf die Entwicklung ganzer Systeme haben können.
Freundinnen und Freunde sind Menschen, die solche Dynamik auslösen und auf sanfte Weise unsere Leben verändern können: Leute wie Lukas, die einem den Liebeskummer vertreiben; Menschen, die einen auf Ideen bringen, deren Werte wir teilen, in deren Gegenwart das Bier besser schmeckt, die Musik besser klingt, die Sonne heller scheint, an deren Tür man um Mitternacht klingeln kann, wenn unsere Welt zusammengebrochen ist. Der bewusste Umgang mit ihnen ist der Weg zu mehr Lebensfreude. Mal begeistern sie uns, mal spenden sie Inspiration, mal rauben sie uns mit ihren Ratschlägen den letzten Nerv. Doch wir lieben sie, weil sie uns mit emotionaler Resonanz versorgen. Von solchen Menschen handelt dieses Buch.
Aneignung der Welt
Gemeinsam auf der Suche nach Identität
»No I won’t be afraid Oh, I won’t be afraid Just as long as you stand, stand by me«
Ben E. King – Stand by Me
Vielleicht verhält es sich mit der ersten Freundschaft ähnlich wie mit der ersten großen Liebe. Man misst alles Spätere an ihr, oder, wie Siegfried Kracauer über den ersten Freund im Leben schrieb: »Mag seine Nähe beglücken, die Erinnerung erst gestaltet sein Bild.«1 Natürlich ist diese Erinnerung von Verklärung durchsonnt, und vielleicht erscheint mir deshalb im Rückblick alles, was vor Erkan kam, wie müdes Vorgeplänkel: der Nachbarssohn, der lieber mit Fischertechnik spielte als mit mir; die Sandkastenfreundin, die mich in die Hand biss, wenn ich ihr Schaufel und Förmchen nicht geben wollte; oder Seppi mit der Carrera-Rennbahn, der am liebsten zu dritt spielte, weil er sich dann mit dem anderen gegen mich verbünden konnte – sie alle wuseln irgendwo umher im Schattenreich der kindlichen Amnesie. Erinnere ich mich an sie oder ersteht ihr Bild aus Fotos, Erzählungen und dem, was meine Einbildungskraft aus ihnen gemacht hat?
An das erste Raufen mit Erkan hingegen erinnere ich mich sehr genau. Es ist eine dieser Flashback-Erinnerungen, die aus dem Reich des Unbewussten einherschweben, wenn man auf der Gartenliege fläzt und es schafft, an nichts Bestimmtes zu denken. Ich sehe uns dann auf einer Wiese liegen, zwischen Teppichklopfstangen; Ball spielen war verboten, von Raufen stand nichts auf dem Schild. Es ging um nichts Ernstes, Raufen war nur ein weiteres Spiel. Wenn man sechs ist, will man Kräfte messen, wie junge Hunde, vielleicht rauft man auch, weil man einfach nicht voneinander lassen will, weil der Nachmittag so schön ist und nicht enden soll.
Erkan war genauso groß wie ich, also eher klein, aber körperlich etwas kompakter. Dafür beherrschte ich einen Schwitzkastentrick, mit dem sich auch ein körperlich Stärkerer eine Zeit lang unschädlich machen ließ. Befreiten sich meine Gegner, nahmen sie oft bittere Rache. Erkan nicht. Er hatte sich gerade aus meiner Umklammerung herausgekämpft, nun lag er oben, hielt mich an den Armen fest. Doch es ging nichts Gemeines von ihm aus, er spuckte einem in solcher Lage nicht ins Gesicht, wie Seppi es getan hätte.
Die Teppichklopfstangen standen zwischen zwei Plattenbauten, in einem davon wohnten Erkan, seine Eltern und seine Schwester. An den Häusern führte die Bundesstraße vorbei, das Brausen der Autos, das geräuschvolle Herunterschalten der LKW, schufen ein stetiges, nervenzehrendes Hintergrundgeräusch. Ganz in der Nähe aber gab es einen aufgelassenen Torfstich, ein sumpfiges, vergessen wirkendes Gelände voller Birken und Erlen. Kanäle mit Brackwasser mäanderten hindurch, Frösche steckten ihre Köpfe aus der Entengrütze. Der »Sumpf« wie wir ihn nannten, sollte erster Schauplatz unserer gemeinsamen Weltaneignung werden. Erkan besaß eine Hacke, mit der er die Torfwände bearbeitete und Stücke herausschlug, aus denen wir Übergänge und Inseln bauten und uns unser kleines matschiges Reich anlegten. Abends staksten wir schlammverkrustet zurück, das Wasser gluckste in den Gummistiefeln. Noch eine Runde Raufen zum Abschied?
Dass Erkan Erkan hieß, fand ich nicht weiter auffällig. Fünf Buchstaben, zwei Silben, zwei Vokale, drei Konsonanten, was sollte daran anders sein als bei Thomas, Stefan, Hansi, Peter? Es war mein Vater, der eines Abends vorsichtig anfragte, ob sich da, zumal beim Raufen, nicht etwas bemerkbar mache, ein Unterschied, eine Distanz vielleicht, eine andere Mentalität? Ich verstand das Wort nicht, spürte aber, dass sich dahinter etwas Abgrenzendes, Abschätziges, ja gänzlich Unzulässiges verbarg. »Spinnst du?«, schrie ich, was mit sechs ganz schön frech war. Ich rannte auf mein Zimmer, wo ich mich verbarrikadierte und auf den nächsten Tag freute, an dem es nach der Schule wieder heißen würde: Rein in die Gummistiefel, rauf aufs Fahrrad und abtauchen in den »Sumpf«!
Vater hat nie mehr etwas in der Richtung gesagt. Ich glaube, er schämte sich ein bisschen. Und er hatte sowieso keinen Einfluss darauf, wer Teil meines Alltags war, denn er verschwand ja allmorgendlich mit dem Opel Richtung Siemens.
Gemeinsam anders
C.S. Lewis hat eine etwas schwärmerische Vision entworfen, wie Freundschaft urgeschichtlich entstanden sein könnte: »Wir können uns vorstellen, daß es unter jenen frühen Jägern und Kriegern einzelne gab (…), die etwas sahen, was andere nicht sahen; daß Wild nicht nur eßbar, sondern auch schön war; daß die Jagd nicht nur notwendig war, sondern Spaß machte; die träumten, daß die Götter nicht nur mächtig, sondern auch heilig seien. Aber solange jeder solch hellsichtige Mensch stirbt, ohne eine verwandte Seele gefunden zu haben, bleibt all das ohne Folgen. (…) Wenn aber zwei solche Menschen einander entdecken, wenn sie ihre Vision miteinander teilen (…) – erst dann wird Freundschaft geboren.«2
Erkan und ich entdeckten einander auf der Grundschule, in der ersten Klasse. Wie, weiß ich nicht mehr genau, es war wohl eines dieser stillen, unverhandelten Einverständnisse, wie sie für die Kinderzeit typisch sind, jene »Seligkeit des Begriffenwerdens« im anderen, von der Siegfried Kracauer gesprochen hat3. Die Kindergartenzeit hatte ich in einer katholischen Institution verbracht, die mit strengem Regiment von Klosterschwestern geführt wurde. Mutter hatte mich zu den Nonnen gesteckt – gemeinerweise, wie ich fand – wohl, um wenigstens vormittags Ruhe zu haben? Ein Kind von Lutheranern war ein Novum in einer stockkonservativen bayerischen Kleinstadt der 1960er-Jahre, deshalb musste erst das Erzbischöfliche Ordinariat der Aufnahme zustimmen. Man erteilte eine Sondergenehmigung, denn man ging ja mit der Zeit. Doch im Kindergarten selbst war davon nichts zu spüren. Wer es im Angesicht eines Marienbilds an Respekt fehlen ließ oder sich schlampig bekreuzigte, konnte sich auf Kopfnüsse und ausgerissene Haarbüschel gefasst machen. Ich genoss eine Art Sonderstatus und war vom Bekreuzigen befreit. Dafür blieb ich Außenseiter, wozu auch meine fehlenden Bayerischkenntnisse beitrugen. Dialekt war in diesem Umfeld noch wichtiger als Religion.
Schule empfand ich als Befreiung, nicht zuletzt, weil da Erkan war. Der war wie ich, eben anders, so glaubte ich. Als Muslim wurde er von der dominanten Mehrheitskonfession in jener Zeit unter »sympathisch-exotisch« verbucht; mich, den »Saupreißen«4, hat die Lässigkeit beeindruckt, mit der er nach außen hin mit seiner Sonderstellung umging. Ich beschloss, mir daran ein Beispiel zu nehmen. Meine dialektalen Anpassungsübungen konnte ich auch einstellen, ich brauchte sie nicht mehr. Erkan sprach Hochdeutsch. Bei den Lehrkräften kam das überdies besser an als Bayerisch. Vielleicht lag ja sogar ein Vorteil darin, anders zu sein?
Die Magie unserer Freundschaft liegt für mich rückblickend in der Kontinuität, die sie entfaltete. Praktisch alle identitätsstiftenden Entwicklungsschritte des kommenden Jahrzehnts haben wir gemeinsam unternommen. Zeit hatten wir ja. Smartphone und Computerspiele gab es nicht und auch keine entwicklungsfördernden Akrobatikkurse, keinen Nachmittagsunterricht, keine ganzheitlichen außerschulischen Lern- und Neigungsgruppen, keine Logopädiekurse, kein Grundschulenglisch. Also eigneten wir uns die Welt auf unsere Weise an.
Als Torfstechen langweilig wurde, nahmen wir die Bahnstrecke in Augenschein, die oberhalb des Sumpfes vorbeiführte. Dort dieselte von Zeit zu Zeit ein dunkelroter Schienenbus vorbei. Wir horchten wie Karl Mays Apachen an den Gleisen: »Wer eher springt, hat verloren!« Man blieb auf den Schienen sitzen, bis das warnende Pfeilsignal zu einem langanhaltenden Heulton anschwoll, kurz vor der Notbremsung rannten wir in unser Moor und versteckten uns keuchend hinter dem Erlengestrüpp. Man sah noch den Lokführer, wie er durchs Fenster schaute und sich an die Stirn tippte. »Ihr spinnt’s ja!« Als ich Jahrzehnte später den Hollywoodfilm »Stand by Me« sah, in dem eine Gruppe Kinder sich in letzter Sekunde auf einer Eisenbahnbrücke durch einen beherzten Sprung vor dem anrollenden Zug rettet, saß ich einen Moment lang nicht mehr auf dem Kinoklappsitz, sondern wieder auf den Gleisen neben dem Moor.