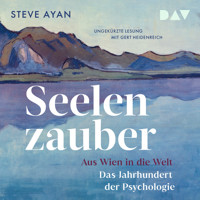22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Aus den Wiener Salons in die Therapiezimmer von heute Was ist ein Mensch? Wo beginnt die Neurose? Ist das sexuelle Verlangen die Quelle aller Wünsche? Lassen sich Traumata, Ängste und Depressionen auflösen? Und was, nebenbei bemerkt, ist der Sinn des Lebens? Dieses farbenfrohe und lebendig geschriebene Buch führt uns zurück in die Geburtsstunde der Psychotherapie im Wien des Fin-de-Siècle. Es erzählt die faszinierende Geschichte von Visionären wie Freud, Jung, Adler und anderen, die das erfanden, was zu einer der Säulen der westlichen Zivilisation wurde – das Versprechen von persönlichem Wohlbefinden. Es ist jener Wandel im Denken, der die Psychologie zu einer der prägendsten Wissenschaften des 20. Jahrhunderts machte – und mit der Psychoanalyse einen intellektuellen wie gesellschaftlichen Trend auslöste. Die Abgründe der »Seele« kannte man auch vor dieser Zeit. Doch die Vorstellung, man könne die Psyche heilen, den Menschen verbessern und seine Potenziale optimieren – diese Idee war neu und revolutionär. - Erstaunliche Charaktere - Überraschende Zufälle - Tiefe Einsichten - mit zahleichen Historischen Abbildungen »Steve Ayan legt die Wurzeln der modernen Psychotherapie frei und arrangiert sie zu einem packenden Stück Wissenschaftsgeschichte.« Barbara Bleisch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 761
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
»Ein eisiger Abendhauch kündigt bereits den Winter an. Nur eine Handvoll Passanten eilt, unter Schirmen versteckt, übers Trottoir. Der Mann, der jetzt am Eingang von Nummer 19 schellt, ist Mediziner – Augenarzt, um genau zu sein – und mit Anfang dreißig der jüngste Teilnehmer in der Runde, die sich zum wöchentlichen Gedankenaustausch trifft. Doktor Freud, der dazu eingeladen hat, geht schon auf die fünfzig zu. Da gehört es sich für den deutlich Jüngeren, sich mit den eigenen Ansichten durchaus zurückzuhalten. Doch etwas Eigenes, Großes arbeitet in ihm – nur was, das weiß er noch nicht. Erhitzt von dem Marsch holt unser Mann ein paarmal tief Luft, dann öffnet sich mit leisem Knarren die Tür. Als er eintritt, erscheint es ihm, als beträte er durch dieses Tor ein aufregendes neues Zeitalter.«
Steve Ayan
Seelenzauber
Aus Wien in die Welt – Das Jahrhundert der Psychologie
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I Das Unbewusste
Ein später Gast
Beruf statt Berufung
Vom Ursprung der Leiden
Psychologie ohne Seele
Die Wunderheilung der Anna O.
Im Netz der Gedanken
Was Dora nicht weiß
Traumhafte Aussichten
Die Letzten werden die Ersten sein
Auf großer Fahrt
Ein Mädchen namens Frank
Verschworene Gemeinschaft
Kapitel II Der Sex
Der Fund
Laboratoriumsexplosionen
Der diskrete Charme der Onanie
Zur Wonne, zur Freiheit
Eine Schule der Analytiker
Der Körperheiler
Alles genital?
»Befreien Sie mich von Reich!«
Kapitel III Die Angst
Der Professor und der liebe Gott
Das Beelzebub-Manöver
Fürchten lernen
Geheimnisse einer Seele
Gefühlskonjunktur
Peter und der Hase
Der Anfang vom Ende
Kapitel IV Das Ich
Schwäche macht stark
Revisionen
Schottland sehen und sterben
Herr der Listen
Die dritte Kraft
Du bist, was du denkst
Gestalt annehmen
Elysium für die Seele
Tod im Paradies
Kapitel V Die Anderen
Macht des Mitgefühls
Fakten sind freundlich
Götter wie du und ich
Verräter, Verräter!
Das unbekannte Wesen
Kapitel VI Der Sinn
Geisterstunde
Demarkationslinien
Sexmagie, Beton und Misteln
Wer ein Warum hat
Krankheit als Waffe
Nachwort Sag, was soll es bedeuten
Danksagung
Literatur
Bildnachweis
Chronologie
Sachregister
Für Erika,
die gute Seele
»Ich habe die friedlichste Gesinnung (…) – ja man muss seinen Feinden verzeihen, aber nicht früher, als bis sie gehenkt sind.«
Sigmund Freud (Heinrich Heine zitierend)
»Jeder Begründer einer Psychotherapierichtung hat in seinen Büchern nur die Probleme zu lösen versucht, die er selbst durchgemacht hat.«
Viktor E. Frankl
Kapitel I
Das Unbewusste
11
Ein später Gast •
11
Beruf statt Berufung •
19
Vom Ursprung der Leiden •
31
Psychologie ohne Seele •
34
Die Wunderheilung der Anna O. •
41
Im Netz der Gedanken •
48
Was Dora nicht weiß •
59
Traumhafte Aussichten •
67
Die Letzten werden die Ersten sein •
78
Auf großer Fahrt •
87
Ein Mädchen namens Frank •
100
Verschworene Gemeinschaft
108
Kapitel II
Der Sex
113
Der Fund •
113
Laboratoriumsexplosionen •
119
Der diskrete Charme der Onanie •
124
Zur Wonne, zur Freiheit •
128
Eine Schule der Analytiker •
137
Der Körperheiler •
143
Alles genital? •
154
»Befreien Sie mich von Reich!«
160
Kapitel III
Die Angst
163
Der Professor und der liebe Gott •
163
Das Beelzebub-Manöver •
167
Fürchten lernen •
174
Geheimnisse einer Seele •
182
Gefühls-konjunktur •
185
Peter und der Hase •
190
Der Anfang vom Ende
197
Kapitel IV
Das Ich
203
Schwäche macht stark •
203
Revisionen •
208
Schottland sehen und sterben •
217
Herr der Listen •
223
Die dritte Kraft •
226
Du bist, was du denkst •
231
Gestalt annehmen •
242
Elysium für die Seele •
249
Tod im Paradies
257
Kapitel V
Die Anderen
265
Macht des Mitgefühls •
265
Fakten sind freundlich •
277
Götter wie du und ich •
284
Verräter, Verräter! •
292
Das unbekannte Wesen
298
Kapitel VI
Der Sinn
313
Geisterstunde •
313
Demarkationslinien •
323
Sexmagie, Beton und Misteln •
330
Wer ein Warum hat •
337
Krankheit als Waffe
348
Nachwort
Sag, was soll es bedeuten
353
Danksagung
360
Literatur
361
Anmerkungen
369
Bildnachweis
386
Register
387
Kapitel I Das Unbewusste
Ein später Gast
Ein Mann von kleiner Statur eilt die Straße entlang. Mit trippelnden Schritten biegt er um eine Hausecke, den Hut tief ins Gesicht gedrückt, die Brille vom Regen benetzt. Es nieselt, und er ist spät dran. Um halb neun beginnt das Treffen, wie jeden Mittwochabend, und der Gastgeber mag es nicht, wenn jemand zu spät kommt. Ein kurzer Blick auf die Taschenuhr – der große Zeiger kratzt schon an der Sechs! Zum Glück ist er fast da.
In Anbetracht des Wetters und der knappen Zeit hat er sich eine Fahrt mit der Elektrischen gegönnt und die Leopoldstadt über den Donaukanal in Richtung Schottentor verlassen. Von dort musste er zu Fuß weiter, an der Votivkirche vorbei, auf der Währinger Straße bis zur übernächsten Ecke. Nun steht er »am Berg«. Vom unteren Ende der Straße glänzt der helle Torbogen von Nummer 19 herauf.
Ein kurzes Stück geht es steil hinab, nur nicht ausrutschen auf dem schlüpfrigen Pflaster! An einem Hauseingang fällt sein Blick auf einen verwaschenen Aushang: »Miederversammlung« …?! A geh – Mieter! Er schüttelt den Kopf. Wie rasch doch der Strom der Gedanken zum Sexuellen hinstrebt. Verbirgt sich hinter den trivialsten Einfällen nicht tatsächlich jene Libido, die der Kollege, zu dem er unterwegs ist, als Triebkraft der Psyche ansieht? Vielleicht verhält es sich genau, wie er sagt, so unerhört es auch klingt. Oder beweist gerade dies, dass wir verdrängen, was uns im Innersten bewegt?
Ein eisiger Abendhauch kündigt bereits den Winter an. Nur eine Handvoll Passanten eilt, unter Schirmen versteckt, übers Trottoir. Der Mann, der jetzt am Eingang von Nummer 19 schellt, ist Mediziner – Augenarzt, um genau zu sein – und mit Anfang dreißig der jüngste Teilnehmer in der Runde, die sich zum wöchentlichen Gedankenaustausch trifft. Doktor Freud, der dazu eingeladen hat, geht schon auf die fünfzig zu. Da gehört es sich für den Jüngeren, sich mit den eigenen Ansichten durchaus zurückzuhalten. Zumal er in vielem nicht so sicher ist, wie sich dieser Freud den Anschein gibt. Dass die Meinungsverschiedenheiten beträchtlich sein werden, spürt er, der späte Gast; etwas Eigenes, Großes arbeitet in ihm – nur was, weiß er noch nicht.
Erhitzt von dem Marsch, holt unser Mann ein paarmal tief Luft, dann öffnet sich mit einem Knarren die Tür. Als er eintritt, erscheint es ihm, als beträte er durch dieses Tor ein aufregendes neues Zeitalter.
Das Jahr 1902 neigt sich dem Ende zu, und Wien, die stolze Hauptstadt der K.-u.-k.-Monarchie, platzt aus den Nähten. Seit Jahren wird ohne Unterlass gebaut. Auf den Straßen, vor allem östlich des Kanals in der Leopoldstadt, drängen sich Neuankömmlinge aus allen Winkeln des Habsburgerreichs, etwa aus Böhmen, Mähren, der Bukowina oder Siebenbürgen. Woche für Woche strömen Hunderte Menschen, viele davon Juden, in die Donaumetropole – auf der Flucht vor Armut und Verfolgung, auf der Suche nach einem besseren Leben. Bei der Volkszählung von 1869, ein Jahr bevor unser Gast geboren wird, meldet Wien rund 600000 Einwohner, darunter 40000 Juden, die meisten aus den östlichen Krongebieten.[1] In den gut dreißig Jahren seither hat sich die Bevölkerungszahl verdreifacht. Bald wird die Zweimillionenmarke erreicht sein.[2]
Die Industrialisierung erfasst Österreich spät, aber heftig. Wien boomt. Überall werden Arbeitskräfte gesucht, in den Fabriken, im Handel, in der Verwaltung, bei Zeitungen, an Gerichten und in der Universität. Auch das Stadtbild verändert sich rasant: Seit der mittelalterliche Wall geschleift und in eine breite Prachtstraße, den Ring, verwandelt wurde, ist das Zentrum kaum wiederzuerkennen. Oper und Parlamentsgebäude, Neues Rathaus und Burgtheater, Universität und Secession, wo man hinsieht, ragen Zeugnisse österreichischer Bedeutsamkeit in den Himmel. Von Hofburg, Heldenplatz und Schönbrunn ganz zu schweigen.
In anderen Bezirken, wie rund um den Prater in der Leopoldstadt, schießen Mietshäuser aus dem Boden. Billige Unterkünfte für die Massen der Arbeiter, Tagelöhner, ungelernten Handlanger und ihre Familien. Hier lebt man eng zusammengepfercht. Viele können sich keine eigene Wohnung leisten und überlassen tagsüber anderen ihr Bett, während sie vierzehn oder sechzehn Stunden lang schuften, um sich und die Kinder über die Runden zu bringen. Die hygienischen Verhältnisse sind miserabel, Krankheit und Seuchen allgegenwärtig.
Franz Josephs Regentschaft geht derweil ins fünfundfünfzigste Jahr. Die Donaumonarchie mit ihrem verstaubten Zeremoniell scheint aus der Zeit gefallen zu sein bei dem Tempo, mit dem sich das Leben im Schatten der prunkvollen Fassaden beschleunigt. Seit der Weltausstellung 1873 hielten etliche Neuerungen in Wien Einzug: Straßenbeleuchtung, Telegrafenamt, die Tramway. In den Gassen tauchen neuerdings immer mehr Gefährte auf, die, wie von Geisterhand gezogen, umeinanderrasen. Fortschritt und Erfindergeist scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein, entsprechend groß sind die Erwartungen an die Zukunft.
Neben der Hoffnung, dass man einem goldenen Zeitalter entgegengeht, birgt das Neue aber auch so manche Irritation. Viele fühlen sich überrollt von der rasanten Veränderung, leiden an Überreizung und nervöser Ängstlichkeit. Modekrankheiten wie die Neurasthenie, eine Mischung aus Unruhe und Niedergeschlagenheit, sowie die unter Frauen verbreitete Hysterie machen die Runde. Es sind die Krankheiten jener »Wiener Moderne«, wie man diese Zeit später nennen wird.
Wien ist ein Schmelztiegel und Experimentierfeld. Die Avantgarde aus Kunst, Philosophie und Wissenschaft erprobt hier neue Denk- und Ausdrucksformen, die mit der als morsch empfundenen Tradition brechen. Bei aller Vielfalt eint die Neuerer eine Vision: Selbstbestimmung. Freiheit von Zwang und Verfolgung, aber auch Freiheit, sich selbst zu erfinden gemäß den je eigenen Möglichkeiten. Statt Herkunft und Schicksal sollen Wille und Tatkraft über das Los des Einzelnen bestimmen, Talent und Ambition jedem ein ihm gemäßes Auskommen sichern. Der Adel mag weiter Opernbälle feiern und die Proletarier ums Überleben kämpfen, das aufstrebende Bürgertum jedoch entwickelt eine eigene Werteskala. Das Recht der Tüchtigen, das laut Charles Darwin in der Natur waltet, soll endlich auch die Gesellschaft durchdringen. Jeder ist seines Glückes Schmied – diese Idee wird zum Dreh- und Angelpunkt einer neuen Zeit.
Wenn das Alte wankt, klammern sich manche umso fester daran. Die Bewahrer und Zweifler, vom Wandel des modernen Lebens überfordert, suchen einen Sündenbock. Einen, den sie bekämpfen können, damit alles bleibt, wie es ist. Dieser Sündenbock ist schnell gefunden, denn es ist seit Jahrhunderten derselbe: der Jude. Auch im liberalen Wien schwillt der Antisemitismus immer wieder an, sobald es wirtschaftlich bergab geht. So etwa im Sommer 1873, als sich der junge Sigmund Freud gerade aufs Universitätsstudium vorbereitet. Infolge einer Spekulationsblase vornehmlich deutscher Investoren bricht die Wiener Börse plötzlich ein. Zahllose Anleger verlieren ihr Geld, Unternehmen machen Bankrott. Schuld an dem Börsenkrach, heißt es, seien die Juden. Dass vor allem sie große Summen bei dem Crash verlieren, ändert daran nichts.
Bislang können Juden in Wien viel leichter als anderswo sozial aufsteigen. Hier dürfen sie Grund und Boden erwerben und in der Verwaltung Karriere machen. Um 1890 ist rund die Hälfte aller Ärzte, Anwälte, Lehrer und Beamten der Stadt jüdisch, bei einem Bevölkerungsanteil von weit unter zehn Prozent. Antisemitische Ressentiments tragen viele assimilierte oder zum Christentum konvertierte Juden sogar mit; ihre Herkunft gilt ihnen als Makel, das jüdische Wesen als falsch und verschlagen. Auch unser später Gast spielt mit dem Gedanken, Protestant zu werden, aus eher pragmatischen Erwägungen: Nichtjuden haben bessere Chancen auf eine gut bezahlte Stelle an der Universität oder der Poliklinik.[3]
In dieser Umbruchzeit kurz nach 1900 durchweht Wien ein »fruchtbares Ideengestöber«.[4] Eine umtriebige, kreative Elite bevölkert die Stadt, darunter die Maler Egon Schiele und Gustav Klimt, die Dichter Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler und Hermann Bahr, die Komponisten Arnold Schönberg und Gustav Mahler, die Architekten Otto Wagner und Adolf Loos, dazu der Essayist Karl Kraus und die Salonlöwin Lou Andreas-Salomé. Sie verachten Borniertheit und hohlen Pomp, rebellieren gegen das allgemeine Vernunfts- und Fortschrittspathos. Tod und Eros sind ihre Sujets.
»Dass hinter der Fassade der Rationalität etwas ganz anderes lauere, (…) galt der künstlerischen und intellektuellen Avantgarde des späten 19. Jahrhunderts als ausgemachte Sache.«[5] Damit sich das Individuum entfalten kann, gilt es zuerst die dunkle, von Wollust und Gewalt regierte Terra incognita der Seele zu erobern. Der Mensch muss die inneren Dämonen, sein Unbewusstes, bezwingen, um Herr seiner selbst zu werden. Daran hat auch der junge Alfred Adler keinen Zweifel, der seinen nassen Mantel im Flur dem Hausmädchen übergibt.
So bahnt sich in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein wahrhaft epochaler Geisteswandel an. Und die Mitglieder jener Gesellschaft, die sich an jedem Mittwochabend in der Berggasse19 im 9. Bezirk versammeln, betrachten sich selbst als die Speerspitze dieser Bewegung.
Es sind nur wenige Stufen hinauf ins Hochparterre. Kurz die beschlagene Brille gewischt und den Schweiß von der Stirn getupft, dann betritt der Neuankömmling das Wartezimmer, wo die anderen bereits sitzen. Und rauchen. Wilhelm Stekel ist da, wie üblich tadellos gekleidet und in Plauderlaune. Auch der etwas gemächlich wirkende Max Kahane und der in sich gekehrte Rudolf Reitler sind zugegen. Am anderen Ende des Zimmers, mit dem Rücken zur Veranda, thront der Hausherr. Er nickt Adler wohlwollend zu.
Tagsüber blicken Freuds Patienten hier durch große Fenster auf die Kastanien im Innenhof. Seine Praxis laufe zufriedenstellend, erklärt der Gastgeber, auch wenn der erhoffte Erfolg des Traumbuchs bislang ausblieb. Kaum zweihundert, dreihundert Exemplare seien verkauft, und die Rezensionen könne man an einer Hand abzählen.[6] Doch es sei kein Wunder, dass man ihn ignoriere und ablehne. Die Macht des Unbewussten und seine treibende Kraft, die Libido – vor allem aber die krank machende Wirkung verdrängtersexueller Wünsche –, das sei den Menschen unheimlich, niemand wolle davon etwas wissen. Doch mit jedem Kopfschütteln der Uneinsichtigen wächst Freuds Überzeugung, er habe eine tiefe Wahrheit aufgedeckt.
Alfred Adler fühlt sich an dieser Adresse noch aus anderem Grund am richtigen Platz. Sein Namensvetter Victor Adler – mit dem er weder verwandt noch verschwägert ist – lebte an gleicher Stelle mit seiner Frau in einem bescheidenen, eingeschossigen Vorgängerbau. Dieser Victor Adler war ebenfalls Arzt und unterhielt eine Armenpraxis. 1889 gründete er mit einigen Gleichgesinnten die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs, in der auch Adler, der Ophthalmologe, aktiv ist. Die Befreiung des Proletariats ist nur eine Frage der Zeit, dem Sozialismus gehört die Zukunft, so viel steht fest. Ob das Gleiche auch für die Psychoanalyse gilt, muss sich erst noch erweisen.
Ende der 1880er-Jahre wird Victor Adlers Behausung abgerissen und an selber Stelle ein fünfgeschossiger Bürgerpalast errichtet. Im September 1891 zieht hier der niedergelassene Nervenarzt Sigmund Freud mit seiner Frau Martha und Töchterchen Mathilde sowie den Söhnen Jean-Martin und Oliver ein. Bis zum Jahr 1895 folgen drei weitere Kinder: Ernst, Sophie und Anna.
Inzwischen feiert Nesthäkchen Anna bald schon seinen siebten Geburtstag. Die Wohnung der Freuds liegt im Mezzanin, ein Stockwerk über der Praxis. Morgens, mittags sowie spät abends, wenn der letzte Patient fort und die Korrespondenz erledigt ist, steigt Freud im Treppenhaus stets zwei Absätze hinauf und wieder hinab. So sind Arbeit und Privates getrennt und doch eng benachbart.
Adler kennt Freud bereits drei Jahre, aber so recht schlau geworden ist er aus ihm nicht. Ein kettenrauchender Arzt – am liebsten mag er kubanische Zigarren, meist begnügt er sich jedoch mit den günstigen Trabucco –, zudem ein kundiger Sammler antiker Kunst, die er häufig von Reisen in den Süden mitbringt. Das Behandlungszimmer gleicht eher einem Museum als einer Praxis.
Freuds Stimme ist warm, sein Urteil entschieden, dabei wirkt er im Auftreten distanziert, fast unnahbar. Er spricht gern mit einem ironischen Unterton, verträgt Kritik und Widerspruch selbst aber schlecht. Und dann seine Behandlungen! Freud tut buchstäblich nichts anderes, als seinen Patienten, vornehmlich Frauen von gehobenem Stand, mehrere Stunden in der Woche beim Reden zuzuhören und ihre Äußerungen zu deuten. Sie sollen alles, was ihnen in den Sinn kommt, ungefiltert aussprechen, egal, wie unwichtig oder peinlich es ihnen erscheint. Freud nennt dies »zwangloses Assoziieren«. Hierbei bettet er die Damen auf einer mit Kissen und Decken gepolsterten Chaiselongue, die ihm einst eine Patientin vermachte. Von seinem Platz aus erspäht Adler durch die offene Tür eine Ecke des Möbelstücks vor dem dunklen Wandteppich.
[1] Das berühmteste Möbelstück der Psychologiegeschichte: Freuds Wiener Patientencouch
Und wozu das freimütige Erzählen? Unter den dabei zutage geförderten Gedanken und Assoziationen legt Freud, so meint er, verschüttete Erinnerungen frei. Deren Verdrängung sei die Ursache von Ängsten, Zwängen und Hysterie. Indem er die uneingestandenen Wünsche und Affekte ins Bewusstsein der Patientinnen hebt, weist er diesen einen Weg zur Heilung. Freud ist weniger Arzt als Archäologe, der in die Grabkammern der Seele hinabsteigt.
Doch der Erfolg seiner Methode gibt ihm recht. Die Hektik der Großstadt und Kontakte in wohlsituierte Kreise bescheren Freud genug Kunden, um sich und seiner Familie eine auskömmliche Existenz zu ermöglichen. Vor allem Hysterikerinnen suchen ihn auf, klagen über unerklärliche Schmerzen, Gedächtnis- und Sprachstörungen, Spastiken oder Lähmungen. Die Hysterie ist neben der Neurastheniedas Übel der Zeit. Es befällt fast ausschließlich Frauen, weshalb die hystéra (griechisch für Gebärmutter) bei der Namensgebung Pate stand. Nur was genau die mysteriöse Störung verursacht, ist bislang ein Rätsel.
Adler erinnert sich, wie sehr ihn die »Studien über Hysterie« faszinierten, die Freud gemeinsam mit dem Kollegen Josef Breuer1895 veröffentlichte. Darin schildern die beiden mehrere Fälle aus ihrer Praxis, bei denen die neuartige Behandlungstechnik zum Einsatz kam. Aus der durchschlagenden Wirkung schlussfolgern Freud und Breuer, der Hysterische leide größtenteils an Reminiszenzen. Sprich: Erinnerungen, die so bedrückend oder unangenehm sind, dass sie nicht bewusst werden dürfen, rumoren im unzugänglichen Teil der Psyche, bis sie schließlich als Symptome zutage treten. Um zu kurieren, muss man die Erinnerungssplitter ans Licht bringen und richtig zu deuten wissen. Können die Patientinnen den verklemmten Affekt sodann ausagieren, verschwinden die Beschwerden; Freud und Breuer sprechen von Katharsis.
Gut vier Jahre nach den »Studien« und um viele Behandlungen erfahrener, legte Freud Ende 1899 nach. Am 8. November erschien »Die Traumdeutung« bei Deuticke in Leipzig – mit der in die Zukunft weisenden Zahl »1900« auf dem Titel. Für manche ist das Werk eine Offenbarung, für andere eine Zumutung. Doch noch ahnt niemand, welche Sprengkraft es besitzt.
Beruf statt Berufung
An jenem regnerischen Abend Ende 1902 rechnet keiner der fünf Herren in Freuds Praxis mit einer Revolution. Doch die Psychoanalyse, wie Freud seine Behandlungstechnik nennt,[1] wird das Selbstverständnis der Menschen erschüttern und ihren Umgang mit sich selbst und miteinander grundlegend verändern. Ihr Kerngedanke besagt, dass alles bewusst Erlebte einen tieferen, verborgenen Sinn hat. Jede seelische Regung – Gefühle, Gedanken, Erinnerungen, Wünsche, auch Irrtümer, Ängste oder Schmerzen – verweist auf anderes, hat etwas zu sagen. Dass hinter den Maskeraden der Verdrängung eine Wahrheit darauf wartet, enträtselt zu werden, wird zum beherrschenden Narrativ der neuen Psychologie des Unbewussten.
Das Epizentrum dieses Bebens ist das von Stimmen und Qualm erfüllte Wartezimmer Doktor Freuds in der Berggasse19. Und das Thema des ersten Abends der Mittwoch-Gesellschaft ist treffend gewählt: das Rauchen. Im Raum herrscht dicke Luft. Martin, wie Freuds ältester Sohn gerufen wird, erinnert sich Jahre später, wie er als Bub einmal spätabends nach einer dieser Runden das Zimmer betrat und sich fragte, wie Menschen in solcher Luft überhaupt atmen und denken konnten.
Für die Gäste stehen Zigarren bereit, der Hausherr selbst raucht des Herzens wegen im Moment nur Pfeife. Dafür stopft er sie umso öfter. »Ich habe selten einen Mann so viel rauchen gesehen«, notiert Stekel. Der Neurologe nahm zu Beginn des Jahres 1900 Kontakt zu Freud auf, nachdem er eine Besprechung der »Traumdeutung« in der Zeitung gelesen hatte. Er war es, der Freud vorgeschlagen hat, zur Vermittlung seiner Ideen einen Gesprächskreis zu gründen. Der journalistisch produktive Stekel avanciert bald schon zum inoffiziellen PR-Agenten der jungen Psychoanalyse. Bereits am Morgen nach der ersten Zusammenkunft verfasst er einen Bericht über den Vorabend bei Freud. Unter dem Titel »Gespräche über das Rauchen« erscheint er am 28. Januar 1903 im »Prager Tagblatt«.
In Stekels Kolportage trägt jeder Teilnehmer ein Pseudonym. Er selbst ist »der Unruhige«, Adler »der Sozialist«, Kahane, ein Ex-Kollege Freuds aus dessen Zeit am Wiener Allgemeinen Krankenhaus, bekommt den Spitznamen »der Bequeme«, und Reitler ist »der Schweigsame«. Nicht zu vergessen »der Meister«. Man kommt rasch auf die stimulierende Wirkung des Tabaks zu sprechen, der die Denk- und Schaffenskraft steigere. Stekel meint sich zu erinnern, seine ersten Gehversuche als Schriftsteller seien exakt in jene Zeit gefallen, als er zu rauchen begonnen habe. »Das beweist nur meine Annahme, dass das Rauchen die Selbstkritik untergräbt«, frotzelt Kahane. Worauf Freud kommentiert: »Geistreich, aber boshaft.« – »Und falsch!«, kontert Stekel.
Freud bekennt, Zigarren würden bei ihm eine Art milde Narkose bewirken, ein »Wohlgefühl der Nerven«. Er schmauche täglich bis zu zwanzig Stück, denn er brauche stets »etwas Warmes zwischen den Lippen«. Die phallische Form, die Assoziation mit dem kindlichen Nuckeln an der Mutterbrust – wenn es überhaupt zur Sprache kam, unterschlug Stekel es. Wie hätte er auch offen darüber in einer Zeitung schreiben können? Nur »der Sozialist« wird mit der Bemerkung zitiert: »Das Rauchen hat in vielen Fällen intime sexuelle Beziehungen.« Der Einwurf bleibt allerdings unerwidert, keiner der Anwesenden will den Kreis gleich am ersten Abend zu einem Bekenntnisklub machen.
Um den weiteren Treffen einen Rahmen zu geben, legt Freud das Prozedere fest: Jede Mittwochssitzung beginnt mit einem Referat, danach wird Gebäck und Kaffee gereicht, ehe man zum Rauchen übergeht, wobei jeder reihum zum Gesagten Stellung nimmt. Freud bleibt stets das Schlusswort vorbehalten, ehe man sich wieder trennt. Je nach Redebedarf ist es dann mitunter nach Mitternacht.
Allerdings nimmt es Stekel, wie sich bald zeigt, mit der Wahrheit nicht allzu genau. Den Kollegen drängt sich der Verdacht auf, dass er manche Details seiner eigenen Behandlungen, die er in der Runde vorstellt, so dreht, wie es ihm gerade passend erscheint. Womöglich erfindet er sie rundheraus, denn kaum bespricht man eine interessante Konstellation von Symptomen, schon wirft der Neurologe ein: »Gerade heute Morgen ist mir exakt so ein Patient begegnet …« Stekels »Mittwochspatienten« werden legendär.
Freud tritt bei alldem als gnädiger Übervater auf, dessen Autorität unangetastet bleibt. So dürfte er den Gästen auch kaum gestanden haben, dass er nur widerwillig den Heilberuf ergriffen hat. »Eine besondere Vorliebe für die Stellung und Tätigkeit des Arztes habe ich nicht verspürt, übrigens auch später nicht«, schreibt er in einem Selbstporträt gut zwanzig Jahre später.[2] Ursprünglich habe er an der Universität reüssieren und Forscher werden wollen. Die Neuropathologie, krankhafte Veränderungen des Hirngewebes also, waren sein Fachgebiet. Doch jeder Anlauf, mit einer großen Entdeckung den Durchbruch zu schaffen, scheiterte. Und die Konkurrenz schlief nicht.
Die Wiener Universität versammelt gegen Ende des 19. Jahrhunderts etliche Koryphäen. Hier lehren unter anderen der Psychophysiker und Philosoph Ernst Mach, der Zoologe Carl Claus (für ihn seziert Freud nach dem Examen Hunderte Flussaale auf der Suche nach ihren Hoden), der Anatom Hermann Nothnagel und der Hirnforscher Theodor Meynert. Zunächst bei diesem, dann beim Physiologen Ernst Wilhelm von Brücke, einem preußischen Pedanten und charismatischen Lehrer, ist Freud Assistent, nachdem er Ende März 1881 den Doktortitel erwarb. Er arbeitet unter anderem an einer Färbetechnik, die die Zellen des Denkorgans unter dem Mikroskop besser sichtbar machen soll. Doch andere kommen ihm zuvor.
Dann, 1884, experimentiert Freud mit der euphorisierenden Wirkung des Alkaloids der Coca-Pflanze. Er konsumiert selbst von der Substanz, die er bei der Firma Merck in Darmstadt bestellt – und ist begeistert! Seiner Verlobten Martha Bernays sendet er einige Gramm per Post nach Hamburg mit der Bitte, sie möge es unbedingt probieren. Freuds Schwermut ist wie weggeblasen. Und Anlass zur Schwermut hat er wahrlich, seit Marthas Mutter mit der Tochter ins ferne Hamburg gezogen ist. Sie wollte damit nebenbei wohl auch die Verbindung der Tochter zu dem mittellosen Physikus, dem Sohn eines verarmten Wollhändlers aus Mähren, lösen. Was soll Martha schon mit so einem? Das ist nicht die Partie, die der Mutter für ihre Älteste vorschwebt.
Freud verfasst eilig eine Abhandlung über das Wundermittel Kokain und reist nach Wandsbek, um seine Verlobtewiederzusehen. Wie er bei seiner Rückkehr Wochen später feststellt, hat er abermals eine Chance verpasst. Statt gelehrte Aufsätze zu verfassen, suchte sein Kollege Carl Koller einen praktischen Nutzen für das Kokain – und fand ihn als Lokalanästhetikum bei Eingriffen am Auge. Wegen unkontrollierbarer Zuckungen bei einer Vollnarkose mussten die Patienten bis dahin bei vollem Bewusstsein die Operationen ertragen. Ihre Schreie waren Koller unerträglich. So kam ihm eine Idee: Er träufelte sich einige Tropfen Kokainlösung ins Auge, und siehe da, es wurde sofort unempfindlich für Schmerzen. Auf diese Weise ließ sich das schlimmste Leid der Patienten fortan ausschalten.
Brücke redet seinem Schüler Freud ins Gewissen. Auch der vierzehn Jahre ältere Freund Josef Breuer, der Freud finanziell unter die Arme greift, erklärt ihm, eine akademische Laufbahn sei zwar nicht ausgeschlossen, aber kaum wahrscheinlich. Nur als niedergelassener Arzt mit eigener Praxis könne er bald genug verdienen, um einen eigenen Hausstand zu gründen. Und das will der dreißigjährige Freud unbedingt, denn er ist über beide Ohren verliebt.
Was für ein Mensch ist dieser Freud? Gewiss kein einfacher. Er dürfte der wohl widersprüchlichste Charakter in der an Widersprüchen reichen Gemeinde der frühen Psychoanalytiker sein. Freud ist jovial und zugleich jähzornig. Er pocht auf die Wissenschaftlichkeit seiner Annahmen über die Psyche, erhebt für sie jedoch einen Anspruch auf Wahrheit, den sonst nur religiöse Gemeinschaften für sich reklamieren. Freud erlebt bitteren Antisemitismus und stellt sich doch als isolierter dar, als er ist. Er schreibt über Sucht und Wege zu ihrer Heilung und ist schwer nikotinabhängig, vermutlich auch spielsüchtig (kaum ein Tag vergeht ohne eine Partie seines geliebten Tarocks). Er hebt die Trennung zwischen normalem und krankhaftem Seelenleben auf, geißelt abtrünnige Schüler aber als »neurotisch« oder »analfixiert«. Er betrachtet seelisches Leid als Resultat verborgener Traumata, hegt aber keinerlei sozialen Reformwillen; im Gegenteil, das Lustprinzip, dem der seelische Apparat gehorcht, kollidiert ihm zufolge unvermeidlich mit den Erfordernissen eines zivilisierten Zusammenlebens, dem Realitätsprinzip. Seine Behandlungstechnik wirke kathartisch und doch verwandle sie, so Freud, nur »neurotisches Elend in alltägliches Leiden«. Dass er sie später auch als »Mohrenwäsche« bezeichnet, zeugt von seinem geringen therapeutischen Optimismus.
Von Kindheit an hadert Sigmund mit seinem Vater, dem glücklosen Wollhändler Jacob Freud aus Freiberg, heute Příbor, in Mähren. Er schwankt zwischen Respekt und Verachtung für den Alten, der seinem Sohn, als dieser zwölf Jahre alt ist, die folgende Begebenheit erzählt: In Freiberg ging er einmal eine Straße entlang, als ihm ein Antisemit unvermittelt den Hut vom Kopf schlug. »Jud, runter vom Trottoir!«, brüllte der Mann. Doch statt sich zu wehren, hob der Vater stumm seinen Hut auf und ging seines Wegs. Der junge Freud ist entsetzt über so viel Feigheit.
Als Jacob Freud 1896 stirbt, schwänzt Sigmund die Beisetzung. Zum Leichenschmaus erscheint er verspätet, zum Ärger seiner Schwestern, die den kranken Vater umsorgten, während Sigmund seinen Studien nachging. Die altgriechische Sage von Ödipus, der den eigenen Vater (unwissentlich) tötet und die Mutter ehelicht, hallt auch aus biografischen Gründen in Freuds Denken wider. Auf den antiken Mythos gründet er im Lauf der Zeit eine ganze Seelenkunde.
Sigismund Schlomo Freud, am 6. Mai 1856 in Freiberg geboren, ist schon als Kind eigen. Er liest exzessiv und ist über Jahre Klassenprimus am Gymnasium. Dem Lerneifer steht seine Kompromisslosigkeit kaum nach. So nennt er sich schon als Jugendlicher kurz Sigmund und beschließt, dass ihn Religion nicht interessiert, obwohl seine Familie die jüdischen Riten pflegt. In einem von Hunderten Briefen an seine Verlobte Martha gesteht er später, er habe »gewiss eine Neigung zur Tyrannei«.[3]
Als Sigmund vier Jahre alt ist, zieht Jacob mit seiner zwanzig Jahre jüngeren zweiten Ehefrau Amalie (laut manchen Quellen ist sie seine dritte) zunächst nach Leipzig, um dort in den Textilhandel einzusteigen; doch er erhält kein Aufenthaltsrecht. In Wien schließlich kommt die Familie wie viele Juden in der Leopoldstadt unter. Sigmund ist das älteste von sieben Kindern – er hat fünf Schwestern und einen kleinen Bruder, Alexander, der 1866 als letzter Spross zur Welt kommt. Julius, anderthalb Jahre nach Sigmund geboren, stirbt hingegen als Kleinkind. Der älteste Sohn nimmt früh eine Sonderstellung ein, denn die Eltern erkennen sein Talent und hoffen, er werde der Familie Wohlstand bescheren. In der Wohnung, die die Freuds bewohnen, hat Sigmund als einziges Kind ein eigenes Kabinett, um ungestört lernen zu können. Als das Klavierspiel einer Schwester ihn bei der Lektüre stört, wird das Instrument kurzerhand aus dem Haus geschafft. Bei einem Besuch im Prater im Sommer 1867 prophezeit ein Wahrsager dem Knaben, er werde einmal am Hof Karriere machen – was die Eltern mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen. Eine Beamtenlaufbahn, vielleicht gar ein Ministerialposten, wäre ganz in ihrem Sinn.
Nach der Matura studiert der Siebzehnjährige dann allerdings Medizin. Ein Vortrag über den Goethe zugeschriebenen Aufsatz »Die Natur« bringt ihn von dem anfänglichen Plan ab, Jurist zu werden. Freud tritt einem Leseverein bei, wo man intensiv über Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche diskutiert. Die meisten Mitglieder der Verbindung sind vom jüdischen Glauben entfremdet und empfinden sich als Außenseiter. Auch Freud schreibt über diese Zeit rückblickend: »Die Universität, die ich 1873 bezog, brachte mir zunächst einige fühlbare Enttäuschungen. Vor allem traf mich die Zumutung, dass ich mich als minderwertig und nicht volkszugehörig fühlen sollte, weil ich Jude war.«[4]
Wie seine Briefwechsel mit Jugendfreunden deutlich zeigen, ist der Student Freud stolz, ehrgeizig, spöttisch und hart im Urteil. Auch sein nachtragendes Naturell macht sich bemerkbar; erlittene Kränkungen vergisst er nicht, weshalb die Beziehung zu Menschen, die ihn enttäuschen, meist dauerhaft abbricht. Freuds Ambition wird genährt davon, dass die Familie nach dem geschäftlichen Versagen des Vaters zeitweise in ärmlichen Verhältnissen lebt.
Neben den sechs Vollgeschwistern hat Sigmund noch zwei Halbbrüder aus Jacobs erster Ehe. Einer von ihnen, Emanuel, ist älter als seine eigene Mutter Amalie und der andere, Philipp, passt laut dem Jungen viel besser zur Mutter als der Vater. Die Halbbrüder gehen Mitte der 1860er-Jahre nach Manchester, wo Sigmund sie 1875 besucht.
Familie Freud: [3] Rechts Vater Jacob mit dem zehnjährigen Sigmund; [2] oben steht dieser mit Anfang zwanzig hinter seiner Mutter Amalia, umringt von Geschwistern und weiteren Verwandten.
Martha Bernays begegnet er zum ersten Mal im Frühling 1882. Sie ist zwanzig, er fünf Jahre älter. Bereits im Juni ist das Paar verlobt. Nun braucht er schleunigst ein festes Einkommen. Vor die Wahl gestellt zwischen seinem Traum von der Forscherlaufbahn und dem Wunsch, auf eigenen Beinen zu stehen, entscheidet sich Freud für Letzteres und lässt sich als Nervenarzt nieder. Am 25. April 1886 eröffnet er eine Praxis in der Rathausstraße 7 nahe dem Ring. In den ersten Tagen lässt er seine Schwestern im Wartezimmer Platz nehmen, damit es so aussieht, als wäre der Praxisinhaber ein nachgefragter Arzt. Damit ist endlich der Weg frei: Am 13. September heiraten Sigmund und Martha im Rathaus von Wandsbek bei Hamburg, wo Martha zu dieser Zeit noch lebt. Von den Flitterwochen an der Ostsee nach Wien zurückgekehrt, findet Freud bessere Praxisräume am nördlichen Ring.
Hier, im sogenannten Sühnhaus, das an der Stelle eines abgebrannten Theaters entstand, kommt 1887 das erste Kind, Mathilde, zur Welt. Es folgt Jean-Martin 1889. Im September 1891, Martha ist zum dritten Mal schwanger, zieht die Familie in die Berggasse um. Die nächsten siebenundvierzig Jahre, bis zur Flucht vor den Nazis im Sommer 1938, wird Freud hier leben, arbeiten und schreiben. Sein Leben verläuft äußerlich gleichförmig. Den September verbringt er meist reisend, der Rest des Jahres ist geprägt vom steten Rhythmus der Ordination, Korrespondenz und Schreibarbeit, unterbrochen nur von festen Essens- und Ruhezeiten. Alle Abenteuer in Freuds Leben spielen sich in seinem Arbeits- und Behandlungszimmer ab, im Gespräch mit den Patienten.
Freud ist ein besessener Arbeiter – er verfasst unter anderem fast täglich lange Briefe, im Lauf der Zeit insgesamt gut zwanzigtausend – und Familienpatriarch. Er besteht darauf, die Namen der Kinder, die Martha ihm schenkt, selbst auszusuchen. Am Ende werden es drei Jungen und drei Mädchen sein. Die erstgeborene Mathilde ist benannt nach der Frau eines verehrten Freundes, Mathilde Breuer; Jean-Martin, kurz Martin, nach dem Pariser Mentor Jean-Martin Charcot, bei dem Freud im Winter 1885/86 fünf Monate studierte. Oliver heißt nach dem englischen Revolutionär Cromwell, der den Juden Religionsfreiheit gewährte, und Ernst nach Freuds Lehrer von Brücke. Die Töchter Sophie und Anna, 1893 und 1895 geboren, bekommen die Namen der Frau seines Förderers Josef Paneth und den seiner Lieblingsschwester.
1902 steht »seine Sache«, wie Freud die Psychoanalyse nennt, noch am Anfang. Alles scheint möglich, baldiger Niedergang ebenso wie rasanter Aufstieg. Am 3. März, ein gutes halbes Jahr vor den ersten Mittwochstreffen, ein erster Achtungserfolg: Sechzehn Jahre nachdem er seine akademische Laufbahn zugunsten der ärztlichen Praxis aufgab, wird Freud zum außerordentlichen Professor der Wiener Universität berufen. An den Freund Wilhelm Fließ in Berlin schreibt er schelmisch: »Die Teilnahme der Bevölkerung ist groß. Es regnet bald schon Glückwünsche und Blumenspenden, als sei die Rolle der Sexualität plötzlich von Seiner Majestät amtlich anerkannt, die Bedeutung des Traums vom Ministerrat bestätigt und die Notwendigkeit einer psychoanalytischen Therapie der Hysterie mit Zweidrittelmehrheit im Parlament durchgedrungen.«[5]
Von nun an wächst der Kreis seiner Anhänger stetig. Vom vierten oder fünften Treffen der Mittwoch-Gesellschaft existiert eine weitere Mitschrift Stekels. Sie verzeichnet neben den vier Jüngern der ersten Stunde – Adler, Kahane, Reitler und ihm selbst – noch zwei weitere Gäste: einen »Gemäßigten«, vermutlich der Musikkritiker David Bach, sowie »den Schriftsteller«. Dahinter verbirgt sich wohl Max Graf, der uns als Vater des kleinen Hans wiederbegegnen wird, bei der ersten Fallgeschichte Freuds über ein von Ängsten beherrschtes Kind. In den folgenden Jahren besuchen viele andere Ärzte, aber auch Nichtmediziner die Sitzungen, so der gelernte Schlosser Otto Rank, der Rechtsanwalt Hanns Sachs und der Verleger Hugo Heller. Jetzt formiert sich der harte Kern der »Freudianer«.
Anfang März 1907 schließlich ist ein junger Psychiater aus der Schweiz zu Gast, der seit einigen Jahren in brieflicher Korrespondenz mit Freud steht: Carl Gustav Jung. Als Nichtjude und renommierter Forscher am Zürcher Burghölzli, einer international bekannten psychiatrischen Klinik, scheint Jung die ideale Besetzung als Zugpferd der Bewegung zu sein. Freud setzt große Stücke auf ihn und macht keinen Hehl daraus, dass er in Jung seinen Kronprinzen sieht, zum Missfallen jener, die sich selbst Hoffnung auf diese Ehre machten.
1908 zieht Freud in der Berggasse19 mit seiner Praxis in das darüberliegende Stockwerk, gegenüber seiner Privatwohnung. Die Mittwoch-Gesellschaft nennt sich ab dem 8. April desselben Jahres »Wiener Psychoanalytische Vereinigung« und trifft sich im Café Korb in der Inneren Stadt. Anders als Adler oder Stekel ist Freud zwar kein großer Kaffeehausgänger, doch die Gruppe findet in seinen Praxisräumen beim besten Willen keinen Platz mehr.
1910 will Freud endlich eine internationale Gesellschaft gründen. Jung soll zu seinem Statthalter gekürt und auf dem Psychoanalytischen Kongress in Nürnberg, dem zweiten überhaupt, als Präsident auf Lebenszeit der neuen Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung gewählt werden. Zudem will Freud ihm die Redaktion des »Zentralblatts«, der Hauszeitschrift seiner Bewegung, übertragen. Doch Adler und Stekel rebellieren gegen diesen Plan; sie befürchten eine versteckte Zensur, wenn Jung, als Freuds rechte Hand, über die Publikationen bestimmt. Am Ende schließt man einen Kompromiss: Jung wird Präsident mit befristeter Amtszeit und Adler im Gegenzug Leiter der Wiener Gruppe, mit Stekel als seinem Stellvertreter.
Doch wenn Freud eines nicht verzeihen kann, dann ist es Widerstand gegen seine Autorität. Sein Groll auf Adler und Stekel schwelt zwei Jahre lang, dann enthebt er die beiden kurz hintereinander ihrer Ämter. Schon 1913 wird auch der »Kronprinz« Jung geschasst sein, so wie zuvor die Freundschaften mit Wilhelm Fließ und Josef Breuer zerbrachen. Jung hatte sich, wie die anderen befreundeten Ärzte, allzu weit auf eigene Pfade abseits des psychoanalytischen Dogmas begeben. Freud sieht die Schuld gleichwohl bei anderen, er verzeiht keine abweichenden Meinungen; einzig treu Ergebene duldet er um sich. Die Neigung zur Unversöhnlichkeit zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben.
Als eine ehemalige Patientin Jungs selbst Psychoanalytikerin werden will und 1911 zu Freud nach Wien reist, empfiehlt ihr Jung: »Treten Sie ihm als dem großen Meister und Rabbi entgegen, dann wird es recht sein.«[6] Nachdem die junge Sabina Spielrein mehreren Zusammenkünften der Psychoanalytischen Vereinigung beigewohnt hat, die aus der Mittwoch-Gesellschaft hervorging, begrüßt sie den Übervater mit der Bemerkung, er sehe ja gar »nicht [so] bösartig« aus, wie er eigentlich sollte.[7] Freud nimmt es mit Humor, schließlich kommt der Seitenhieb von einer Frau.
Binnen einer Dekade nach Erscheinen der »Traumdeutung«1899 formieren sich nicht nur eine international agierende Organisation und eine wahrhaft unerhörte Seelenkunde, nein, es entsteht eine neue kulturelle Strömung, die Freud mit strenger Hand dirigiert. Er propagiert eine nie dagewesene Sicht darauf, was den Menschen in seinem Inneren bewegt, und auf das Verhältnis zwischen Körper und Psyche, Gehirn und Geist. Um das zu verstehen, blicken wir kurz auf die erste Station von Freuds medizinischer Karriere, als sich der junge Arzt noch am Wiener Allgemeinen Krankenhaus verdingte. Dort, wo seine Ideen ihren Anfang nahmen.
Vom Ursprung der Leiden
An einem späten Abend Anfang der 1880er-Jahre brennt noch Licht im Labor der physiologischen Abteilung. Ein Forschungsassistent macht sich an seinem Präparat zu schaffen. Vorsichtig zerlegt er ein menschliches Gehirn in hauchdünne Scheiben. Schnitt um Schnitt arbeitet sich das Mikrotom, ein eigens dafür konstruierter feinmechanischer Apparat, durch das Gewebe, als würde es einen Laib Käse hobeln. Der Assistent gewöhnte sich schnell daran, erwarb sogar eine gewisse Fingerfertigkeit. Doch der Versuch, die zarten Proben einzufärben, um unter dem Mikroskop die Bausteine der Hirnrinde, die Neuronen, sichtbar zu machen, will nicht recht gelingen. Mal ist die Färbung zu stark, mal zu blass, mal greift die Prozedur das Gewebe an, mal birst es beim Aushärten. Es ist zum Mäusemelken!
Freud arbeitet bereits mehrere Jahre am Allgemeinen Krankenhaus, mit über zweitausend Betten eines der größten in Europa. Er durchläuft alle wichtigen Abteilungen von Anatomie und Chirurgie über die Innere und die Kinderheilkunde bis zur Neurologie. Nachdem er bei dem Zoologen Claus vergleichende Tierstudien durchgeführt hat, samt einem mehrwöchigen Studienaufenthalt in Triest, tritt er im Oktober 1876 eine Stelle als Famulus in Brückes Labor an. Freud ist zwanzig und hat den Kopf voller Pläne.
Das Gehirn harrt damals noch der wissenschaftlichen Eroberung. Es ist der Ort, wo Körper und Geist zusammentreffen, so viel ist klar. Nur wie dies vonstattengeht, was das drei Pfund schwere, gefurchte Nervengewebe mit Denken, Fühlen, Wollen und Erinnern genau zu tun hat, liegt im Dunkeln. Kein Wunder, können Forscher doch allein dem toten Denkorgan präparierend zu Leibe rücken. Ein lebendes Gehirn bei der Arbeit zu beobachten und seine Funktionen zu studieren, ist unmöglich. So sind sich die Experten selbst darüber uneinig, ob das Gehirn aus vielen getrennten Einheiten besteht oder ob es eine zusammenhängende Masse bildet. Seine Grundbausteine, die Hirnzellen oder Neuronen, sind bei entsprechender Färbung unter dem Mikroskop zwar gut zu erkennen; nur ob und wie sie verbunden sind und funktionieren, weiß niemand.
Freud ist deprimiert. Er bekommt keinen Fuß auf den Boden, scheitert bei jedem Anlauf, endlich einen Durchbruch zu erzielen. Der Italiener Camillo Golgi fand 1873 – als Freud gerade sein Studium begann – mit der reazione nera, der schwarzen Reaktion, eine erste Methode zur Färbung von Hirngewebe und erschloss der Forschung damit einen neuen Kosmos. Ob er selbst einen Weg finden kann, weiter ins Innere des menschlichen Wesens vorzudringen? Freud hat Zweifel. Noch mehr zweifelt er jedoch an einer Grundfeste der augenblicklichen Medizin, wonach alles seelische Leiden, ob Wahn, Hysterie, Schwermut, Ängste oder Zwänge, in körperlichen Schäden wurzelt. Ein altes Dogma der Medizin besagt: Wenn die Psyche krankt, krankt in Wahrheit das Gehirn. Können seelische Krankheiten nicht einfach »psychogen« bedingt sein, ohne dass ein Defekt des Nervensystems vorliegt? Das fragt sich der junge Freud.
So hartnäckig seine Kollegen alles Seelische auf ein körperliches Substrat zurückführen, so unfähig sind sie, dieses Substrat dingfest zu machen. Während er die gräuliche Hirnmasse auf seinem Seziertisch betrachtet, rätselt Freud, wo zwischen all den Furchen und Windungen der menschliche Wille haust, wo Ängste und Erinnerungen. Wird man je in diese Schichten hinabblicken können, gar zur Natur des Bewusstseins vorstoßen?
Das biologische Dogma seiner Zeit fußt auch auf einer wissenschaftlichen Jahrhundertleistung, die auf viele Gebiete der Naturforschung ausstrahlte: Die Rede ist vom Erfolg der Infektiologie. Seit Ärzte wie Louis Pasteur und Robert Koch krankheitserregende Mikroorganismen entdeckten, schien es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch andere Leiden auf ähnliche Weise aufklären ließen: Wenn Wundbrand oder Tuberkulose von winzigen, für das bloße Auge unsichtbaren Keimen herrühren, könnte das auch auf Störungen der Seele zutreffen. Bringen von solchen Erregern produzierte Gifte das Seelenorgan aus dem Lot? Freud spielt einige Zeit mit dem Gedanken, ob die hysterische Übererregung auf die Wirkung eines »Sexualtoxins« zurückgehen könnte. Er lässt die Hypothese allerdings bald wieder fallen.
Für ihn ist die Frage nach den somatischen Wurzeln der Psyche von entscheidender Bedeutung. Denn trifft die Hypothese zu, wonach jedes seelische Leiden eine physiologische Ursache hat, dann sind körperlich gesunde Menschen, die Ängste, Lähmungen oder sonstige Ausfälle zeigen, im Grunde Hypochonder oder Simulanten. Kommen weder die Lebensumstände noch emotionale Belastungen als Auslöser infrage, können bloß Willensschwäche oder Flucht in die Krankheit dahinterstecken. Sprich: Die Betroffenen wollen krank sein, sie entscheiden sich dafür, um von den Ansprüchen des Alltags verschont zu bleiben. Freud hält dies nicht grundsätzlich für ausgeschlossen, immerhin hat Krankheit durchaus Vorteile. Allerdings dürften sich die wenigsten Betroffenen bewusst dafür entscheiden. Wenn sie etwas vorspielen, dann auch sich selbst – mangels Einsicht in ihre tatsächlichen Beweggründe.
An der Seele Leidende finden bei den Ärzten jener Epoche meist weder Verständnis noch echte Hilfe. Die zeitgenössische Psychiatrie verwahrt Patienten, beobachtet sie und verfeinert ihre Diagnosen. Wirkliche Heilmethoden gibt es keine, denn die oft eingesetzte Hydro- oder Elektrotherapie ist ganz offensichtlich nutzlos. Die eiskalten Güsse und elektrischen »Stromkuren« haben allein den Zweck, psychisches Leid durch ein anderes, körperliches zu vertreiben. Suggestionen unter Hypnose wiederum wirken zwar manchmal, aber oft auch nicht. Auf diese Technik, die Freud bei einem Studienaufenthalt an der Pariser Salpêtrière kennenlernt, ist wenig Verlass.
Auch in Freuds 1886 eröffneter Praxis steht ein Galvanisator, mit dem sich Reizströme verabreichen lassen. Allerdings setzt ihn Freud kaum jemals ein. Er favorisiert die Macht des Redens, will »zunächst und unmittelbar auf das Seelische des Menschen einwirken. (…) Ein solches Mittel ist vor allem das Wort, und Worte sind auch das wesentliche Handwerkszeug der Seelenbehandlung.« Von Psychoanalyse ist da noch keine Rede, dieser Begriff taucht erst im Mai 1896 in Freuds Aufsatz »Weitere Bemerkungen über die Abwehr-Neuropsychosen« auf.
Man stelle sich die Erleichterung vor, die es für Menschen in Not bedeutet haben muss, keine Misshandlung oder Diffamierung vonseiten ihres Behandlers fürchten zu müssen. Sich aussprechen können, sagen, was einen bedrückt und wie man sich fühlt, und der Sachkunde des Arztes vertrauen, das ist der große Vorzug der freudschen Seelenbehandlung.
Doch so weit ist es noch nicht. Vorerst ist Freud ein frustrierter Assistenzarzt in einem riesigen Krankenhaus, der nach seiner Mission sucht. Es ist spät geworden, seine Augen brennen, das Sichten der neuen Schnitte kann auch bis morgen warten. Zudem befällt ihn unbändige Lust zu rauchen. Er legt das Hirn in sein Gefäß zurück und trägt es in die anatomische Sammlung. Dann löscht er das Licht, verlässt das Institut durch das imposante Haupttor und zündet sich, kaum auf der Straße, eine Zigarre an. Während er genussvoll den Rauch ausstößt, macht er sich mit hochgeklapptem Kragen auf den Heimweg.
Psychologie ohne Seele
Batesburg ist ein trauriges Nest. Die Tage plätschern gleichförmig dahin, ihre Eintönigkeit wird nur übertroffen von der endlosen Weite der Baumwollplantagen. Der Job an der Schule, wo er den Dorftölpeln und Landpomeranzen, die die Farmer der Gegend ihre Kinder nennen, das Nötigste beibringen soll, ist ihm ein Graus. Dabei arbeitet er noch kein Jahr hier. Doch es war die einzig passende Stelle weit und breit, als er nach fünf Jahren Studium den Master an der Furman University in Greenville ablegte, einem Baptistencollege, wie so viele in den Südstaaten. Jetzt, mit einundzwanzig, ist er Schuldirektor am »Batesburg Institute«, wie sich die Einrichtung großspurig nennt. Eins weiß John Broadus Watson: Er muss hier weg. Lieber heute als morgen.
Etwa zu der Zeit, als Freud in Wien den Reaktionen auf sein Traumbuch entgegenfiebert, hadert der Collegeabsolvent Watson sechstausend Kilometer entfernt im US-Bundesstaat South Carolina mit seinem Schicksal. Er ist arm, ein Landei mit einem Abschluss in Pädagogik, die Mutter, tiefgläubig, sparte sich das Geld für sein Studium vom Mund ab. Watson hat weder Bestnoten (er belegte den 14. Platz unter 22 Absolventen seines Jahrgangs) noch Freunde in einflussreichen Positionen. Doch er versucht das Unmögliche: Am 20. Juli 1900 schreibt er einen Brief an William Rainey Harper, den Präsidenten der wenige Jahre zuvor gegründeten Universität von Chicago. Er bittet Harper um ein Stipendium oder wenigstens um Erlass der Gebühren und verspricht vollen Einsatz. Watson ist davon beseelt, etwas aus seinem Leben zu machen, und die einzige Chance bietet ihm der Abschluss an einer »echten Universität«. Immerhin steuert der Direktor seines Colleges eine schmeichelnde Empfehlung für die Bewerbung bei. Er nennt Watson »einen unserer besten Köpfe (…) ein Gentleman von erstaunlichen Gaben, sehr strebsam, ein erfolgreicher Lehrer und ein Mann von tadellosem Charakter«.[1] Das ist, nun ja, schamlos übertrieben.
Geboren am 9. Januar 1878, wächst John B. Watson in einem Weiler inmitten von Baumwollfeldern auf. Er ist das vierte von sechs Kindern. Als John dreizehn Jahre alt ist, lässt der Vater, ein Trinker und Maulheld, die Familie sitzen. Seine Frau Emma hat nur eine Chance: Sie verkauft die Farm und zieht mit ihren Kindern ins nahe Greenville. Dort gehen John und seine Geschwister zur Schule, und dort besucht der Junge, der nach dem Wunsch der Mutter Prediger werden soll, das College.
Benannt ist er nach John Albert Broadus, einem bekannten Theologen, den die Mutter verehrt. Das Pseudonym »Albert B.« wird Watson zwanzig Jahre später einem Kleinkind geben, dem er in einem berühmten Experiment beibringt, sich beim Anblick flauschiger Gegenstände fürchterlich zu erschrecken – vielleicht eine späte Rache an seinem Namenspatron? Emma Watson arbeitet in einer Baptistengemeinde, trotzdem reicht das Geld hinten und vorne nicht.
John ist ein Eigenbrötler. Verschlossen und aufbrausend, mit einem Hang zur Anmaßung. Ein Professor urteilt, er sei »mehr an Theorien als an Menschen interessiert« und schätze »sich selbst zu hoch«.[2] Doch Watson hat Ehrgeiz und große Pläne. Sein kühnster Einfall wird sein, eine eigene, streng wissenschaftliche Forschungsdisziplin zu begründen: eine Psychologie ohne Bewusstsein. Zunächst aber gerät der junge Mann mit dem Gesetz in Konflikt. Er ist dem Alkohol nicht abgeneigt und zettelt mehrfach Schlägereien an; einmal nimmt ihn die Polizei in Arrest, nachdem er auf offener Straße ein Gewehr abfeuerte.
Woher der Impuls zu dem Bittschreiben an Harper auch kam, Watson wird belohnt: Im Herbst 1900, an der Schwelle zum neuen Jahrhundert, beginnt er in Chicago, Pädagogik und Psychologie zu studieren. Die Metropole am Lake Michigan elektrisiert ihn; er taucht ein in das pulsierende Großstadtleben. Während man in Wien Glanz und Gloria zelebriert, bauen Architekten wie Louis Sullivan und Frank Lloyd Wright hier funktionale Wolkenkratzer, Kathedralen der Zukunft. Und mit den Kolossen aus Stahl und Beton wachsen die Träume ihrer Bewohner in den Himmel.
In Chicago lehrt seit 1894 der Philosoph John Dewey, Begründer des Pragmatismus. Watson belegt ein Seminar über Immanuel Kant, kann mit dessen Spekulationen über die »Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis« jedoch wenig anfangen. Er sucht etwas Handfestes, das das Leben der Menschen verändert. So findet er zur Psychologie.
Doch sein bevorzugtes Studienobjekt wird nicht etwa die vertrackte menschliche Seele, sondern – die Laborratte. Unter Anleitung des Biologen Jacques Loeb untersucht Watson, wie die Nager Labyrinthe durchstreifen, sich Futterplätze merken und auf Sinnesreize reagieren. Loeb stammt aus Deutschland und vertritt eine streng mechanistische Sicht auf das Lebendige. Der Mensch sei nichts als eine biochemische Maschine, die den objektiv beschreibbaren Naturgesetzen gehorche. »Dass wir eine Ethik besitzen, verdanken wir lediglich unseren Instinkten«, so Loeb, »welche in derselben Weise chemisch und erblich festgelegt sind wie die Form unseres Körpers.«[3] Denken, Bewusstsein, Wille – für den Forscher sind das kausal unwirksame Begleiterscheinungen neuronaler Aktivität. Dieses reduktionistische Weltbild beeindruckt Watson.
1903 reicht er als bislang jüngster Promovend der Universität seine Doktorarbeit ein. Darin geht es um den Zusammenhang zwischen der Hirnentwicklung von Ratten verschiedenen Alters und dem Verhalten der Tiere im Labyrinth. Die sogenannte Markscheide oder Myelin beschleunigt, wie man heute weiß, die Reizweiterleitung an den Nervenbahnen, was eine Voraussetzung für assoziatives Lernen ist. Auch in den folgenden Jahren bleibt Watson seinen Tierstudien treu und untersucht in teils grausamen Experimenten, wie sich Tiere, die er nach und nach ihrer Sinnesorgane beraubt, ohne sensorische Reize orientieren.
Den Verlockungen der Großstadt widersteht Watson nicht. Er tingelt durch Bars, Theater, Shows, auch Bordelle. Bis zu seinem Durchbruch als Verhaltensforscher muss er immer wieder Schulden aufnehmen, um einen Privatbankrott abzuwenden. Die Not nährt seinen Wunsch, eines Tages den großen Coup zu landen.
Bei Frauen kommt der schmucke Watson gut an. Er macht einigen Studentinnen den Hof, vor allem einer jungen Frau namens Vida Sutton, die ihn jedoch abblitzen lässt. Seine ungestüme Art findet nicht bei jeder Anklang. In einem Seminar lernt Watson dann die neunzehnjährige Mary Ickes kennen. Die beiden kommen sich näher, halten ihre Beziehung geheim und heiraten schließlich am 26. Dezember 1903. Sie werden zwei Kinder haben, die wie sie selbst heißen: Mary und John.
Womit Watson nicht gerechnet hat, ist das bohrende Misstrauen seines Schwagers, Harold Ickes. Der kann Watson nicht ausstehen und unterstellt ihm, er betrüge seine Schwester mit Vida Sutton. Ickes setzt sogar einen Privatdetektiv auf Watson an, der aber nichts Handfestes beibringen kann. Zwar trifft sich Watson gelegentlich mit Sutton, doch auf eine intime Beziehung deutet nichts hin. Dennoch schwärzt Ickes den Schwager bei der Universitätsleitung an und fordert seine Entlassung. Der Fall wird geprüft und in Ermangelung von Beweisen zu den Akten gelegt.
Nachdem er sich mit seinen akribischen Laborstudien einen Namen gemacht hat, wechselt Watson im Herbst 1908 – in Wien gründet sich gerade die Psychoanalytische Vereinigung – an die Johns Hopkins University nach Baltimore. Geschickt nutzt er teils echte, teils auch erfundene Offerten anderer Universitäten, um den eigenen Preis in die Höhe zu treiben. Als in Baltimore kurz darauf der Leiter der Fakultät für Philosophie und Psychologie, James Mark Baldwin, wegen eines Sexskandals zurücktritt, wittert Watson seine Chance. Der begabte Experimentator und konsequente Empirist übernimmt im Alter von dreißig Jahren den Chefposten.
Watson arbeitet unermüdlich, oft bis zur Erschöpfung. Parallel zu seiner Tätigkeit in Baltimore betreibt er Feldstudien in einer Brutkolonie von Wandervögeln auf einer Inselgruppe vor der Küste Floridas, hält Kurse an verschiedenen Universitäten, editiert wissenschaftliche Journale und verfasst Artikel für populäre Zeitschriften. Watson erkennt, dass es seiner Laufbahn förderlich ist, wenn er mit steilen Thesen an die Öffentlichkeit tritt.
1910 verfasst er ein erstes Manifest, das im »Harper’s Magazine« unter dem Titel »Die neue Wissenschaft vom Verhalten der Tiere« erscheint.[4] Darin stellt er der spekulativen Metaphysik der Seele eine fortschrittliche Psychologie des Verhaltens gegenüber. Nicht anders als die Physik oder Biologie beschreibt sie allgemeine Gesetze, wie sie der Russe Iwan Pawlow zuvor mit seiner Konditionierung von Hunden entdeckt hat. Ein anfangs neutraler (»unkonditionierter«) Reiz wie ein Glockenläuten kann, wenn er zusammen mit einem biologisch relevanten Reiz, etwa Futter, präsentiert wird, bald darauf selbst die typischen Reaktionen auslösen. Pawlows Hunde begannen zu sabbern, sobald auch nur das Glöckchen erklang.
Im Frühjahr 1913 proklamiert Watson an der Columbia University in New York den Beginn einer neuen Wissenschaft. Einer seiner Vorträge erscheint kurz darauf gedruckt unter dem Titel »Psychologie, wie sie der Behaviorist sieht«.[5] Den Ausdruck »Behaviorist« erfand Watson, um schon mit der Berufsbezeichnung klarzumachen, was er für die einzig tragfähige Grundlage der Psychologie hält: messbare Daten, gewonnen aus beobachtbarem Verhalten (englisch: behavior), egal ob von Menschen oder Tieren, denn zwischen beiden bestehe kein grundlegender Unterschied. Sprache und abstraktes Denken erweiterten das Verhaltensrepertoire zwar um ein gutes Stück, doch die Gemeinsamkeiten überwögen die Unterschiede, so Watson.
[4] Ein Forscher will nach oben: Der Psychologe John B. Watson als junger Mann
Die Seelenkunde hält er für einen »vollkommen objektiven, experimentellen Zweig der Naturwissenschaften, dessen theoretisches Ziel die Vorhersage und Kontrolle von Verhalten ist«.[6] Damit lehnt Watson nicht bloß jede Spekulation über das Unbewusste ab; er bricht auch mit der bislang dominierenden Strömung der Psychologie, die empirische Bewusstseinsforschung betrieb. Durch systematische Selbstbeobachtung erhoffen sich die Pioniere des Fachs wie der Leipziger Wilhelm Wundt und seine Schüler, die Elemente des Denkens und Wahrnehmens zu bestimmen. Sie wenden den Blick nach innen, beschreiben Empfindungen und Assoziationen, ziehen Parallelen zwischen objektiven Sinnesreizen und ihrer subjektiven Wahrnehmung. Watson lehnt derlei Methoden als unzuverlässig ab. »Die Zeit scheint gekommen«, schreibt er, »dass sich die Psychologie aller Bezugnahme auf das Bewusstsein entledigt und sich nicht länger der Illusion hingibt, sie müsse geistige Zustände untersuchen.«[7]
Dieser Anspruch begründet das Programm einer Verhaltenswissenschaft. Sie unterscheidet sich radikal vom Ausdeuten und Bewusstmachen seelischer Konflikte, wie die Psychoanalyse sie verlangt. Der Behaviorismus legt den Fokus auf das Verhalten, genauer gesagt auf Reiz-Reaktion-Schemata und daraus abzuleitende Lerngesetze. Psychotherapie ist aus diesem Blickwinkel nichts anderes als ein gezielt herbeigeführter Lernprozess.
Obwohl Watson kein Interesse hat, eine Heilmethode zu entwickeln, begründet er eine Forschungsrichtung, aus der letztlich die Verhaltenstherapie hervorgeht. Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass ein Mann, für den »die Seele« nichts als ein schöner Schein war, zu einem Urahn der modernen Seelenheilkunde wurde. 1890 erklärte der Philosoph William James: »Die Psychologie ist keine Wissenschaft, sondern die Hoffnung auf eine Wissenschaft.«[8] Der ehrgeizige Doktor Watson will diese Hoffnung Realität werden lassen.
Die Wunderheilung der Anna O.
Die erste psychoanalytische Behandlung, die diesen Namen verdient, ereignet sich gut anderthalb Jahrzehnte, bevor der Begriff »Psychoanalyse« geboren wird – von Ende 1880 bis zum Sommer 1882. Sie wird auch nicht von Freud durchgeführt, der zu dieser Zeit noch Hirne präpariert, sondern von einem Wiener Internisten, den Freud über seinen Chef Ernst von Brücke kennenlernte: Josef Breuer. Und die Patientin, sozusagen der »Fall 0« in der Geschichte der modernen Psychotherapie, hat bei der Sache buchstäblich eine Menge mitzureden.
Bertha Pappenheim, die als »Anna O.« Berühmtheit erlangt, verordnet sich ihre Redekur, wie sie es nennt, mehr oder weniger selbst. Die kluge und sensible spätere Frauenrechtlerin spricht bisweilen scherzhaft (und in offen sexueller Anspielung) von »Kaminfegen«, besser gesagt »chimney sweeping«, denn sie verfällt infolge ihres Leidens phasenweise ins Englische. Ihr Arzt ist kaum mehr als ein Stichwortgeber und Protokollant der Prozedur. Breuer berichtet seinem Kollegen Freud Mitte November 1882 von dem sonderbaren Fall, der diesen wiederum zu weitreichenden Folgerungen über den Ursprung der Hysterie anregt. Wie kam es dazu?
Bertha stammt aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie und ist mit Martha Bernays befreundet, der Frau, mit der sich Freud im Sommer 1882 verlobt. Als Bertha elf Jahre alt ist, ziehen die Pappenheims – Vater Siegmund, Mutter Recha, Bertha und ihr kleiner Bruder Wilhelm – in die Liechtensteinstraße im 9. Wiener Bezirk, nur wenige Schritte von Freuds späterer Praxis entfernt. Die Sommermonate verbringt die Familie gern in den Bergen, im Kurort Bad Ischl. Dort erkrankt der von Bertha innig geliebte Vater 1880 schwer. Tief besorgt hütet die Einundzwanzigjährige sein Krankenbett. Und hier beginnt ihr ungewöhnliches Leiden.
Zunächst plagen Bertha Ängste und Halluzinationen, sie sieht Schlangen und böse Fratzen; dann versagt ihr die Sprache, sie kann tagelang nicht sprechen oder bringt zwischenzeitlich nur Englisch, Französisch oder Italienisch über die Lippen (als Tochter aus gutem Hause hat sie eine mehrsprachige Bildung genossen). Hinzu kommen heftige Schmerzen im Gesicht, Taubheit und halbseitige Lähmungen der Gliedmaßen, sie fängt an zu schielen, sieht Objekte verzerrt, bekommt zwischenzeitlich kaum einen Bissen herunter, und ihr Gedächtnis setzt aus. Kurz: Sie zeigt fast sämtliche bekannten Symptome einer Hysterie.
Ende des 19. Jahrhunderts sind derart viele Frauen von den typischen Schmerzen, Zuckungen, Sprach- und Gedächtnisausfällen betroffen, dass es einer Epidemie gleichkommt. Wie eine ansteckende Infektion machen die Anfälle die Runde, treffen jedoch fast nur höhere Töchter. Frauen aus dem Arbeitermilieu bleiben davon so gut wie verschont. Zudem erkranken hauptsächlich Jüngere. Offenbar muss das Leiden etwas mit den Lebensumständen der Betroffenen zu tun haben.
Einerseits sind Frauen aus dem Bürgertum in vieler Hinsicht privilegiert: Sie sind besser ernährt, gebildeter, körperlich weniger beansprucht und machen wohl auch seltener traumatische Erfahrungen durch. Andererseits stehen sie in einer Hinsicht fast rund um die Uhr unter Druck: Sie müssen stets die Contenance wahren. In der Fin-de-Siècle-Gesellschaft ist die Unterdrückung jeglicher Körperlichkeit Pflicht.
Die Mieder der Frauen sind so eng wie die Regeln für standesgemäßes Verhalten. Wer etwas auf sich hält, muss die Etikette befolgen, darf tunlichst nicht schwitzen, keine Gerüche oder unflätigen Geräusche verbreiten, und vor allem: nicht an Sex denken, geschweige denn darüber reden! Regelmäßig fallen Damen in Ohnmacht, weshalb in vielen Häusern Döschen mit Riechsalz für den Notfall bereitstehen. Sexuelle Aufklärung findet nicht statt, zumindest nicht offiziell. Liegt die Ursache der Hysterie womöglich in dieser Leugnung der sinnlichen Bedürfnisse? Jedenfalls könnte das erklären, warum Arbeiterinnen von der Hysterie verschont bleiben: Ist ihr Leben auch sonst von Bürden geprägt, stinken und Sex haben können sie, so viel sie wollen. Nur ist ein solcher Hinweis in der damaligen lustfeindlichen Gesellschaft völlig undenkbar.
Mit einem Stipendium in der Tasche reist Freud im Oktober 1885 nach Paris, um bei Jean-Martin Charcot, dem berühmten Professor an der Salpêtrière, zu studieren. Der Gast aus Wien wohnt Charcots Hysterievorführungen im Hörsaal der medizinischen Fakultät bei, in denen dieser per hypnotischer Suggestion Patientinnen von Lähmungen befreit und Ohnmachtsanfälle beendet. Die mit großer Geste inszenierten Hypnosen ziehen ein Publikum in ihren Bann, das weit über den Kreis angehender Ärzte hinausreicht. Charcot zelebriert wahre Wunderheilungen, indem er durch Berührung der Hypnotisierten, etwa am Bauch oder an den Schultern, einen Schock auslöst. Daraufhin scheinen die Frauen oft augenblicklich von ihren Symptomen erlöst zu sein. Wie sich später herausstellt, instruierte Charcot manche der Patientinnen, wie sie auf sein Handauflegen reagieren sollten, andere mimten wohl in vorauseilendem Gehorsam die Genesenen, um die Erwartungen des Professors und der Zuschauer zu erfüllen. Wo genau die Grenze zwischen Magie und Medizin verläuft, kann bei diesen Veranstaltungen niemand so recht sagen. Was zählt, ist der Glaube an die Heilwirkung.
Dennoch sind die Leiden der Betroffenen nicht bloß vorgetäuscht. Freud vermutet, die Hysterikerin simuliere, aber sie ahne nichts davon. Soll heißen: Die Symptome fungieren als ein Ventil für widerstreitende seelische Kräfte, nur der Mechanismus, der das erlaubt, bleibt den Betroffenen verborgen. Sie täuschen ihre Hysterie nicht vor, auch pure Einbildung oder schwache Konstitution erklären diese nicht. Laut Freud steckt mehr dahinter.
Gemeinsam mit Breuer verfasst er eine »Vorläufige Mitteilung« über einige Fälle von Hysterie, die 1893 im »Neurologischen Zentralblatt« erscheint. Zwei Jahre später nehmen die beiden den Aufsatz als erstes Kapitel in ihr Buch »Studien über Hysterie« auf. Darin schreiben sie: »der Hysterische leide[t] größtenteils an Reminiszenzen«.[1] Mit anderen Worten: Die Symptome resultierten aus der Verdrängung unbewusster, weil sexueller Wünsche und aus Erlebnissen, die dem Gedächtnis nicht zugänglich seien.
Doch wie kam Freud auf diese Idee? Breuer wusste sich mit Anna O. und ihren rasch wechselnden Beschwerden anfangs kaum zu helfen. Er beschränkte sich darauf, ihr Verhalten zu beobachten und sie erzählen zu lassen. Um sie zum ungezwungenen Reden zu animieren, versetzte er sie, so gut es ging, in einen tranceähnlichen Zustand tiefer Entspannung, in dem sie versuchen sollte, sich an den Ursprung, das erste Auftreten jedes Symptoms zu erinnern. Diese Methode entpuppt sich als Glücksgriff. »Als das erste Mal durch ein zufälliges, unprovoziertes Aussprechen (…) eine Störung verschwand, die schon lange bestanden hatte, war ich sehr überrascht«,[2] notiert Breuer.Bertha soll gezielt den initialen Moment jedes ihrer Symptome aufspüren.
So geht es etwa in einer Sitzung um Berthas Unfähigkeit zu trinken – sie deckt ihren Flüssigkeitsbedarf zwischenzeitlich allein aus Obst und Melonen, da es sie vor Wasser und anderen Getränken ekelt. Unter Hypnose