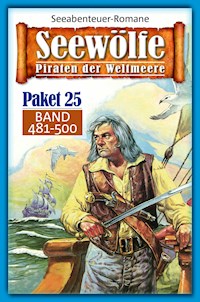2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Die Schebecke der Seewölfe lief auf die beiden ankernden Fleuten zu, die offenbar damit beschäftigt waren, aus einer anderen, halb gesunkenen Fleute Ladegüter abzubergen. Hasard wollte den Holländern Hilfe anbieten, aber die Mijnheers schienen darauf keinen Wert zu legen. Im Gegenteil, die eine Fleute setzte Segel, ging ankerauf und steuerte der Schebecke entgegen, während auf der anderen die Stückpforten geöffnet wurden. Hasard zögerte noch, Befehl zum Abdrehen zu geben. Vermutlich mußte er den Mijnheers zuerst einmal erklären, daß er die Absicht habe, ihnen zu helfen. Er irrte sich. Sie wollten sich gar nicht helfen lassen, sondern den Schnüffler vertreiben. Und das taten sie, indem sie der Schebecke einen Schuß vor den Bug setzten...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum© 1976/2020 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.eISBN: 978-3-96688-014-5Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Burt Frederick
Holländer-Gold
Gegen die Gewalt der Natur hilft aller Reichtum nichts
Die vier Räder der Kutsche verursachten einen harten Klang von Eisen. Die Hufgeräusche der beiden Gespannpferde dröhnten in den engen Hafengassen, und jedesmal, wenn ein Rad von einem buckligen Pflasterstein abglitt, knallte es wie ein Pistolenschuß.
Noch lag Dunkelheit über Amsterdam. Nebel kroch aus den Hafenbecken und drang in das Gassen-Labyrinth vor.
Die Kutsche, schwarz wie die Gespannpferde, verschmolz fast mit der Finsternis. Die schweren Samtvorhänge waren zugezogen. Der Mann auf dem Bock hatte alle Anweisungen seines Herrn befolgt. Er hatte die Lampen nicht angezündet und benutzte keine Hauptstraßen. Dabei mußte er sich auf den Orientierungssinn der Pferde und auf seine Augen verlassen. Der Kutscher hatte Angst. Sein Schicksal war ungewiß.
Es würde sich entscheiden, sobald sie den Kai erreichten, an dem die „Marijke van Brabant“ lag. Es gab nur zwei Möglichkeiten: Entweder durfte er mit an Bord, oder er kriegte einen Tritt in den Hintern …
Die Hauptpersonen des Romans:
Wim Wijninga – der feiste Kaufmann setzt sich aus Amsterdam ab, wo ihm der Boden zu heiß geworden ist.
Henrietta Wijninga – sie ist das Gegenteil ihres Ehemannes, nämlich ziemlich dünn, und sie hat Haare auf den Zähnen.
Joop Wijninga – der Sohn der beiden ist ein Hüne – außerdem liebt er die Gewalt.
Gerrit Beekens – sein Vater wurde von Wim Wijninga in den Tod getrieben, und jetzt verlangt er als Sohn Gerechtigkeit.
Luise Kerkhoff – als Verlobte von Gerrit Beekens gerät sie in eine prekäre Situation, aus der sie sich nicht aus eigener Kraft befreien kann.
Philip Hasard Killigrew – der Seewolf unternimmt einen Alleingang und muß aufs Ganze gehen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
1.
„Sei ganz ruhig, Henrietta“, sagte Wijninga.
Die Fülle seines Leibes wogte, bebte und erzitterte unter den Stößen der Kutsche. Daran vermochten weder die Lederpolster der Sitze noch die komfortable Federung des Zweispänners etwas zu ändern. Das Straßenpflaster war miserabel. Die kleine Flamme einer Öllampe, durch ein korbartiges Eisengehäuse gesichert, erhellte das Innere des Luxusgefährts nur schwach. Seitenwände, Türen und Dach waren mit abgestepptem rotem Samt gepolstert.
„Bleibe ruhig“, wiederholte Wijninga und versuchte, den Arm um die Schultern seiner Frau zu legen. Wegen der Enge des Raumes und seines eigenen Umfangs gelang es ihm nicht, und er gab den Versuch auf.
Die große, hagere Frau an seiner Seite, wandte unwillig den Kopf.
„Was?“ schrie sie, um den Lärm der Kutschenräder und der Pferdehufe zu übertönen. „Was hast du gesagt?“ Ihr Gesicht war streng – Hakennase, stechende Augen und die zum Knoten hochgesteckten grauen Haare verstärkten diesen Eindruck.
„Ich sagte“, brüllte ihr Mann, „daß du ganz ruhig sein kannst! Du brauchst keine Angst zu haben!“
Er trug sein kostbarstes rotes Wams, das mit gold- und silberdurchwirkter Litze bestickt war. Ein weinrotes Samtbarett hing in verwegener Schrägneigung auf seinem kurzen Haarschopf, der zwischen aschblond und grau nicht genau einzustufen war. Wijningas hellblaue Augen ruhten wäßrig hinter den Fettpolstern seiner Wangen.
Die Frau starrte ihn an, als hätte sie es plötzlich mit einem unbekannten Wesen zu tun, das feist und glitschig aus den Tiefen des Meeres herauf gekrochen war. Im nächsten Moment prustete sie los und hieb sich auf die langen, knochigen Schenkel, die sich selbst unter dem Gewand aus schwerer Wolle abzeichneten.
„Hast du das gehört, Joop?“ schrie sie. „He, hast du das gehört? Dein Vater sagt, ich brauche keine Angst zu haben! Das sagt er!“ Sie kicherte schrill.
Joop Wijninga zog die Mundwinkel nach unten. Jede weitere Reaktion ersparte er sich. Er saß seinen Eltern gegenüber, mit dem Rücken zur Fahrtrichtung – blond, groß, wie ein Schrank aus friesischer Eiche. Seine Mutter hatte diesen Vergleich geprägt. Sie bewunderte ihn – gewissermaßen als Ersatz für den eigenen Mann, an dem es nichts mehr zu bewundern gab, seit er sich mit den Jahren einen zusätzlichen Zentner Körpergewicht angefressen hatte.
Joop durchschaute die aufgesetzte Heiterkeit seiner Mutter. Er hatte kein Verlangen, sich an den Sticheleien zu beteiligen, mit denen die beiden ihre ehelichen Kämpfe auszufechten pflegten.
Henrietta Wijninga spürte das Abweisende in der Haltung ihres Sohnes und wandte sich abermals ihrer fetteren Ehehälfte zu. „Tu nicht so scheinheilig! Spiel dich gefälligst nicht auf! Ich hatte keine Angst – im Gegensatz zu dir! Schließlich habe ich einen großen, starken Sohn, der mich beschützt. Wenigstens das habe ich! Andere Frauen können sich rühmen, von einem mutigen, starken Ehemann …“
„Mutter, sei bitte still!“ unterbrach Joop Wijninga ihren giftigen Wortschwall – allerdings nicht aus Mitleid mit seinem Erzeuger, der starr geradeaus blickte und mit Schmollmund zu erkennen gab, daß er vorläufig nicht mehr gewillt sei, seine Frau zu beachten.
„Aber …“, setzte Henrietta an.
„Still!“ fuhr Joop sie mit einer energischen Handbewegung an. Er hatte die Brauen zusammengezogen und horchte scharf in die Roll- und Hufgeräusche, deren Hall zwischen den Hauswänden zum Dröhnen verstärkt wurde.
Sein Vater sah ihn erschrocken an.
„Was ist?“ formten seine rosigen Wulstlippen, ohne daß er zu hören war. „Was ist los?“
„Ich glaube, das verfluchte Pack ist schon wieder hinter uns“, knurrte Joop. Er richtete sich auf, duckte sich unter dem gepolsterten Dach, löschte die Öllampe und zog über den Köpfen seiner Eltern den Vorhang des schmalen Heckfensters beiseite. Mit zusammengekniffenen Augen spähte er in die Dunkelheit der zu Ende gehenden Nacht.
Sie hatten bewußt diesen Zeitpunkt gewählt, weil sie gemeint hatten, daß es die Stunde sei, in der bestimmt alle Menschen im Tief schlaf lagen. Es war der Zeitpunkt, zu dem man am unauffälligsten verschwinden konnte. Aber dieser Hundesohn Beekens schien sogar das gerochen zu haben.
Joop Wijninga sah das Blitzen von Pferdegeschirr in großer Entfernung. Im nächsten Moment war es wieder verschwunden, als sie in eine andere Gasse einbogen. Er schloß den Vorhang und setzte sich. Die Öllampe zündete er nicht wieder an.
„Da ist tatsächlich jemand hinter uns“, sagte er. „Ich wette, Beekens hat alles aufgeboten, um unsere Abreise zu verhindern.“
„Was tun wir denn jetzt?“ kreischte Henrietta. Sie gestikulierte in der Dunkelheit.
Wim Wijninga tastete nach der kleinen Truhe, die vor seinem Sitz, unter seinen Beinen, stand. Es befanden sich die wichtigsten geschäftlichen und persönlichen Dokumente darin. Alles andere war schon an Bord der „Marijke van Brabant“ und wurde bewacht. Alles andere – vor allem das Barvermögen, das er in Sicherheit zu bringen gedachte.
„Sag, was wir tun können, Joop!“ rief Wijninga mit ängstlicher Stimme.
„Ganz einfach“, erwiderte der Hüne mit lautstarker Zuversicht. „Wir werden sie überlisten.“ Er schilderte seinen Plan kurz und bündig, mit wenigen Sätzen.
Wim Wijninga klatschte begeistert in die Hände. „Phantastisch! Einfach phantastisch!“
„Joop weiß immer einen Ausweg“, sagte Henrietta Wijninga.
Sie befanden sich noch immer in der Mündung der Themse. Doch längst waren keine Ufer mehr zu sehen. Dieser Aprilmorgen des Jahres 1598 war so grau, wie ein Aprilmorgen nur sein konnte.
Feine Regenschwaden wehten über das Deck der Schebecke, die vor einem mäßigen Westwind auf Nordostkurs lag. Die von der Feuchtigkeit durchtränkten Lateinersegei schienen nur widerwillig auf den Wind zu reagieren, klatschten bisweilen erschlaffend und blähten sich dann wieder unter erneut zunehmender Windkraft.
An Deck hielten sich achtern nur der Seewolf, Dan O’Flynn und Rudergänger Pete Ballie auf. Vorn ging Ed Carberry breitbeinig auf und ab, die Riesenpranken auf den Rücken gelegt. Al Conroy überprüfte sorgfältig jede einzelne Ölzeugabdeckung, die er und seine Helfer den insgesamt zwölf Culverinen und vier Drehbassen schon am Morgen des vorangegangenen Tages angelegt hatten.
London verabschiedete sich auf die Art und Weise von ihnen, die böse Zungen der englischen Hauptstadt als unabänderliches Merkmal andichteten: neblig, regnerisch, trübe, kalt.
Carberry blieb neben dem schwarzhaarigen Stückmeister stehen.
„Jetzt fehlt bloß noch, daß es schneit“, sagte er mißmutig.
Al Conroy zupfte zur Probe an den kreuzweise gezurrten Tauen, die sich über dem Lauf des vorderen Geschützes an Steuerbord spannten. Er richtete sich auf und wandte sich zu dem Mann mit dem Narbengesicht um.
„Hast du vergessen, was so ein richtiger englischer April ist, Mister Carberry? Der kann machen, was er will. Und wenn’s ihm gefällt, dann liefert er dir auch ein bißchen weiße Pracht.“
„Ich fühle mich gleich wie Weihnachten“, entgegnete der Profos brummend. „Aber feierlich wird’s auf jeden Fall. Das kann ich dir flüstern.“ Er klatschte mit der Linken gegen den vorderen Pfahlmast, als würde der Klang des Holzes seine Prophezeiung bestätigen.
„Ich nehme an, du redest nicht davon, daß du uns Weihnachtslieder vorsingen willst.“ Al Conroy grinste.
Der Profos tippte sich an die Stirn. „Himmel, Arsch, ich rede die ganze Zeit vom Wetter. Von was denn wohl sonst?“
„Man merkt, daß wir in England waren. Da gibt’s ja kein anderes Thema als das verdammte Wetter. Hast dich richtig dran gewöhnt, was?“
Carberry grinste ebenfalls. „An das Gerede – ja. Aber an das Wetter selbst nicht. Da ist mir die Karibik doch zehnmal lieber. Dir etwa nicht?“
„Klar, Mann. Bloß fasele ich nicht von Schnee und solchen Scherzen. Und feierlich ist mir ganz und gar nicht.“
Carberry schüttelte mißbilligend den Kopf. „Nicht dir wird feierlich. Keinem von uns. Da oben geht’s rund, sage ich dir.“ Mit hochgestrecktem Daumen deutete er zum wolkenverhangenen Himmel. „Die Nordsee kommt uns diesmal schräg, fürchte ich.“
„Sturm?“
„Haargenau.“
„Woher willst du das wissen?“
„Das rieche ich.“ Der Profos schob das mächtige Rammkinn vor und reckte die Nase in den Wind. „Aus diesem schlappen Lüftchen wird ein höllisch rauher Hundesohn. Darauf kannst du Gift nehmen. Die Luft riecht danach.“
Der Stückmeister grinste breiter. „Kein Kunststück, deine Vorhersage. So was kann jeder.“
„Was? Wie?“ Der Profos starrte ihn an.
„Na klar! Die Wahrscheinlichkeit, daß wir Sturm kriegen, kannst du an zehn Fingern ausrechnen. Erstens geht es auf der Nordsee sowieso selten friedlich zu. Zweitens haben wir April, wie du mittlerweile festgestellt haben wirst. Und drittens werden wir bis Norwegen lange genug unterwegs sein, um von jeder denkbaren Wettersorte was abzukriegen. Laß uns mal ausrechnen, wie wir die Wahrscheinlichkeit in Zahlen ausdrücken können …“
Ed Carberry nahm Reißaus. Manchmal gierte Al regelrecht danach, sich als Rechenkünstler zu betätigen. Solange es sich auf Pulvermengen und Geschoßgewichte bezog, war dagegen nichts einzuwenden. Doch wenn Al anfing, mit seinen Zahlen öffentlich herumzujonglieren, dann konnte einem leicht der Schädel schwirren – sofern man ihm nur lange genug zuhörte.
Carberry nahm daher schlendernd Kurs auf die Kombüse, zumal ein erstes leises Knurren seines Magens bereits meldete, daß die Frühstückszeit näherrückte. In Vorfreude schnuppernd pirschte er auf das spaltbreit offenstehende Kombüsenschott zu. Weder Mac Pellew, der alte Griesgram, noch der Kutscher ließen sich gern auf die Finger und in die Töpfe gucken. Vor allem morgens konnten sie da giftig werden wie Stachelrochen. Es war also ratsam, die geruchsmäßige Topf- und Pfannenerkundung tarnend und täuschend durchzuführen.
Er beschloß, dieses Vorhaben mit der gebotenen Unauffälligkeit in die Tat umzusetzen, ehe er daran ging, dem Rest der Crew ein leises „Reise, reise, aufstehen!“ ins Ohr zu flüstern. Natürlich würde er den Anforderungen des Borddienstes dann am besten gewachsen sein, wenn ihn eine gewisse Vorfreude erfüllte. Ein Vorgeschmack auf das, was wohl spätestens in einer halben Stunde Leib und Seele wieder ins Lot bringen würde.
Die Gedanken des Profos wanderten in anregende Richtungen, während er sich lautlos dem Kombüsenschott näherte. Er stellte sich knusprig gebraten und doch saftigen Schinkenspeck vor – von gutgenährten englischen Schweinen stammend. Dazu konnten Mac oder der Kutscher ein paar Dutzend von den frischen Eiern, die sie in London eingekauft hatten, in die Pfannen hauen. Englische Hühner legten nur große braune Eier, und die waren bekanntlich besonders nahrhaft.
Er wandte kurz den Kopf. Hasard, Dan und Pete sahen ihn. Aber sie würden ihn nicht verraten, das wußte er. Er konnte völlig beruhigt sein.
Er reckte die Nase vor und versuchte, Witterung aufzunehmen. Erstaunlich war nur, daß sein Riechorgan keinen der vermuteten Genüsse ankündigte. Nun, auch dafür gab es eine Erklärung, das war kein Grund zur Beunruhigung. Die Ursache lag im Einfallswinkel des Windes. Deshalb auch das offenstehende Schott. Die Kombüsenstinte ließen die frische Luft hereinwehen, um sich die Köpfe zu kühlen. Nichts drang folglich heraus.
Er verharrte vor dem Spalt, der die Breite von zwei Handtellern hatte. Drinnen dampfte und brodelte es. Mac Pellew und der Kutscher arbeiteten im Zwielicht aus der mäßigen Helligkeit des beginnenden Tages und dem Schein ihrer Ölfunzeln.
Er sah lediglich die Schultern der beiden Männer und ihre roten Köpfe im Halbprofil. Sie schwitzten, während sie rührten. Es waren große hölzerne Löffel, die sie mit beiden Fäusten halten mußten, um den Inhalt der Töpfe in Bewegung zu setzen.
Die Augen des Profos wurden groß. Da waren nur diese Töpfe auf dem Kochfeuer. Eher Kübel schon, vier an der Zahl. Nichts sonst. Keine Pfannen. Kein Brutzelgeräusch. Nur dieses merkwürdige Brodeln, hin und wieder unterbrochen von regelrechtem Schmatzen. Der Profos schnupperte heftiger.
Bei allen Seeteufeln, so stark war der Wind nicht, daß er jeglichen Geruch vertrieben hätte! Irgend etwas stimmte hier nicht. Man mußte das Gefühl kriegen, einer Ungeheuerlichkeit auf der Spur zu sein. Er konnte sich nicht länger zurückhalten und stieß das Schott auf.
„Was geht hier vor?“ rief er schnaubend, stemmte die Fäuste in die Hüften und schob das kantige Kinn vor.
Der Kutscher und Mac Pellew fuhren herum. Erschrecken und Empörung entstanden nahezu gleichzeitig in ihren schweißglänzenden Gesichtern. Der Kutscher, der dem Profos am nächsten stand, hob drohend den großen Holzlöffel aus dem Topf. Eine graue, breiige Masse klebte an dem Löffel.
„Was fällt dir ein, hier so reinzuplatzen?“ sagte der Kutscher zornig.
„Und spiel dich gefälligst nicht auf“, fügte Mac Pellew knurrend hinzu. „Hier gibt’s nichts herumzumeckern. Wenn dir an unserem Essen was nicht paßt, kannst du dich hinterher beschweren. Nicht vorher.“
„Das könnte dir so passen“, entgegnete der Profos dröhnend. „Wer ist für die Bordroutine verantwortlich – du oder ich?“
„Was soll denn das wohl mit Bordroutine zu tun haben?“ fauchte Mac Pellew. „Du denkst doch bloß an deinen eigenen Wanst – beziehungsweise daran, wie du ihn dir am zweckmäßigsten vollschlagen kannst.“
„Keine Diskussionen bitte!“ fuhr der Kutscher energisch dazwischen, ehe Carberry zu einer donnernden Erwiderung ansetzen konnte. „Wir wollen mit unserer Arbeit fertig werden, und die Männer haben ein Recht auf ihr Frühstück.“