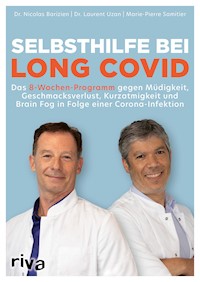
2,99 €
Mehr erfahren.
Leiden Sie nach einer Coronainfektion immer noch an Erschöpfung und Kurzatmigkeit? Schmerzen Ihre Gelenke? Fällt es Ihnen schwer, sich zu konzentrieren? Haben Sie Ihren Geruchs- und Geschmackssinn verloren? Diese und weitere Beschwerden sind typisch für das Long-Covid-Syndrom und erschweren vielen Menschen, die eigentlich als genesen gelten, die Rückkehr in den Alltag. Der Reha-Spezialist Dr. Nicolas Barizien und der Kardiologe Dr. Laurent Uzan haben ein 8-Wochen-Programm entwickelt, mit denen Sie Ihre Symptome wirksam bekämpfen können. Hierbei sind Entspannung, eine ausgewogene Ernährung und körperliche Aktivitäten im richtigen Maß die wichtigsten Faktoren auf dem Weg zur Genesung. Mithilfe von Selbsttests, einem Symptomtagebuch und ausführlich beschriebenen Übungen lernen Sie, Ihre Beschwerden einzuschätzen und das Programm an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. So finden Sie schon bald wieder zurück zu alter Kraft und Gesundheit!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hinweis
Dieses E-Book enthält einige Seiten, die zum Ausfüllen vorgesehen sind. Mit folgendem Link können Sie diese Seiten bei Bedarf downloaden und anschließend ausdrucken: www.m-vg.de/link/Ausfuellseiten-Long-Covid
Dr. Nicolas Barizien | Dr. Laurent Uzan | Marie-Pierre Samitier
SELBSTHILFE BEILONG COVID
Dr. Nicolas Barizien | Dr. Laurent Uzan | Marie-Pierre Samitier
SELBSTHILFE BEILONG COVID
Das 8-Wochen-Programm gegen Müdigkeit, Geschmacksverlust, Kurzatmigkeit und Brain Fog in Folge einer Corona-Infektion
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtige Hinweise
Dieses Buch ist für Lernzwecke gedacht. Es stellt keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung dar und sollte auch nicht als solcher benutzt werden. Wenn Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt. Der Verlag und die Autoren haften für keine nachteiligen Auswirkungen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind.
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2022
© 2022 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Die französische Originalausgabe erschien 2021 bei Marabout unter dem Titel Covid Long. Comment s’en sortir. © 2021 by © Hachette Livre (Marabout). All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Katrin Bosshardt
Redaktion: Michaela Mallwitz
Umschlaggestaltung: Manuela Amode
Umschlagabbildung: © Laura Zuili
Illustrationen: © Emmanuelle Pioli
Satz: Daniel Förster
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7423-2117-6
ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-1894-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-1893-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.riva-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für Hélène, meine geliebte Gattin.»Felicitas natus est ex amore et sapientia.«Meinen drei Goldstücken Marine, Julie und Thomas.Mögen die Neugier und die Liebe zu guter Arbeit mit euch sein.Für meine Eltern Claudine und Claude, und für Martine undGeorges, Claire, Isabelle, Olivier und Matondo.Und für Sie alle, die Sie seit vielen Jahren oder nur für einen Tag meine Patientensind und mir Ihre Gesundheit anvertrauen. Ich lerne täglich von Ihnen.
Nicolas Barizien
Für Ruben, der immer in meinen Gedanken ist.
Laurent Uzan
Meiner lieben Mama, die mich beim Schreiben dieses im Dezember2020 begonnenen Buches von Anfang an unterstützt hat.Meinen geliebten Kindern.Für alle Patienten, die mit Long Covid und seinen Symptomen konfrontiert wurden.
Marie-Pierre Samitier
INHALT
Einleitung
Der Leidensweg der Long-Covid-Patienten
Vielfältige Symptome
1. Mysteriöse Müdigkeit
2. Außer Atem
3. Wenn das Herz plötzlich schnell ermüdet
4. Nichts riecht und schmeckt mehr
5. Wie Nebel in meinem Kopf
6. Im Kriegszustand mit meinem Verdauungstrakt
7. Auf der Fährte der Dysautonomie
8. Die Selbstdiagnose: Ein erster Schritt auf dem Weg zur Genesung
Das Long-Covid-Programm
9. Rehabilitation bei Long Covid: Die Grundlagen
10. Das Long-Covid-Programm: Wieder fit in 8 Wochen
11. Smell-Reha: Wieder schmecken und riechen lernen in 8 Wochen
Zum Abschluss
Anhang
Nützliche Anregungen
Quellen
Überungsverzeichnis
Dank
Über die Autoren
EINLEITUNG
Im Winter 2019 erreichen dramatische Informationen aus der chinesischen Stadt Wuhan Europa. Eine neue Atemwegserkrankung zwingt China dazu, in Rekordzeit neue Krankenhäuser zu bauen. Wie benommen schaut Europa mitleidig zu, wie das, was sich zur größten Pandemie des 21. Jahrhunderts entwickeln wird, seine italienischen Nachbarn überrollt: Covid-19.
Fassungslos blicken wir auf dieses Szenario, das einem Katastrophenfilm zu entstammen scheint. Viele von uns vertrauen mit einer Prise Nationalstolz darauf, das Virus werde nicht über die Alpen gelangen. Doch ab Februar 2020 verkündet das Fernsehen immer beunruhigendere Nachrichten. Bald ist ganz Europa betroffen, und am 22. März tritt in Deutschland ein Corona-Lockdown in Kraft, nachdem der französische Staatschef bereits um 20 Uhr des 16. März einen generellen Lockdown verhängt hatte. So etwas war noch nie da gewesen.
Herkunft eines Killers
Was ist dieses berüchtigte Coronavirus oder SARS-CoV-2, das im Winter 2019 in der chinesischen Provinz Hubei auftaucht und die ganze Menschheit erzittern lässt? Es gehört zu einer großen Familie von Viren, die durch Tiere übertragen werden, und trägt den Namen »Coronavirus«, weil die Spike-Proteine auf seiner Oberfläche unter dem Mikroskop an die Zacken einer Krone erinnern. SARS-CoV-2 ist bereits das siebte Coronavirus, das im Menschen nachgewiesen wurde, verursacht aber im Gegensatz zu seinen Artgenossen nicht nur eine Triefnase.
Die Abkürzung SARS steht für schweres akutes respiratorisches Syndrom (englisch severe acute respiratory syndrome und bedeutet, dass das Virus eine potenziell tödliche Atemwegserkrankung verursacht. »CoV« zeigt an, dass es sich um ein Coronavirus handelt, und die Zahl 2 identifiziert es als kleinen Bruder des SARS-CoV-1, eines anderen Coronavirus, das (in diesem Fall bewiesenermaßen) aus einem chinesischen Labor entwich und die asiatische SARS-Epidemie zwischen 2002 und 2004 auslöste. Es verbreitet sich über Aerosole, die Speicheltröpfchen, die wir beim Sprechen, Husten, Niesen und sogar beim Atmen absondern. Deshalb ist es extrem ansteckend.
Sein Modus Operandi und unser Schutz dagegen
Der SARS-CoV-2-Erreger befällt die Atemwege seines Opfers und vermischt sich mit Speichel. Beim Sprechen verbreiten wir eine Wolke von virushaltigen Tröpfchen. Wenn ein gesunder Mensch sich zu lange in dieser Wolke aufhält, steckt er sich an. Deshalb sollten Sie folgende Schutzmaßnahmen beachten:
Wenn Sie sich sicherer fühlen, tragen Sie in Innenräumen eine Maske bei engem Kontakt mit anderen, damit eventuell kontaminierte Speicheltröpfchen nicht in die Luft gelangen.
Soziale Distanzierung (
social distancing
): Halten Sie einen Sicherheitsabstand von ungefähr 1,5 Meter ein, um außerhalb der Aerosolwolke zu verbleiben.
Wenn wir in die Hände husten und niesen, unsere Lippen berühren, in den Augen reiben oder sogar in der Nase popeln (igitt!), gelangen Krankheitserreger an unsere Hände, und wir verteilen sie fröhlich auf alles, was wir berühren. So schützen Sie sich vor einer Schmierinfektion:
Waschen Sie Ihre Hände gut mit Seife oder desinfizieren Sie sie mit einem der inzwischen nur zu gut bekannten Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis.
Reinigen Sie Gegenstände wie Gläser, Besteck und Esstisch sowie Oberflächen wie Schreibtische, Tastaturen, Türen und Türgriffe, die Sie regelmäßig berühren.
Ein trojanisches Pferd
Eine infizierte Person kann das Virus als »stiller Träger« unwissentlich übertragen und weitherum verbreiten. Dies ist der Fall bei asymptomatischen Patienten und Menschen, die sich noch in der präsymptomatischen Phase befinden, das heißt erst später Symptome entwickeln.
Hat man das Virus einmal eingeatmet, vermehrt es sich zunächst in den Schleimhäuten von Nase und Rachen. Über seine Spike-Proteine dockt es an den Zellwänden an und schleust seine RNA in die Zelle. Die kontaminierte Zelle folgt der Bauanleitung des RNA-Codes und stellt Virusbauteile her, woraufhin sich das Virus vervielfältigen kann.
Am 11. Februar 2020 gibt die Weltgesundheitsorganisation WHO der Lungenkrankheit, die durch das in allen betroffenen Ländern identifizierte SARS-CoV-2-Virus verursacht wird, den Namen Covid-19 (coronavirus disease 2019). Am 11. März 2020 stuft sie Covid-19 aufgrund seiner weltweiten Verbreitung offiziell als Pandemie ein. Das Coronavirus kann beim Menschen vier Formen der Covid-Erkrankung auslösen:
Asymptomatisches Covid-19:
Die infizierte Person verspürt keine oder nur so leichte Symptome, dass sie sich nicht weiter darum kümmert. Diese Form der Infektion ist an sich harmlos, dient aber dem Virus als »trojanisches Pferd«. Es kann sich unbemerkt verbreiten.
Covid-19 mit leichtem Verlauf:
Die häufigste Form der Krankheit, die Sie wahrscheinlich aus eigener Erfahrung kennen. Fieber, Gliederschmerzen, Erschöpfung, Durchfall, also die Symptome einer leichten Grippe. Dazu kommen aber fast immer Symptome, die Covid von der saisonalen Grippe unterscheiden, insbesondere der Geruchs- und Geschmacksverlust, der ein paar Tage, aber auch mehr als ein Jahr anhalten kann. Bei leichtem Verlauf kann man die Krankheit in den eigenen vier Wänden auskurieren, gesunder Menschenverstand und unter Umständen die Hilfe des Hausarztes reichen völlig aus.
Covid-19 mit moderatem Verlauf:
Aus der leichten Grippe entwickelt sich schnell eine virale Lungenentzündung mit Sauerstoffmangel im Blut. Der Patient hat das Gefühl zu ersticken und muss im Krankenhaus über eine Nasenbrille oder eine Gesichtsmaske mit Sauerstoff versorgt werden.
Covid-19 mit schwerem Verlauf:
Die übliche Dosierung der Sauerstoffzufuhr (immerhin neun Liter Sauerstoff pro Minute) reicht nicht mehr aus, um die Gewebe, darunter auch die des Gehirns, mit genügend Sauerstoff zu versorgen. Der Patient wird mit einem akuten Atemnotsyndrom (
acute respiratory distress syndrome, ARDS
) auf die Intensivstation verlegt.
Die »Maschinerie« der öffentlichen und privaten Krankenhäuser des deutschen Gesundheitssystems hat während der ersten Wellen vorbildlich funktioniert. Doch während die Patienten mit schwerem Verlauf adäquat behandelt wurden, hat man leichtere Formen zu oft als harmlos betrachtet und unterschätzt.
Denn gerade in diesen Fällen dauern Beschwerden wie Fieber, Husten, Atemnot, Erschöpfung, Gliederschmerzen, Engegefühl in der Brust oder Gehirnnebel häufig an oder tauchen genau dann wieder auf, wenn der Patient das Gefühl hat, auf dem Weg der Genesung zu sein. Die Rede ist von Long Covid.
Ein Buch, das Sie begleitet
Bestimmt halten Sie dieses Buch in den Händen, weil Sie – oder einer Ihrer Angehörigen – zu den Betroffenen gehören. Wir werden Sie über Ihre Symptome aufklären. Vor allem aber zeigen wir Ihnen Lösungen auf, um diese unsichtbare Erkrankung zu überwinden, die Ihre familiäre oder berufliche Umgebung oft nicht versteht.
Unser Ratgeber basiert auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft, zu dem täglich neue Erkenntnisse hinzukommen, und es ist so vollständig wie möglich.
Nicht alle unsere Lösungsvorschläge sind durch Publikationen in bekannten internationalen Fachzeitschriften belegt. Manche sind das Ergebnis medizinischer Vernunft und unserer großen Erfahrung in der Betreuung von Sportlern und Kranken, deren körperliche Verfassung optimiert werden soll.
Und sie funktionieren, wenn auch nicht immer so schnell und einfach, wie Sie hoffen mögen. Erwiesenermaßen verbessern sie die Lebensqualität der Patienten, die unter den Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung (auch PASC genannt, post acute sequelae of SARS-CoV-2) leiden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie wieder zu Ihrem »alten Zustand« zurückfinden. Dabei stützen wir uns auf einen ganzheitlichen (den Menschen als Ganzes betrachtenden) und multidisziplinären (die Analyse verschiedener Gesundheitsexperten berücksichtigenden) Ansatz, um Ihre funktionellen Fähigkeiten (Ihren Formzustand) zu evaluieren.
Das Wichtigste ist, dass Sie sich hundertprozentig für Ihre Rehabilitation einsetzen. Dazu gehört, dass Sie regelmäßig trainieren, die Selbsttests machen und Ihre Fortschritte im Auge behalten. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Ihr Beitrag für die Genesung entscheidend ist. Zum gleichen Ergebnis kam man auch in den angelsächsischen Ländern.1 Stecken Sie so viel Zeit und Energie wie möglich in das Unterfangen.
Je eher Sie mit einer Reha beginnen, desto größer sind die Chancen, dass Sie sich wieder völlig erholen. Aus der Praxis wissen wir, dass man nicht länger als sechs Monate warten sollte. Nach dieser Zeitspanne dauert der Genesungsprozess länger. Genau deshalb ist dieses Buch so wichtig. Es gibt Ihnen eine Gebrauchsanweisung an die Hand, damit Sie schnell reagieren können.
Unser Buch lädt Sie dazu ein, in die noch ungeschriebene Geschichte des Long Covid einzutauchen und das Abenteuer seiner ganzheitlichen Behandlung mitzuerleben. Das Long-Covid-Programm haben unsere Teams am Krankenhaus Foch in Suresnes und am Institut Médical Sport Santé in Paris, die über eine in Frankreich einzigartige Erfahrung verfügen, im Juni 2020 in gemeinsamer Arbeit entwickelt.
Das Rehabilitationsprogramm ist an individuelle Bedürfnisse angepasst, damit alle Patientinnen und Patienten wieder zu ihrer alten Gesundheit zurückfinden.
Auf den folgenden Seiten bekommen Sie nützliche Tipps von Ernährungsberatern, Fachund Sportärzten, Physiotherapeuten und Fitnesscoachs, damit Sie Ihre Reha ohne Bedenken zu Hause beginnen können. Denn kurzfristig bieten sich oft keine anderen Möglichkeiten, weil die rasante Zunahme der Long-Covid-Fälle die ohnehin schon überbeschäftigten Fachleute mit zusätzlicher Arbeit überflutet hat.
Erfahrungsberichte werden Ihnen zeigen, dass auch viele andere Menschen mit Long Covid zu kämpfen haben. Wie diese Patienten werden auch Sie Schritt für Schritt genesen.
Dieses Buch ist allen Long-Covid-Patienten und ihren Angehörigen gewidmet. Es ist aber auch für jene Menschen gedacht, die noch an der unsichtbaren Krankheit zweifeln, weil ja »sonst alles bestens ist«.
Ihre Rekonvaleszenz mag Ihnen unendlich langwierig vorkommen. Trotzdem halten wir Long Covid nicht für eine chronische Krankheit. Wenn Sie sich mit aller Kraft für Ihre Genesung einsetzen, können Sie sich mit Genugtuung als Überlebenden betrachten. Hier ist das Kampflied, das Sie zum Krieger für Ihre Gesundheit, zum rehab warrior macht.
At first I was afraid, I was petrifiedKept thinking I could never live without you by my sideBut then I spent so many nights thinking how you did me wrongAnd I grew strongAnd I learned how to get alongAnd so you‘re backFrom outer spaceI‘ve got all my life to liveAnd I will survive2.
Gloria Gaynor, I Will Survive
DER LEIDENSWEG DER LONG-COVID-PATIENTEN
Matthieu ist 29 Jahre alt. Er hat sich im Oktober 2020 angesteckt. Anfangs verschrieb ihm sein Hausarzt einfach Paracetamol. Aber mit der Zeit verschlimmerte sich sein Zustand. Matthieu achtete zunächst selbst nicht darauf, erst massivere Beschwerden alarmierten ihn.
»Ich hatte die klassischen Symptome: Halsschmerzen, Husten, 38,5 Grad Fieber und Müdigkeit. Das Fieber war ein Warnzeichen für mich. Ich habe mir bei Ärzten Ferndiagnosen eingeholt, den PCR-Test gemacht und herausgefunden, dass ich Covid-19 hatte. Zur Behandlung habe ich Paracetamol genommen. Ich wurde für ein paar Tage krankgeschrieben und arbeitete während der Quarantäne im Homeoffice. Meine Partnerin hat sich testen lassen: negativ. Auch wenn wir Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hatten und in getrennten Zimmern schliefen, ist es wirklich überraschend, dass sie sich nicht angesteckt hat! Bei zwei PCR-Tests fand sich keine Spur des Virus.
Die Wochen vergingen, und ich war immer noch etwas müde. Ich habe aber nicht darauf geachtet. Anfang Dezember 2020 fühlte ich mich total erschöpft. Der Arzt in der Nähe meines Arbeitsorts tippte auf ein Post-Covid-Syndrom. Er verschrieb mir ein Multivitamin-MineralstoffPräparat, Vitamin D und Gelée Royale und schrieb mich für zwei Tage krank. Als ich nach dem Weihnachtsurlaub meine Arbeit wieder aufnahm, hatte ich Konzentrationsprobleme und war weniger leistungsfähig, konnte unmöglich mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen.
Jedes Mal fand ich eine Ausrede: Ach, ich bin aus diesem oder jenem Grund müde. Aber schließlich fand ich keine Erklärungen mehr für meine Erschöpfung.
Anfang März 2021 suchte ich dann meinen Hausarzt auf. In der Meinung, es handle sich um ein Burn-out, hat er mir ein paar Tage Ruhe verordnet. Bei einer zweiten Konsultation hat er mich an den Covid-Rehadienst des Krankenhauses Foch verwiesen. Zuerst musste ich eine Thorax-Computertomografie, einen Herzultraschall und einen Covid-19-Antikörpertest machen und sämtliche Daten zum Krankheitsverlauf angeben. Über die Plattform Omnidoc erhielt ich dann Zugang zum Covid-Rehadienst. Doktor Barizien hat meine Krankenakte überprüft, und nun konnte ich den Fragebogen zu den Post-Covid-Symptomen ausfüllen. Dieser Vorgang hat mehrere Tage gedauert, weil es so viele Dokumente auszufüllen gab, die mein behandelnder Arzt (der einen Account auf der Plattform hat) dann online stellte.
Erst ab April 2021 wurde ich vom Rehadienst der Klinik Foch betreut und schöpfte neues Zutrauen. Ich fürchtete, die Projekte nicht weiterführen zu können, die ich als Maschinenbauingenieur leitete.
Am 9. April habe ich mit der Reha begonnen. Die Erschöpfung war nicht mein einziges Problem, ich litt auch unter schweren kognitiven Störungen. Ich wurde von einem Pneumologen, einer Ernährungsberaterin, einem Physiotherapeuten und einer Psychologin betreut. Anhand eines Belastungstests bestimmte man meinen Herzrhythmus, das Volumen der ein- und ausgeatmeten Luft sowie meine maximale Leistungsfähigkeit. Die Resultate lagen unter den für Männer meines Alters erwarteten Werten und spiegelten meinen Gesundheitszustand genau wider: Ich leide eindeutig an Long Covid.
Die Psychologin hat mich aufgrund der kognitiven Störungen einer Neuropsychologin zugewiesen. Man ließ mich eine PET-Untersuchung machen, bei der eine radioaktive Substanz gespritzt wird, die sich im Körper verteilt. Ein Computer erzeugt dann Bilder vom Gehirn, die zeigen, ob bestimmte Bereiche nicht mehr aktiv sind. Ende April stellte man bei mir mehrere solche träge Bereiche fest. Das erklärte meine Probleme beim Arbeiten. Der Arzt empfahl mir eine Therapie und stellte mir eine allmähliche Besserung in Aussicht. Also begann ich nach einer neurokognitiven Untersuchung eine Reha bei einem auf Neurologie spezialisierten Logopäden. Ich war beruhigt, weil meine Probleme jetzt einen Namen hatten. Dank kognitiver Rehabilitation und Belastungstraining würde ich die Erschöpfung und die anderen Beschwerden überwinden.«
Nicht mehr leben könnenWIE ZUVOR
Der erste Lockdown in Deutschland wird am 22. März 2020 verhängt und dauert bis zum 4. Mai. Während dieser sieben Wochen lebt das Land wie unter einer Käseglocke. In den eigenen vier Wänden eingeschlossen, mit Angst im Bauch, organisiert sich jeder, so gut er kann, und arbeitet im Homeoffice, während die Kinder Homeschooling haben oder den ganzen Tag herumwuseln. Wer an einer leichten Form von Covid-19 erkrankt, erholt sich langsam zu Hause unter der Bettdecke, aber für viele wird sich der Alltag am Ende des Lockdowns als katastrophal erweisen.
Die Freude, endlich wieder hinauszukönnen, verfliegt schnell. Erschöpfung, Kopf- und andere Schmerzen oder Konzentrationsstörungen machen es unmöglich, den gewohnten Alltag wieder aufzunehmen. Viele Menschen konsultieren nach Aufhebung des Lockdowns ihren Arzt oder suchen wegen starker Schmerzen sogar die Notaufnahme auf.
Betroffene klagen über so viele verschiedene Symptome, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, dass die Ärzte mit ihrem Latein am Ende sind. Es kommt vor, dass Patienten allzu schnell als überängstlich, arbeitsfaul oder überspannt abgetan werden. Das Unbekannte verwirrt die Ärzte genauso wie ihre Long-Covid-Patienten, die sich vor allem während der ersten Welle alleingelassen fühlen. Ihr Leidensweg beginnt.
Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die im Laufe der ersten Welle erkrankt sind, berichten von grippeähnlichen Symptomen wie Unwohlsein, Fieber, Verdauungsprobleme, Durchfall, große Müdigkeit und Frösteln. Dieser Zustand dauert zwischen drei Tagen und bis zu drei Wochen an. Dazu kommen Gliederschmerzen, die mit Muskelschwäche einhergehen.
Im Anfangsstadium äußert sich die Krankheit demnach wie ein grippaler Infekt, der häufig von Geschmacks- und Geruchsverlust begleitet ist. Danach geht es den Patienten allmählich besser, aber bald folgt ein Rückfall mit leichteren oder schwereren Symptomen. Wenn diese auch nach einem Monat noch nicht abgeklungen sind, spricht man von Long Covid.
Man weiß noch sehr wenig über diese Infektionskrankheit, auch wenn die Forschung ständig Fortschritte macht und jede Woche neue Publikationen erscheinen. Die Entwicklung der Krankheit bleibt mysteriös. Die Symptome sind vielfältig und von unterschiedlichem Schweregrad. Neben Lungen- und Herzbeschwerden treten Bauchschmerzen (zum Beispiel aufgrund von Verdauungsstörungen oder Lebererkrankungen), Hautkrankheiten sowie neurologische Funktionsstörungen auf. Manche Patienten verlieren für Tage oder Monate ihren Geruchs- und Geschmackssinn. Es ist noch unklar, warum manche Kranke Post Covid entwickeln und andere nicht. Gibt es körperliche Risikofaktoren, sind manche Menschen aufgrund ihres Stoffwechsels besonders anfällig? Oder ist Long Covid genetisch bedingt? Unterscheiden sich die Symptome je nach Variante des Virus? Man bräuchte Scharen von Patienten, um über komplette Datensätze zu verfügen.
Entstehungsgeschichte: Die ersten Long-Covid-Patienten
Im Mai 2020 scheinen manche Menschen einen Rückfall zu erleiden. Die gleichen Beschwerden wie während ihrer Covid-Erkrankung im März oder April treten wieder auf. Starke Gliederschmerzen, Schmerzen im Brustkorb und Atemnot bei der geringsten Anstrengung, ja sogar Fieberschübe. Richtigerweise konsultieren sie einen Arzt. Und das Ergebnis fällt beruhigend und beunruhigend zugleich aus.
Der PCR-Test ist negativ, es ist also keine neue Virusinfektion vorhanden, Laboruntersuchungen und Thorax-Röntgenbilder zeigen keine Auffälligkeiten, und das Elektrokardiogramm schließt Gott sei Dank einen Herzinfarkt aus. Aber angesichts des negativen Befunds aller Untersuchungen werden die Patienten mit Paracetamol und bestenfalls ein paar beschwichtigenden Worten abgespeist: »Das ist nicht schlimm, ruhen Sie sich aus, das geht vorbei.« Aber das beruhigt die Patienten nicht, weil die Angst vor dem Unbekannten genauso groß ist wie die vor der Krankheit.
Wer sind die Long-Covid-Patientinnen und -Patienten?
Eine im März 2021 in der Fachzeitschrift Nature Medicine erschienene internationale Studie zeigt, dass 13,3 Prozent aller Covid-Erkrankten an Symptomen leiden, die länger als 28 Tage anhalten. Frauen und Menschen mit einem hohen Body-Mass-Index sind häufiger betroffen.3
Während der ersten Welle lagen vorwiegend Männer über 75 Jahren, die unter Bewegungsmangel, Übergewicht und Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen litten, auf der Intensivstation. Ganz anders sieht es bei den Long-Covid-Patienten aus.
Die meisten von ihnen sind tätige, normalgewichtige Menschen unter 60 Jahren ohne Vorerkrankungen – also die »aktiven Kräfte« des Landes, Väter und Mütter, Leute, die voll im Berufsleben stehen. Die Kohortenstudie French Covid, die bis zum 17. März 2021 4310 Patienten beobachtet hat, sagt aus, dass 60 Prozent der Covid-19-Patienten sechs Monate später immer noch mindestens ein Symptom aufweisen, ein Viertel von ihnen sogar drei oder mehr. Zwei Prozent mussten erneut ins Krankenhaus. Außerdem wird aus der Studie ersichtlich, dass ein Drittel der Patienten, die nach sechs Monaten noch unter Beschwerden leiden, ihre Arbeit noch nicht wiederaufgenommen haben.4
Worüber klagen Long-Covid-Patienten?
Schon die ersten Long-Covid-Patienten klagten über unzählige Beschwerden, im medizinischen Jargon »Symptome« genannt. Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert. Jene, die ihren Arzt oder die Notaufnahme aufsuchen, listen eine ganze Palette von Krankheitszeichen auf, die auf den ersten Blick keinen medizinischen Zusammenhang erkennen lassen: extreme Erschöpfung, Atemnot schon beim Sprechen oder bei der geringsten Anstrengung, Engegefühl und Schmerzen im Brustkorb, Glieder- und Muskelschmerzen nach normalen Alltagsaktivitäten, Kopfschmerzen, Schwindel, Nackenschmerzen, Durchfall, Sodbrennen, Hautausschläge und Gehirnnebel. Ärzte sind dazu ausgebildet, Krankheiten zu diagnostizieren, insbesondere jene, die für ihre Patienten lebensbedrohlich sind. Angesichts der Long-Covid-Symptome hört jeder gute Arzt die Alarmglocken klingen. Sie könnten auf potenziell schwere Krankheiten hindeuten, die es unbedingt auszuschließen gilt:
Bei Atemnot: Asthma, Lungenembolie, Pneumothorax, Lungenentzündung, Lungenfibrose.
Bei Kopfschmerzen, Schwindel und neurokognitiven Störungen: Schlaganfall, Enzephalitis (Gehirnentzündung), Meningitis (Hirnhautentzündung).
Bei Verdauungsproblemen: Magengeschwür, Bauchspeicheldrüsenentzündung, virale Magen-Darm-Erkrankung.
Bei Schmerzen im Brustkorb: Infarkt, Perikarditis (Herzbeutelentzündung), Myokarditis (Herzmuskelentzündung).
VON DEN SYMPTOMEN ZU DEN SYNDROMEN
Eine Diagnose beruht normalerweise auf dem Versuch, einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Symptomen herzustellen und so einen Hinweis auf eine bekannte Krankheit zu erhalten.
Anschließend sucht der Arzt anhand von klinischen Untersuchungen und Zusatzuntersuchungen wie Labortests und medizinischer Bildgebung nach einem objektiven Nachweis für die Erkrankung eines Organs.
Long Covid ist auf der ganzen Welt zu einer Art zweiter, nicht akuter Pandemie geworden. Man versucht nun, die auftretenden Symptome zu gruppieren. Bestimmte Konstellationen ergeben dann ein Syndrom, das Ausdruck einer bestimmten Form der Krankheit ist.
Mit Bluttests und mehr oder weniger ausgeklügelten medizinischen Bildgebungsverfahren kann notfallmäßig abgeklärt werden, ob eine möglicherweise schwere Erkrankung vorliegt.
Manchmal kann eine SARS-CoV-2-Infektion eine Vorerkrankung reaktivieren, die sich dann als Symptom von Long Covid präsentiert. So kann Covid-bedingte lange Bettlägerigkeit bei entsprechender Veranlagung bisweilen eine Lungenembolie auslösen. Aber mangels objektiver Beweise werden solche Diagnosen meistens gar nicht gestellt.
Der Weg zur Long-Covid-Diagnose
Zunächst muss eine Reihe Untersuchungen vorgenommen werden, um andere Erkrankungen, Komplikationen und die Dekompensation einer Vorerkrankung auszuschließen. Erst wenn die Alarmglocken verstummt sind, kann die Diagnose Long Covid gestellt werden.
Laboruntersuchungen
Blutbild: rote und weiße Blutzellen, Blutplättchen.
Nierenfunktion: Blutionogramm, Harnstoff, Serumcreatinin.
Leberfunktion: Transaminasen, Gamma-GT. So kann zum Beispiel überprüft werden, ob die Leber normal funktioniert oder ob Covid-19 eine Hepatitis ausgelöst hat.
Entzündung: CRP
5
, Ferritinämie. Daran ist zu erkennen, in welchem Grad die körpereigenen Abwehrkräfte in Gang gesetzt wurden.
Endokrinologie: Nüchternblutzucker, TSH
6
SARS-CoV-2-Antikörpertest: Zum Nachweis einer vergangenen Coronavirusinfektion bei zuvor ungeimpften Personen.
Kardiologie: Troponin, D-Dimere. Damit kann überprüft werden, ob das Herz von der Infektion betroffen war und ob ein Infarkt oder eine Lungenembolie vorgelegen haben.
Der behandelnde Arzt verschreibt je nach Krankheitsbild weitere Untersuchungen mittels bildgebender Verfahren: MRT des Gehirns, CT-Angiografie.
Wenn sich bei einem der Labortests Abweichungen finden, kann der Arzt eine bestimmte Pathologie für die Symptome verantwortlich machen und Long Covid ausschließen. Er ist nun in der Lage, andere Krankheiten oder ernsthafte Folgeerkrankungen (zum Beispiel Infarkt oder Lungenembolie) zu diagnostizieren, die eine rasche Behandlung erfordern. Es ist wie bei Ginger Ale und Bier: Sieht aus wie Long Covid, und die Symptome klingen danach, ist aber trotzdem etwas anderes. Kommen hingegen bei den Tests keine Anomalien ans Licht, bestätigt sich der Verdacht auf Long Covid. Manche Ärzte, Internisten, Spezialisten für Infektionskrankheiten, Kardiologen, Pneumologen oder Rehabilitationsärzte krempeln ihren ohnehin schon übervollen Arbeitsalltag um, weil sie diese neue Krankheit besser verstehen möchten. Sie betreuen die jungen Patienten, die auch mehrere Monate nach ihrer Corona-Erkrankung noch leiden.
Die von der Obersten Gesundheitsbehörde Frankreichs (HAS) empfohlenen Untersuchungen
Notieren Sie in der Tabelle, welche Untersuchungen Sie gemacht haben.
Zusatzuntersuchungen
Durchgeführt
Datum
Normaler Befund
Pathologischer Befund
Zusatzuntersuchungen
Ja
Nein
PCR-Test SARS-CoV-2
SARS-CoV-2-Antikörpertest
Erste Thorax-Computertomografie
Herzultraschall
Elektrokardiogramm
Thorax-Computertomografie nach drei Monaten
Lungenfunktionstests
Standard-Laboruntersuchungen
Ferritinwerte
Troponin
D-Dimere
CRP
Die Entstehung desLONG-COVID-PROGRAMMS
Wie viele andere Krankenhauseinrichtungen nimmt die Klinik Foch in Suresnes Menschen auf, die mittelschwer oder schwer an Covid-19 erkrankt sind. Jeder potenziell schwere Covid-Fall durchläuft den Notdienst, dessen Reanimationsteam seinen Personalbestand inzwischen verdreifacht hat.
Long-Covid-Patienten hingegen haben keine Symptome, die eine erneute Krankenhausaufnahme notwendig machen, und beginnen ihren Genesungsprozess zu Hause. Die Notfallmediziner und die Reanimationsteams der Klinik Foch berichteten, dass Anstrengung die Atembeschwerden und Schmerzen der Patienten verstärkte. Aus diesem Grund kamen wir zum Schluss, dass diese Patienten nicht auf einer Tragbahre der Notfallstation, also im Ruhezustand, untersucht werden sollten, sondern dass das Resultat eines Gehtests oder eine Belastungsprobe auf dem Fahrradergometer viel aufschlussreicher wäre.
Das war die Geburtsstunde des Long-Covid-Programms. Die Abteilung für funktionelle Rehabilitation der Klinik Foch untersucht schon seit 2015 die körperliche Verfassung von Krebspatienten, die sich einer Operation unterziehen müssen, auf die manchmal begleitend eine Bestrahlung oder Chemotherapie folgt. Pate für diesen innovativen Ansatz stand ein kanadisches Programm, das Prof. Francesco Carli, Anästhesist und Ausbilder an der McGill-Universität in Montreal, entwickelte: das perioperative Programm (peri operative program, POP). Das multidisziplinäre Konzept zur Erfassung und zum Wiederaufbau der körperlichen Leistungsfähigkeit hat seine Wirksamkeit bereits unter Beweis gestellt und ist auf dem besten Weg, zu einem Eckstein der perioperativen Pflege (der Versorgung vor, während und nach der Operation) von Krebskranken zu werden.
Da die Asthenie von Long-Covid-Patienten dem Erschöpfungszustand von Krebspatienten sehr nahekam, konnte man auch deren körperliche Verfassung mit der gleichen Methode bewerten. Es überrascht also keineswegs, dass die Abteilung für funktionelle Rehabilitation der Klinik Foch auch sie vom perioperativen Programm von Prof. Carli profitieren lässt.
Was bei Laboruntersuchungen und statischer Bildgebung verborgen blieb, kam so bei Belastungstests ans Licht.
Das Profil der Long-Covid-Patienten
Schon in den ersten Monaten stellte sich ein Profilbild des typischen Long-Covid-Patienten heraus. Während auf der Intensivstation mehrheitlich Männer über 75 Jahren mit Übergewicht und kardiovaskulären Begleiterkrankungen liegen, haben Long-Covid-Patienten nur eine leichte Form von Covid-19 durchgemacht. Es handelt sich hauptsächlich um Frauen und Männer unter 60 Jahren, die weder übergewichtig sind noch an kardiovaskulären Vorerkrankungen leiden. Bereits bei den ersten Auswertungen offenbarten sich drei Hauptprofile: mangelernährte Patienten mit eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit; unter Stress oder Angststörungen leidende Patienten; unter Langzeitfolgen leidende Patienten.
Mangelernährte Patienten mit eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit
Diese Patienten haben während ihrer akuten Covid-Erkrankung, oft schon in den ersten zwei Wochen, zwischen fünf und zehn Prozent Gewicht verloren und nicht wieder zugenommen. Das geht sehr schnell: Wenn jemand 60 Kilogramm wiegt, bedeutet ein Verlust von zehn Prozent des Körpergewichts, dass er sechs Kilogramm abnimmt. Ernährungswissenschaftler bezeichnen dies als schwere Mangelernährung. Ursache des Gewichtsverlusts ist, dass bei akuten Infektionskrankheiten dem Körper zur Fieberbekämpfung Wasser entzogen und gleichzeitig Muskelmasse abgebaut wird. Es ist also nicht schwer zu verstehen, dass diese Patienten aufgrund des Muskelschwunds schnell ermüden.
Unter Stress oder Angststörungen leidende Patienten
Diese Menschen saugen den emotionalen Stress in ihrer Umgebung wie Schwämme auf. Nun ist man natürlich vor dem Hintergrund einer weltweiten Pandemie, wo täglich die Zahl der Toten, der Patienten auf der Intensivstation und der Tausenden Infizierten verkündet wird, enormem Stress ausgesetzt. Es ist verständlich, dass die Ansteckung mit Covid-19 vielerlei Ängste auslöst: Man könnte daran sterben, seine Angehörigen anstecken, Folgeschäden davontragen, den Arbeitsplatz verlieren oder nicht mehr fähig sein, sich um seine Kinder zu kümmern. Angst und Sorge nehmen immer mehr Raum ein, bis schließlich der Zusammenbruch folgt. Es ist eine Art »pandemisches Burn-out«.
An Langzeitfolgen (PASC) leidende Patienten
Diese Patienten leiden unter Funktionsstörungen des Herz-Kreislauf-Systems, des Verdauungsoder des neurokognitiven Systems, obwohl keine Organverletzungen feststellbar sind. Die meisten Long-Covid-Patienten leiden an Symptomen, die in mehrere der folgenden Kategorien gehören:
Atmungsstörungen
Herzstörungen
Verdauungsstörungen
neurokognitive Störungen
Haut-, Gefäß- und Wärmeregulationsstörungen
Dank der Gruppierung der Symptome in mehrere Kategorien konnten sich die Ärzte auf eine Beschreibung von Long-Covid einigen. Praktisch immer vorhanden sind Erschöpfung und Geschmacks- und Geruchsstörungen. Die Suche nach dem Zusammenhang zwischen den verschiedenen Kategorien führte bereits ab Ende Juli 2020 auf die Spur der autonomen Dysfunktion (beschrieben in Teil I, Kapitel 7).
In Teil I dieses Buches nehmen wir alle von Patienten angegebenen Symptome unter die Lupe, die als Covid-Langzeitfolgen anerkannt wurden, seit das Expertenteam der obersten Französischen Gesundheitsbehörde am 10. Februar 2021 einen Leitfaden zur Diagnose und Behandlung von Long-Covid bei Erwachsenen publiziert hat.7
Eine neue Seite aufschlagen oder wie Long-Covid-Patienten wieder in Form kommen
Das Long-Covid-Programm bietet Patienten die Möglichkeit, ihre Belastungsfähigkeit durch selbstständiges und auf sie zugeschnittenes Training schrittweise wieder aufzubauen, bei Bedarf unter Supervision eines Physiotherapeuten.
Ausgehend vom Formzustand des Patienten werden realistische Ziele festgelegt, die er schrittweise erreichen soll. Das Programm berücksichtigt die vier bekannten Faktoren, die für jede sportliche Leistung entscheidend sind:
Mentales Wohlbefinden
Gesunde Ernährung
Guter Schlaf
Körperliches Wohlbefinden
Bevor der Patient das Aufbautraining beginnt, werden seine funktionellen Fähigkeiten und sein Umfeld anhand einer multidisziplinären Bestandsaufnahme ausgewertet. Auf dieser Basis entsteht ein speziell auf den Betroffenen zugeschnittenes Programm, das diesen dazu bringt, sein Verhalten zu ändern und so seinen Formzustand zu verbessern.
An der Klinik Foch dauert die Bestandsaufnahme drei bis vier Stunden. In dieser Zeit füllt der Patient zahlreiche Fragebogen aus, unterhält sich mit vier verschiedenen medizinischen Fachkräften (einem Arzt, einem Physiotherapeuten, einer Diätassistentin und einer klinischen Psychologin) und wird einer Reihe von körperlichen Untersuchungen unterzogen, damit seine Muskelkraft und seine kardiorespiratorische Ausdauer beurteilt werden können.
Unterhaltung mit einem Psychologen
Ziel der Unterhaltung ist, den psychologischen Zustand des Patienten zu beurteilen; seine Stimmung (Thymusfunktion), seine Angst (wie er mit dem Alltagsstress umgeht) und eine mögliche Depression, die durch die Covid-Erkrankung verschlimmert oder ausgelöst worden ist.
Ausgehend von einem Fragebogen, den der Patient im Wartezimmer selbstständig ausfüllt, konzentriert sich die Psychologin im Gespräch auf vier Fragestellungen:
Über welche psychologischen Ressourcen verfügt der Patient? Braucht er psychologische Betreuung, und wenn ja, welcher Art (zum Beispiel Verhaltenstherapie, kognitive Therapie, Hypnotherapie)?
Leidet der Patient an neurokognitiven Störungen, die eine ausführlichere Untersuchung bei einem Neuropsychologen nötig machen?
Sollte der Patient einen Spezialisten konsultieren, weil er an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, eine schwere Depression zu entwickeln droht oder die aktuelle Situation seine bereits vorhandene emotionale Fragilität dekompensieren könnte?
Ist eine Untersuchung oder die Behandlung von Schlafproblemen nötig?
Gespräch mit einer Diätassistentin
Manche Long-Covid-Patienten verlieren aufgrund von hohem Fieber und Durchfällen, die Muskelschwund (Sarkopenie) und Dehydrierung verursachen, zwischen fünf und zehn Prozent ihres Körpergewichts. Die Überprüfung der Gewichtsverteilung mithilfe einer Körperanalysewaage und die Auswertung eines Ernährungstagebuchs, das jeder Patient im Wartezimmer ausfüllt, geben Auskunft über den Verlauf dieser Gewichtsänderung. Die Diätassistentin erstellt dann das Ernährungsprofil des Patienten, beurteilt seinen Ernährungszustand und vereinbart mit ihm, wie er Muskelmasse auf- oder Fettmasse abbauen kann. Sie händigt dem Patienten ein Begleitheftchen aus, in dem er anhand von Beispielen sieht, wie er sein Essverhalten ändern kann. Das Gespräch hat also folgende Ziele:
Beurteilung des Ernährungszustands des Patienten
Festlegung der Ziele zur Veränderung der Gewichtsverteilung
Hilfsmittel zur Veränderung des Essverhaltens
Wenn die Situation zu komplex ist, wird dem Patienten geraten, eine Ernährungsberatung außerhalb der Klinik aufzusuchen.
Erstellen einer Muskelbilanz mit einem Physiotherapeuten
Im Verlauf der Untersuchung wertet der Physiotherapeut den Zustand des Muskelapparats und die Kondition aus und bestimmt den Schwierigkeitsgrad der Übungen, die der Patient im Rahmen des Programms zu Hause durchführen soll.
Die Muskelkraft wird hauptsächlich anhand bekannter Techniken, die von allen Rehabilitationszentren anerkannt werden, bestimmt.
Handgriffstärke (
handgrip strength test
) und Extensionskraft des Quadrizeps:
Zur Messung der Greifkraft drückt der Patient einen Griff, der mit einem Dynamometer ausgerüstet ist; beim Quadrizepstest sitzt der Patient mit gebeugtem Knie und streckt dann das Bein gegen einen Widerstand durch. Das Dynamometer zeigt die erzeugte Kraft an. Beim Vergleich mit den von Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht abhängigen Normwerten wird klar, ob ein objektiver Kraftverlust vorliegt. Mithilfe von Messungen lassen sich auch die Fortschritte mitverfolgen, die der Patient im Verlauf der Rekonvaleszenz beim Wiederaufbau der Muskelmasse erzielt.
Gehtest:
Der Patient absolviert den sogenannten 6-Minuten-Gehtest. Dabei soll er einen ausgemessenen Flur so oft wie möglich auf- und abgehen. Nach sechs Minuten berechnet der Physiotherapeut die zurückgelegte Distanz. Der Test gibt nicht nur Auskunft über die kardiorespiratorische Ausdauer, sondern auch über die Sauerstoffsättigung im Blut des Patienten, der während der Belastung einen Pulsoximeter trägt. Weist ein Long-Covid-Patient im Ruhezustand oder unter Belastung eine Sauerstoffentsättigung auf, muss ein Lungenfacharzt abklären, ob eine Lungenfibrose vorliegt.
Liegestütze:
Der Physiotherapeut legt den Schwierigkeitsgrad der Kräftigungsübungen fest, die der Patient im Rahmen des Covid-Rehaprogramms ausführen soll. Zur Stärkung der Arm- und Schultermuskulatur sind Liegestütze vorgesehen. Dabei gibt es drei Level: Liegestütze gegen die Wand (Level 1, leicht), Liegestütze an einem Tisch (Level 2, mittelschwer), Liegestütze auf dem Boden mit abgelegten Knien (Level 3, schwierig). Nach Abschluss der Muskelbilanz kennt der Patient sein Level und weiß, wie viele Sätze jeder Übung er während des Covid-Rehaprogramms dreimal wöchentlich machen muss.
Spiroergometrie auf dem Fahrrad und Arztgespräch
Am genausten kann ein Facharzt die funktionelle Leistungsfähigkeit von Long-Covid-Patienten ermitteln, indem er eine Spiroergometrie durchführt. Zunächst nimmt der Arzt eine kardiologische Anamnese vor und notiert, welche Medikamente der Patient einnimmt. Dann lässt er ihn eine 15- bis 20-minütige »Fahrradtour« machen. Zunächst klebt er dem Patienten Elektroden auf die Brust und rüstet ihn mit einem digitalen Sauerstoffgerät und einer Blutdruckmanschette aus. Der Proband sieht nun ein bisschen wie ein Weihnachtsbaum aus. Der Arzt setzt ihm auch eine Maske auf, die Mund und Nase bedeckt und während der Belastung den Sauerstoffverbrauch und die Produktion von Kohlendioxid misst.
Der Test beginnt mit einer Ruhephase, auf die ein Valsalva-Manöver8 mit einer 15-sekündigen Apnoe9 durch verschlossene Atemwege folgt. So könnte eine Abweichung der Herzfrequenz um mehr als zehn Schläge festgestellt werden, ein erstes Anzeichen für eine kardiale Dysautonomie.
Nun wird eine Spirometrie ausgeführt, die klärt, ob eine restriktive oder obstruktive Ventilationsstörung vorliegt, die auf ein vermindertes Atemvolumen oder Asthma hindeuten würde.
Erst jetzt beginnt die eigentliche Spiroergometrie, bei der jede Testperson mit dem Fahrrad eine ihrem Leistungsvermögen angepasste Steigung bewältigen muss, bis sie ihre Belastungsgrenze erreicht. Während des Tests überwacht der Arzt die Sauerstoffsättigung im Blut, die Herzfrequenz und den Blutdruck. Außerdem beobachtet er, wie der Patient seine Atmung der kontinuierlich steigenden Belastungsintensität anpasst: So lässt sich ein Hyperventilationssyndrom bestätigen. Die Untersuchung fördert nicht nur kardiologische Störungen zutage, die beim Ruhe-EKG unbemerkt blieben, sondern auch das Syndrom der »kleinen Lungen«. Und sie bestimmt den Intensitätsgrad des Aufbautrainings.





























