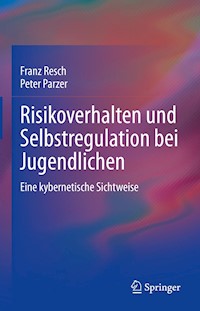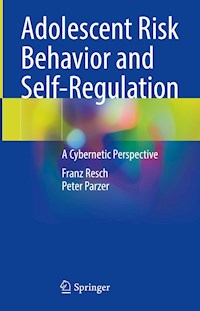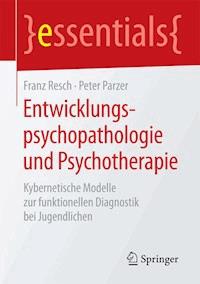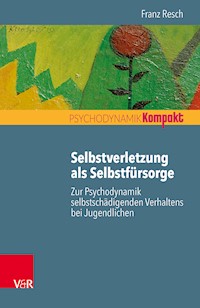
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Psychodynamik kompakt
- Sprache: Deutsch
Selbstverletzungen als Symptom einer Entwicklungsstörung des Selbst bei Jugendlichen haben in den letzten Jahren zunehmende Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zweifellos gibt es Unterschiede zwischen den Körperinszenierungen der Jugend von heute zu früheren Jugendkulturen, vor allem was die Dynamik und Radikalität der Verdinglichung des eigenen Körpers angeht. Selbstverletzungen besitzen eine paradoxe Funktion der Selbstfürsorge. Sie reduzieren unerträgliche Spannungszustände, lassen drängende Suizidideen in den Hintergrund treten und unterbrechen die Angst vor Selbstverlust und ein Gefühl, "verrückt zu werden". Biographisch finden sich häufig kindliche Traumatisierungen bis hin zu sexuellen Missbrauchserlebnissen, die zumeist auf der Basis einer tiefgreifenden emotionalen Vernachlässigung in den frühen Beziehungen aufbauen. Die komplexe Psychodynamik des selbstverletzenden Verhaltens bei Jugendlichen wird anschaulich erklärt und mündet in praxisbezogene Therapieempfehlungen. Denn: Selbstverletzende Intentionen und Handlungen können heute erfolgreich behandelt werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 71
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Franz Resch
Selbstverletzung als Selbstfürsorge
Zur Psychodynamik selbstschädigenden Verhaltens bei Jugendlichen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99852-7
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
Umschlagabbildung: Paul Klee, Drei Blumen, 1920/akg‐images
© 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen / Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Inhalt
Vorwort zur Reihe
Vorwort zum Band
1 Einleitung
2 Geschichte und kulturelle Einbettung
3 Beschreibung und Definitionen
4 Klinisches Bild
5 Komorbidität
6 Bausteine einer Pathogenese: Somatische Befunde
7 Bausteine einer Pathogenese: Trauma und Biografie
8 Auslöser und Ansteckungsphänomene
9 Motive der Selbstverletzung
10 Psychodynamik
10.1 Psychische Struktur und Konflikt
10.2 Das archaische Über-Ich
10.3 Dissoziation und Fragmentation
10.4 Selbstkompetenz und Selbstfürsorge
10.5 Interaktionelle Verstrickung
11Verlauf – Selbstverletzung als Sucht?
12 Therapie
12.1 Akutversorgung und Setting
12.2 Therapiekonzepte
12.3 Kooperation mit dem therapeutischen Umfeld
12.4 Umgang mit Suizidalität
12.5 Der psychodynamische Rahmen
Literatur
Vorwort zur Reihe
Zielsetzung von PSYCHODYNAMIK KOMPAKT ist es, alle psychotherapeutisch Interessierten, die in verschiedenen Settings mit unterschiedlichen Klientengruppen arbeiten, zu aktuellen und wichtigen Fragestellungen anzusprechen. Die Reihe soll Diskussionsgrundlagen liefern, den Forschungsstand aufarbeiten, Therapieerfahrungen vermitteln und neue Konzepte vorstellen: theoretisch fundiert, kurz, bündig und praxistauglich.
Die Psychoanalyse hat nicht nur historisch beeindruckende Modellvorstellungen für das Verständnis und die psychotherapeutische Behandlung von Patienten hervorgebracht. In den letzten Jahren sind neue Entwicklungen hinzugekommen, die klassische Konzepte erweitern, ergänzen und für den therapeutischen Alltag fruchtbar machen. Psychodynamisch denken und handeln ist mehr und mehr in verschiedensten Berufsfeldern gefordert, nicht nur in den klassischen psychotherapeutischen Angeboten. Mit einer schlanken Handreichung von 60 bis 70 Seiten je Band kann sich der Leser schnell und kompetent zu den unterschiedlichen Themen auf den Stand bringen.
Themenschwerpunkte sind unter anderem:
–Kernbegriffe und Konzepte wie zum Beispiel therapeutische Haltung und therapeutische Beziehung, Widerstand und Abwehr, Interventionsformen, Arbeitsbündnis, Übertragung und Gegenübertragung, Trauma, Mitgefühl und Achtsamkeit, Autonomie und Selbstbestimmung, Bindung.
–Neuere und integrative Konzepte und Behandlungsansätze wie zum Beispiel Übertragungsfokussierte Psychotherapie, Schematherapie, Mentalisierungsbasierte Therapie, Traumatherapie, internetbasierte Therapie, Psychotherapie und Pharmakotherapie, Verhaltenstherapie und psychodynamische Ansätze.
–Störungsbezogene Behandlungsansätze wie zum Beispiel Dissoziation und Traumatisierung, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen, Borderline-Störungen bei Männern, autistische Störungen, ADHS bei Frauen.
–Lösungen für Problemsituationen in Behandlungen wie zum Beispiel bei Beginn und Ende der Therapie, suizidalen Gefährdungen, Schweigen, Verweigern, Agieren, Therapieabbrüchen; Kunst als therapeutisches Medium, Symbolisierung und Kreativität, Umgang mit Grenzen.
–Arbeitsfelder jenseits klassischer Settings wie zum Beispiel Supervision, psychodynamische Beratung, Arbeit mit Geflüchteten und Migranten, Psychotherapie im Alter, die Arbeit mit Angehörigen, Eltern, Familien, Gruppen, Eltern-Säuglings-Kleinkind-Psychotherapie.
–Berufsbild, Effektivität, Evaluation wie zum Beispiel zentrale Wirkprinzipien psychodynamischer Therapie, psychotherapeutische Identität, Psychotherapieforschung.
Alle Themen werden von ausgewiesenen Expertinnen und Experten bearbeitet. Die Bände enthalten Fallbeispiele und konkrete Umsetzungen für psychodynamisches Arbeiten. Ziel ist es, auch jenseits des therapeutischen Schulendenkens psychodynamische Konzepte verstehbar zu machen, deren Wirkprinzipien und Praxisfelder aufzuzeigen und damit für alle Therapeutinnen und Therapeuten eine gemeinsame Verständnisgrundlage zu schaffen, die den Dialog befördern kann.
Franz Resch und Inge Seiffge-Krenke
Vorwort zum Band
Selbstverletzungen als Symptom einer Entwicklungsstörung des Selbst bei Jugendlichen haben in den letzten Jahren zunehmende Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zweifellos gibt es Unterschiede zwischen den Körperinszenierungen der Jugend von heute zu früheren Jugendkulturen, vor allem was die Dynamik und Radikalität der Verdinglichung des eigenen Körpers angeht. Mit diesem Buch ist Franz Resch ein ganz großartiger Wurf gelungen, denn hier geht es nicht nur um die kulturelle Herleitung, sondern er räumt in erfrischender Weise mit ganz viel Vorteilen und Verallgemeinerungen auf wie »Mädchen schneiden – Jungen agieren aus« und »alle, die ritzen, sind Borderliner«. Tatsächlich ist es klinisch wichtig, zwischen den »Nachahmungstaten« im Peer-Kontext und dem Schneiden aufgrund dramatischer biografischer Erfahrungen mit dem Zusammenbruch des Selbstregulationssystems zu unterscheiden.
Für die Jugendlichen, die zu uns in die Praxen und Kliniken kommen, erfüllen Selbstverletzungen sehr unterschiedliche Funktionen; dies es gilt zu erkennen und, am Beginn der Therapie, auch ein Stück weit zu akzeptieren, stellen sie doch Bewältigungsversuche dar, um dem »verletzten Selbst« zu helfen. So beängstigend und schockierend die dramatischen, tiefgehenden Schnitte, die Selbstverstümmelungen, Brandverletzungen sind, wir müssen verstehen, dass Selbstverletzungen eine paradoxe Funktion der Selbstfürsorge darstellen können. Sie reduzieren unerträgliche Spannungszustände, lassen drängende Suizidideen in den Hintergrund treten und unterbrechen die Angst vor Selbstverlust und ein Gefühl, »verrückt zu werden«. Biografisch finden sich häufig kindliche Traumatisierungen bis hin zu sexuellen Missbrauchserlebnissen, die zumeist auf der Basis einer tief greifenden emotionalen Vernachlässigung in den frühen Beziehungen aufbauen.
Bei der Differenzierung von Formen und Funktionen der Selbstverletzung ist die in diesem Buch vorgenommene Untergliederung in vier Strukturlevel mit unterschiedlichem Adaptationsniveau bedeutsam, sie führen nämlich auch zu einem ganz unterschiedlichen Verlauf der Selbstverletzung. Dies ist hochwichtig und hilfreich für Kliniker, nicht zuletzt deshalb, weil sich daraus ganz verschiedene Behandlungskonsequenzen ergeben.
Wegen der großen interaktionellen Bedeutung der Selbstverletzung im therapeutischen Kontext nimmt die psychodynamische Perspektive einen breiten Raum ein. Die Sorge des Therapeuten, der Therapeutin, die Hilflosigkeit, die Schwierigkeit, den Verlauf einzuschätzen und das Agieren einzudämmen, werden eindrucksvoll beschrieben, aber auch die Arbeit mit den Eltern (und manchen Praxiseinrichtungen!) kann belastend sein. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Praxiseinrichtungen ist dennoch dringend erforderlich und wird anschaulich beschrieben. Die kritische Sicht auf die stationäre Aufnahme, die ja auch Reduktion von Kompetenz mit sich bringen kann, tut gut – vor allem den vielen Therapeuten und Therapeutinnen, die ambulant arbeiten und es häufig als ein Versagen erleben, wenn ambulante Patienten aufgrund einer Zuspitzung der Selbstverletzung in die Klinik müssen.
Die komplexe Psychodynamik des selbstverletzenden Verhaltens bei Jugendlichen mündet in praxisbezogene Therapieempfehlungen. Denn: Selbstverletzende Intentionen und Handlungen können heute erfolgreich behandelt werden. Man merkt dem Buch an, dass es auf einer jahrzehntelangen klinischen Erfahrung der Heidelberger Klinik für Kinder- und Jugendspsychiatrie im Umgang mit diesem komplexen Krankheitsbild beruht. Die vorgestellten Überlegungen helfen allen therapeutisch Tätigen, das Thema aktiv anzugehen, und nehmen ihre Sorgen und Probleme, ihre Gegenübertragungsgefühle empathisch auf. Ein mutiges und klar strukturiertes Buch, das hilft, die therapeutische Beziehung mit diesen so beeinträchtigten Patientinnen und Patienten zu gestalten. Es veranschaulicht im besten Sinne Winnicotts »concern« für den Patienten, die Patientin und ermutigt, die Verantwortung mit anderen zu teilen.
Inge Seiffge-Krenke
1 Einleitung
Ein beunruhigendes Bild bietet sich uns Therapeutinnen und Therapeuten heute immer wieder: Jugendliche, die sich tiefe Schnittverletzungen an Armen und Beinen, Bauch und Brust, ja sogar im Gesicht zufügen, Jugendliche, die Zigaretten an ihren Unterarmen ausdrücken oder ihre Finger absichtlich in sich schließende Türen halten. Jugendliche, die Haarlack und Deospray einatmen oder spitze Gegenstände schlucken, um sich Schaden zuzufügen.
Verzweiflung und Hass, Vorwurf und Selbstverachtung kommen dabei zum Ausdruck – ein fatales Spiel mit sich selbst ohne Freude, dramatische Inszenierungen, Schmerz, Wut und Blut, Selbstsuche und Selbstabwertung in einem Atemzug (Resch, 2001a). Über diesen verzweifelten Aktionen liegt die Scham, die manchmal das Geschehene mit Heimlichkeit zudeckt, wobei an anderer Stelle die Verzweiflung sich Bahn bricht und die Verletzungen in greller Öffentlichkeit zur Schau stellen lässt.
Neben diesen tief greifenden Beeinträchtigungen finden wir bei vielen Jugendlichen oberflächliche Manipulationen am Körper, die diesen wie ein Ding erscheinen lassen, wenn Jugendliche ihre Körperoberflächen ritzen und mit Texturen überziehen, sich Schriften eingravieren oder mit spitzen Gegenständen, scharfen Rasierklingen oder Glasscherben aus frisch zerschlagenen Trinkgläsern blutende Schnitte zufügen. Der Drang, sich zu ritzen, kann ansteckend werden – es gibt Gruppen, in denen, kaum dass einer sich zu schneiden beginnt, die anderen bereitwillig mitziehen. Epidemische Selbstverletzung werden solche Phänomene genannt.
Im therapeutischen Alltag kommen alle diese Formen vor. Selbstverletzungen als Ausdruck einer Störung in der Selbstentwicklung haben in den letzten Jahren offenbar zugenommen. Woher kommt das? Wohin wird das führen? Das vorliegende Buch will einige Antworten aus Sicht der Psychodynamik versuchen.
Durch zwei Selbstberichte von Patientinnen wird das grundlegende Problem abgesteckt:
»Wenn ich mich selbst nicht mehr spüre, dann schneide ich mich und merke, dass ich noch lebe …« (Zitat einer 16-jährigen Patientin).
»Wenn etwas mir im Inneren schrecklich wehtut, dann verletze ich mich, damit ihr seht, wie sehr es mir wehtut …« (Zitat einer 15-jährigen Patientin).
Im Folgenden werden sowohl selbstbezogene Aspekte der Selbstverletzung als auch die interaktionellen Bedeutungen von selbstverletzenden Akten näher beleuchtet.
2 Geschichte und kulturelle Einbettung