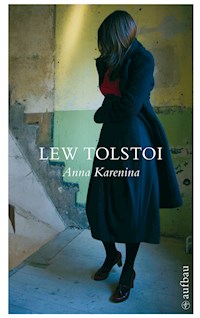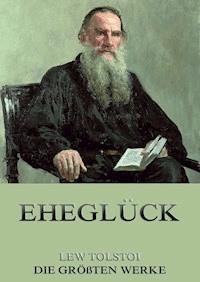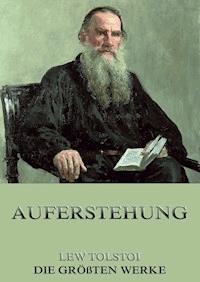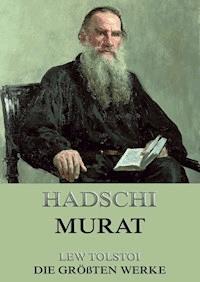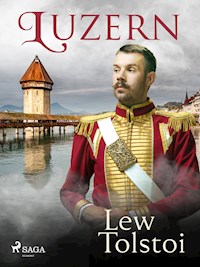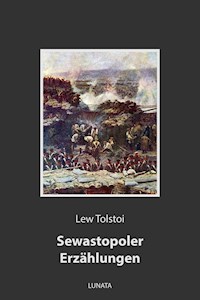
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Sewastopoler Erzählungen enthalten drei narrative Berichte über Tolstois zunächst enthusiastische Teilnahme am Krimkrieg: Sewastopol im Dezember 1854, Sewastopol im Mai 1855 und Sewastopol im August 1855. Tolstoi wendet sich stets direkt an den Leser und spricht ihn an, so dass beim Leser der Eindruck entsteht, als würde er mit Tolstoi einen Spaziergang durch die stark umkämpfte Stadt machen. Die Sewastopol-Trilogie bildete einen Wendepunkt in der russischen Kriegserzählung, denn Tolstoi wandte in ihnen zum ersten Mal eine neue und für die damalige Zeit ungewöhnliche Art des Berichtens über den Krieg an: profunde Kenntnisse auf militärischem Gebiet, kombiniert mit einer schonungslosen Darstellung dessen selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUNATA
Sewastopoler Erzählungen
Lew Tolstoi
Sewastopoler Erzählungen
© 1856 Lew Tolstoi
Originaltitel Sevastopol'skie rasskazy
Aus dem Russischen von Hanny Brentano
Illustrationen A. Brentano
Umschlagbild Franz Roubaud
© Lunata Berlin 2020
Inhalt
Sewastopol im Dezember 1854
Sewastopol im Mai 1855
Sewastopol im August 1855
Sewastopol im Dezember 1854
Die Morgenröte beginnt eben erst den Himmelsrand über dem Sapunberge zu färben; die dunkelblaue Meeresfläche hat bereits die Dämmerung der Nacht abgestreift und harrt des ersten Sonnenstrahls, um in frohem Glanze aufzuleuchten; von der Bucht her weht es kalt und feucht; es liegt kein Schnee, alles ist schwarz, aber der schneidende Morgenfrost legt sich aufs Gesicht und knirscht unter den Füßen, und das ferne, nie verstummende Meeresbrausen, das hier und da von den rollenden Schüssen in Sewastopol übertönt wird, stört die Stille des Morgens. Auf den Schiffen ist es ruhig. Die achte Stunde schlägt.
Auf der Nordseite beginnt die Tätigkeit des Tages die Ruhe der Nacht allmählich zu verdrängen: hier schreitet eine Wachablösung waffenklirrend vorüber, dort eilt ein Arzt bereits ins Lazarett; da kriecht ein Soldat aus der Erdhütte, wäscht das sonnverbrannte Gesicht im eisigen Wasser, wendet sich dem rötlich schimmernden Osthimmel zu und betet, sich schnell bekreuzigend, zu Gott; hier rollt eine hohe, schwere Madschara1, von Kamelen gezogen, knarrend zum Friedhof hinaus; sie ist fast bis an den Rand mit blutigen Leichnamen beladen, die nun beerdigt werden sollen ... Ihr nähert euch dem Landungsplatze, – ein eigentümlicher Geruch von Steinkohle, Dünger, Feuchtigkeit und Fleisch schlägt euch entgegen; tausenderlei verschiedene Dinge – Holz, Fleisch, Schanzkörbe, Mehl, Eisen usw. – liegen haufenweise neben der Landungsbrücke; Soldaten verschiedener Regimenter mit Säcken und Gewehren oder ohne Säcke und Gewehre drängen sich hier, rauchen, zanken sich, schleppen Lasten auf den Dampfer, der qualmend an der Brücke liegt; Privatjollen, die mit allerlei Volk – Soldaten, Matrosen, Händlern, Weibern – angefüllt sind, legen an der Brücke an oder stoßen ab.
»Nach der Grafskaja, Euer Wohlgeboren? Bitte!« bieten euch zwei oder drei verabschiedete Matrosen ihre Dienste an, indem sie sich aus ihren Jollen erheben.
Ihr wählt den, der euch am nächsten ist, schreitet über den halbverfaulten Kadaver eines braunen Pferdes, der hier im Schmutz neben dem Boot liegt, und begebt euch ans Steuerruder. Ihr stoßt vom Ufer ab. Rund umher leuchtet nun schon die See in der Morgensonne; vor euch habt ihr einen alten Matrosen in einem Gewande aus Kamelhaar und einen jungen, blondköpfigen Burschen, die schweigend eifrig drauf los rudern. Ihr überblickt die gestreiften Riesenleiber der Schiffe, die nah und fern über die Bucht verstreut sind, und die kleinen schwarzen Punkte der Schaluppen, die sich auf dem glänzenden Azurblau bewegen, und die hübschen hellen Häuser der Stadt, die – von den rosigen Strahlen der Morgensonne umspielt – auf dem jenseitigen Ufer sichtbar werden, und die schaumbespritzte weiße Linie des Molo und der versenkten Schiffe, deren schwarze Mastenspitzen hier und da düster aus dem Wasser ragen, und die feindliche Flotte, die in der Ferne an dem kristallklaren Horizonte aufschimmert, und die schäumenden Furchen, auf denen die durch die Ruder verursachten salzigen Bläschen hüpfen; ihr hört die gleichmäßigen Laute von Stimmen, die über das Wasser bis zu euch dringen, und das majestätische Rollen der Kanonade, die sich drüben in Sewastopol zu verstärken scheint.
Es ist unmöglich, daß bei dem Gedanken: auch wir sind in Sewastopol, eure Seele nicht erfüllt werde von einem Gefühl der Tapferkeit, des Stolzes, und daß das Blut nicht schneller durch eure Adern rinne.
»Euer Wohlgeboren! halten Sie grade auf den Kistentin (das Schiff »Konstantin«) zu,« ruft der alte Matrose, indem er sich zurückwendet, um die Richtung zu prüfen, die ihr dem Boote gebt, »das Steuer rechts!«
»Und er hat noch alle seine Kanonen,« bemerkt der blondhaarige Bursche, am Schiff vorbeifahrend und es musternd.
»Natürlich, er ist ja neu; Kornilow hat ihn befehligt,« erwidert der Alte, das Schiff ebenfalls betrachtend.
»Da schau, wo die platzt!« sagt der Knabe nach langem Schweigen, während er auf ein weißes Wölkchen zerflatternden Rauches blickt, das plötzlich hoch über der südlichen Bucht erscheint, und von dem scharfen Geräusch einer platzenden Bombe begleitet ist.
»Er feuert heut von der neuen Batterie,« erklärt der Alte, kaltblütig in die Hände spuckend; »na, streng' dich mal an, Mischka, wir wollen die Barkasse überholen!« – Und die Jolle gleitet schneller über die breite, wogende Bucht dahin, überholt tatsächlich die schwere Barkasse, die mit irgendwelchen Säcken beladen ist und von ungeschickten Soldaten ungleichmäßig gerudert wird, und landet zwischen einer Unzahl am Ufer befestigter Bote jeder Art an der Grafskaja-Brücke.
Auf dem Kai bewegen sich lärmende Gruppen grauer Soldaten, schwarzer Matrosen und bunter Frauen. Alte Weiber verkaufen Semmeln, russische Bauern mit Samowars schreien: »Heißer Sbitenj2!« Und gleich hier auf den ersten Stufen der Landungstruppe stößt man auf verrostete Kanonenkugeln, Bomben, Kartätschen und gußeiserne Geschütze verschiedenen Kalibers; ein wenig weiter, auf dem großen Platze, liegen mächtige Balken, Kanonenlafetten, schlafende Soldaten, stehen Pferde, Fuhrwerke, grüne Pulverkästen mit Geschützen, Sturmböcke der Infanterie, bewegen sich Soldaten, Matrosen, Offiziere, Frauen, Kinder und Händler, fahren Lastwagen mit Heu, mit Säcken oder Tonnen; hier reitet ein Kosak und ein Offizier, dort fährt ein General in einer Droschke. Rechts ist die Straße durch eine Barrikade versperrt, in deren Schießscharten kleine Kanonen stehen; daneben sitzt ein Matrose, der sein Pfeifchen raucht. Links erhebt sich ein hübsches Haus mit römischen Ziffern unterm Giebel, und davor stehen Soldaten mit blutbefleckten Tragbahren, – überall seht ihr die unangenehmen Kennzeichen eines Kriegslagers. Der erste Eindruck ist unbedingt ein sehr unsympathischer: die seltsame Vermischung des Lager- und Stadtlebens, der schönen Stadt und des schmutzigen Biwaks ist nicht nur häßlich, sondern erscheint auch wie ein widerwärtiges Durcheinander; es ist, als wären alle erschreckt und in Hast, als wüßte niemand, was er tun soll. Aber blickt nur genauer in die Gesichter dieser Menschen, die sich um euch bewegen, und ihr werdet ganz andrer Meinung werden. Betrachtet zum Beispiel jenen Trainsoldaten, der seine drei Braunen zur Tränke führt und dabei so ruhig vor sich hinsummt, daß man es ihm anmerkt, er wird sich in dieser bunten Menge, die für ihn gar nicht existiert, nicht verirren, er erfüllt seine Pflicht, welche es auch sei – Pferde tränken oder Geschütze schleppen –, ebenso ruhig, selbstbewußt und gleichmütig, als geschehe das alles irgendwo im Tula oder in Saransk. Denselben Ausdruck findet ihr auf dem Gesicht des Offiziers, der in tadellos weißen Handschuhen an euch vorübergeht, und des Matrosen, der rauchend auf der Barrikade sitzt, und auf den Gesichtern der Soldaten, die mit ihren Tragbahren auf der Treppe des ehemaligen Kasinos warten, und auf dem Gesicht des jungen Mädchens, das, in der Furcht, sein rosafarbenes Kleid naß zu machen, von Stein zu Stein über die Straße hüpft.
Ja! euch steht unbedingt eine Enttäuschung bevor, wenn ihr zum erstenmal in Sewastopol ankommt. Vergebens werdet ihr auf den Gesichtern nach Spuren der Unruhe und Kopflosigkeit, oder der Begeisterung, der Todesbereitschaft und Entschlossenheit suchen; nichts von alledem ist zu bemerken: ihr findet nur Alltagsmenschen, die sich ruhig mit ihrer Alltagsarbeit befassen, so daß ihr euch vielleicht den Vorwurf übermäßiger Begeisterung machen werdet, daß ihr ein wenig zweifeln werdet an der Richtigkeit der Vorstellung vom Heldenmut der Verteidiger Sewastopols, die in euch nach den Erzählungen und Beschreibungen und nach dem, was ihr auf der Nordseite gesehen und gehört habt, entstanden ist. Aber bevor ihr diesem Zweifel Raum gebt, geht hinaus auf die Bastionen, seht euch die Verteidiger Sewastopols am Orte der Verteidigung selbst an, oder besser noch: geht hinein in das Haus da drüben, das früher das Kasino von Sewastopol war und auf dessen Vortreppe jetzt Soldaten mit Tragbahren stehen, – dort werdet ihr die Verteidiger Sewastopols finden, dort werden sich euren Augen entsetzliche und traurige, erhabene und unterhaltende, immer aber Erstaunen erregende, die Seele erhebende Szenen bieten.
Ihr betretet den großen Versammlungssaal. Gleich beim Öffnen der Tür erschreckt euch der Anblick und der Geruch von vierzig bis fünfzig amputierten und auf das schwerste verwundeten Kranken, von denen einige auf Pritschen, die meisten aber auf dem Fußboden liegen. Gebt dem Gefühl nicht nach, das euch auf der Schwelle zurückhalten möchte, – es ist ein häßliches Gefühl; geht nur weiter, schämt euch nicht, daß ihr gekommen seid, gleichsam um die Leidenden »anzuschauen«, schämt euch nicht, zu ihnen zu treten und mit ihnen zu sprechen: die Unglücklichen sehen gern ein teilnehmendes Menschenantlitz, erzählen gern von ihren Leiden und hören gern Worte der Liebe und des Mitgefühls. Geht zwischen den Lagerstätten hindurch und sucht ein Antlitz, das weniger streng und von Schmerzen gequält aussieht und das euch den Mut gibt, näherzutreten, um mit dem Kranken zu sprechen.
»Wo bist du verwundet?« fragt ihr unsicher und zaghaft einen alten, abgemagerten Soldaten, der, auf seiner Pritsche sitzend, euch mit gutmütigem Blicke folgt und euch aufzufordern scheint, zu ihm zu kommen. Ich sage: »unsicher und zaghaft«, denn Leiden flößen nicht nur tiefes Mitgefühl ein, sondern auch eine gewisse Angst vor der Möglichkeit zu beleidigen und eine hohe Achtung vor dem, der sie erduldet.
»Am Bein,« antwortete der Soldat, und im selben Augenblick bemerkt ihr selbst an den Falten der Decke, daß ihm das eine Bein bis über das Knie fehlt. »Gottlob,« fügt er hinzu, »jetzt werd' ich aus dem Lazarett entlassen.«
»Und ist's schon lange, daß du verwundet wurdest?«
»Die sechste Woche ist's jetzt, Euer Wohlgeboren!«
»Was schmerzt dich denn jetzt?«
»Jetzt schmerzt gar nichts, nein; nur bei schlechtem Wetter ist mir's, als wenn's in der Wade bohren tät', – sonst nichts.«
»Wie wurdest du denn verwundet?«
»Auf der fünften Bastion war's, Euer Wohlgeboren, als das erste Bombardement war: ich hatte die Kanone gerichtet, wollte weitergehen, so auf diese Art, wollte zur nächsten Schießscharte, da traf er mich ins Bein; es war, als ob ich in ein Loch getreten wäre, – ich schau hin, und das Bein ist fort.«
»Hat es denn in diesem ersten Moment gar nicht weh getan?«
»Nein; es war nur, als ob etwas Heißes an mein Bein stoße.«
»Nun und dann?«
»Auch dann war weiter nichts; nur als man die Haut straff zu ziehen anfing, da war's, als sei alles wund. Die Hauptsache, Euer Wohlgeboren, ist: an nichts denken; wenn man nicht denkt, fehlt einem nichts. Es kommt alles nur daher, daß der Mensch denkt.«
Da tritt eine Frau in grauem, gestreiftem Kleide und mit einem schwarzen Tuch um den Kopf heran; sie mischt sich ins Gespräch und beginnt von dem Matrosen zu erzählen, von seinen Leiden, von dem verzweifelten Zustande, in dem er sich vier Wochen hindurch befunden, und wie er, schwerverwundet, die Tragbahre hatte halten lassen, um die Salve unserer Batterie zu beobachten, wie die Großfürsten mit ihm gesprochen und ihm fünfundzwanzig Rubel geschenkt, und wie er ihnen gesagt, daß er auf die Bastion zurück wolle, um wenigstens die Jungen zu unterweisen, wenn er auch selbst nicht mehr arbeiten könne. Während die Frau das alles in einem Atem hervorsprudelt, blickt sie bald auf euch, bald auf den Matrosen, der – abgewandt und als ob er gar nicht zuhöre – auf seinem Kopfkissen Charpie zupft, und ihre Augen leuchten in eigenartiger Begeisterung.
»Es ist meine Hausfrau, Euer Wohlgeboren!« bemerkt der Matrose mit einem Ausdruck, als wollte er sagen: »Sie müssen schon entschuldigen. Man weiß ja – dummes Zeug zu schwätzen ist nun einmal Weibersache!«
Ihr fangt an, die Verteidiger Sewastopols zu verstehen, euch ist, als müßtet ihr euch vor diesem Manne schämen. Ihr möchtet ihm gar vieles sagen, um ihm euer Mitgefühl und euere Bewunderung auszudrücken; aber ihr findet keine Worte oder seid nicht zufrieden mit denen, die euch einfallen, und ihr beugt euch stumm vor dieser verschwiegenen, uneingestandenen Größe und Geistesstärke, vor dieser verschämten Würde.
»Nun, gebe Gott, daß du dich bald erholst,« sprecht ihr und bleibt dann vor einem anderen Kranken stehen, der auf dem Fußboden liegt und in unerträglichen Leiden den Tod zu erwarten scheint.
Es ist ein blonder Mann mit aufgeschwollenem, blassem Gesicht. Er liegt auf dem Rücken, den linken Arm zurückgeworfen, in einer Stellung, die bittere Qualen verrät. Der trockene, geöffnete Mund stößt nur mühsam den röchelnden Atem aus; die blauen, matten Augen sind nach oben gedreht, und unter der verschobenen Decke ragt der verbandagierte Stumpf des rechten Armes hervor. Der schwere Totengeruch fällt euch noch stärker auf als vorhin, und die verzehrende innerliche Glut, die alle Glieder des Dulders durchdringt, scheint sich euch mitzuteilen.
»Ist er bewußtlos?« fragt ihr die Frau, welche euch folgt und euch freundlich, wie Verwandte, anblickt.
»Nein, er hört noch, aber er ist sehr schlecht dran,« fügt sie flüsternd hinzu; »ich hab' ihm heute Tee zu trinken gegeben, – na ja, wenn er mir auch fremd ist, man muß doch Mitleid haben! – er hat aber fast gar nichts getrunken.«
»Wie geht es dir?« fragt ihr ihn.
Der Verwundete bewegt auf diese Frage die Pupillen, aber er sieht und versteht euch nicht.
Etwas weiter seht ihr einen alten Soldaten, der eben die Wäsche wechselt. Sein Gesicht und sein Körper sind fast ziegelfarben und zum Skelett abgemagert. Der eine Arm fehlt ihm gänzlich: er ist ihm an der Schulter abgenommen worden. Der Alte sitzt aufrecht da, er befindet sich auf dem Wege der Besserung, aber der tote, glanzlose Blick, die entsetzliche Magerkeit und die Furchen im Gesicht lasten erkennen, daß ihr einen Menschen vor euch habt, der die größere Hälfte seines Lebens schon durchlitten hat.
Auf der andern Seite seht ihr auf einer Pritsche das bleiche und zarte Dulderantlitz einer Frau, auf deren Wangen die Fieberröte spielt.
»Unsere Matrosenfrau, – am fünften ist ihr eine Bombe ans Bein geflogen,« erklärt eure Führerin, »sie brachte ihrem Manne das Mittagessen auf die Bastion.«
»Hat man das Bein amputiert?«
»Ja, überm Knie.«
Und nun, wenn eure Nerven stark sind, geht durch die Tür links: in jenem Zimmer werden die Verwundeten verbunden und operiert. Ihr werdet dort Ärzte sehen mit bis zu den Ellbogen mit Blut befleckten Armen und blassen, finsteren Gesichtern; sie machen sich an einer Pritsche zu schaffen, auf welcher mit offenen Augen und wie im Fieber sinnlose, bisweilen einfache und rührende Worte sprechend, ein Verwundeter im Chloroformschlafe liegt. Die Ärzte sind mit der widerwärtigen, aber wohltätigen Arbeit des Amputierens beschäftigt. Ihr werdet sehen, wie ein scharfes, gebogenes Messer in das weiße, gesunde Fleisch dringt, werdet sehen, wie der Verwundete plötzlich mit einem entsetzlichen, herzzerreißenden Schrei und mit Verwünschungen zu sich kommt, und wie der Feldscher den abgeschnittenen Arm in eine Ecke wirft; ihr werdet sehen, wie in demselben Zimmer ein anderer Verwundeter auf einer Tragbahre liegt und, der Operation des Kameraden zuschauend, sich windet und stöhnt, nicht so sehr wegen des physischen Schmerzes als in der Qual der Erwartung; ihr werdet schreckliche, die Seele erschütternde Szenen sehen, – nicht den Krieg in regelmäßigen, schönen und glänzenden Reihen mit Musik und Trommelklang, mit wehenden Fahnen und umhergaloppierenden Reitergenerälen, sondern den Krieg in seiner wahren Gestalt, – in Blut, in Leid und Tod ...
Wenn ihr dieses Haus der Qualen verlasset, werdet ihr jedenfalls mit Wonne die frische Luft voll einatmen, werdet euch mit Freuden der eigenen Gesundheit bewußt werden, aber ihr werdet aus dem Anblick dieser Leiden auch das Bewusstsein eurer Nichtigkeit geschöpft haben und nun ruhig, ohne Wanken, auf die Bastionen gehen.
»Was sind Tod und Leiden eines so nichtigen Wurmes, wie ich es bin, im Vergleich zu den Leiden und dem Tode so vieler!« Aber der Anblick des klaren Himmels, der leuchtenden Sonne, der hübschen Stadt, der geöffneten Kirche und des nach allen Richtungen ausrückenden Kriegsvolkes versetzt euren Geist bald wieder in den normalen Zustand des Leichtsinns, der kleinlichen Sorgen und der Hingabe an die Gegenwart.
Vielleicht begegnet ihr dem aus der Kirche kommenden Leichenzuge irgend eines Offiziers, mit rosafarbenem Sarge, Musik und wehenden Fahnen; vielleicht dringen die Töne der Kanonade auf der Bastion an euer Ohr, aber das bringt euch nicht wieder auf die früheren Ideen; der Leichenzug erscheint euch nur als ein sehr schönes militärisches Schauspiel, die Kanonade als sehr schönes Kriegsgetöse, doch ihr verknüpft weder mit diesem Schauspiel noch mit diesen Tönen den klaren, auf euch selbst angewandten Gedanken von Tod und Leiden, wie ihr das am Verbandorte getan.
An der Kirche und der Barrikade vorbei gelangt ihr in den belebtesten Teil der Stadt. Auf beiden Seiten hängen Schilder von Verkaufsläden und Restaurants. Kaufleute, Frauen in Hüten oder mit Kopftüchern, stutzerhafte Offiziere – alles verrät die Standhaftigkeit, das Selbstvertrauen und die Sicherheit der Bewohner.
Wenn ihr die Gespräche der Seeleute und Offiziere anhören wollt, so tretet in das Gasthaus rechts: dort wird ganz gewiß schon von der verflossenen Nacht, von Fenjka, vom vierundzwanzigsten gesprochen, aber auch davon, wie teuer und schlecht die Koteletts hier sind, und davon, daß dieser und jener Kamerad gefallen ist.
»Hol's der Teufel, wie arg es heute bei uns ist!« sagt mit Bassstimme ein hochblonder, bartloser Marineoffizier, der einen grünen, gestrickten Schal trägt.
»Wo ist das – bei uns?« fragt ein anderer.
»Auf der vierten Bastion,« erwidert der junge Offizier, und ihr betrachtet ihn bei den Worten »auf der vierten Bastion« unbedingt mit größerer Aufmerksamkeit und selbst mit einiger Hochachtung. Seine allzu große Ungeniertheit, das Herumfuchteln mit den Händen, das laute Sprechen und Lachen, all das, was ihr zuerst für Keckheit hieltet, erscheint euch nun als Ausdruck der besonderen prahlerischen Stimmung, die manche junge Leute nach bestandener Gefahr überkommt; immerhin denkt ihr, er werde euch nun erzählen, daß es wegen der Bomben und Kugeln auf der vierten Bastion arg ist, – weit gefehlt! Arg ist es, weil es schmutzig ist.
»Man kann nicht bis zur Batterie,« sagt er, auf seine Stiefel weisend, die bis über die Waden mit Schmutz bedeckt sind. – »Und mir haben sie heut' den besten Konstabelsmaat getötet, grad in die Stirn hat's ihn getroffen,« sagt ein anderer. – »Wen? Mitjuchin?« – »Nein ... Aber was ist denn, wird man mir endlich den Kalbsbraten bringen? Solche Kanaillen!« fügt er, zum Kellner gewandt, hinzu. »Nicht Mitjuchin, sondern Abramow. So ein tüchtiger Kerl, – war bei sechs Ausfällen.«
An der andern Ecke des Tisches sitzen bei Koteletts mit Erbsen und einer Flasche sauren roten Krimer Weines, Bordeaux genannt, zwei Infanterieoffiziere: der eine, ein junger Mann mit rotem Kragen und zwei Sternchen auf dem Mantel, erzählt dem andern, der einen schwarzen Kragen und keinen Stern hat, von der Schlacht an der Alma. Er hat schon etwas zu viel getrunken, und an den Pausen in seiner Erzählung, an seinem unsicheren Blick, der daran zu zweifeln scheint, daß dieser Erzählung Glauben geschenkt wird, vor allem aber an der allzu großen Rolle, die er selbst bei alledem gespielt haben will, und an den übertriebenen Schrecknissen in der Schilderung merkt man, daß er von der strengen Wahrheit stark abweicht. Aber euch liegt nichts an diesen Erzählungen, die ihr noch lange an allen Enden Russlands zu hören bekommen werdet: ihr wollt so schnell als möglich auf die Bastion gelangen, und zwar grade auf die vierte, von der man euch schon so viel und so verschiedenes berichtet hat. Wenn jemand sagt, er sei auf der vierten Bastion gewesen, so sagt er das mit besonderer Befriedigung und mit Stolz; wenn jemand sagt: ich gehe auf die vierte Bastion, so bemerkt man an ihm ganz gewiß entweder eine kleine Erregtheit oder zu große Gleichgültigkeit; wenn man jemand necken will, so sagt man: dich soll man auf die vierte Bastion schicken; wenn man Tragbahren begegnet und fragt: woher? erhält man in den meisten Fällen die Antwort: von der vierten Bastion. Im allgemeinen existieren zwei völlig entgegengesetzte Meinungen über diese schreckliche Bastion: die Meinung derer, die nie dort waren und überzeugt sind, daß die vierte Bastion das sichere Grab für jeden ist, der hingeht, und die Meinung derer, die dort hausen, wie der hochblonde Schiffsfähnrich, und die, wenn sie von der vierten Bastion sprechen, nur sagen, ob's dort trocken oder schmutzig, ob's in der Erdhütte warm oder kalt ist und dergleichen.
Während der halben Stunde, die ihr im Gasthause verbracht habt, hat sich das Wetter geändert: der Nebel, der auf dem Meere lag, hat sich zu grauen, langweiligen, nassen Wolken geballt und verdeckt die Sonne; ein trübseliger Reif fällt von oben und macht Dächer, Trottoirs und Soldatenmäntel feucht.
Nachdem ihr eine zweite Barrikade passiert habt, wendet ihr euch durch das Tor rechts einer breiten, ansteigenden Straße zu. Hinter dieser Barrikade sind die Häuser zu beiden Seiten der Straße unbewohnt, die Aushängeschilder fehlen, die Türen sind mit Brettern vernagelt, die Fenster eingeschlagen, hier fehlt ein Stück der Mauer, dort ist ein Dach zertrümmert. Die Gebäude gleichen alten Veteranen, die Kummer und Not jeder Art durchgemacht haben, und scheinen stolz und verächtlich auf euch herabzusehen. Ihr stolpert unterwegs über umherliegende Kanonenkugeln und über wassergefüllte Gruben, welche die Bomben im Steinboden aufgewühlt haben. Auf der Straße begegnet oder überholt ihr Gruppen von Soldaten, Kosaken, Offizieren, hier und da wohl auch eine Frau mit einem Kinde, die aber keine Dame im Hut ist, sondern ein Matrosenweib in altem Pelz und Soldatenstiefeln. Die Straße weiter verfolgend und einen kleinen Bergabhang hinabschreitend, findet ihr euch nicht mehr von Häusern umgeben, sondern von seltsamen Trümmerhaufen: Steinen, Brettern, Lehm, Balken; vor euch auf dem steilen Berge seht ihr eine schwarze, schmutzige, von Gräben durchzogene Fläche, – das eben ist die vierte Bastion ... Hier begegnet ihr noch weniger Menschen; Frauen sieht man überhaupt nicht, die Soldaten gehen schnell, auf dem Wege bemerkt ihr hier und da Blutstropfen, und unfehlbar kommen euch vier Soldaten mit einer Tragbahre entgegen, auf der ihr ein gelblichblasses Antlitz und einen blutigen Soldatenmantel seht. Wenn ihr fragt: »Wo ist er verwundet?« antworten die Träger ärgerlich, ohne sich nach euch umzuwenden: »Am Bein,« oder: »Am Arm,« wenn der Kranke leicht verwundet ist, oder aber sie schweigen ernst, wenn auf der Tragbahre kein Kopf sichtbar und der Unglückliche schon tot oder schwer verletzt ist.
Das nahe Pfeifen einer Kanonenkugel oder einer Bombe überrascht euch unangenehm, grade als ihr den Berg zu ersteigen beginnt. Ihr versteht plötzlich, und zwar ganz anders, als ihr sie vorher verstanden habt, die Bedeutung der Detonationen, die ihr in der Stadt hörtet. Irgend eine stille, schöne Erinnerung leuchtet plötzlich in euren Gedanken auf, eure eigene Persönlichkeit beschäftigt euch mit einem Male mehr als das, was ihr ringsumher beobachtet, eure Aufmerksamkeit für die Umgebung nimmt ab und ein gewisses unangenehmes Gefühl der Unentschlossenheit bemächtigt sich eurer. Ungeachtet dieser kleinlichen Stimme, die beim Anblick der Gefahr plötzlich in euch laut wird, richtet ihr – besonders als ihr den Soldaten seht, der eben, mit den Händen fuchtelnd und auf dem schlammigen Schmutz ausgleitend, im Trabe lachend an euch vorüberläuft – euch stolz auf, hebt den Kopf höher und beginnt, den schlüpfrigen, lehmigen Berg zu erklimmen. Ihr seid kaum ein wenig bergauf geklettert, als rechts und links um euch die Flintenkugeln pfeifen; ihr überlegt vielleicht einen Augenblick, ob es nicht ratsamer wäre, im Laufgraben zu gehen, der mit dem Wege parallel läuft; aber dieser Graben ist so mit einem flüssigen, gelben, stinkenden, bis über die Knie reichenden Kot angefüllt, daß ihr sicherlich den Weg auf dem Berge wählen werdet, um so mehr als ihr seht, daß alle ihn gehen. Etwa zweihundert Schritt weiter kommt ihr zu einer aufgewühlten, schmutzigen Fläche, die von allen Seiten von Schanzkörben, Erdwällen, Pulverkellern, Plattformen, Erdhütten umgeben ist; obenauf stehen große, gußeiserne Geschütze und liegen in regelmäßig aufgeschichteten Haufen Kanonenkugeln. Alles dies scheint euch ohne jeden Zweck, ohne Sinn und Ordnung aufgetürmt zu sein. Hier auf der Batterie sitzt eine Gruppe von Matrosen, dort inmitten des Platzes liegt, halb im Schmutz versunken, eine zertrümmerte Kanone, da geht ein Infanterist mit einem Gewehr über die Batterien und zieht mühsam seine Füße aus dem klebrigen Schmutze. Aber überall, von allen Seiten und von jedem Standorte aus, seht ihr Trümmer, nichtgeplatzte Bomben, Kanonenkugeln, Spuren des Lagerlebens, alles halb versenkt in dem flüssigen, klebrigen Schmutze. In eurer Nähe – so scheint es euch – hört ihr eine Kanonenkugel aufschlagen; von allen Seiten ertönen die verschiedenen Laute der Flintenkugeln, die wie Bienen summen, schnell vorüberpfeifen oder wie Darmsaiten brummen; ihr vernehmt den fürchterlichen Lärm der Geschütze, der euch erschüttert und euch wie etwas ganz besonders Entsetzliches erscheint.