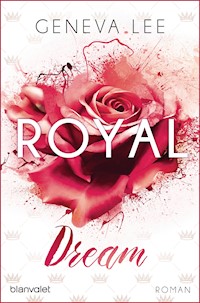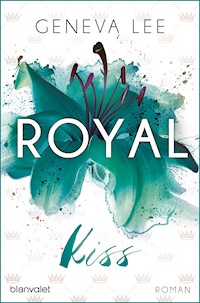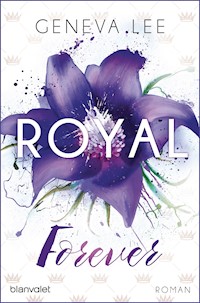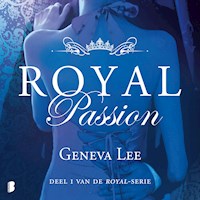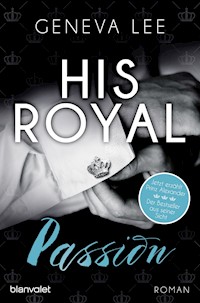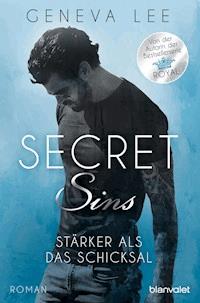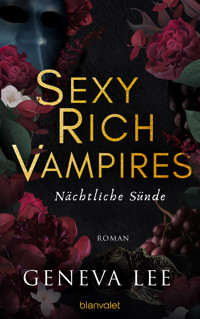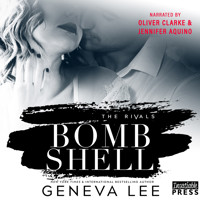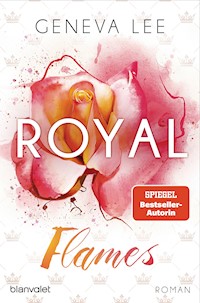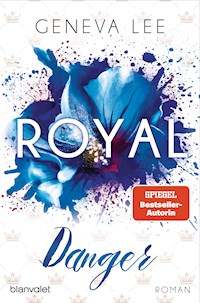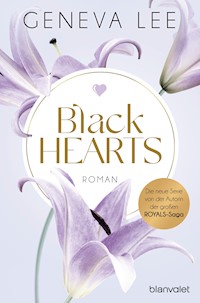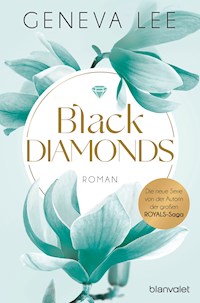12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Noch pompöser, noch dekadenter, noch gefährlicher: Die spannende Fortsetzung der sinnlichen Reihe um Vampir Julian und seine Thea!
Einen Monat nachdem Theas Welt auf den Kopf gestellt wurde, kämpft sie darum, ins Leben zurückzufinden. Ihr Herz ist gebrochen, ihre Mutter liegt im Koma, und die Geldsorgen begleiten sie täglich. Dann taucht Julian im Krankenhaus auf, und das Gefühlschaos beginnt erneut. Er hatte sie weggestoßen, und Thea glaubt nicht, diesen Schmerz erneut aushalten zu können. Was sie nicht weiß: Für Julian ist Thea die Liebe seines Lebens, doch er war gezwungen sie zu verlassen, um sie zu beschützen. Kann sie die Sehnsucht unterdrücken und der Versuchung widerstehen, die von dem sexy Blutsauger ausgeht?
Die Fortsetzung der unwiderstehlichen »Sexy Rich Vampires«-Trilogie von Geneva Lee!
1: Sexy Rich Vampires – Blutige Versuchung
2: Sexy Rich Vampires – Unsterbliche Sehnsucht
3: Sexy Rich Vampires – Nächtliche Sünde
4: Sexy Rich Vampires – Königliches Begehren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Buch
Noch pompöser, noch dekadenter, noch gefährlicher: Die spannende Fortsetzung der sinnlichen Reihe um Vampir Julian und seine Thea!
Einen Monat nachdem Theas Welt auf den Kopf gestellt wurde, kämpft sie darum, ins Leben zurückzufinden. Ihr Herz ist gebrochen, ihre Mutter liegt im Koma, und die Geldsorgen begleiten sie täglich. Dann taucht Julian im Krankenhaus auf, und das Gefühlschaos beginnt erneut. Er hatte sie weggestoßen, und Thea glaubt nicht, diesen Schmerz erneut aushalten zu können. Was sie nicht weiß: Für Julian ist Thea die Liebe seines Lebens, doch er war gezwungen, sie zu verlassen, um sie zu beschützen. Kann sie die Sehnsucht unterdrücken und der Versuchung widerstehen, die von dem sexy Blutsauger ausgeht?
Autorin
Geneva Lee ist eine hoffnungslose Romantikerin und liebt Geschichten mit starken, gefährlichen Helden. Mit der »Royals«-Saga, der Liebesgeschichte zwischen dem englischen Kronprinzen Alexander und der bürgerlichen Clara, eroberte sie die internationalen Bestsellerlisten. Auch die »Rivals«-Reihe traf mitten ins Herz ihrer Leser*innen. Mit ihrer neuen Trilogie, den »Sexy Rich Vampires«, begibt sich die SPIEGEL-Bestsellerautorin zum ersten Mal in die Welt der Fantastik – ohne dabei aber den großen Gefühlen, der Leidenschaft und dem Luxus untreu zu werden.
Von Geneva Lee bereits bei Blanvalet erschienen (Auswahl):Die »Royals«-Saga von Geneva LeeClara und Alexander:Band 1 – Royal PassionBand 2 – Royal DesireBand 3 – Royal LoveBand 1 aus der Sicht des Prinzen – His Royal Passion
Belle und Smith:Band 4 – Royal DreamBand 5 – Royal KissBand 6 – Royal Forever
Clara und Alexander – Die große Liebesgeschichte geht weiter:Band 7 – Royal DestinyBand 8 – Royal GamesBand 9 – Royal LiesBand 10 – Royal Secrets
Die »Rivals«-Reihe von Geneva LeeBand 1 – Black Roses Band 2 – Back DiamondsBand 3 – Black Hearts
GENEVA LEE
SEXY RICH VAMPIRES
Unsterbliche Sehnsucht
Deutsch von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »FILTHY RICH VAMPIRES – SECOND RITE« bei Estate Publishing + Media.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2022 by Geneva Lee
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Hamburg nach einer Originalvorlage von Estate Publishing + Media
Coverdesign: © Estate Books
Umschlagmotiv: stock.adobe.com (Tussik; Elizaveta; Alena, Murilo; Pixel-Shot; r-tee; Gluiki)
JS · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 1
www.blanvalet.de
1 THEA
EINEN MONAT SPÄTER …
»Du musst hier raus«, verkündete Olivia, als sie, noch in ihren Trainingsklamotten, mit Strickstulpen über den Leggings, das Zimmer meiner Mutter betrat. In den Armen hielt sie einen Blumenstrauß.
»Ist heute Sonntag?«, fragte ich und wunderte mich, wo der Freitag und der Samstag geblieben waren. »Ja! Dass du das nicht weißt, beweist, dass ich recht habe.« Sie nahm die alten, welken Stängel heraus und ersetzte sie durch frische Blumen. Sie zupfte den Strauß zurecht, dann drehte sie sich um und lächelte meine Mutter an. »Hallo, Mama Melbourne.«
Meine Mutter antwortete nicht. Sie konnte es nicht, weil sie im Koma lag, aber Olivia war trotzdem immer nett zu ihr und grüßte sie.
Meine Mitbewohnerin hockte sich auf den Stuhl neben meinem und zog die Knie an die Brust. »Im Ernst, Thea. Sie würde nicht wollen, dass du hier herumhockst. Du musst rausgehen. Die Welt sehen.«
Ich zuckte zusammen. Genau das hatte ich getan, als ich den Anruf erhielt, dass meiner Mutter etwas zugestoßen sei. In den letzten vier Wochen hatte ich kaum etwas anderes als das Innere dieses Zimmers gesehen.
»Okay, schlechte Wortwahl«, sagte sie schnell. »Aber, Schatz, du bist nicht diejenige, die in diesem Krankenhausbett liegt.«
»Das weiß ich«, schnauzte ich sie an und fühlte mich sofort schuldig. Sowohl Olivia als auch Tanner waren so oft wie möglich hier gewesen, und ich hatte mich wie ein Miststück benommen. »Es tut mir leid. Ich wünschte nur, sie würde aufwachen.«
»Ich auch, Schatz.« Sie drückte meine Schulter, und einen Moment lang fühlte ich mich an Jacqueline erinnert.
»Wäre ich doch nur nicht weggegangen«, klagte ich. »Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen, um irgendeinem Idioten, den ich kaum kannte, nach Paris zu folgen.«
»Aber du hast es nun mal getan«, sagte sie ungeduldig. Ich warf ihr einen überraschten Blick zu.
»Tut mir leid.« Sie seufzte. »Es ändert nichts mehr, wenn du dir Vorwürfe deswegen machst.«
»Ich weiß. Deshalb bin ich jetzt hier.«
»Aber du kannst nichts für sie tun, Thea, solange sie in diesem Zustand ist. Du weißt, was die Ärzte gesagt haben.«
Das Problem war, dass die Ärzte nicht viel gesagt hatten. Was mit meiner Mutter geschehen war, war für sie genauso ein Rätsel wie für mich. Und es war nicht allein das Koma, das uns Grund zur Sorge gab. Bei den Tests, die sie durchgeführt hatten, waren mehrere neue Tumore erkannt worden, aber die Rückkehr ihrer Krebserkrankung hatte nichts mit ihrem Koma zu tun. Zum Glück waren die Tumore operabel – sobald sie aufgewacht war, würde es losgehen. Doch da keiner wusste, weshalb sie nicht mehr aufwachte und wie lange sie in diesem Zustand bleiben würde, war ich fest entschlossen, dabei zu sein, wenn sie die Augen aufschlug.
Bevor ich Olivia an meinen Vorsatz erinnern konnte, wurden wir durch ein energisches Klopfen an der Tür unterbrochen. Dr. Reeves, der für Mom zuständige Arzt, kam mit einer Akte herein. Als er sah, dass ich nicht allein war, setzte er ein strahlendes Lächeln auf.
Olivia stellte schnell ihre Füße auf den Boden und setzte sich gerade hin. »Guten Tag, Doktor.«
»Schön, Sie zu sehen, Olivia.« Er nickte in Richtung der frischen Blumen. »Sie sind wirklich eine gute Freundin. Sie können sich glücklich schätzen, sie zu haben, Thea.«
»Ich weiß«, brummte ich. Dabei fiel es mir schwer, nicht die Augen zu verdrehen. Olivia hatte ein Auge auf Dr. Reeves geworfen und sich seinen Dienstplan eingeprägt. An den meisten Tagen kam sie vorbei, um mir frische Kleidung oder Kaffee zu bringen, aber jeden Sonntag kam sie mit der Präzision eines Uhrwerks her, um mit dem behandelnden Arzt zu flirten.
»Ich habe gerade versucht, Thea davon zu überzeugen, dass sie eine Pause braucht«, sagte Olivia und klimperte mit den Wimpern.
»Ich mache Pausen.«
»Toilettenpausen zählen nicht«, teilte sie mir mit und starrte dabei immer noch Dr. Reeves an. »Oder etwa doch?«
»Ich fürchte, sie hat recht«, wandte er sich liebenswürdig an mich. »Ich möchte einige der Scans wiederholen, die wir bei Ihrer Mutter gemacht haben. Vielleicht können Sie beide so lange rausgehen und zusammen zu Mittag essen.«
Mein Blick huschte zwischen dem Arzt und Olivia hin und her. »Habt ihr euch abgesprochen?!«
»Tja, schwierige Situationen erfordern besondere Maßnahmen«, erklärte Olivia, stand auf und warf mir meinen Mantel zu.
Ich fing ihn und runzelte die Stirn. Ich musste wirklich erbärmlich aussehen, wenn der Arzt mich rauswarf. »Wie lange werden die Tests dauern?«
»Ein paar Stunden«, sagte er.
»Und wenn sie …«
»Wir rufen Sie sofort an, sobald sich etwas ändert«, unterbrach er mich.
Ja, sie hatten die ganze Sache abgekartet. Widerwillig stand ich auf und ging zu Moms Bett hinüber. Vorsichtig mied ich die Schläuche und Kabel, die an einem Dutzend Maschinen hingen, die ihren Puls, ihre Herzfrequenz, ihren Sauerstofflevel, ihren Blutdruck und Gott-weiß-was überwachten, und küsste ihre Stirn. »Ich bin bald wieder da.«
Ich drehte mich gerade noch rechtzeitig um, um Olivias besorgte Miene zu sehen. Schnell setzte sie ein Lächeln auf. »Bringen wir dich hier weg.«
Olivia hakte sich bei mir unter und führte mich aus dem Krankenhauszimmer. Dann marschierte sie mit mir zielstrebig zum Aufzug.
»Wir könnten doch in der Cafeteria essen«, schlug ich vor. Immerhin hätte ich damit Mutters Krankenstube verlassen.
Sie stöhnte nur. »Nein. Für die nächsten zwei Stunden gehörst du mir.« Ich öffnete meinen Mund, um zu widersprechen, aber sie hob eine Hand.
»Du hast gehört, was er gesagt hat. Sie wird nicht einmal im Zimmer sein. Außerdem gibt es an der Ecke einen neuen Burrito-Laden.« Sie drückte den Knopf für die Lobby, immer noch Arm in Arm mit mir. Vermutlich stufte sie mich als fluchtgefährdet ein.
Es war ein seltsames Gefühl, durch die Glasschiebetüren des Krankenhauses auf den Bürgersteig zu treten. In San Francisco herrschte eine für kalifornische Verhältnisse ungewöhnliche Kälte. Ich knöpfte meinen Mantel zu und stieß dabei fast mit einem vorbeigehenden Paar zusammen.
»Tut mir leid«, murmelte ich, als sie schnell auswichen.
Der Mann machte eine genervte Miene, aber seine Freundin lächelte. »Kein Problem. Schöne Feiertage.«
Mir fiel keine Erwiderung ein, also nickte ich. Aber da waren sie schon weitergegangen, die Arme voller Papiertüten mit Weihnachtseinkäufen. Ich beobachtete, wie der Mann stehen blieb, um ihr die Päckchen abzunehmen, die sie trug. Dann nahm er ihre Hand. Ein dumpfer Schmerz durchzuckte mein gebrochenes Herz, und als ich mich umdrehte, stellte ich fest, dass die ganze Straße voller Paare und Familien war, die ihre Weihnachtseinkäufe erledigten.
»Lass uns diesen blöden Burrito holen«, murmelte ich.
Olivia schenkte mir ein mitfühlendes Lächeln und zog mich die Straße hinunter. »Komm schon. Schlucken wir unsere Gefühle runter.«
Mit etwas Guacamole und saurer Sahne schmeckten meine Gefühle ziemlich gut. Als wir unsere riesigen Burritos aufgegessen hatten, fühlte ich mich schon besser. Aber das wollte ich Olivia nicht eingestehen. Sie sollte sich das nicht zur Gewohnheit machen.
»Danke«, sagte ich, als wir aus dem Restaurant kamen. »Ich glaube, ich sollte jetzt besser …«
»Wir haben noch eine Stunde Zeit«, teilte sie mir mit. »Denk nicht einmal daran, jetzt schon zurückzugehen.«
»Gut.« Es wurde von Minute zu Minute kälter, und wir schmiegten uns beim Gehen aneinander. Auf der anderen Straßenseite an der Ecke entdeckte ich einen Mann, der uns beobachtete. Selbst von hier aus wirkten seine Augen zu dunkel. Hatten wir die Aufmerksamkeit eines Vampirs auf uns gezogen?
Oder wünschte ich nur, wir hätten es getan? Ein Teil von mir träumte davon, dass ich in die Welt, aus der ich geflohen war, zurückgeschleppt werden würde. Wie würde Julian reagieren, wenn er hörte, dass ich von einem seiner Artgenossen angegriffen worden war? Würde es ihn überhaupt interessieren? Falls er die Wahrheit gesagt hatte – dass es besser für mich war, mich aus seiner Welt herauszuhalten –, dann vielleicht. Nachdem die Tage ohne jegliche Kontaktaufnahme verstrichen, wurde mir klar, dass ich ihm gleichgültig war. Die Wahrheit war, dass ich nie in seine stinkreiche Welt gepasst hätte. Der Fremde starrte uns unentwegt an, als wir parallel zu ihm gingen. Ich konnte zwei schwarze Löcher sehen, wo seine Augen sein sollten. Es schüttelte mich.
Es war ein Vampir.
»Thea, was sagst du dazu?« Olivia unterbrach meine Gedanken mit einem eindringlichen Ruck an meinem Arm.
»Hm?« Ich blickte zu ihr hinüber. Dann erinnerte ich mich an den Vampir. Ich drehte mich wieder um und stellte fest, dass er verschwunden war.
»Lass uns reingehen«, sagte Olivia, um sich nicht zu wiederholen, und zog mich zu dem Laden, an dem wir gerade vorbeigingen.
Ich warf einen Blick auf die lädierte Tür, um den abblätternden Schriftzug zu lesen. Da stand »Madame Lenore« und darunter »Wahrsagerin« mit einer gezeichneten Hand darunter. Ich wollte mir auf keinen Fall von einer Fremden aus der Hand lesen lassen, während draußen auf der Straße ein Vampir sein Unwesen trieb.
»Warte!« Aber es war zu spät. Olivia rief ein fröhliches »Hallo« in den von Möbeln überquellenden Raum.
Eine alte Frau steckte ihren Kopf hinter einem Perlenvorhang hervor. Zwischen ihren Lippen hing eine Zigarette.
»Nur herein!«, rief Madame Lenore mit einem schweren Akzent. »Nehmen Sie schon mal Platz. Ich bin gleich da.« Die Perlenvorhänge klirrten, als sie wieder nach hinten verschwand.
Es bedurfte einiger Konzentration, um sich in dem Labyrinth von Merkwürdigkeiten zurechtzufinden, das sich in dem winzigen Laden befand: eine wahllose Ansammlung von Stühlen aus verschiedenen Epochen, ein Schrank voller angelaufenem Silber und überall verstreut waren Bücher in Englisch, Französisch und vielen anderen Sprachen aufgestapelt. Die Wahrsagerin schwebte in einem Gewand aus bunten Seidenstoffen zurück in den Raum und zeigte auf einen abgenutzten Tisch in der Nähe. Wir setzten uns um die Lagen von Spitzentischdecken, während Madame Lenore einen frischen Räucherkegel anzündete und mit der Hand den aufsteigenden Rauch im Raum verteilte. Sandelholzduft stieg mir in die Nase, bis ich husten musste.
»Ihre Hand.« Sie streckte ihre eigene knochige Hand aus. »Oh, ich nicht«, sagte ich schnell. »Das war ihre Idee.«
Olivia legte gehorsam ihre Hand in die der alten Frau, ihre Augen funkelten. »Werde ich reich?« Olivia kicherte und sah mich an.
»Wenn Sie das wollen«, sagte die alte Frau vorsichtig. »Sie könnten aber auch glücklich werden.«
Ich verkniff mir ein Lächeln und wandte mich ab, bevor Olivia es bemerkte. Offensichtlich machte es Madame Lenore nichts aus, harte Wahrheiten auszusprechen.
»Was ist der Unterschied?«, fragte Olivia.
»Geld macht nicht glücklich«, sagte ich unbedacht. Meine Wangen wurden rot, als mir klar wurde, was ich gesagt hatte.
Aber falls ich ihr den Text gestohlen hatte, schien es Madame Lenore nichts auszumachen. »Ihre Freundin ist weise. Ich sehe zwei Wege.«
Ich hörte nur mit einem halben Ohr zu, als sie Olivia ein vorhersehbares Schicksal prophezeite. Am Ende war meine Mitbewohnerin völlig deprimiert. Lenores Vision von einem normalen, einfachen Leben war nicht das, was Olivia sich erhoffte.
»Sie sind dran«, wandte sich Lenore an mich.
»Nein, wirklich. Wir sollten gehen.« Dass ich so zögerte, ihr meine Handfläche zu zeigen, war albern. Wahrscheinlich war sie nur eine alte Frau, die den Leuten für Geld irgendwas erzählte. Aber ich wusste etwas, was Olivia nicht wusste.
Magie war real. Oder sie war es gewesen. Und obwohl es wahrscheinlich ziemlich weit hergeholt war, sich einzubilden, dass diese alte Frau auch nur ein Fünkchen Magie im Leib hatte, konnte ich mir nicht sicher sein.
»Tu es einfach, Thea!«, drängte Olivia. »Für mich.«
»Gut.« Ich legte meine Hand mit der Handfläche nach oben auf den Tisch.
»Wird sie einen großen, dunklen Fremden treffen?«, fragte Olivia und kicherte wieder.
Lenore schwieg, während sie die Linien auf meiner Hand studierte. Dann sprach sie leise: »Es scheint, als hätte sie ihn bereits getroffen.«
Ich riss meine Hand zurück.
»Wir sollten gehen«, sagte ich zittrig.
»Wollen Sie nicht wissen, welche Geheimnisse ich sehe?«, fragte sie.
»Ich dachte, Sie wollten mir meine Zukunft prophezeien.« Ich stand auf – denn eigentlich wollte ich das auch nicht.
»Was ist Ihre Zukunft anderes als ein Geheimnis, Thea?« Ein rätselhaftes Lächeln umspielte ihre Lippen. »Kommen Sie zu mir, wenn Sie bereit sind, die Wahrheit zu erfahren.«
Ich kramte ein paar Zwanziger aus meiner Handtasche – der Erlös des Chanelparfums, das ich in Paris gekauft hatte – und warf sie auf den Tisch. »Danke.«
Ich schaffte es in Rekordzeit aus dem Laden. Olivia stürmte eine Sekunde später durch die Tür. »Okay, das war seltsam.«
»Es war gar nichts«, sagte ich mit Entschiedenheit. »Sie ist nur eine alte Betrügerin. Ich muss zurück.«
»Ich begleite dich.«
Wir machten uns auf den Weg zum Krankenhaus, über uns zogen Wolken über den Himmel und beschatteten die Straße.
Als wir an der Ecke ankamen, drehte ich mich um und sah, dass Lenore uns mit großen Augen durch das Schaufenster nachsah. Dann verschwand sie. Als die Ampel grün wurde und wir über den Zebrastreifen in Richtung Krankenhaus rannten, versuchte ich, das Bild abzuschütteln.
»Es tut mir so leid«, sagte Olivia an der Tür.
»Ist schon okay.« Ich umarmte sie kurz.
»Ist es nicht. Ihretwegen denkst du jetzt an ihn.« Olivia wollte Julians Namen nicht aussprechen. Ich schüttelte den Kopf. »Sie war mir einfach unheimlich«, log ich. »Können wir das nächste Mal einfach einen Kaffee trinken gehen?«
»Abgemacht«, versprach sie.
»Sei vorsichtig!«, rief ich ihr hinterher, als sie sich auf den Weg in Richtung unserer Wohnung machte.
Olivia lächelte und bog dann um die Ecke.
Ich besorgte mir einen Becher Kaffee, bevor ich mich wieder auf den Weg zum Zimmer meiner Mutter machte. So sehr ich mich auch bemühte, ich konnte das ungute Gefühl in meinem Magen nicht ganz abschütteln.
Und als ich im Krankenhauszimmer meiner Mutter ankam, erfuhr ich, dass es berechtigt war.
2 JULIAN
»Nein.«
Ich starrte die Barkeeperin an und wartete auf eine Erklärung. Sie wischte ein Glas aus und stellte es unter den Absinth-Brunnen, drehte aber den Hahn nicht auf.
»Muss ich dich daran erinnern, dass mir der ganze Block gehört?« Ich knurrte und griff nach dem Glas.
»Das hast du schon«, sagte sie unbeeindruckt. »Schmeiß mich raus. Beiß mich. Das ist mir scheißegal, aber du kriegst nichts mehr. Du musst hier verschwinden.«
Matt ging ich zurück in das Privatzimmer, das ich vor drei oder vier Nächten genommen hatte. Ich stieg über ein paar Körper hinweg, ließ mich auf ein Kissen sinken und versank in Dunkelheit. Dem Gestöhne nach zu urteilen, waren die Körper auf dem Boden nicht alle bewusstlos. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass sie alle noch lebten. Sebastians Kopf tauchte auf, gefolgt von seiner nackten Brust. Er befreite sich aus einem Gewirr nackter Gliedmaßen, erhob sich und schlenderte zu mir. Der Hosenschlitz seiner Jeans stand offen und gab den Blick auf Schamhaar frei, das ich lieber nicht gesehen hätte.
»Ich dachte, du wolltest ein paar Drinks holen«, sagte er und ließ sich mir gegenüber auf ein Fransenkissen sinken. Er wischte sich etwas Blut von den Lippen und nahm eine Opiumpfeife vom Tisch.
»Sie hat sich geweigert, mich zu bedienen«, sagte ich bitter. Eine hoffnungsvolle und völlig nackte Frau kroch auf mich zu, aber ich scheuchte sie weg.
Sebastian hob eine Augenbraue. »Ich werde mit ihr reden«, sagte er, bevor er mit dem Kopf zur Orgie in der Ecke deutete. »Mach ein bisschen mit, dann fühlst du dich besser.«
»Du bist nicht wirklich mein Typ«, sagte ich.
»Hör zu, du kannst die Gedanken an Thea nicht wegtrinken – zumindest nicht mit Absinth.« Er sah mir in die Augen. »Eine Nummer zu schieben dagegen …«
»Ich bin an keiner dieser Frauen interessiert«, knurrte ich.
»Ich hätte da auch ein paar Männer, falls du etwas Neues ausprobieren willst«, schlug er vor.
Ich verdrehte die Augen und stand auf. Ich hatte den Überblick über die Tage und die Mengen von Absinth und Opium verloren, die ich konsumiert hatte. Aber selbst wenn die Drogen gewirkt hätten, hätte ich keine Lust gehabt, bei Sebastians Sex-Marathon mitzumischen. Da mein Bruder noch nie jemanden getroffen hatte, den er nicht vögeln wollte, war das für ihn nur schwer zu verstehen.
Er seufzte. »Vampire sind sexuelle Wesen. Es ist okay, seinen Instinkten zu folgen.«
»Jetzt gerade verlangt mein Instinkt, dir den Kopf abzureißen, falls du nicht aufhörst zu reden.« Ich legte eine Hand an die Wand und war überrascht, den weichen Samt zu spüren. Ich fuhr mit den Fingern über die gemusterte Tapete und fragte mich, wann ich meine Handschuhe ausgezogen haben mochte.
»Ich kann verstehen, warum Layla dir nichts mehr ausschenkt.« Er hielt mir die Pfeife hin. »Nimm etwas Opium.«
Ich schüttelte meinen Kopf, der mehr schmerzte, als er sollte. Opium konnte das beheben. Es würde auch dazu führen, dass ich die nächsten Stunden in der Ecke sitzen und Sebastian dabei zusehen würde, wie er alles bestieg, das ein Loch hatte. Das Problem war nur, dass der Rausch bei Vampiren viel zu schnell einem üblen Kater wich.
Schmerz schoss durch meinen Gaumen, und meine Reißzähne wollten ausfahren. Ich wusste nicht, wie lange wir schon hier drin waren, aber ich wusste, dass ich schon seit Tagen nichts anderes mehr zu mir genommen hatte als Rauschmittel.
»Ich muss etwas zu mir nehmen«, sagte ich ihm.
»Es gibt hier genug …«
»Sauberes Blut«, unterbrach ich ihn. »Ich sehe mal nach, ob Layla Beutel hat.«
»Frag sie nett!«, rief er mir hinterher, aber ich war schon auf dem Weg zur Bar.
Layla seufzte, als sie mich sah. Sie legte eine Hand auf ihre üppige Hüfte, ihre Brüste quollen förmlich aus ihrem mit Fischbein verstärkten Korsett. Mein Blick wanderte von ihrem Dekolleté zu dem sanften Pulsschlag an ihrem Hals. Ich hatte noch nie gesehen, dass sie eine der Substanzen zu sich nahm, die sie ausschenkte.
»Kann ich dir helfen?«, fragte sie und klang dabei so, als ob sie das lieber nicht tun würde.
»Blutbeutel«, sagte ich und riss meinen Blick von ihrem Hals los.
»Haben wir nicht. Sieh dich doch um. Es gibt hier viele Menschen. Bitte nett darum, dann wird dir jemand etwas abgeben.«
»Wäre es dir lieber, ich würde einen Unschuldigen von der Straße hier hereinzerren?«, forderte ich sie heraus. »Ich fasse hier niemanden an … außer dir.«
Ich hatte kein Interesse an Layla, mir ging es nur darum, die heftigen Kopfschmerzen loszuwerden, die von Sekunde zu Sekunde schlimmer wurden.
»Du bist ganz schön frech«, zischte sie. »Du glaubst wohl, weil du ein Rousseaux bist, kannst du dir alles nehmen, was du willst?«
»Ich glaube, ich kann das, weil ich ein Vampir bin, Schätzchen.« Ich trat näher an die Bar heran und legte eine Hand auf das Holz.
Sie murmelte etwas auf Französisch. Ich verstand nur zwei Worte.
Dégoutant und pur-sang.
Nun, sie hatte in beiden Fällen nicht unrecht. Ich nutzte die aufgestützte Hand, um über den Tresen zu springen. Jedenfalls versuchte ich es.
Einen Moment später prallte ich gegen eine Wand.
»Macht er Probleme?«, fragte ein brutal aussehender Vampir Layla und rieb sich die Hände, ohne mich aus den Augen zu lassen.
Mir fiel wieder ein, warum ich meine Handschuhe ausgezogen hatte. Niemand hier trug welche. Es war zu einfach, mich als Reinblüter zu identifizieren, wenn ich sie trug. Le Poste de Nuit hatte nicht gerade die oberen Ränge der Vampirgesellschaft als Publikum. Versteckt im Keller eines Stripclubs in Pigalle, zog der Laden hauptsächlich verwandelte Vampire an. Seit Sebastian uns hergeschleppt hatte, hatte ich kein Fünkchen Magie gespürt. Dies waren keine Vampire, die auf Tradition Wert legten oder sich um Blutlinien scherten.
Aber wir hatten eines gemeinsam. Wir waren alle auf der Flucht vor etwas.
Als ich wütend den Vampir anschaute, der mich über die Bar geschleudert hatte, wusste ich, was mir helfen würde.
»Was geht dich das an, du Wechselbalg?« Ich stand auf und klopfte mir den Staub von der Kleidung. Köpfe drehten sich zu mir um. Man war schockiert darüber, dass jemand in einem Raum voller verwandelter Vampire so vulgär redete.
»Alek!« Layla lief um den Tresen herum und versuchte dazwischenzugehen, aber da stürmte er schon auf mich zu.
Die Backsteinmauer hatte also einen Namen. Das würde es mir leichter machen, seine Knöpfe zu drücken. Ich musste Layla nur davon abhalten, meinen Plan zu vereiteln.
»Misch dich nicht in Männergespräche ein, Süße!«, rief ich ihr zu.
Ein paar weitere Vampire standen auf. Das Einzige, was für Vampire schlimmer war als Respektlosigkeit, war frauenfeindliche Respektlosigkeit.
»Alek«, Layla klang panisch, »er ist ein Rousseaux.«
Ich ließ die Schultern hängen, als sie mich outete. So viel zur Suche nach einer allerletzten Ablenkung.
Aber Alek schob sich an ihr vorbei. »Ist mir egal, selbst wenn er der liebe Gott persönlich wäre.«
»Das ist die richtige Einstellung, Alek.« Ich dehnte meine Finger. »Wie wär’s mit einem Tänzchen?«
Ein bösartiges Grinsen erschien auf seinem Gesicht. »Ich hatte gehofft, dass du fragst.«
»Dann lass uns tanzen.« Ich krümmte einen Finger und winkte ihn heran.
Bevor sich einer von uns rühren konnte, dröhnte Laylas Stimme durch die Bar. »Macht das draußen!«
Wir richteten uns beide auf und gingen zur Tür. Ich nickte ihr zu, als ich vorbeiging.
»Was tust du da?«, fragte sie und packte mich am Ärmel. »Du weißt doch, was dabei herauskommt.«
Sie setzte also auf Alek. Das war ein gutes Zeichen. Ich hatte den Gegner nicht zufällig gewählt. Alek sah aus, als könnte er mit mir fertig werden.
»Weiß ich«, erwiderte ich und fühlte mich seltsam fröhlich bei dieser Aussicht. »Wenn der Convent kommt und herumschnüffelt, sag denen, dass ich angefangen habe. Mein Bruder wird es bestätigen. Alek bekommt keine Probleme.«
»Wenn du glaubst, dass sie hinnehmen, dass ein verwandelter Vampir einen Reinblüter tötet …«
»Ach, hör auf«, unterbrach ich sie. »Ich sorge dafür, dass es nach Notwehr aussieht.«
Ich wartete ihre Gegenargumente gar nicht erst ab. Ich hatte eine Verabredung.
Ein paar weitere Vampire folgten mir, als ich die Kellertreppe hinaufstieg. Ich konnte riechen, wie in ihnen der Blutrausch erwachte. Das würde die Sache sicher beschleunigen.
Und das hier auch.
Sobald ich den obersten Treppenabsatz erreichte, warf ich mich auf Alek. Wir stürzten durch den Hinterausgang in den Stripclub und landeten in der Menge. Die Leute sprangen kreischend von ihren Plätzen hoch, als ich Alek auf die Bühne schleuderte. Ich sprang neben ihn und trat zur Seite, als eine Tänzerin mit auf die Brüste gepressten Händen flüchtete.
»Dreckiges Reinblut, du denkst wohl, für dich gelten keine Regeln«, knurrte er mich an und deutete auf den Club. »Sie sagte draußen.«
»Ich habe draußen eher frei interpretiert.« Ich zuckte mit den Schultern. »Jetzt halte mich nicht länger hin und lass dir den Arsch versohlen.«
»Mir ist scheißegal, wer du bist.« Er zog den Kopf ein und sorgte für seine Deckung. »Ich werde mir heute Abend deinen Kopf an die Wand hängen.«
»Das werden wir ja sehen, du Wechselbalg.« Auch ich nahm eine Kampfposition ein, gab vor, zuschlagen zu wollen. Der Spruch brachte bei ihm das Fass zum Überlaufen, und er stürzte sich auf mich. Im letzten Moment entspannte ich mich, schloss die Augen und wartete auf den Tod.
Aber der Tod war ein Arschloch.
Lautes Krachen erschütterte den Raum, aber nichts geschah, kein Aufprall, keine Finger, die sich in meinen Hals oder meine Brust bohrten. Ich öffnete ein Auge. Alek lag benommen auf dem Boden. Am anderen Ende der Bühne zupfte eine schöne Blondine ihre Lederhandschuhe zurecht und warf mir einen vorwurfsvollen Blick zu. In ihrem roten Kaschmirmantel und den roten Pumps sah sie aus, als käme sie gerade aus einem Fünf-Sterne-Restaurant.
»Du hast ein echt mieses Timing«, sagte ich.
»Das kann man so und so sehen«, flötete Jacqueline zuckersüß und drehte sich ein winziges Stück, um den Vampir, der auf sie zuraste, am Hals zu packen und ihn hochzuheben. »Böser Junge. Wo sind deine Manieren?«
Sie schleuderte ihn gegen die anderen, die uns gefolgt waren, weil sie sich ein bisschen Action erhofft hatten. Die Vampire stoben auseinander und warfen bei ihrer Flucht Stühle und Tische um. Zwei reinblütige Vampire wie wir waren praktisch unbesiegbar.
»Was machst du hier?«, fragte ich.
»Deinen Arsch retten.« Sie griff in ihren Mantel, zog einen Blutbeutel und ein weiteres Paar Handschuhe heraus und warf mir beides zu.
Ich steckte die Handschuhe in meine Tasche, riss den Blutbeutel auf, kippte ihn in ein paar Schlucken hinunter und warf den leeren Plastikbeutel auf den Boden.
»Besser?«, fragte sie.
Ich war mir nicht sicher, wie ich darauf antworten sollte. Ich war noch am Leben, was nicht das war, was ich mir erhofft hatte, aber meine Kopfschmerzen waren weg. Das war also erledigt.
»Wie hast du mich gefunden?« Ich ging an ihr vorbei und sprang von der Bühne.
Jacqueline folgte mir. Als wir den Eingang erreichten, stolperte eine Gruppe von jungen Männern herein. Ihre Augen weiteten sich, als sie die Verwüstung betrachteten, die wir angerichtet hatten.
»Der Club ist heute geschlossen«, säuselte Jacqueline. Sie starrten sie an, als hätten sie noch nie in ihrem Leben eine Frau gesehen.
Von seinem zweifellos hohen Blutalkoholgehalt beflügelt, beugte sich einer näher an sie heran. »Wo wollt ihr hin? Können wir mitkommen?«
»Oh, ihr süßen, einfachen Jungs, mich verkraftet ihr nicht.« Sie fasste sie fest ins Auge. »Geht nach Hause, schlaft euch aus und helft morgen euren Müttern beim Hausputz.«
Sie blinzelten verwirrt, drehten sich aber um und gingen zurück auf die Straßen von Paris. Als wir aus dem Club kamen, sahen wir, wie sie sich trennten und jeder seiner Wege ging.
»Sie hatten keine Chance«, sagte ich trocken.
Jacqueline stürzte sich so schnell auf mich, dass ich erst reagieren konnte, als ihre Handfläche gegen meine Wange klatschte. Ich rieb mir die Wange.
»Du auch nicht«, warf sie mir vor. »Was hast du dir dabei gedacht? Wenn Sebastian nicht angerufen hätte …«
»Seit wann seid ihr zwei beste Freunde?« Ich fuhr fort, meine Wange zu massieren. Jacqueline war furchtbar stark.
»Wir haben ein gemeinsames Ziel: deinen sturen Arsch am Leben zu erhalten.« Sie packte mich an der Jacke und schob mich vorwärts. »Ich bringe dich nach Hause.«
Mit ihr zu streiten war sinnlos, auch wenn zu Hause der letzte Ort war, an dem ich sein wollte. Was hätte es gebracht, ihr zu sagen, was sie bereits wusste?
Dass ich überall, wo ich hinschaute, Thea sah.
Dass ich sie immer noch riechen konnte.
Dass ich bei dem Versuch, die Erinnerung an sie auszulöschen, fast das ganze Haus zerlegt hätte.
Jacqueline war zwar nicht blind, aber das bedeutete nicht, dass sie in den letzten Monaten besonders verständnisvoll gewesen war. Sie hatte ihre Meinung zu meiner Entscheidung deutlich gemacht, als sie Thea abholte und ihr beim Packen half. Seitdem hatte nichts sie von ihrer Haltung abbringen können.
Wir gingen schweigend weiter, während die Sonne langsam aufging. Jetzt, nachdem ich etwas Blut getrunken hatte, fühlte ich mich körperlich besser – bis auf das klaffende Loch an der Stelle, wo mein Herz sein sollte. Wie ich es auch anstellte – nichts hatte es gefüllt. Es war eine schwärende Wunde, die niemand sonst sehen konnte. Mit jedem Atemzug, jedem Schritt und in jedem Augenblick spürte ich ihre Abwesenheit.
Hughes kam uns an der Haustür entgegen, er war bereits für den Tag angezogen und schürzte die Lippen, als er mein Aussehen bemerkte, aber er sagte nichts.
»Guten Morgen«, begrüßte ich ihn steif. Ich streifte den Wollmantel ab, der an mehreren Stellen zerrissen war, und reichte ihn ihm.
»Soll ich …« Er betrachtete den Mantel und schien zu dem Schluss zu kommen, dass er nicht mehr zu reparieren war. »Ich werde einen neuen bestellen lassen.«
Ich machte mich auf den Weg zur Treppe, doch er rief mir hinterher. »Ihr Zimmer ist so, wie Sie es verlassen haben, ganz wie Sie es gewünscht haben.«
Na, toll. Ich konnte es kaum erwarten, Jacquelines Kommentar dazu zu hören. Ich zog mein Hemd aus, während ich die restlichen Stufen hinaufging.
Sie sagte nichts, als wir das Schlafzimmer betraten – oder das, was davon übrig war. Die Sessel waren zerfetzt, die Bilder lagen auf dem Boden, das Bett war zerstört. Ich war ausgerastet und hatte versucht, Thea aus dem Raum zu verbannen, aber sie war nicht in den Gegenständen. Sie war in den Wänden, auf dem Boden, in der Luft selbst. Ich konnte ihr nicht entkommen. Egal, wo ich hinging. Das hatte ich begriffen, als ich meine Zeit im Pigalle verschwendet hatte.
Aber hier konnte ich ihr nicht nur nicht entkommen. Ich konnte sie nicht ignorieren.
Ich ließ mich auf die Reste eines Sessels sinken und hob einen Schal auf, der noch immer nach ihr roch.
Ich knüllte ihn in meiner Faust zusammen und wartete darauf, dass meine beste Freundin ihr Schweigen brach.
Sie öffnete den Mund, holte tief Luft und warf mir einen wütenden Blick zu. »Mit dem Raum hier hatte ich mir wirklich große Mühe gegeben.«
Daran hatte ich nicht gedacht. »Tut mir leid.«
»Was machst du da?«, fragte sie und versuchte zuerst, sich neben mich auf die Trümmer zu setzen. Dann gab sie auf und stellte sich vor mich. »Du hast selbst mit ihr Schluss gemacht.«
»Weiß ich«, sagte ich bitter.
»Wenn du noch etwas für sie empfindest …«
»Sie ist meine Brut-Consort!«, brüllte ich.
»Das soll dann wohl Ja heißen.« Ihre Nasenflügel blähten sich, und sie verschränkte die Arme. »Also, was ist das Problem? Deine Familie? Die Sache mit der Jungfräulichkeit?«
»Damit geht es los.«
»Manchmal wünschte ich, du hättest mehr Fantasie.« Sie schüttelte den Kopf. »Es gibt eine Möglichkeit, das zu umgehen. Man muss sich nur darum kümmern.«
»Ich kann nicht«, sagte ich durch zusammengebissene Zähne.
Sie schnalzte mit der Zunge. »Du meinst, du willst nicht.«
»Ich meine, dass ich nicht kann«, sagte ich laut. »Alles in mir will zu ihr. Ich weiß nicht, wie lange ich noch widerstehen kann.«
»Na dann, was ist dein Plan? Willst du dich umbringen lassen, damit du nicht in Versuchung gerätst?«, fragte sie.
Ich hob das Gesicht zu ihr, meine Antwort stand darin geschrieben.
Jacqueline ging ein paar Schritte, ihre Wut wich der Verzweiflung. »Wie? Warum?« Sie schüttelte den Kopf, um ihre Gedanken zu ordnen. »Wie konntest du einfach aufgeben? Wie würde sich Thea fühlen, wenn sie erführe, dass du lieber stirbst, als mit ihr zusammen zu sein?«
»Glaubst du, ich habe eine Wahl?«, flüsterte ich. Aus irgendeinem Grund kam mir diese Vorstellung noch schlimmer vor.
»Was ist passiert?«
»Der Convent hat mir einen Besuch abgestattet. Um ihr Leben zu retten, musste ich mich von ihr lossagen.«
Jacqueline schüttelte den Kopf. »Glaubst du wirklich, sie würden sie umbringen?«
»Es wurde über ihre Exekution diskutiert.«
»Also hast du sie stattdessen getötet?«
»Ich habe sie gerettet«, brüllte ich.
»Und welchen Preis musste sie dafür zahlen? Welchen Sinn hat das Leben, wenn man innerlich leer ist?«
Ich ließ den Kopf hängen. »Ich hatte keine andere Wahl.«
»Doch, hattest du und hast du immer noch.«
»Was redest du da?«, murmelte ich.
»Julian.« Sie schleuderte mir meinen Namen entgegen. »Schwing deinen Arsch nach Kalifornien.«
3 CAMILA
Am Montag erhielt ich den Anruf, auf den ich seit dem Abend in der Oper gewartet hatte. Ein Monat war seit unserem Angriff auf die privilegierte Vampir-Elite vergangen, und was hatte Julian in dieser Zeit unternommen? Nichts.
Es war erbärmlich.
Aber wenn man meinem Informanten trauen durfte, war mein geliebter Zwilling nun endlich auf die Suche nach seinem Menschen gegangen. Für den Privatjet unserer Familie war ein Flugplan von Paris nach San Francisco eingereicht worden.
Bedachte ich die Gerüchte, die mir zu Ohren gekommen waren, hatte er länger durchgehalten als erwartet. Es schien, als wäre er praktisch an diese erbärmliche Kreatur gefesselt. Deshalb war ich schockiert, als er sich nach ihr verzehrte, anstatt das einzufordern, was er so offensichtlich wollte. Sie war ein Mensch. Sie gehörte ihm, und er hatte sie einfach gehen lassen. Vielleicht wurde er weich. Es sah so aus, als würde meine ganze Familie weich werden, und das war das Problem.
Es war Zeit für einen Weckruf.
Ich parkte gegenüber von seinem Pariser Haus und wartete, bis der Wagen kam, der ihn zum Flughafen brachte. Ich hatte darauf vertraut, dass Jacqueline ihn überzeugen würde, etwas zu unternehmen. Meinen Bruder zu irgendwas zu überreden war im Grunde das Einzige, wozu sie taugte.
Julian reiste mit nichts weiter als einer kleinen ledernen Reisetasche ab. Er sah schlimmer aus als in jener blutigen Nacht in der Pariser Oper. Damals war er tödlich gewesen und hatte mehrere meiner Kameraden ausgeschaltet. Aber er war auch wild und von Blutgier getrieben gewesen – ein Fehler, der ihn fast das Leben gekostet und mich gezwungen hätte einzugreifen.
Ich mag meine Familie hassen, aber niemand anders hatte die Erlaubnis, sie zu töten.
Doch wenn ich ihn selbst tötete, könnte ich sie nicht finden, und sie war die Trophäe, hinter der ich her war.
Seit ihrer Abreise hatte er keinen Kontakt zu seinem Menschen aufgenommen, was mich daran gehindert hatte, sie aufzuspüren. Die Kreatur war einfach verschwunden. Niemand schien viel über sie zu wissen, aber die Gerüchte weckten mein Interesse. Ich wollte sie kennenlernen, bevor ich über ihr Schicksal entschied.
Mein Handy klingelte, als ich meinem Bruder gerade dabei zusah, wie er ins Auto stieg, um zu unserem Privatjet zu fahren.
Ich meldete mich mit einem knappen »Ja?«.
»Schlechtes Timing?«, fragte eine aalglatte Stimme.
Ich verzog das Gesicht. »Was wollen Sie, Boucher?«
Ich traute dem knopfäugigen Vampir nicht, aber er brannte darauf, uns Informationen zu verkaufen. Er hatte dringend aus seinem Exil nach Paris zurückkehren wollen. Nun, da ihm das gewährt worden war, stand er in unserer Schuld, was nicht bedeutete, dass er loyal war. Es bedeutete nur, dass er einen niedrigen Preis hatte.
»Ich hatte Kontakt zu einem unserer Mitarbeiter in Kalifornien«, sagte er langsam. »Aber wenn jetzt ein schlechter Zeitpunkt ist …«
»Machen Sie sich nicht wichtig!«, schnauzte ich ihn an. »Sagen Sie mir einfach, was Sie gefunden haben.«
»Einen Menschen, der bei einer Wahrsagerin war«, sagte mir Boucher. »Theas Beschreibung passt auf sie. Die alte Hexe, die den Salon betreibt, war nicht gerade erpicht darauf, ihr Wissen zu teilen.«
»Bezahlen Sie sie«, befahl ich.
»Warum sie bezahlen? Mein Mitarbeiter ist sehr überzeugend. Sie wusste nicht viel, aber sie bestätigte, dass die Frau mit einem Vampir zu tun gehabt hatte.«
»Jemand soll der Spur folgen und sie im Auge behalten.« Vielleicht konnte ich meinem Bruder bei seiner Freundin zuvorkommen. Das wäre ein Wiedersehen! Aber es gab etwas, das ich zuerst tun musste. »Ich muss gehen.«
Bevor ich auflegen konnte, hielt mich Boucher auf. »Eins noch.«
»Ja?«, fragte ich ungehalten.
»Die Hexe sagte, sie stänke nach Olibanum.«
»Olibanum?« Ich stutzte. Typisch Boucher, dass er sich die wichtigen Details für den Schluss aufhob. Ich konnte den Mann nicht ausstehen. Er hatte keine Ideale. Er hasste es einfach bloß, sich an irgendwelche Regeln zu halten. Je nachdem, wie es ihm in den Kram passte, half er uns genauso, wie er den Reinblütigen half. Aber er hatte immer noch einen Trumpf im Ärmel.
»Wenn das wahr ist, bedeutet das …«, begann er.
»Ich weiß, was es bedeutet«, zischte ich. Julians Auto fuhr davon, und ich sah meine Chance. Ich hatte zu lange auf diesen Moment gewartet, um mich jetzt ablenken zu lassen. Ich hatte etwas zu erledigen. »Gute Arbeit, Boucher.«
Ich legte auf, schnappte mir den Kanister aus dem Fußraum des Mercedes, stieg aus und ging auf die andere Straßenseite. Ein Fahrer hielt kreischend an und schrie aus seinem Fenster, bis er mich sah. Diese armseligen Menschenmänner – sie ließen sich so leicht ablenken. Ein anderes Mal hätte ich vielleicht für einen Bissen innegehalten, aber in Julians Haus wartete etwas viel Köstlicheres auf mich.
Ich läutete und wartete, während ich den Gürtel meines schwarzen Trenchcoats enger schnallte. Die Tür öffnete sich und Hughes erschien. Er sah aus, als würde es ihn überfordern, einen Besucher zu empfangen, wenn sein Herr nicht da war.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er.
Es war keine Überraschung, dass er mich nicht erkannte. Es war schon ein paar Jahrzehnte her, und obwohl wir beide nicht gealtert waren, war ich nicht mehr die Frau, an die er sich erinnerte. Ich nahm meine Chanel-Sonnenbrille ab. Seine Gelassenheit geriet ins Wanken, und er atmete heftig ein.
»Mistress Rousseaux«, begrüßte er mich schockiert. Er riss die Tür auf, trat zur Seite und ließ mich ins Haus. »Ich fürchte, Ihr Bruder ist nicht hier, aber er ist gerade erst gegangen. Ich kann ihn zurückrufen.«
»Das ist nicht nötig.« Ich sah mich im Eingangsbereich um und war beeindruckt vom geschmackvollen Interieur. Allerdings war Julian wie ich mit Geld und Privilegien aufgewachsen. Er wusste, wie man beides nutzt.
»Aber er wird es wissen wollen. Er hat den Eindruck, dass …« Hughes brach ab.
»Ja?«, fragte ich nach. Ich wollte hören, dass er es aussprach.
»Dass Sie gestorben sind. Wir dachten alle …«
»Ist das die hübsche Geschichte, die sie über mich erzählen?«, fragte ich lachend. »Warum überrascht mich das nicht?«
»Ich verstehe das nicht, aber bitte lassen Sie mich anrufen …«
Seine Worte starben zusammen mit ihm. Ich ließ seinen Kopf auf den Boden krachen, als sein Körper auf dem Marmorboden zusammenbrach.
»Tut mir leid, Hughes. Ist nichts Persönliches«, sagte ich zu seiner Leiche. Ihn zu töten war einfacher, als in seiner Nähe zu arbeiten, und ich hatte etwas zu erledigen.
Ich machte mir nicht die Mühe, auf Zehenspitzen zu gehen. Schleichen würde bedeuten, dass ich mir Sorgen machte, erwischt zu werden. Das tat ich aber nicht.
Die langen Finger meiner rechten Hand strichen über das Eichenholzgeländer, als ich die Treppe hinaufstieg, die um das Foyer herum in den ersten Stock führte.
Brandstifter wissen, wo man ein Feuer legen muss. Es liegt ihnen im Blut wie eine Krankheit. Mein Mann war Brandstifter gewesen – als er noch lebte.
Ein Dachboden oder ein Keller verbargen die Flammen am längsten. Obwohl ein Dachstuhlbrand, wenn man ihn rechtzeitig entdeckte, mit geringem Schaden für den Rest des Hauses gelöscht werden konnte. Ein Kellerbrand war ein bisschen so, als würde man eine Flamme vom Herd brennen lassen. Unbeaufsichtigt würde die Feuersbrunst das ganze Gebäude zu einer schwelenden Ruine einäschern. Aber meine Brandstiftung wollte ich ebenso wenig verbergen wie meine Schritte. Der Plan war, eine Botschaft zu senden. Ich hielt den Kanister, den ich bei mir trug, fest in der Hand. Wenn man einen Krieg begann, war es lohnenswert, gut vorbereitet zu sein. Wenn man ein Feuer entfachte, war Benzin immer hilfreich.
Ich tränkte die Treppe, während ich ging. Die Dämpfe brannten mir in der Nase und ich atmete gierig die Verheißung flüssiger Zerstörung ein. Sein Schlafzimmer befand sich im obersten Stockwerk. Darunter warteten zwei weitere Stockwerke, und darunter die extravaganten Wohnräume, die mit seinem gesammelten Lebenswerk vollgestopft waren: Antiquitäten, Bücher, Kunst. Im Eingangsbereich war ich an einem schönen Renoir vorbeigekommen. Mein Bruder hatte einst einen so exquisiten Geschmack gehabt.
Und jetzt sehnte er sich nach einem verdammten Menschen.
Ekel drang mir bis in die Knochen, als ich in sein Zimmer trat. Es sah aus, als wäre es durchwühlt worden. Ein zerbrochener Spiegel war auf die Seite gekippt, überall lagen Glassplitter herum. Das Bett war umgeworfen worden. Ich konnte überall den Geruch der Menschenfrau wahrnehmen. Meine Augen verdunkelten sich. Wenn sie hier wäre, würde ich sie ausbluten lassen. Ich würde ihn zwingen zuzusehen – ihn dazu bringen, den erbärmlichen modernen Vampir zu erkennen, zu dem er geworden war.
Das war der Schlüssel, um Julian zu brechen – meine ganze Familie zu brechen. Sobald sie ihrer wahren Natur nachgaben, würden sie darum betteln, sich uns anzuschließen.
Und wenn eine reinblütige Familie fiel, würden die anderen folgen.
Ich ging zum Nachttisch, der mit Briefen und Büchern bedeckt war. Einige waren zerrissen worden.
»Wonach hast du gesucht, kleiner Bruder?«, fragte ich den leeren Raum, doch dann entdeckte ich ihn.
Ein gefalteter Brief, vergilbt und brüchig, lag auf einem Stapel alter Notizbücher. Ich hob ihn auf und sah mir den Inhalt an. Das Gekritzel war schwer zu lesen, und das dumme Machwerk war eine seltsame Mischung aus Französisch und Latein. Ich schnaubte, als ich die Unterschrift las – das einzige Geräusch, das die Stille des leeren Hauses durchzog. Hatte er den Brief aus Eitelkeit oder aus Sentimentalität behalten? Die Tatsache, dass er nach Hunderten von Jahren immer noch bei seinem Bett lag, hatte etwas zu bedeuten.
Ich ließ ihn auf das Bett fallen und sammelte dann die verschiedenen Seiten ein, die er aus den Büchern herausgerissen hatte. Ich zerknüllte sie und legte sie zu meinem Scheiterhaufen. Ich nahm ein einziges Streichholz heraus und zündete es an, schnippte es auf den Stapel – das alte Papier war ein gefundenes Fressen.
»Fröhliche Einweihungsparty, Julian«, sagte ich, als die Flammen an seinem Bett fraßen.
Von hier aus würde sich das Feuer in alle Richtungen ausbreiten, bis das ganze Haus von seiner Umarmung verschlungen wurde. Ich ließ mir Zeit, als ich aus dem Haus ging, und genoss die zunehmende Hitze in meinem Rücken. Aber ich hielt nicht an, um mein Werk zu begutachten. Ich stieg über Hughes’ Leiche und hielt inne. Ich wusste, wie man einen Vampir vernichtet: das Herz durchbohren und den Körper verbrennen.
Ich gebe zu, dass ich das Pferd von hinten aufzäumte, aber jetzt, da ich wusste, wo seine kostbare Menschenfrau war, würde ich sie aus seinem Leben streichen – nachdem ich herausgefunden hatte, welche Geheimnisse sich in ihrem Blut verbargen. Vielleicht würden ihm dann endlich die Augen aufgehen. Vorerst ließ ich das brennende Haus und alles und jeden darin zurück – eine Botschaft an meinen Bruder und unsere stinkreiche Familie.
Nur den Renoir nahm ich mit.
4 THEA
Die Ärzte konnten es sich nicht erklären. In der einen Minute lag meine Mutter im Koma, in der nächsten war sie wach. Ich kam von der grässlichen Weissagung herein und fand sie aufrecht sitzend vor, als ob nichts geschehen wäre. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, also tat ich beides, während sie Dutzende von Tests durchführten.
»Unverzeihlich, dass ich nicht hier war«, murmelte ich und kuschelte mich neben sie aufs Bett.
Meine Mutter lächelte, obwohl sie wie ein menschliches Nadelkissen aussah. »Jetzt bist du ja da. Das ist das Einzige, was zählt.« Sie stockte und holte tief Luft. »Aber du musst bestimmt wieder los.«
Ihre Worte trafen mich ins Herz, und ich zwang mich, den Kopf zu schütteln. »Vergiss es. Ich gehöre hierher, und hier bleibe ich auch.«
»Es hat also nicht geklappt?«, fragte sie. »Dieser mysteriöse Job, den du angenommen hast?«
Seit sie aufgewacht war, hatte ich mich vor diesem Gespräch gefürchtet, aber ich wusste, dass ich es nicht mehr lange hinauszögern konnte. Wir hatten kaum miteinander gesprochen, während ich weg war. Sie war wütend über meine Entscheidung, ein Sabbatical zu nehmen. Vor allem, weil ich so kurz vor dem Abschluss stand. Damals hatte ich alles in meiner Macht Stehende getan, um zu verhindern, dass sie erfährt, warum ich alles hinschmeiße und nach Paris gehe. Wir hatten zwar einen guten Draht zueinander, aber sie war immer noch meine Mutter. Was hätte ich ihr denn sagen sollen? Dass ich mich Hals über Kopf in einen Vampir verliebt hatte?
»Ich glaube, ich wollte einfach mal etwas Unvernünftiges tun«, gestand ich ihr und ließ den Kopf hängen. »Es war dumm.«
»Möglicherweise«, sagte sie liebevoll, »aber, mein liebes Mädchen, du hast noch nie etwas Unvernünftiges getan. Vielleicht war es an der Zeit.«
Ich blickte zu ihr auf. Das war nicht die Reaktion, die ich erwartet hatte. »Warte mal. Jetzt findest du es plötzlich okay?«
»Die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit rückt die Dinge in ein neues Licht.« Sie zog mich näher an sich heran und umarmte mich mit ihrem freien Arm. Der andere war mit Drähten und Schläuchen gespickt. »Ich will nicht, dass du dein ganzes Leben damit verbringst, zu kellnern und zu versuchen, über die Runden zu kommen. Ich bin froh, dass du gegangen bist.« Sie blickte zu mir hinüber. »Du auch?«
Ein Kloß bildete sich in meiner Kehle. Ich hatte den letzten Monat damit verbracht, mich dafür zu verurteilen, dass ich gegangen war. Das war einfacher, als die Wahrheit zu akzeptieren.
Julian hatte mich verletzt und mir das Herz gebrochen. Ich hatte alles aufgegeben, um ihn auf eine verrückte Reise um die Welt zu begleiten, die schon zu Ende war, bevor sie richtig begonnen hatte. Ich sollte ihn hassen. Ich sollte mich dumm fühlen. Ein bisschen war es auch so. Aber wenn mir jetzt jemand die Schlüssel zu einer Zeitmaschine anböte, würde ich keine Minute davon verändern.
Die Erinnerungen kribbelten auf meiner Haut, wenn ich nur an ihn dachte. Manchmal hätte ich fast schwören können, dass ich immer noch seine Hand in meiner spürte. Ich ballte meine Hand zur Faust, strich mit den Fingerspitzen über meine nackte Handfläche und erinnerte mich an den zarten Schmerz, den ich in dem Moment verspürte, als er meine Hand nahm. Er hatte mir in jener Nacht die Jungfräulichkeit gelassen und stattdessen mein Herz erobert.
»Verstehe«, sagte Mama leise, als ich schwieg. »Dieser Job war also …«
»Kompliziert.« Meine Stimme brach sich bei dem Wort und verriet meinen Schmerz. »Er war sehr kompliziert.«
»Thea, bist du …?«
Bevor sie ihre Frage beenden konnte, steckte Dr. Reeves den Kopf herein. »Wie geht es meinem Lieblingswunder?«
Meine Mutter errötete, setzte sich etwas aufrechter hin und schob das Kissen hinter ihren Rücken.
Offensichtlich war Olivia nicht die Einzige, die ein Auge auf den gut aussehenden Arzt geworfen hatte. Ich konnte nicht erkennen, was sie beide an ihm fanden. Andererseits war ich nicht gerade emotional offen.
»Wunderbar«, schwärmte meine Mutter. »Aber wann kann ich nach Hause?«
»Sie wollen mich schon verlassen?« Dr. Reeves trat ein und lehnte sich gegen den Türrahmen. Er steckte einen Stift in seinen Laborkittel und lächelte.
»Natürlich nicht«, sagte sie, »aber ich möchte gern aus diesen Klamotten herauskommen.«
»Wir warten nur noch auf die Ergebnisse Ihres CT-Scans. Sobald wir die haben, sind Sie eine freie Frau.« Reeves blickte zu mir. »Keine Sonntagsblumen mehr, nehme ich an.«
Ich rollte mit den Augen. Seit Wochen war ich Zeugin des ständigen Flirtens zwischen ihm und meiner Mitbewohnerin. »Ich gebe Ihnen ihre Nummer.«
»Oh, das ist nicht …«, sagte er und klang leicht panisch.
»Ist schon okay. Ich muss sie nur vorher fragen.«
Ich holte mein Handy heraus, um Olivia eine Textnachricht zu schreiben, und mir wurde ganz flau im Magen. Ich hatte einen verpassten Anruf von einer französischen Nummer. Bevor ich mich entschuldigen konnte, um die Voicemail abzuhören, klopfte eine stämmige Frau mit einem Klemmbrett in der Hand an die Tür.
»Kann ich mit der Patientin sprechen?«, fragte sie, als sie schon halb drin war. »Ich bin von der Buchhaltung.« Sie zeigte auf ihr Namensschild, auf dem »Marge« stand. Darunter in fetten blauen Buchstaben das Wort »Buchhaltung«. Ich musste mich fast übergeben, als ich das sah. »Ich brauch ein paar Unterschriften, Mrs Melbourne.«
»Ms«, korrigierte meine Mutter sie stolz. »Ich bin nicht verheiratet.«
»Oh, ich bitte um Entschuldigung«, sagte sie, den Blick auf ihre Papiere gerichtet, während sie ans Bett trat. »Es geht ganz schnell.«
»Ich komme später noch mal vorbei«, sagte Dr. Reeves und verschwand, um uns etwas Privatsphäre zu geben.
Am liebsten wäre ich auch verschwunden. Das war der Teil, den ich immer gehasst habe. Irgendwann tauchte immer die Buchhaltung auf, um die Bezahlung zu vereinbaren. Ich nahm es Reeves nicht übel, dass er gegangen war. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das für einen Arzt sein musste, er hatte so hart gearbeitet, um das Leben meiner Mutter zu retten, aber er musste wissen, dass die Schulden uns ersticken würden. Ich hatte es von dem Moment an gewusst, als ich den Anruf erhielt. Wenigstens hatte das Krankenhaus gewartet, bis meine Mutter aufgewacht war. Bis jetzt hatte mich niemand wegen der Rechnung behelligt.
»Ich mach das«, sagte ich und griff nach dem Klemmbrett. »Ich habe eine anwaltliche Vollmacht.«
»Thea, das musst du nicht«, sagte Mama sanft. »Das ist nicht dein Problem.«
»Von wegen«, murmelte ich. Meine Mutter war der einzige Mensch, auf den ich immer zählen konnte, wenn es hart auf hart kam. Sie war alles, was ich hatte, und umgekehrt. Ich hatte sie gerade erst zurück, und sie in dieser Situation zu belasten, war das Letzte, was ich ihr zumuten wollte.
Ich wühlte mich durch den Papierkram. Wir hatten dem Krankenhaus bereits ein kleines Vermögen geschuldet. Sie waren so freundlich gewesen, unseren früheren Kontostand ganz oben zu vermerken, um mich daran zu erinnern. Die Schulden für den Monat auf der Intensivstation kamen noch hinzu. Ich sah, wie sich die Zahlen mit jedem einzelnen Vorgang erhöhten – und dann erreichte ich die letzte Seite.
»Ich verstehe nicht«, sagte ich verwirrt und starrte auf die letzte Zeile. Über der Null zierte ein Minuszeichen einen Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich.
»Es kann sein, dass es noch einige letzte Anpassungen gibt. Anfang des Monats wurde uns mitgeteilt, dass die Rechnung privat beglichen wird, aber ich habe trotzdem alle Forderungen aufgelistet«, erklärte sie mir. »Ihr Mann hat darauf bestanden, dass wir nicht auf die Versicherung Ihrer Mutter warten.«
»Mein was?«, wiederholte ich. Mein Mund wurde trocken, und mein Herz begann zu rasen. Abwesend strich ich mir über die linke Brust. »Ich bin nicht verheiratet.«
»Thea, was ist hier los?« Meine Mutter reckte den Hals und versuchte, den Papierkram zu sehen.
»Ein Fehler«, sagte ich leise.
»Er war ziemlich deutlich.« Die Buchhalterin kam näher und überprüfte das Krankenhausarmband meiner Mutter. »Ja, er hat die Rechnung für Kelly Melbourne bezahlt. Sie sind Kelly Melbourne, richtig?«
»Ja.« Mom schaute ratlos zwischen uns hin und her. »Aber das verstehe ich nicht. Wer hat meine Rechnung bezahlt?«
Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Sollte ich jetzt glücklich, wütend oder auf der Hut sein? Vielleicht war es ein Irrtum. Vielleicht hatte jemand den falschen Namen gesagt. Vielleicht war irgendein Milliardär hereingekommen und hatte angefangen, Krankenhausrechnungen zu bezahlen, weil er Schuldgefühle wegen seines Kontostandes hatte.
Aber ich ahnte, dass es nichts von alledem war.
»Tut mir leid, ich dachte, er sei Ihr Schwiegersohn. Er wirkte sehr familiär«, sagte Marge. Ich errötete über ihre Wortwahl, während sie mich genauer musterte. »Sie sind nicht verheiratet?«
»Nein«, sagte ich entschlossen.
»Dann muss heute Ihr Glückstag sein.« Der abfällige Unterton in ihren Worten entging mir nicht.
Wenn ein Mann auftauchte und anfing, einem die Schulden zu bezahlen, schienen alle anzunehmen, man sei ein Escortgirl.
Aber was sie über mich dachte, war mir egal. Ich dachte an den Anruf, den ich verpasst hatte. War er das gewesen? Hatte er angerufen, um mir zu sagen, dass er die Rechnungen bezahlen würde? Ich wusste nicht recht, was überraschender war. Dass er sich trotz der Trennung an unsere Vereinbarung gehalten hatte oder dass es ihn überhaupt interessierte.
»Ich regele das«, sagte ich zu meiner Mutter. »Unterschreib nichts.«
»Es ist bereits alles unter Dach und Fach«, sagte Marge. »Wenn ich Sie wäre …« Sie brach ab, als ich ihr einen scharfen Blick zuwarf. »Ich komme später wieder.«
Ganz sicher plante sie, meine Mutter zu überreden, wenn ich nicht da war. Sie hatte natürlich recht. Die Zahlung nicht anzunehmen war albern, aber ich brauchte eine Minute, um diese Wendung der Ereignisse zu verarbeiten.
»Thea, weißt du, wer diese Rechnungen bezahlt hat?«, fragte meine Mutter, als wir allein waren.
Ich konnte mich nicht überwinden, sie anzusehen. Nach einer Minute nickte ich. »Ich glaube schon.«
Schweigen breitete sich zwischen uns aus. Aber es gab keine Missbilligung, als sie schließlich fragte: »Was hat es dich gekostet? Was hat dieser Mann genommen?«
»Nur mein Herz.« Ich schloss die Augen und fragte mich, wie es möglich war, so unter seiner Abwesenheit zu leiden. »Er hat nichts anderes genommen. Er hat nichts anderes gewollt.«
»Irgendwie bezweifle ich das«, sagte sie vorsichtig. »Oh, Schatz, ich habe das Gefühl, dass mehr hinter dieser Geschichte steckt.«
»Stimmt«, murmelte ich.
Mama griff nach meiner Hand. Sie drückte sie heftig. »Tu das, was sich für dich richtig anfühlt.«
»Ich kann sie nicht zwingen, sein Geld zurückzugeben.« Ich schüttelte den Kopf. »Aber ich kann es ihm zurückzahlen.«
»Was?«, keuchte sie. »Wie? Doch nicht …«
»Nichts dergleichen«, sagte ich schnell, als ich merkte, dass sie einen falschen Eindruck gewonnen hatte. Dachten wirklich alle, ich hätte einen reichen Gönner, der mich aushielt? »Er hat mir ein Cello geschenkt – ein teures. Ich kann es verkaufen.«
Es tat weh, daran zu denken. Das Cello war alles, was mir von meiner Beziehung zu Julian geblieben war.
Bis jetzt war keine Zeit gewesen, es zu verkaufen. Wenigstens hatte ich mir das eingeredet. Aber nun, wo ich den Gedanken zulassen musste, den letzten greifbaren Beweis für unsere Beziehung zu verlieren, hätte ich am liebsten geweint. Ein Cello hatte uns zusammengebracht. Ein Cello würde die Bande zwischen uns lösen.
Es war passend – fast schon opernhaft.
»Vielleicht solltest du zuerst mit ihm reden«, schlug sie vor. »Gib ihm eine Chance …«
»Er ist in Paris«, unterbrach ich sie. »Und es gibt nichts zu bereden. Es war für uns beide ein vorübergehender Anfall von Wahn.«
»Du liebst ihn«, sagte sie traurig. Das war keine Frage, sie wusste es einfach. Natürlich wusste sie es. Sie war meine Mutter.
Ich stand auf und fühlte mich etwas schwindelig. »Entschuldige mich. Ich muss telefonieren.«
Sie nickte und ließ meine Hand los, als ich aufstand. »Ich gehe nicht weg.« Ich beugte mich hinunter und umarmte sie fest.
Als ich in den Flur kam, schaute ich auf den verpassten Anruf auf meinem Telefon. Meine Finger zitterten, als ich über die Benachrichtigung strich, und ich ließ das Telefon fallen. Es landete mit einem nervenaufreibenden Knacken.
»Gute Arbeit, Thea«, murmelte ich und bückte mich, um es aufzuheben. Ich konnte bereits einen Riss im Bildschirm sehen.
Lange, elegante Finger berührten meine, als ich danach griff. Als seine Haut meine berührte, traf mich der Schock des Wiedererkennens wie ein Stromstoß. Meine Knie knickten ein, aber bevor mich das gleiche Schicksal ereilte wie mein Handy, fing er mich auf. Julian stützte mich, bis ich wieder sicher stand, dann trat er ein kleines Stück zurück.
Es fühlte sich an, als würde meine Brust bersten und all den Aufruhr herauslassen, der in mir tobte. Ich brachte es nicht über mich, ihn anzusehen. Ich war mir nicht sicher, ob ich es überleben würde. Allein die Berührung hatte meinen Körper in einen nervösen Rauschzustand versetzt. Alles in mir wollte in seine Arme fallen und jeden einzelnen kostbaren Moment auskosten.
Aber mein Kopf war bei diesem Plan nicht mit an Bord. Es gab zu viel auf einmal zu begreifen. Zu viel Schmerz. Zu viel Hoffnung. Zu viel Liebe. Zu viel Wut.
Ich umklammerte mein Handy, mein Daumen blieb an der Bruchkante hängen und ich schnitt mich.
Ich zuckte zusammen und blickte nach unten, wo ich Blut an der Wunde entdeckte. Ich schob ihn in den Mund, um nicht versehentlich einen Blutrausch bei ihm auszulösen.
»Bist du verletzt?«, fragte er besorgt und trat näher. Ich wich zurück und schüttelte den Kopf.
»Lass es mich sehen, Kleines«, sagte er sanft, aber bestimmt.
Ohne nachzudenken, hielt ich ihm meinen verletzten Finger zur Begutachtung hin. Julian nahm ihn, seine bloßen Hände umschlossen meine. Es hatte nichts zu bedeuten. Das wusste ich. Er hatte die Sache beendet. Er hatte mir das Herz gebrochen. Er hatte mich zurückgewiesen. Dennoch konnte ich mich nicht an die Vernunft oder Logik klammern, nicht einmal an die Wut, die unter der Oberfläche meiner Verwirrung kochte. Alles, was zählte, war, dass seine Hand meine berührte.
Und natürlich brach ich in Tränen aus.
Es war so dumm, so menschlich, das zu tun. Er streckte die Arme nach mir aus, aber ich wich vor ihm zurück.
»Warum bist du hergekommen?«, schluchzte ich, weil ich kein Mitleid von ihm wollte.
»Ich hatte eine Rechnung zu begleichen«, erwiderte er knapp, was meine Aufmerksamkeit auf seine geschwungenen Lippen lenkte und mich daran erinnerte, was hinter ihnen wartete. Als ob mein Körper auch an seine Reißzähne dachte, spürte ich ein leichtes Pochen in meinem Oberschenkel, wo er mich gebissen hatte.
»Das hättest du nicht tun müssen. Unsere Vereinbarung …«
»Ich schere mich einen Dreck um eine dumme Vereinbarung, Thea«, murmelte er. »Ich lasse nicht zu, dass du in einem Krankenhaus sitzt und dir wegen Rechnungen den Kopf zerbrichst.«
»Wieso interessiert dich das überhaupt noch?«, fuhr ich ihn an.
Er zuckte zurück, und in seinen blauen Augen glühte der Schmerz. »Das habe ich wohl verdient.«
»Vielleicht solltest du …«
Bevor ich ihn bitten konnte zu gehen, erschien Dr. Reeves. »Ist alles in Ordnung, Thea?«
»Ja«, sagte ich, aber Julian versteifte sich. »Ein Freund ist vorbeigekommen.«
Dr. Reeves sah nicht überzeugt aus. Er wandte sich an Julian. »Ich fürchte, die Besuchszeit ist für heute vorbei. Nur die Familie …«
»Ich gehöre zur Familie«, unterbrach ihn Julian. Mein dummes, verräterisches Herz freute sich über seine Behauptung.
»Ich dachte, dass Kelly nur eine Tochter hat«, sagte er und schaute mich an, damit ich es bestätigte.
»Öhm.« Ich kaute auf meiner Lippe. »Julian ist …«
»Familie«, sagte er erneut und blickte Reeves eindringlich in die Augen. »Sie müssen jetzt nach einem Patienten sehen. Auf einer anderen Etage.«
Dr. Reeves nickte, ein verwirrter Ausdruck huschte über sein Gesicht. »Entschuldigen Sie, ich muss nachsehen, ob die Testergebnisse von Mrs Grant schon da sind.«
Ich stöhnte auf, als der Doktor wie benommen in Richtung Aufzug ging. »Hast du ihn gebannt?«
»Unser Gespräch war noch nicht beendet«, sagte Julian beiläufig, aber ich bemerkte die Schwärze an den Rändern seiner Iris.
»Doch, war es.« Ich hob das Kinn und ignorierte den Impuls, zu ihm zu gehen. »Ich kann den Verkauf des Grancino arrangieren, oder du kannst es zurückhaben. Das sollte das meiste abdecken. Der Rest …«
»Stopp!«, knurrte er. Ein paar vorbeigehende Krankenschwestern zuckten bei seinem Tonfall zusammen. Er kam näher. »Ich will nicht, dass du es mir wiedergibst. Ich bin nicht gekommen, um mit dir zu streiten.«
Ich schluckte und hoffte, dass meine Stimme nicht zitterte, als er mich mit dem Rücken an die Wand drückte. »Was willst du? Warum bist du gekommen?«
Er neigte seinen Kopf zu meinem Ohr und flüsterte.
»Deinetwegen. Ich bin wegen meiner Bestimmung zurückgekommen.«