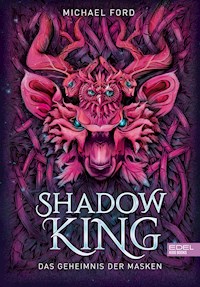
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Kids Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Seit die 13-jährige Julia im Wald eine alte Tiermaske entdeckt hat, wird sie von heftigen Träumen geplagt, in denen sie die Welt mit den Augen eines Tieres sieht. Immer wieder begegnet sie in ihren Träumen anderen Tieren: einem Hirsch, einer Eule und einem Wolf. Mit der Zeit findet sie heraus, dass es sich dabei um andere Jugendliche handelt, die ebenfalls seltsame hölzerne Tiermasken gefunden haben. Als ihr dann auch noch zwei mysteriöse Fremde im Wald auflauern, muss Julia erkennen, dass ihr Leben in Gefahr ist. Mithilfe der Maske flieht sie und macht sich zusammen mit ihrer neuen Freundin Abena auf den Weg nach Schottland, um die anderen Maskenträgern zu suchen. Dort wird sie bereits von dem dritten Maskenträger, den gutaussehenden Ehsan, erwartet. Gemeinsam mit ihm und den anderen, muss sie lernen, die Magie ihrer Masken zu nutzen, um den Shadow King zu besiegen. Ihnen bleiben nur noch wenige Tage, bis er erwacht und die Welt ins Verderben stürzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Shadow King
Das Geheimnis der Masken
eISBN 978-3-96129-252-3
Edel Kids Books
Ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
Copyright © Edel Germany GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Originaltitel: »The Forever King«
Copyright © 2021 by Working Partners, Ltd.
Text: Michael Ford
Übersetzung: Maren Illinger
Lektorat: Maria Schmidt
Covergestaltung: Frauke Schneider
Kapitelvignetten: Hase: nutriaaa/shutterstock.com, Wolf: Thattana Luechai/shutterstock.com, Hirsch: Cytart/shutterstock.com, Eule: Kaewta/shutterstock.com
ePub-Konvertierung: Datagrafix GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Die Menschen aus der Gegend nannten die Höhlen Caer Droia – Labyrinth. Es hieß, es gebe über hundert Wege hinein, aber keinen einzigen hinaus. Man erzählte sich viel über die Caer Droia, von Kobolden und dergleichen, aber das waren nur Schauergeschichten, um neugierige Kinder abzuschrecken. Die Caer Droia waren auch ohne Monster gefährlich genug.
Die vielen Eingänge lagen in der Landschaft verstreut – auf Waldlichtungen oder in Stollen, die unter dem Totholz vergangener Herbste begannen. Und hier und da konnte man, wenn man sich zwischen zwei große Felsen zwängte, den dunklen Schlund eines Tunnels finden. In sehr trockenen Sommern, so hieß es, taten sich mitunter Erdlöcher in den schwarzen Abgrund auf. Von Zeit zu Zeit verschwand ein Schaf von den umliegenden Höfen und wurde erst Monate später als verrottendes Skelett wiedergefunden, das in einer morastigen Öffnung eingeklemmt war.
Ein paar abenteuerlustige Höhlenforscher hatten versucht, das Labyrinth zu erkunden, doch sie waren nicht weit gekommen. Es galt als unnötiges Risiko. Der Mühe nicht wert.
Jedenfalls für die meisten.
An einem der ersten Frühlingstage, der so kühl und klar war wie ein letzter Hauch des Winters, bemerkten mehrere Einwohner des Städtchens zwei unbekannte Besucher. Es war ein seltsames Paar – die Frau groß und drahtig, mit krähenschwarzen Haaren und so hellen Augen, dass sie grau wirkten, der Mann ein stämmiger Riese, muskulös wie ein Bodybuilder.
Als sie den Laden für Kletterausrüstung in der Hauptstraße betraten, nahm der Eigentümer an, sie hätten sich schlichtweg verlaufen und wollten nach dem Weg fragen. Umso überraschter war er, dass sie Kunden waren und sogar eine lange Einkaufsliste dabeihatten. Er hörte sich ihre Wünsche geduldig an und schaffte alles herbei, was sie brauchten: Stirnlampen, Helme, Seile und Klettergurte. Er versuchte, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, doch die Frau antwortete nur einsilbig, der Mann gar nicht. Als sie den Laden wieder verließen, nachdem sie ein kleines Vermögen dort ausgegeben hatten, atmete er erleichtert auf. Die beiden waren ihm … unheimlich.
Das Paar verließ die Stadt und hielt einige Meilen außerhalb an einer einsamen Straße, lief an einer verwitterten Steinmauer vorbei und auf ein Wäldchen am Fuß eines Hügels zu. Sie hatten keine Karte bei sich, denn sie folgten keinem vorgegebenen Weg. Die Autoschlüssel ließen sie im unverschlossenen Wagen zurück.
Der Einstieg in die Caer Droia war an dieser Stelle schmal und unter einem Felsvorsprung verborgen. Wortlos legten die Frau und ihr Gefährte ihre Ausrüstung an. Die Frau ließ sich als Erste durch die Öffnung hinab, der Mann folgte ihr. Dann verschluckte sie die Dunkelheit.
Drei Stunden lang kämpften sie sich durch enge Gänge, völlig durchnässt von den vielen unterirdischen Wasserbecken, die sie durchqueren mussten. Scharfe Steinspitzen schnitten ihnen in die Haut und schürften ihre Arme und Beine auf, doch sie beklagten sich nicht. Ihre Stirnlampen warfen ein weißes Licht auf den feuchten Fels, der vor ihnen lag und silbrig schimmerte. So, wie die Schatten über die Wände huschten, sah es aus, als würden sie sich wellenförmig bewegen wie das Innere einer gigantischen Kreatur.
Sie ließen kein Seil als Wegweiser zurück an die Oberfläche hinter sich.
Schließlich gelangten sie in eine Sackgasse – Steine und Geröll versperrten den halb überfluteten Durchgang. Die Frau fuhr tastend über das Gestein. In einen großen Felsen war eine Art Symbol eingeritzt. Ein geschwungenes, wirbelndes Zeichen … Oder war es nur eine Täuschung von Schatten und Licht?
Die Frau stieß ein leises Zischen aus. Dann ging sie in die Knie, glitt ins Wasser, das die Steine umgab, und tauchte in die Schwärze.
Der Mann folgte ihr, ohne zu zögern.
Das Wasser war tief und trüb vom Steinstaub im Licht der Stirnlampen. Sie schwammen durch einen schmalen Spalt zwischen den Felsen, drückten, quetschten sich hindurch. Dann tauchten sie wieder auf und stiegen auf der anderen Seite aus dem Wasser.
Sie waren in eine Höhle gelangt. Der Raum war etwa dreißig Meter breit und ebenso hoch, und von der Decke hingen unzählige Stalaktiten. In den Wänden glitzerten Quarzadern. Doch das Bemerkenswerteste waren nicht die Gesteinsformationen, sondern das, was sich in der Mitte des Gewölbes erhob.
Ein Baum.
Seine Rinde musste schon vor langer Zeit abgeblättert sein und hatte ihn bleich wie einen Knochen zurückgelassen. Nackte, gekrümmte Äste reckten sich in die Höhe, wo sie sich mit den Stalaktiten verwoben, und die frei liegenden Wurzeln zogen sich über den Höhlenboden wie gespannte Sehnen unter blasser, alter Haut.
In den Augen der Frau blitzte etwas auf, als sie ihn betrachtete.
»Wir haben ihn gefunden, Triton«, sagte sie. Ihre Stimme war nicht mehr als ein erregtes Flüstern. »Gerade zur rechten Zeit.«
Der Mann nickte. Seine Lippen waren blau vor Kälte.
Als die Frau wieder sprach, war es kein Englisch. Ihre Worte glichen einem Lied, einer Art Singsang. Keltisch vielleicht, sie strömten aus ihr heraus wie Wasser, plätscherten immer schneller und wilder. Ein tosender, schäumender Fluss.
Sie kniete sich vor den Baum und umfasste seine Wurzeln mit beiden Händen. Etwas geschah mit ihr – es war, als nähme sie etwas aus dem Baum in sich auf, ihre Haut wurde so fahl wie der Stamm und so dünn, dass die Adern darunter sichtbar wurden. Schwarze Adern. Ein dunkles Gift floss wie Tinte über ihre Hände und Unterarme und verschwand unter den Ärmeln ihres Overalls. An ihrem Hals kam es wieder zum Vorschein, kletterte über Kinn und Wangen.
Als sie wieder aufstand, holte sie tief Luft und drehte sich lächelnd zu ihrem Begleiter um. Sie wirkte größer als zuvor. Stärker. Verjüngt. Ihre Haut leuchtete. Von der Dunkelheit war nichts zurückgeblieben als eine kleine schwarze Spirale in der Mitte ihrer Stirn, wie eine Tätowierung. Sie pulsierte, als wäre sie lebendig. Der Mann stellte sich neben sie, und gemeinsam betrachteten sie den Baum.
Obwohl kein Wind wehte, begannen sich seine Zweige zu bewegen, streckten sich wie Finger.
»Erwache zum Leben, mein König«, raunte die Frau. »Komm wieder zu Kräften. Wenn die Frühjahrstagundnachtgleiche eintritt …« – ihre Stimme wurde leiser und drang scharf durch die Dunkelheit – »bist du endlich frei.«
1
Das Taxi vom winzigen Bahnhof in Llangelin stank nach Zigaretten und dem Mittagessen des Fahrers, was auch immer das gewesen war. Julia Holt wollte nur raus. Sie kurbelte das Fenster herunter und sog die süße Frühlingsluft ein.
»Hier kommen nich’ grad viele raus«, bemerkte der Fahrer. »Aber wenn Sie Ruhe und Frieden wollen, ist es genau das Richtige für Sie.«
»So ist es«, erwiderte Julias Mutter fröhlich.
Julia verdrehte die Augen. Das Richtige für dich, dachte sie.
»Und natürlich hat die ganze Gegend einen starken Bezug zur druidischen Geschichte«, fügte ihre Mum hinzu. »Sie wissen ja, wegen der Ley-Linien …«
Julia kannte es in- und auswendig. Mum faselte immer von Ley-Linien – nicht gekennzeichneten, prähistorischen Linien, die angeblich spirituelle Stätten und alte Bauwerke miteinander verbanden. In der Nähe von Llangelin sollten sich mehrere dieser Linien kreuzen, einer der Hauptgründe, warum Mum sich für den Ort entschieden hatte.
»Wie weit noch?«, fragte Julia, als Mum eine kurze Atempause einlegte.
»Laut Navi sind wir gleich da«, antwortete der Fahrer. »Ah – da ist es ja schon!«
An einem verwitterten Wegweiser mit der Aufschrift Little Nook bogen sie von der Landstraße ab, rumpelten über einen unebenen Feldweg zwischen hohen Hecken und platschten durch Pfützen vom letzten Regenschauer. Der Weg endete vor einem kleinen Cottage mit Reetdach, das mit dem Rücken zum Wald stand. Die winzigen zweiflügeligen Fenster waren vom Alter verzogen und schief, und die Pflanzen, die in Tontöpfen an der Mauer standen, wucherten unkontrolliert vor sich hin.
Sie hielten genau vor der hölzernen Haustür, die so aussah, als wäre sie gut zwei Handbreit zu klein für alle, die in den letzten hundertfünfzig Jahren zur Welt gekommen waren.
»Oh, ist das nicht romantisch?«, flötete Mum und stieg aus. »Viel schöner als auf den Fotos im Internet!«
»Es ist gruselig«, murmelte Julia. Es sah aus wie ein Haus aus einem Märchen, in dem unschuldigen Kindern schlimme Dinge passierten.
Der Fahrer holte ihr Gepäck aus dem Kofferraum. »Na dann, schönen Urlaub«, sagte er.
Julia machte sich nicht die Mühe, ihn zu korrigieren. Das hier war kein Urlaub. Fast alle ihre Freunde würden sich in den Ferien in London treffen oder sogar ins Ausland reisen, das war Urlaub. Nur sie saß hier fest, mitten im Nirgendwo, während ihre Mum arbeitete.
»Und viel Glück mit dem Buch, Frau Professor!«, fügte der Fahrer hinzu, ehe er den Motor startete.
»Danke!«, rief Julias Mum ihm nach. Dann wandte sie sich an Julia. »Wie nett von ihm, dass er es sich gemerkt hat.«
Wäre auch schwer, es zu vergessen, Mum, dachte Julia. Du hast auf der ganzen Fahrt von nichts anderem geredet.
Der Fahrer hatte sich bemüht, Interesse an den alten Geschichten und Brauchtümern zu zeigen, aber Julia hatte gemerkt, dass er nur höflich war. Sie konnte es ihm nicht verübeln. Ihre Mutter mochte eine der führenden Wissenschaftlerinnen zum Thema druidischen Glaubens sein, mit ihrem Doktortitel von der Universität Oxford, doch sie schien nicht zu begreifen, dass nicht jeder ihre Begeisterung für Hügelgräber, alte Tonscherben und lang vergessene Gottheiten teilte.
Mum studierte ein zusammengefaltetes Papier, das sie aus ihrer Tasche gezogen hatte. »Siehst du hier irgendwo einen Brag, mein Schatz?«
»Muss ich wissen, was das ist?«
»Eine Art Kobold in der keltischen Mythologie.« Sie sagte es, als wäre es selbstverständlich. »Hier steht, dass der Schlüssel darunterliegt.«
Julia entdeckte eine komische kleine Statue zwischen den Blumentöpfen. Sie erinnerte an einen mageren Gnom mit einem Mantel aus Blättern und Zweigen. Darunter fand sie einen alten Kupferschlüssel, auf dem es von Asseln nur so wimmelte. Igitt. Sie hob ihn auf, klopfte ihn ab und steckte ihn ins Schloss. Mit einem dumpfen Knirschen drehte er sich, und sie konnte die quietschende Tür aufdrücken.
Drinnen war es düster, die Luft roch modrig und feucht. Ein Spinnennetz kitzelte ihr Gesicht, als sie eintrat, und sie wischte es mit dem Handrücken weg.
»Süß!«, sagte Mum.
Julia sah eine kleine Küche, eine Anrichte mit bunt zusammengewürfelten Tellern. Der gepflasterte Boden war mit ausgetretenen Flickenteppichen bedeckt. Auf der Tischplatte lagen kleine dunkle Bohnen, die verdächtig nach Mäusekötteln aussahen. Auf der anderen Seite befand sich das Wohnzimmer mit einer niedrigen Holzdecke, einem durchgesessenen Sofa, einem alten Ledersessel und einem Kamin. Irgendetwas fehlte.
»Ähm … wo ist der Fernseher?«
Ihre Mum lachte. »Oh Jules. Ich bin sicher, wir überleben ein paar Tage ohne Fernseher.«
Julia nahm ihr Handy heraus. Kein Empfang. »Hast du das WLAN-Passwort?« Ihre Mum gab keine Antwort, und als Julia sich zu ihr umdrehte, sagte ihr schuldbewusster Blick alles. »Das ist nicht dein Ernst – nicht mal Internet?«
»Ich dachte, es wäre gut, wenn wir mal abschalten. Mal wirklich Zeit miteinander verbringen, weißt du?«
Julia lagen hundert Antworten auf der Zunge, doch sie hielt sich zurück und versuchte, vernünftig zu klingen. »Mum, du bist hier, um dein Buch fertig zu schreiben. Und was soll ich machen? Ich kann nicht mal an meinem Geburtstag mit meinen Freunden chatten.«
Das Gesicht ihrer Mutter sprach Bände. Die erschrocken geweiteten Augen. Die halb geöffneten Lippen, die zuckten, als wüssten sie nicht mehr, wie man Wörter bildet.
»Du hast es vergessen«, sagte Julia kühl. Sie konnte nicht behaupten, besonders überrascht zu sein. Irgendwie tat ihre Mum ihr sogar leid, weil sie so durch und durch lebensuntauglich war.
»Entschuldige bitte. Ich mache es wieder gut.« Julia gab keine Antwort. Lass sie ein bisschen zappeln. »Und weißt du was? Ich arbeite nur vormittags. Nach dem Mittagessen machen wir, was du willst.«
»Zum Beispiel?«, gab Julia zurück. »Wir sind mindestens zehn Meilen von der nächsten richtigen Stadt entfernt, und wir haben nicht mal ein Auto!«
Wieder wedelte Mum mit dem Papier. »Da steht, dass es hier jede Menge Wanderwege gibt. Llangelin hat eine wunderschöne sächsische Kirche. Und im Schrank sind ein paar Brettspiele …«
»Brettspiele für einen Spieler?«, entgegnete Julia bissig. Die Antwort ihrer Mutter wartete sie nicht ab. Sie nahm ihren Koffer und marschierte in ihr Zimmer.
Julia saß auf dem Bett, das sich anfühlte, als wäre es mit Stroh gefüllt, zog einen Schokoriegel aus der Tasche und wartete darauf, dass ihre Wut abflaute. Was nicht geschah. Sie waren hier quasi am Ende der Welt. Was stimmte nicht mit ihrer Mum? War sie wirklich so ahnungslos, dass sie glaubte, Julia würde es hier gefallen?
Nein, natürlich nicht. Ihre Mum war nicht dumm. Dass sie hier waren, lag ausschließlich daran, dass es ihr immer nur um sich und ihre Arbeit ging. Julia war nur Ballast. Ablenkung. Etwas, das ihr im Weg war.
Als es Dad noch gegeben hatte, hatte Julia das gar nicht bemerkt. Doch wenn sie jetzt zurückblickte, sah sie es umso klarer. Immer war er es gewesen, der für Julia da gewesen war. Der den Haushalt geführt, sie zur Schule gebracht hatte, zum Elternabend gegangen war, das Essen gekocht und an ihren Geburtstag gedacht hatte. Der, statt sie durch die Kälte laufen zu lassen, losgefahren war, um sie abzuholen, als sie bei ihrer Freundin Beth übernachtet hatte.
Dabei war Mum ans Telefon gegangen. Hatte gesagt, sie würde gleich kommen. War sie aber nicht. Sie hatte Dad geschickt, garantiert unter demselben Vorwand wie immer. Ihre Arbeit. Mum war immer beschäftigt, entweder in der Bibliothek oder in ihrem Arbeitszimmer hinter verschlossener Tür oder auf dem Sprung zu einer Konferenz im Ausland. Dad war derjenige, der sich um sie kümmerte, Mum tat nur manchmal so, wenn es ihr passte.
Jetzt konnte sie es sich nicht mehr aussuchen, aber sie lebte weiter, als hätte sich nichts verändert. Klar, von Zeit zu Zeit machte sie große Versprechungen. Aber am nächsten Tag war alles wieder wie vor-her.
Das Zimmer war klein, aber gemütlich, die niedrige Decke war auch hier aus Holz, und an der Wand stand ein schwerer alter Kleiderschrank. Es gab ein paar Bilder, kleine gerahmte Skizzen oder Aquarelle von der Landschaft. Sie erinnerten Julia an die Bilder, die ihr Dad gemalt hatte. Er war ein talentierter Künstler gewesen, hatte jedes Jahr die Geburtstagskarten für Freunde und Familie selbst gemalt.
Es klopfte an der Tür. »Liebling, können wir reden?«
Klar, so wie immer …
»Es ist nicht abgeschlossen«, antwortete sie.
Die Tür ging auf, doch ihre Mutter verharrte auf der Schwelle. »Jules, es tut mir leid, dass wir so einen schlechten Start hatten. Und ich weiß, dass ich nicht viel für dich da war. Aber ich tue mein Bestes, wirklich. Es war …« Sie unterbrach sich. »Woher hast du den?«
Julia merkte, dass sie den Schokoriegel ansah. Zu spät für eine Lüge. »Vom Bahnhof«, murmelte sie.
Ihre Mum stemmte die Hände in die Hüften. »Ich habe nicht mitbekommen, dass du ihn bezahlt hast.«
Julia konnte nicht verhindern, dass ihre Wangen rot anliefen.
»Das habe ich mir gedacht.« Mums Miene verhärtete sich. »Jules, wie konntest du nur? Ich dachte, wir hätten nach der Sache mit dem Armband darüber geredet.«
Julias Gesicht brannte vor Scham. »Du meinst, du hast geredet.«
»Und du hast versprochen, nicht mehr zu stehlen«, gab Mum zurück und sah sie finster an. »Was soll das? Du bekommst Taschengeld! Ich habe meine Tochter nicht zur Diebin erzogen.«
Julia hätte ihr den Schokoriegel am liebsten ins Gesicht geschleudert. »Du hast mich überhaupt nicht erzogen!«, fauchte sie. »Sondern Dad.«
Ihre Mutter schnappte nach Luft. Die Farbe wich aus ihrem Gesicht.
Julia sprang auf und schnappte sich ihren Mantel. Sie wünschte, sie hätte das nicht gesagt. Aber jetzt war es raus, und sie konnte es nicht zurücknehmen.
»Wo willst du hin?«, fragte ihre Mutter leise.
»Nach draußen«, sagte Julia. »Dann hast du Zeit, um an deinem tollen Buch zu arbeiten.«
Kurz fragte sie sich, ob Mum sich ihr in den Weg stellen würde, doch sie trat zur Seite. Julia stürmte die Treppe hinunter, rannte aus der Haustür und ließ sie hinter sich zufallen.
Draußen atmete sie die kühle, frische Luft ein, schloss die Augen und spürte die Wärme der Sonne im Gesicht. Das hätte ich nicht sagen sollen. Die Schuld wartete wie ein ungebetener Gast auf ihre Reaktion. Wenn sie vernünftig wäre, würde sie jetzt zurückgehen, sich entschuldigen, die Sache wieder geradebiegen. Ihre Mum litt ja auch, auf ihre Art. Anders konnte es gar nicht sein. Aber dazu war Julia nicht bereit. Es würde dumm und albern aussehen, aus dem Haus zu stürmen, nur um Sekunden später wieder angekrochen zu kommen.
Also was jetzt? Wohin konnte sie gehen? Zu Hause wäre es etwas anderes gewesen. Sie hätte zu einer Freundin gehen können, ins Café, ins Kino. All das gab es hier nicht. Selbst wenn sie zur Straße ging, waren es einige Meilen bis zur Zivilisation.
Statt den Feldweg zu nehmen, über den sie gekommen waren, schlüpfte sie durch ein kleines Tor auf einen Pfad in den Wald hinterm Haus. Sie wusste nicht, wohin er führte, aber wenn sie sich verirrte, konnte sie ja einfach ihre Spuren zurückverfolgen.
Der Pfad schlängelte sich zwischen Bäumen hindurch, wurde undeutlicher und verschwand schließlich ganz, doch Julia lief weiter, raschelte durchs Laub und sprang über herabgefallene Äste und sumpfige Stellen. Ein Eichhörnchen flitzte über den Waldboden. Nach kurzer Zeit waren ihre Turnschuhe voll Schlamm, und die Kälte kroch hinein.
Sie aß den restlichen Schokoriegel auf und stopfte die zerrissene Verpackung in die Hosentasche. Sie war ebenso wütend auf sich selbst wie auf ihre Mum. Es war falsch gewesen, den Riegel zu nehmen, aber sie hatte gar nicht nachgedacht. Das war es, was ihr am meisten Sorgen machte: Stehlen war beinahe eine Selbstverständlichkeit für sie geworden – der billige Kick, etwas zu nehmen, obwohl sie das Geld in der Tasche hatte, um dafür zu bezahlen. Jedes Mal nahm sie sich vor, dass es das letzte Mal wäre.
Es hatte angefangen, nachdem ihr Vater gestorben war. Süßigkeiten und Kleinkram, hauptsächlich wegen des Nervenkitzels. Doch vor ein paar Wochen hatte sie an einem Stand auf dem Markt ein Armband in ihre Tasche gleiten lassen, und der Standbesitzer hatte sie erwischt. Sie verzog das Gesicht bei der Erinnerung, wie er sie gezwungen hatte, ihre Mum anzurufen. Das oder die Polizei, hatte er gesagt. Sie konnte sich glücklich schätzen, dass er ihr die Wahl gelassen hatte.
Als sie auf der anderen Seite der Bäume herauskam, lag ein großes, sanft geschwungenes Feld vor ihr, dicht bewachsen von jungen grünen Maispflanzen, die ihr bis ans Knie reichten. Sie hielt einen Moment inne und ließ den Blick schweifen. Die Ränder des Felds lagen brach, und in den blühenden Wiesenkräutern summten Insekten. Die Sonne senkte sich bereits den weißen Kreidefelsen in der Ferne entgegen.
Der Anblick besänftigte ihre Wut und beruhigte ihren Herzschlag. Es war wirklich schön, aber es machte sie auch traurig. Dad hatte die Natur geliebt und mit seiner Kamera viele lange Spaziergänge unternommen. »Ein herrliches Abenteuer!«, pflegte er zu sagen, wenn er nach Hause kam. Am Wochenende hatte er sie immer gefragt, ob sie mitkommen wolle, aber meistens hatte sie andere Pläne gehabt, war im Einkaufszentrum verabredet gewesen oder wollte mit Beth und Niq abhängen. Hätte sie gewusst, dass seine Einladungen so plötzlich auf einer vereisten Straße ein Ende nehmen würden, hätte sie jede einzelne von ihnen angenommen. Wie viele Spaziergänge mit ihm hatte sie verpasst? Wie viele weitere Erinnerungen hätte sie an ihren Vater haben können? Er war immer für sie da gewesen, und sie hatte es für selbstverständlich gehalten.
Irgendwie, dachte sie, tat es gut, allein zu sein. Nur sie und die Natur. Es war beruhigend. Selbst die Sache mit ihrem Geburtstag störte sie gar nicht so sehr, auch wenn sie es vor Mum anders dargestellt hatte. Eigentlich war sie ganz froh, den Tag hier zu verbringen, weit weg von zu Hause. Wahrscheinlich hätten ihre Freunde sowieso keine große Lust auf eine Party gehabt. Sie war in den letzten Monaten nicht gerade einfach gewesen.
Als ihr Dad gestorben war, waren sie alle um sie herumgeschlichen, doch niemand schien so richtig zu wissen, was er sagen sollte. Und sie hatte es auch nicht gewusst. Seither hatten sich die Dinge merklich verändert. Kleine Dinge. Ihre Freunde trafen sich ohne sie oder redeten über Musik, von der sie noch nie gehört hatte. Chatnachrichten gingen an ihr vorbei. Sie glaubte nicht, dass jemand sie absichtlich ausschloss, aber sie war nicht mehr Teil der Gruppe wie früher.
So war Trauer – niemand konnte die Last sehen, geschweige denn ihr helfen, sie zu tragen.
Aber Mum wusste, wie es war. Das dadförmige Loch in ihrem Leben war dasselbe. Julia sog die Frühlingsluft tief in die Lunge. Das ist albern. Ich sollte zurückgehen.
Sie wollte gerade umkehren, als ein Vogel ihren Blick anzog. Er glitt auf reglosen Schwingen über das Feld. Ein Raubvogel, mit einem Fächerschwanz und gespreizten Flügelspitzen, der das Land unter sich absuchte. Julia war keine Expertin, aber sie nahm an, dass es ein Bussard oder ein Habicht war. Sie beobachtete ihn einige Sekunden lang, dann streckte er plötzlich die Flügel v-förmig nach oben und schoss im Sturzflug abwärts. Julias Augen folgten ihm. Da, unten im Gras, sah sie etwas Weißes. Irgendein Tier.
Es schrak auf, als der Vogel flach über die Spitzen der Maispflanzen hinwegglitt, und verschwand im raschelnden Gras. Dann war ein entsetzliches Quieken zu hören, das sich mit dem schrillen Ruf des Vogels vermischte.
Julias Füße hämmerten schon über den Boden, sie ruderte mit den Armen und schrie: »Nein! Nicht!«
Beim Rennen sah sie schlagende braune Flügel und weißes Fell, während die beiden Tiere im Gras miteinander rangen. Federn flogen. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie den Kampfplatz erreichte. »Weg da!«, schrie sie.
Der Vogel flatterte panisch auf und ließ seine Beute am Boden zurück.
Julia japste. Erst hatte sie das arme Geschöpf, das auf der Seite im Gras lag, wegen seines schneeweißen Fells für eine Katze gehalten, doch als es sich mühsam aufrappelte, sah sie seine langen Ohren und begriff, dass es ein Hase war. Ein weißer Hase. Einer seiner langen Vorderläufe war blutverschmiert. Ein verblüffend grünes Auge musterte sie wachsam.
Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Sie wollte dem Tier helfen. Aber wenn sie zu nahe kam, würde es sie sicher beißen. »Alles in Ordnung, Kleiner?«, fragte sie sanft und ging mit einem Meter Abstand in die Hocke.
Zu ihrer Überraschung lief der Hase nicht weg. Eins seiner Ohren schwenkte in ihre Richtung.
Bestimmt steht er unter Schock.
Vielleicht brauchte er einen Tierarzt. Julia sah auf ihr Handy, nur für den Fall, dass sie hier Empfang hatte. Hatte sie nicht. Über ihnen kreiste immer noch der Vogel.
Er wartet, dass ich weggehe, damit er es zu Ende bringen kann.
»Keine Angst«, sagte sie zu dem Hasen. »Ich gehe nicht weg.«
Die Nase des Hasen zuckte. Dann hoppelte er durchs Gras davon. Julia richtete sich auf, blickte ihm nach und schaute wieder zum Himmel, wo der Vogel mit ausgebreiteten Flügeln kreiste. Einige Meter weiter blieb der Hase stehen und sah sie an. »Na los«, sagte sie und scheuchte ihn weg. Doch der Hase rührte sich nicht. Julia machte ein paar Schritte in seine Richtung. Er hoppelte weiter und sah sie unverwandt an.
Julia hatte ein eigentümliches Gefühl. Das konnte doch nicht sein. Oder? Der Hase war ein wildes Tier. Er sollte Angst vor Menschen haben. Aber nein.
Er wartet auf mich …
Ohne richtig zu wissen, warum, folgte sie ihm. Sie überquerten das Feld und steuerten auf eine Baumgruppe am anderen Ende zu. Julia erwartete jeden Moment, dass der Hase schneller wurde und davonsprang. Doch er schien bei ihr bleiben zu wollen. Vielleicht wusste er, dass der Tod noch immer am Himmel lauerte. Alle paar Meter blieb er stehen und drehte sich nach ihr um, dann hoppelte er weiter.
Sie erreichten die Bäume. Wenn der Raubvogel noch da war, so konnte Julia ihn durch die belaubten Zweige über sich nicht mehr sehen. Sie filterten das Nachmittagslicht und tauchten das Wäldchen in einen flaschengrünen Schein, der beinahe dieselbe Farbe hatte wie die Augen des Hasen.
Das verletzte Tier lief auf einen bemoosten Baumstumpf zu, wo es neben einem dunklen Loch im Boden stehen blieb – einem Spalt zwischen den Wurzeln. Julia nahm an, dass hier sein Bau war, doch der Hase schlüpfte nicht hinein. Er blieb stehen und drehte den Kopf zwischen dem Loch und ihr hin und her.
»Was?«, fragte sie und kam sich albern vor. »Du bist jetzt in Sicherheit.« Sie zeigte auf die Öffnung. »Geh schon rein.«
Doch der Hase rührte sich nicht.
Vorsichtig, um ihm keine Angst zu machen, wagte Julia sich näher heran, bis sie so nah war, dass sie ihn hätte streicheln können. Jetzt sah sie, dass etwas in dem Loch unter dem Baumstumpf steckte – etwas mit einer scharfen Kante, das nicht nach etwas aussah, das aus der Natur stammte. Der Hase zuckte nicht zurück, als sie an seinem Kopf vorbeilangte und die Hand in das Loch steckte.
Ihre Finger schlossen sich um den Gegenstand. Er fühlte sich wie glattes Holz an. Als sie ihn hervorzog, stockte ihr der Atem, und sie hätte ihn beinahe fallen gelassen.
Die Bäume schienen sich enger um sie zu schließen, die kleine Lichtung zu schrumpfen, und trotz der warmen Luft bekam sie Gänsehaut auf den Armen.
In ihrer Hand lag eine hölzerne Maske. Die Vorderseite hatte die Form eines Hasengesichts, mit einer fein ausgearbeiteten Schnauze und zwei spitzen Ohren. Es gab noch weitere, flachere Schnitzereien auf der Oberfläche – gerade und geschwungene Linien, die weder Bilder noch Buchstaben waren, sondern irgendwas dazwischen.
Julia blickte wieder den echten Hasen an. Er beobachtete sie, ohne zu blinzeln. Sie spürte Angst, doch sein Blick beruhigte sie.
Ihre Gedanken überschlugen sich. Wie kam dieses sonderbare Ding hierher? Julia hatte genug alte Ausstellungsstücke in Museen gesehen, um zu wissen, dass diese Maske in der Tat sehr alt sein musste. Die Form war schlicht – sie konnte die Meißelspuren auf dem unbehandelten Holz erkennen –, und als sie mit den Fingerspitzen über die Oberfläche strich, konnte sie beinahe den Schöpfer der Maske vor sich sehen, wie er an einem Feuer unterm Sternenhimmel saß und mit einfachen Werkzeugen die Form herausarbeitete. Vor langer, langer Zeit, als die Menschen noch im Einklang mit der Natur gelebt hatten.
Jetzt, da sie darüber nachdachte, erinnerte sie das Muster an Zeichnungen, die sie in Mums Büchern über Druiden gesehen hatte. Und Mum hatte gesagt, dass in der Nähe von Llangelin alte Ley-Linien zusammenliefen … Aber so alt konnte die Maske doch wohl nicht sein. Oder doch?
Sie drehte die Maske um. An der Unterseite befanden sich links und rechts kleine Löcher, an denen früher wohl eine Art Band befestigt gewesen war, das mit der Zeit verrottet war.
Julia wollte zurück zum Haus, und zwar schnell. Trotz ihres Streits spürte sie den Drang, ihrer Mutter die Maske zu zeigen. Was wäre besser, um sie die bösen Worte vergessen zu lassen, als ein mögliches Druiden-Relikt? Sie stellte sich die Aufregung in Mums Gesicht vor. Den Stolz. Und wenn Julia ihr erzählte, wo und wie sie die Maske gefunden hatte … Mum würde es kaum glauben.
Sie sah den weißen Hasen an. »Wolltest du … dass ich die finde?« Sie konnte nicht fassen, dass sie mit einem Hasen redete, als könnte er ihr antworten.
Doch er sah sie nur weiter unverwandt an. Und obwohl er natürlich nichts sagte, verstand sie irgendwie doch, was er von ihr wollte, denn sie selbst fühlte das gleiche Verlangen. Sie wollte das glatte kühle Holz auf ihrem Gesicht spüren. Sie wollte durch die Gucklöcher schauen, wie die Menschen vor wer weiß wie langer Zeit es getan haben mussten. Sie konnte nicht widerstehen.
Sie hob die Maske ans Gesicht.
Sie bedeckte nur die obere Hälfte, der Mund blieb frei, doch sie passte perfekt. Als ob sich die Konturen der Maske an ihre Gesichtszüge anpassten. Auch ohne Band blieb sie an ihrem Platz, als Julia die Hände sinken ließ.
Schwindel überkam sie.
Plötzlich fühlte sie sich, als hätte eine unsichtbare Welle sie erfasst, so mächtig, dass sie nach hinten geschleudert wurde. Durch die Gucklöcher verdoppelte sich ihre Sicht. Der Wald verschwamm. Geräusche explodierten wie Feuerwerkskörper dicht neben ihrem Kopf, erfüllten ihr Gehirn und ließen ihre Knochen vibrieren.
Julia hob die Hände, um die Maske abzunehmen, doch es ging nicht. Sie klebte an ihrem Gesicht. Panik durchfuhr sie, als sie versuchte, die Finger unter den Rand zu schieben und zu ihrem Entsetzen keinen Spalt zwischen der Maske und ihrem Gesicht finden konnte – nur eine glatte Oberfläche zwischen Holz und Haut, wo eins ins andere überging.
Die Welt begann sich zu drehen. Es dauert nur einen Augenblick, doch als es vorbei war, war nichts mehr wie zuvor.
2
Die Welt hatte ihre Farbe verloren. Die Lichtung bestand nur noch aus tausend grauen Schattierungen. Als Julia panisch den Kopf von einer Seite zur anderen drehte, sah sie alles in extrem hoher Auflösung, vom gekerbten Relief der Baumrinde bis zum zarten Flaum, der die Oberfläche der Blätter bedeckte.
Was passiert mit mir?
Und nicht nur ihre Sicht hatte sich verändert. Ihre Nase witterte zuckend die wetteifernden Gerüche des modrigen Unterholzes und den beißenden Gestank eines Dachses – Woher weiß ich, dass es ein Dachs ist? – aus einem unterirdischen Bau. Das grässliche Durcheinander von Tönen entzerrte sich zu klaren, unterscheidbaren Geräuschen, doch jedes war lauter als zuvor, als wäre es gefiltert und verstärkt durch die besten Kopfhörer, die sie je getragen hatte: ihr eigener keuchender Atem, das Rascheln eines Insektenflügels, das Tapsen von Pfoten im Laub.
Sie drehte den Kopf und sah den weißen Hasen, der sie immer noch beobachtete. Seine Augen waren die einzige Farbe auf der Welt. Strahlend grün wie geschliffene Smaragde, tiefe Quellen der Weisheit.
»Hilf mir«, flehte sie. Ihre Stimme war gleich und doch anders: Sie konnte sie in ihren Knochen und Ohren spüren. Der Hase flitzte unter einen Busch. »Warte!«, rief sie, und ihr Herz stockte vor Angst. Eine plötzliche, unerschütterliche Gewissheit überkam sie: Wenn sie den Hasen verlor, würde sie nie erfahren, was mit ihr geschehen war.
Der weiße Hase sprang hakenschlagend durch die Bäume, hierhin und dorthin. Julia folgte ihm und passte sich seinem Lauf an. Während sie rannte, spürte sie, dass sich noch etwas verändert hatte. Sie war schnell – unglaublich schnell –, ihre Füße flogen über die Baumwurzeln, ohne dass sie nach unten schauen musste. Sie stolperte nicht, sie wurde nicht langsamer. Der Wald war ihr Element. Er schien sich auf sie einzustellen.
Gemeinsam brachen sie aus den Bäumen hervor und rannten durch das hohe Gras der Wiese. Julia verlor ihre Furcht. Das hier machte ihr keine Angst mehr, es machte … Spaß. Ihre Füße schienen kaum den Boden zu berühren, während sie dem Hasen nachsetzte.
Sie kamen an einen plätschernden Bach, flach, aber etwa drei Meter breit. Ihr Führer hoppelte über die glänzenden Steine ans gegenüberliegende Ufer. Julia sprang und landete leichtfüßig auf der anderen Seite, ohne auch nur ihren Lauf zu unterbrechen. Der Boden stieg jetzt an, es ging durch Buschland und Stechginster, doch der Hase flitzte unverändert schnell um die dornigen Büsche.
»Warte auf mich!«, rief Julia. So langsam ermüdete sie doch, und der Hase entfernte sich, seine kräftigen Hinterläufe trugen ihn den Hang hinauf. Als Julia selbst die Spitze des Hügels erreichte, war der Hase mindestens zwanzig Meter vor ihr und rannte immer noch weiter.
Sie waren auf einem Plateau angelangt, das von Grasbüscheln bedeckt war und von einem starken Wind gepeitscht wurde. Keuchend sah Julia den Hasen auf einen großen Steinblock zulaufen, der aus der Erde ragte. Mit brennender Lunge rannte sie ihm nach. Der Hase machte einen gewaltigen Satz und landete oben auf dem Stein. Als Julia ihn erreichte, gaben ihre Beine unter ihr nach, und sie fiel auf die Knie.
Der Schwindel kam zurück und überschwemmte ihren Magen. Sie griff nach der Maske. Diesmal ließ sie sich ohne Probleme abnehmen. Sie warf sie beiseite und übergab sich auf den Boden.
Einen Moment lang atmete sie auf Händen und Knien tief ein und aus und wartete ab, bis die Welt wieder ins Gleichgewicht gekommen war. Die Farben waren zurück. Das saftige Grün des Grases und der silbrige Glanz der Quarzadern im Granit.
Sie legte eine Hand auf die raue Oberfläche des Steins, stemmte sich hoch und wischte sich den Mund am Ärmel ab. Ihr Körper fühlte sich schwer und unbeholfen an und nicht ganz wie ihr eigener. Ihre Beine zitterten vor Anstrengung. Der Hase war verschwunden, sie konnte ihn nirgends sehen.
Als sie sich umblickte, stellte Julia fest, dass sie auf den Kreidefelsen stand, die sie vom Haus aus gesehen hatte. Von hier konnte sie sogar den eckigen Turm der Kirche unten in Llangelin ausmachen. Er musste mehrere Meilen weit weg sein. Sie versuchte, ihren Standpunkt zu bestimmen und herauszufinden, wo das Cottage lag.
»Nein …«, brachte sie nur heraus.
Es war unmöglich, dass sie sich so weit vom Haus entfernt hatte. Sie war dem Hasen doch höchstens ein oder zwei Minuten hinterhergerannt. So hatte es sich jedenfalls angefühlt. Doch die Wärme des Nachmittags war verflogen, und der Stein warf einen langen Schatten. Sie blickte nach Westen und sah am rosa gestreiften Himmel den Kreis der Sonne in den fernen Horizont der walisischen Hügel sinken.
Wie viel Zeit war vergangen? Sie zog das Handy aus der Tasche und stellte fest, dass es etwa eine Stunde war. Noch immer kein Empfang.
Sie musste in einer Art Trance gewesen sein. Sie hatte das Bewusstsein verloren und war völlig benommen hierhergelaufen. Es war unwahrscheinlich, aber gab es eine andere Erklärung?
Ihre Mutter würde sich Sorgen machen. Große Sorgen.
Der Stein, an dem sie lehnte, war etwa zwei Meter hoch, ein Monolith aus Granit, der nach oben hin spitz zulief, wie ein Finger, der sich aus der Erde reckte. Er musste vor langer Zeit hier aufgestellt worden sein, vielleicht als eine Art Wegmarke. Auf seiner Oberfläche waren undeutliche Zeichen, vielleicht die Spuren des Werkzeugs, mit dem er bearbeitet worden war, aber sie konnten auch über die Jahrhunderte durch Regen und Wind entstanden sein.
Wieder hielt sie nach dem Hasen Ausschau, doch er war fort.
Wenn es ihn überhaupt je gegeben hat.
Die Maske aber war echt. Sie lag ein paar Schritte vor ihr an eine Distel gelehnt und beäugte sie kühl, wie um sie herauszufordern, sie noch einmal aufzusetzen.
Julia brauchte ganze zwei Stunden und ein paar falsche Abzweigungen für den Rückweg. Schließlich fand sie die Hauptstraße und folgte ihr bis zum Wegweiser nach Little Nook.
Als sie, die Maske fest umklammert, beim Cottage ankam, war es schon seit einer ganzen Weile dunkel. Die Füße taten ihr weh, und sie wollte nur noch schlafen. Ihre Mutter würde außer sich sein. Sie stellte sich auf einen Streit ein und überlegte, was sie sagen sollte – wie sie in Worte fassen konnte, was passiert war. Doch je weiter sie sich von dem Hügel entfernte, desto verschwommener wurde die Erinnerung. Der Angriff des Vogels, der verletzte Hase, der Hinkelstein … Diese Dinge schienen ihr in einem Traum begegnet zu sein und nicht im echten Leben.
Immerhin hatte sie die Maske. Die war echt – eindeutig, fraglos echt.
Die Haustür war nicht abgeschlossen, und Julia trat leise ein. Sie rechnete damit, dass ihre Mum mit Gewittermiene durch den Flur gestürmt kam und etwas über Verantwortung und Egoismus schrie und den ganzen üblichen Kram. Doch im Haus war es still.
Sorge durchzuckte sie. Vielleicht hatte Mum sich verzweifelt aufgemacht, um sie zu suchen? Vielleicht war sie sogar den ganzen Weg bis nach Llangelin gelaufen, um die Polizei zu rufen …
Doch nein, es war nicht vollkommen still – aus einem Raum im Obergeschoss hörte Julia leises Klappern. Ihre Schuldgefühle lösten sich in Luft auf, und an ihre Stelle trat ein harter Klumpen Wut.
Ihre Mutter tippte. Sie schrieb an ihrem blöden Buch.
Sie hat gar nicht gemerkt, dass ich weg war.
Julia schnaubte empört und schlich nach oben. Durch die Tür des zweiten Schlafzimmers sah sie ihre Mutter über den Schreibtisch gebeugt, umgeben von Papieren, einen Bleistift hinterm Ohr, während ihre Finger über die Tasten hüpften.
Es hätte nicht wehtun sollen – schließlich war Julia daran gewöhnt –, doch es tat weh.
Ich bin ihr scheißegal.
Die Lust, Mum ihre Entdeckung zu zeigen, verging ihr. Sie hatte es nicht verdient. Und wenn sich herausstellte, dass die Maske wichtig für ihre Forschung war, umso besser. Das war der Preis, den sie zahlen würde, weil sie so eine miese Mutter war.
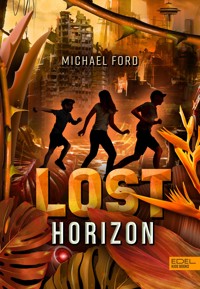
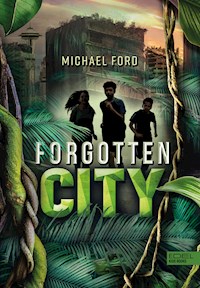













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













