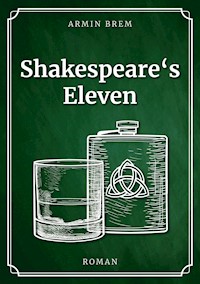
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Julia (33) sich zur Kur im irischen Hafenstädtchen Kildalough aufhält, wird sie Zeugin eines kleinen politischen Skandals. Tony Walsh, der aalglatte Spitzenkandidat der Konservativen, ist darin verwickelt. Ihr Sinn für Gerechtigkeit bringt Julia dazu, sich mit ihrem Friseur und ihrem Bruder dem Guerilla-Wahlkampfteam des idealistischen Gegenkandidaten John Learey anzuschließen. Als ein weißer Hirsch mit einem keltischen Symbol auf der Brust und ein Buch mit brisanten Thesen über Politik, Pink Floyd und die freundliche Übernahme auftauchen, hat Julia alle Hände voll zu tun, um noch größeres Chaos zu verhindern. Mit schwarzem Humor werden die Stärken und Schwächen von Religion, Politik und Gesellschaft behandelt und die Frage gestellt, inwiefern wir diese Systeme zum Besseren verändern können. "Brem schafft es gekonnt, Zitate aus der Popkultur so in die Geschichte einzubauen, dass diese oft nur auf den zweiten Blick zu erkennen sind. Es ist ein großartiger Spaß, diese zu entdecken." Erwin Lindemann, Wuppertal "Ein Buch, so ironisch wie Regen an deinem Hochzeitstag." Alanis M.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Armin Brem
Shakespeare‘s Eleven
Impressum
© 2022 Armin Brem
Verlagslabel: Küchenschwabe Books
ISBN: 978-3-347-76909-0
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
Lektorat: Simona Turini
Korrektorat: Ellen Rennen
Covergestaltung, Buchsatz: www.dare.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Armin Brem
Shakespeare‘s Eleven
Kapitel 1, Let It Be
Victoria, Kanada, Herbst 2039
Ringo aß am liebsten Nusskuchen. So stand es im Fenster des kleinen Cafés und als Beweis dafür hing ein vergilbtes Foto darunter, das den Ex-Beatle mit schon schütter werdendem Haar zeigte. Er hielt höflich lächelnd einen Teller in der Hand, auf dem ein gigantisches Stück Kuchen im Schatten eines Berges aus Schlagsahne auf seinen Verzehr wartete.
Frank musste lächeln. Natürlich hatte sie gerade dieses Café für ihre Treffen ausgesucht. Er blickte zur Turmuhr. Wie üblich war er zu früh, ihm blieb also noch ein wenig Zeit.
Er genoss es, noch ein wenig im Studentenviertel zwischen Secondhand-Buchläden und alternativen Imbissbuden herumzuschlendern und die Atmosphäre des Ortes aufzusaugen. Denn, das musste er sich eingestehen, so was machte er viel zu selten. Das Sich-treiben-Lassen fiel ihm mit zunehmendem Alter immer schwerer, was nicht zuletzt an seinem enormen Arbeitspensum lag, schließlich war er einer der bekanntesten Radiomoderatoren der englischsprachigen Welt.
Seine heutige Interviewpartnerin stellte sogar für seine Verhältnisse etwas Besonderes dar. Denn eigentlich gab sie keine Interviews. Sie hatte etwas geschafft, das Frank nur als paradox bezeichnen konnte, denn ihre Popularität begründete sich genau darauf, dass sie sich größtenteils von den Medien fernhielt. Frank musste lächeln. Die wichtigste Influencerin der westlichen Welt hatte nicht einen Social-Media-Account. Und sie hasste diesen Begriff: Influencerin. Vielleicht würde er ihn bei einer guten Gelegenheit in das Interview einbauen.
Als er schließlich, pünktlich auf die Minute, das Café „Avenir“ betrat, fiel sie ihm schon von Weitem auf. Inmitten vieler junger Studenten war sie der Ruhepol. Mit ihrem grau melierten Haar saß sie an dem kleinen, wackelig wirkenden Tisch am Fenster.
Julia Morrison. Sie hatte diesem Interview erst nach langem Zögern zugestimmt und das, obwohl sie und Frank gewisse … Berührungspunkte hatten. Für sie gab es nach wie vor kein Klischee, keine Schublade, die zu passen schien. Revolutionärin oder Reformerin? Intrigantin oder Visionärin? Über sie waren mehr Gerüchte als Fakten im Umlauf, wahrscheinlich zog sie einige Fäden im Hintergrund, aber auch hier verschwammen Wunschdenken, Fiktion und Realität zu einem Bild in der öffentlichen Wahrnehmung, das mit ihrer Person nur wenig gemein hatte.
Es war Anfang Oktober in Kanada, doch in Victoria lag die Temperatur noch über der 20-Grad-Marke, es war sonnig und viele Straßencafés hatten draußen noch oder wieder geöffnet.
„Julia, wie schön, dich zu sehen. Ich freue mich sehr.“
Als sie Frank anlächelte und aufstand, um ihn zu umarmen, war er für einen Moment sprachlos. Und das als Journalist, als alter Hase im Radiogeschäft, der es gewohnt war, Prominente zu treffen und zu interviewen. Aber Julias Präsenz hatte auf ihn schon immer eine besondere Wirkung gehabt. Sie hatte dieses gewisse Etwas, das jeden Raum füllte, sobald sie ihn betrat. Das beeindruckte ihn und nahm ihm für einige Sekunden jegliche Luft zum Atmen.
Es gab verschiedene Arten von Prominenten und Frank kannte sie alle. Zuerst die unglaubliche Fülle von B– und so weiter Promis, die nur durch ständige Präsenz von ihrer Belanglosigkeit ablenken konnten. Es gab Ruhm als Höhepunkt harter Arbeit, einen Prominentenstatus, der vererbt wurde oder auf einem außerordentlichen Talent gründete. Doch all das traf auf Julia nicht zu. Sie war die Zeitzeugin einer, na ja, historischen Wende und diese Art von Berühmtheit war absolut selten.
Außerdem sah sie großartig aus – noch immer. Frank hatte Fotos von ihr aus den 2010er-Jahren gesehen. Damals hatte sie ihr pechschwarzes Haar ganz kurz getragen. Jetzt war es etwa schulterlang, zu einem einfachen Pferdeschwanz zusammengebunden und von feinen grau-weißen Strähnen durchzogen.
„Frank, das Vergnügen ist auf meiner Seite. Wie geht es Janine und den Kindern?“
Julia freute sich, auf Vancouver Island zu sein. Ein Paradies. Dazu Frank. Und seine Familie, mit der sie nach dem Interview hoffentlich noch etwas Zeit verbringen konnte. Es passte einfach alles zusammen, die Zeit, der Ort, die Menschen.
Frank war bekannt für seine unkonventionellen Interviews. BTO konnte sich das auch leisten, denn der staatliche Sender war weit über die Grenzen Kanadas hinaus bekannt, Englisch war – immer noch – eine Weltsprache und die kanadischen Medien waren beliebt für ihre unabhängige, ehrliche und nicht zuletzt neutrale Berichterstattung. Auch der Boom der Radiosender war immer noch ungebrochen, aber natürlich lag die Popularität von BTO nicht zuletzt an Frank. Er hielt nichts von Interviews in Studios oder sterilen Hotelzimmern, er mochte es gerne lebendiger.
Wenn Julia Frank ansah, erinnerte er sie immer an diesen schottischen Komiker mit der grauen Mähne, Schnauzer und Kinnbart, dessen Name ihr partout nicht einfallen wollte. Franks ursprünglicher Vorschlag war gewesen, das Interview wegen der Geräuschkulisse des fließenden Wassers beim Fliegenfischen im Campbell River aufzunehmen. Julia hatte dankend abgelehnt. Sie konnte sich Frank gut vorstellen, wie er in den Fluten Forellen angelte, aber das war nicht ihre Art. Sie hatte darauf bestanden, den ersten von drei Interviewterminen in einem Café an der Uferpromenade in Victoria aufzunehmen. Alles Weitere würde sich dann ergeben.
„Danke der Nachfrage, alles bestens. Ich freue mich schon auf eine gute Tasse Kaffee und ein nettes Gespräch mit dir. In dieser Reihenfolge, denn ohne Koffein bin ich ungenießbar“, sagte Frank.
Die Kellnerin kam und stutzte kurz, als sie Frank erkannte. Dann lächelte sie jedoch sofort professionell ihre Verlegenheit weg, empfahl ihnen den „sensationellen Macadamia-Nusskuchen“, für den die Beatles in den 1960er-Jahren auf ihrer US-Tournee extra einen Zwischenstopp in Victoria eingelegt hatten, und nahm auch gleich die Bestellung zweier Stücke auf.
Frank hatte im Café offenbar niemanden vorgewarnt, alles war authentisch.
Er schaltete das Aufnahmegerät ein, zwinkerte Julia zu und begann mit dem Interview.
„Julia Morrison, im Namen von Radio BTO begrüße ich Sie hier im Café ‚Avenir‘ auf Vancouver Island zu unserem Interview. Wenn Sie gestatten, möchte ich bemerken, welche Ehre es für mich ist, dieses Interview zu führen. Viele Reporter haben in den letzten Jahren vergeblich versucht, Sie zu Ihrem Lebenswerk zu befragen.“
Bei dem Wort „Lebenswerk“ legte Julia ihren Kopf schief. War es jetzt wirklich so weit, hatte sie dieses Alter erreicht, in dem ein Blick nach vorn nicht mehr lohnte und sich alle deswegen auf den Blick zurück konzentrierten? Mehrere Einwände gingen ihr durch den Kopf, die sie aber erst einmal beiseiteschob.
„Vielen Dank, Frank, ich freue mich auch, hier zu sein. Nur bin ich mir nicht sicher, ob es über eine alte Frau wie mich etwas zu berichten gibt, das Ihre Hörer interessieren könnte.“
Frank lächelte. „Sie wissen, dass ich jedem Gast zu Beginn des Interviews drei Fragen stelle? Wer, wann und was!“
Julia deutete ein Nicken an.
„Okay, die Fragen lauten: Wer verbirgt sich hinter den Shakespeare Brothers? Wann waren Sie das letzte Mal in der Kirche? Und was zur Hölle war damals mit diesem Hirsch los?“
Julia verzog keine Miene. Sie fixierte Frank mit den Augen, ohne jedoch auf seine Fragen einzugehen.
„Ganz einfache Fragen.“ Frank nickte ihr aufmunternd zu.
„Möchten Sie auch ganz einfache Antworten?“
„Sie weichen mir aus.“
„Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich Ihre Fragen überhaupt beantworten kann und wenn ja, dann sicher nicht kurz. Und einfach vermutlich auch nicht.“
„Nun, dann lassen Sie uns vorne beginnen. Sie lebten Anfang der 2010er Jahre in Liverpool.“
„Liverpool ist meine Heimatstadt, ich bin dort aufgewachsen.“
„Aber sie verbrachten als Jugendliche auch einige Zeit in Deutschland.“
„In der Nähe von Bochum. Meine Mutter stammt aus dem Ruhrgebiet. Schon als Kinder haben wir oft die Ferien dort verbracht. Nach der Trennung meiner Eltern ging sie wieder zurück nach Deutschland. Doch mein Lebensmittelpunkt blieb in England, dort hatte ich Freunde und Familie.“
„Und später Ihren Mann.“
Julia seufzte und sammelte ihre Gedanken.
„Möchten Sie lieber …“ Frank sah sie fragend an.
„Nein, es ist ja bekannt, dass die Ehe schwierig war und kurz nach den Ereignissen in Irland zu Ende ging. Ich habe nur lange nicht mehr an meinen Ex-Mann gedacht, das ist alles.“
Sie lächelte Frank zu. Er blickte mit gerunzelter Stirn zurück, als würde er versuchen, sie einzuschätzen, ohne dabei zu einem Ergebnis zu kommen.
„In den 2010er-Jahren reisten Sie öfter von Liverpool in ein kleines Fischerdorf an der Ostküste Irlands“, fuhr Frank mit seinen Fragen fort.
„Auch das stimmt natürlich und ist bekannt. Irland war für mich immer ein Stück Freiheit, so herrlich grün und unkompliziert. Ich erholte mich immer in einem kleinen Spa in der Nähe von Kildalough.“
„… das damals ein unbekanntes, touristisch nicht besonders erschlossenes Fischerdorf war.“
„Genau das war der Grund, wieso ich gerne dorthin reiste. Es war ruhig, abgelegen und nicht so laut und voll wie Liverpool. Es gab dort dieses kleine Café, die hatten die weltbesten Scones und hausgemachte Stachelbeermarmelade … zum Niederknien. Nach kurzer Zeit kannte mich dort jeder. Das Leben war sehr unkompliziert und familiär, nicht so anonym wie in der Großstadt. Heute gleicht Kildalough eher einem Wallfahrtsort.“
„Für John Learey, den Sie persönlich kannten.“
„Ich hatte das große Glück, John zu begegnen, bevor er, na ja, berühmt wurde.“
Frank nahm einen Schluck Wasser.
„Johns Geschichte kennt heutzutage jeder. Dennoch ranken sich viele Gerüchte um sein Leben, seinen Freundeskreis. Um einen gewissen Angus zum Beispiel, dessen Rolle in der ganzen Geschichte etwas dubios und umstritten ist. Haben Sie diesen Angus kennengelernt?“
Julia lehnte sich zurück und schlug ein Bein über das andere.
„Frank, bei Angus handelt es sich lediglich um einen Mythos, ich würde ihn schon fast als eine irische Version von Robin Hood bezeichnen. Er soll Teil einer Gruppe gewesen sein, die wahlweise als Freiheitskämpfer, politische Aktivisten oder Anarchisten bezeichnet wurde. Deckname Shakespeare Brothers, dass ich nicht lache. Sie spielen auf eine Legende an, ein Ergebnis wilder Verschwörungstheorien.
Es wurde immer spekuliert, dass jemand im Hintergrund verschiedene Faktoren manipuliert hätte oder – wenn Sie so wollen – die Fäden in der Hand hielt. Frank, halten Sie sich einfach an die Tatsachen. Es war die richtige Zeit, es war der richtige Ort. Nichts ist so unaufhaltbar wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“
Julia setzte sich aufrecht auf ihren Stuhl und sammelte ihre Gedanken für einen Moment. Die Erinnerung an Kildalough weckte verschiedene Emotionen in ihr, die nun knapp unter der Oberfläche lauerten.
„Der Rest ist Geschichte.“ Sie legte sich den Zeigefinger an die Lippen, als wollte sie sich selbst davon abhalten, noch mehr zu sagen.
„Keine Shakespeare Brothers?“
Julia nahm sich erneut einen Moment Zeit, um zu antworten.
„Wer, wann und was waren Ihre Fragen. Hier ist meine Gegenfrage: Wer hätte denn wann was in Gang setzen müssen, damit die Dinge genau so laufen, wie sie gelaufen sind? So etwas lässt sich nie im Leben konstruieren. Und es gab definitiv keine Shakespeare Brothers!“
Frank presste die Lippen zusammen und nickte. Julia hatte den Eindruck, als wäre er mit ihrer Antwort noch nicht hundertprozentig zufrieden. Also war das Thema für ihn noch nicht abgehakt, auch wenn er jetzt fortfuhr.
„Sie waren dabei. Eine Zeitzeugin“, sagte er.
„Vor allem war ich gesundheitlich ziemlich angeschlagen. Und zur Kur.“
Kildalough, Irland, Herbst 2019
Als Julias Puls sich wieder beruhigt hatte, sie wieder zu Atem kam und auch nicht mehr am ganzen Körper zitterte, setzte sie sich vorsichtig auf und stieg aus dem Bett.
Während sie ihre Kleidungsstücke überall im Zimmer aufsammelte, betrachtete George, obwohl das kein neuer Anblick für ihn war, fasziniert ihren nackten Körper. Die Tatsache, dass Julias Schönheit von innen heraus zu strahlen schien und dass, obwohl oder vielleicht gerade weil ihr Körper alles andere als perfekt war, gefiel ihm. Er konnte seine Blicke nicht von ihr lösen, als sie durchs Zimmer lief, ihre Unterwäsche sortierte und auf einem Bein balancierend ihre Strümpfe anzog.
Sie hatte ein Fältchen hier, ein Röllchen da und war halt keine zwanzig mehr, aber genau das machte sie zu einer natürlichen Schönheit und eben nicht zu einem hochstilisierten Kunstprodukt. Er kannte hübschere Frauen, die immer das Gefühl hatten, sie müssten etwas an ihrem Aussehen verändern. Bei Julia spürte er, dass sie - zumindest im Moment - mit sich zufrieden und ausgeglichen war, trotz einiger kleiner Unzulänglichkeiten, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprachen. Es schien, als würde das ein oder andere Manko dadurch in den Hintergrund gedrängt, dass sie es schlicht und einfach ignorierte.
„Diesmal bist du zur Kur wegen …?“
„Luft. Vor allem wegen der Guten. Irischen. Luft.“
George spürte den Stimmungswechsel und bereute es, dieses Thema angesprochen zu haben. Sie mochte diese Diskussion nicht, denn beiden war klar, dass sie nur vor ihren Problemen davonlief.
„Drohender Burn-out, chronische … du weißt schon.“
Er wusste schon. Auch wenn sie kaum etwas erzählte, hatte er sich aus Bemerkungen von ihr, die er hier und da aufgeschnappt hatte, ein Bild gemacht. Ein Mann, der aus einer Metzgerdynastie stammte, mit einer Familie im Hintergrund, die für jede Ehefrau eine Herausforderung darstellen musste.
„Und bitte spar dir den sarkastischen Unterton, die Situation ist schon verfahren genug.“
George stand auf, umarmte Julia von hinten und küsste ihren Hals.
„Du weißt, Sarkasmus liegt mir nicht.“ Sie legte den Kopf schief und hob die Augenbrauen.
„Wenn es um dich geht. Für mich spielt das alles keine Rolle. Dein Mann, deine Ehe. Ich freue mich einfach, dass du hier bist. Nur hatte ich während der letzten beiden Stunden nicht gerade den Eindruck, dass du zu wenig Kondition oder Probleme mit der Atmung hast, aber ich bin schließlich nicht dein Arzt.“
„Erstens waren das keine zwei Stunden, sondern höchstens zwanzig Minuten, so viel zum Thema verzerrte Wahrnehmung, und zweitens bist du wirklich nicht mein Arzt. Du bist mein Friseur. Und jetzt komm und zieh dich an, du hast versprochen, mir die Haare zu machen.“
Als verschlafenes Hafenstädtchen an der Ostküste Irlands lag Kildalough etwas abseits der großen Touristenströme, die von Dublin aus meist nordwärts Richtung Knowth und Dowth strömten oder das Land Richtung Westküste durchquerten. Gerade weit genug abseits, damit die Einheimischen ihre Ruhe hatten, aber nah genug, um dort Arbeit zu finden, wo die Touristen schließlich landeten. Denn es war absolut in Ordnung, mit Urlaubern Geld zu verdienen, solange die nicht das eigene Dorf belagerten.
Wer die schönere Route über das Meer in Richtung Kildalough nahm, musste wohl oder übel direkt vor der grotesken Bausünde anlegen, die sich Kildalough Harbor Hotel nannte. Errichtet in bester Lage, direkt am Hafen und ein absoluter Albtraum aus Glas und Beton.
Glücklicherweise versprühte der Rest des Städtchens genügend Charme, um das einigermaßen wettzumachen. Kleine Cottages mit Reetdächern, gestrichen in bunten, knalligen Farben, lenkten die Besucher von der Waterfront ab und führten den Blick zum Zentrum. Dort stand – natürlich – wie fast überall im katholischen Irland eine schlichte, aus Natursteinen errichtete Kirche. In diesem Fall war sie dem heiligen Hubertus geweiht, was eine kleine Besonderheit war, denn als belgischer Schutzheiliger war dieser Patron der Jäger und Hunde nicht besonders populär in Irland.
Die Bewohner des Städtchens waren stolz auf ihren exotischen Schutzheiligen und betonten immer wieder, wie schön es war, nicht den allgegenwärtigen St. Patrick zu verehren. Ändern konnten sie es so oder so nicht, denn die Kirche stand hier seit achthundert Jahren und wo käme man da hin, wenn man seine Heiligen einfach aus einer Laune heraus auswechselte?
Die letzte Wirtschaftskrise hatte Irland hart getroffen, aber glücklicherweise waren die Iren Entbehrungen gewohnt. Mittlerweile begann wieder einmal der langsame Aufstieg aus dem Loch, in das sie zuletzt alle gefallen waren.
Dabei hatte doch alles so gut ausgesehen, die Wirtschaft brummte und auch George hatte mitspekuliert und durchaus vom letzten Immobilienboom profitiert. Es war ihm gelungen, eine kleine Kette von Friseursalons aufzubauen und diese dann – bis auf den ursprünglichen Laden in seiner Heimatstadt – an einen Investor zu verkaufen.
Die meisten Firmenanteile und Aktien, in die er seinen Gewinn investiert hatte, waren inzwischen so gut wie wertlos. Aber es waren ihm immerhin sein Haus und sein Friseursalon geblieben, er war schuldenfrei und hatte einen mintfarbenen Jaguar XJ Baujahr 96 mit seinem B@rbershop-Logo. Seines Erachtens der letzte richtige Jaguar und die einzige langfristige Beziehung in seinem Leben. Julia hatte dem mintgrünen Gefährt schon eine Reihe anderer Namen gegeben und weigerte sich strikt, mit dem B@rbermobil zu fahren, wenn es nicht unbedingt notwendig war.
Victoria, Kanada, Herbst 2039
„Wissen Sie, Frank, Kildalough war für mich immer mehr als nur ein Ort der Ruhe. Ich habe in meinem Leben immer versucht, mich an der Philosophie meiner Großmutter zu orientieren, zu der ich als Kind ein sehr inniges Verhältnis hatte. Für sie gab es diese speziellen Orte, Wälder, Felsen oder Bäume, die ihr Kraft gaben. Ihre Inseln des Glücks. Sie spürte immer, wenn sie diesen Plätzen zu lange ferngeblieben war, wenn sie sozusagen wieder reif für ihre Insel war.“
Frank nickte. Es fiel ihm aber schwer, sich voll auf Julias Worte zu konzentrieren, da seine persönliche Insel des Glücks gerade in Form eines Stücks Nusskuchen vor ihm stand. Julia schien das zu bemerken. Mit erhobener Augenbraue forderte sie seine ungeteilte Konzentration ein und so ließ er, schweren Herzens, die voll beladene Kuchengabel zurück auf den Teller sinken.
Julia fuhr fort: „Es half ihr dann immer, einen dieser Orte zu besuchen, manchmal nur für ein paar Minuten, aber diese Zeit gab ihr Kraft. Meine Großmutter nahm mich oft mit zu einem ihrer Lieblingsplätze, einem alten, knorrigen Baum. Der schwarze Stamm war voller Löcher, aber dennoch trieb er jeden Frühling helle grüne Blätter aus, die sich in die Sonne reckten. Wir setzten uns darunter, lehnten uns an und schwiegen. Ich spürte die Energie des Baumes und genauso spürte ich die besondere Energie, die von Kildalough ausging.“
„Das hört sich sehr spirituell an. Die Kräfte der Naturgeister.“ Franks Blick huschte über Julias Kuchenteller. Sie hatte ihr Stück noch nicht angerührt.
Nun jedoch nahm sie die Kuchengabel auf. „Ich bin kein gläubiger Mensch, für mich ist die Philosophie eine wichtige Konstante. Ich wollte immer Antworten haben und nicht noch mehr Fragen. Aber ich weiß, was mir Kraft gibt, und dieses kleine Hafenstädtchen gehört dazu.“
Sie stach ein Stück ihres Kuchens ab, dippte es in Schlagsahne und steckte es sich in den Mund. Frank musste ein Lächeln unterdrücken, als er ihre Reaktion beobachtete. Sie schien für einen Moment alles um sich herum zu vergessen und Frank überlegte, ob Macadamianuss-Kuchen nicht auch spirituelle Kräfte haben könnte. Schließlich wuchs eine Nuss an einem Baum und somit … Er verfolgte diesen Gedanken jedoch nicht weiter.
„Kildalough hatte also eine besondere Energie …?“ Schmunzelnd nahm Frank das Gespräch wieder auf, nachdem eine ungewöhnlich lange Pause entstanden war.
„Ganz Irland hat diese ursprüngliche Energie. Doch in Kildalough spüre ich sie immer am meisten. Das beginnt schon auf dem Weg dorthin. Wenn Sie von Norden her in die Stadt fahren, kommen Sie durch eine Allee mit alten Eichen. Sie fahren an Cottages mit winzig kleinen, aber penibel gepflegten Vorgärten vorbei. Und dann sind Sie auch schon im Zentrum, direkt an der Kirche. Dort war immer was los, das Zentrum des urbanen Lebens.“
„Und die katholische Gemeinde mit Mother Mary als zentrale Figur.“
Julia nickte und spießte eher beiläufig ein weiteres Stück Kuchen auf ihre Gabel. Der Gedanke an Mother Mary schien viele Erinnerungen zu wecken, denn plötzlich lächelte sie.
„Nicht nur eine zentrale Figur, eher eine Institution. Sie war eine ganz besondere Frau. Wenn man sich in schwierigen Situationen befand, kam sie und gab weise Ratschläge.“
Kildalough, Irland, Herbst 2019
„Lass das sein! Lass das sein, lass das sein, lass das sein!“
Mother Mary war zu ihrer vollen Größe aufgefahren. Der halbstarke Bengel, dem sie die Zigaretten abgenommen hatte, wusste noch nicht so recht, was da über ihn gekommen war.
George und Julia kamen auf dem Weg zum Friseursalon am Kindergarten vorbei, in dem Mother Mary seit einer gefühlten Ewigkeit das Kommando innehatte.
Die Schwester gehörte zu dem Typ Frau, der nie zu altern schien. George selbst hatte sie schon während seiner Zeit im Kindergarten erlebt und er hatte ihr Äußeres genau so in Erinnerung, wie sie auch jetzt noch aussah. Sie war eine große Frau, immer in schwarzer Ordenstracht, alles hochgeschlossen, den Kopf bedeckt, sodass nur ansatzweise einige grau melierte Haare zu erahnen waren.
Seit fast vierzig Jahren kümmerte sie sich um den Nachwuchs der Stadt und die Tatsache, dass viele „ihrer“ Kinder die Kindergartenzeit schon lange hinter sich gelassen hatten, hielt Mother Mary nicht davon ab, sich auch weiterhin um ihre Erziehung zu kümmern. Sie war eine Respektsperson, ein Fels in der Brandung.
Der schmächtige Teenager, der mit gesenktem Kopf vor ihr stand, hatte eigentlich nur möglichst cool eine Zigarette rauchen wollen. Verstört starrte er nun auf den Boden, wohl in der Hoffnung, dass sich ein Loch auftun würde, um ihn gnädigerweise zu verschlucken.
Wahrscheinlich auf einen Befehl seines Unterbewusstseins hin hatte George seinen Schritt beschleunigt, doch kurz bevor er aus Mother Marys Gravitationsbereich entkommen war, hörte er seinen Namen.
„George. Solltest du nicht schon längst im Laden stehen?“
Er blieb abrupt stehen und wandte sich um. Sofort verschränkte er die Hände hinter dem Rücken und blickte zu Boden. Julia stellte erstaunt und ein wenig belustigt fest, dass dieser fast eins neunzig große Mann mit seinen schwarzen Locken und seinem Robin-Hood-Bärtchen plötzlich wie ein Schuljunge wirkte, der beim Abschreiben erwischt worden war.
„Guten Morgen, Mother Mary. Ich bin mir sicher, Beata hat dort alles im Griff. Ich musste mich noch um einen Gast der Stadt kümmern.“
„So hört man.“ Mother Mary warf einen kritischen Blick auf Julia und steckte unauffällig die konfiszierten Zigaretten in ihre Tasche. Verschwendung war eine ernst zu nehmende Sünde.
„Guten Morgen, Mother Mary, ich habe schon viel von Ihnen gehört.“ Julia streckte ihre Hand aus. Der Händedruck der Schwester glich einem Schraubstock.
„Konnten Sie in der ganzen Stadt keinen besseren Fremdenführer als George finden?“
„An jeder Ecke, aber er ist nicht mein Fremdenführer. Er ist mein …“ Julia schwieg für einen Moment. Umgehend traf sie Mother Marys fragender Blick. „… Friseur“, vervollständigte sie ihren Satz.
Die beiden Frauen lächelten und nickten sich zu. Mother Mary hatte mit dieser Geste gezeigt, dass sie die, wenn man den Buschtrommeln Glauben schenkte, außereheliche Episode mit George zwar nicht gutheißen konnte, aber rein persönlich nichts gegen Julia hatte. Schließlich ging Julia ihrer Wege, mit George im Schlepptau, der gequält grinste.
Beata hatte, wie erwartet, den Friseursalon schon geöffnet und alles unter Kontrolle. Das Werbeschild stand vor der Tür, die Regale waren mit diversen Sprühdosen, Tiegeln, Tuben und sonstigem Zubehör gefüllt und, was am allerwichtigsten war, „Il Monstroso“, die riesige italienische Siebträger-Kaffeemaschine, war vorgeheizt, betankt und bereit für ihren Einsatz.
Wenn George der Kopf seines kleinen Unternehmens war, dann war Beata die Seele. Wobei in diesem Fall der Kopf eher zum Träumen neigte und die Seele stramm organisiert war und Geschäftssinn bewies. Wie viele ihrer polnischen Landsleute war Beata zur Blütezeit des irischen Wirtschaftswunders, als Arbeitskräfte händeringend gesucht wurden, nach Irland gekommen. Mit Ende zwanzig hatte sie nicht nur ihren Mann, sondern auch gleich ihr Land verlassen und jetzt, zwanzig Jahre später, fühlte sie sich in dem kleinen Fischerstädtchen zu Hause und konnte fluchen wie ein irischer Torfstecher.
Ihr ruhiges Wesen und ihre Zuverlässigkeit brachten eine gewisse Beständigkeit in den Friseursalon, die perfekte Ergänzung zu Georges Umtriebigkeit.
Dass es den besten Kaffee der Stadt ausgerechnet in einem Friseursalon gab, hatte sich schnell herumgesprochen. Die ganze Kaffeekultur hatte es auf dieser grünsten aller Inseln immer schon schwer gehabt und war erst in den letzten Jahren aufgeblüht. Irish Breakfast Tea galt lange als das Maß der Dinge, ganz im Gegensatz zu Arabicabohnen. Sogar beim weltweit bekannten Irish Coffee kam es mehr auf die Qualität des Whiskeys an als auf die des verwendeten Kaffees.
Vor einigen Jahren hatten zwei Sizilianer etwas Kaffeekultur nach Kildalough bringen wollen. Sie waren ihrer Zeit einfach voraus gewesen und übrig geblieben war nur ihre Kaffeemaschine, die George sich bei der Schlie-ßung des Cafés günstig unter den Nagel gerissen hatte.
Georges Erfolgsrezept war es, den Kaffee kostenlos an die Stammkunden auszuschenken, und da in dem kleinen Städtchen nahezu jeder irgendwie Stammkunde war, egal ob er gerade einen Haarschnitt benötigte oder nicht, fanden sich vormittags immer die üblichen Verdächtigen im Salon ein, auf einen Haarschnitt, einen Kaffee oder auch beides.
Julia saß entspannt in ihrem Friseurstuhl. Sie musste mit ihren in Alufolie eingeschlagenen Haaren warten, bis die Farbe der Strähnchen lange genug eingewirkt hatte. Eine Illustrierte lag aufgeschlagen auf ihrem Schoß, sie betrachtete aber stattdessen die Menschenmenge, die sich hier kaffeetrinkend versammelt hatte. Es war sehr unterhaltsam, dem Treiben im B@rbershop zuzusehen.
Es hatten sich vorwiegend Männer aller Altersschichten eingefunden, die ihrer Meinung nach tagesaktuelle Themen besprachen, philosophierten und sich über lokale Politik und Personen des öffentlichen Lebens austauschten. Julia fand, dass sie tratschten wie die Waschweiber, und der Gedanke ließ sie schmunzeln. Dabei gab es einen harten Kern, dessen Zusammensetzung jeden Vormittag nahezu gleich war. Allen voran Shaun der Postbote.
Shaun war in der Regel morgens der Erste, der im B@rbershop erschien. Nicht selten stand er schon vor der geschlossenen Ladentür und wartete, bis Beata aufsperrte. Postbote in Kildalough war für ihn der zweitschönste Job der Welt nach Papst. Zum einen wurde er intellektuell nicht überstrapaziert, zum anderen konnte der Großteil seiner Aufgaben jederzeit auch von seiner Mutter erledigt werden.
Somit konnte er sich um seine wichtigsten Kunden intensiver kümmern, denn er wusste, wie wichtig seine Briefe für die ortsansässigen Geschäftsleute waren. Er sortierte die Post nicht nach Hausnummern, sondern nach Priorität. Seine Runde begann stets beim Bäcker, der praktischerweise gleich neben dem Metzger lag, welcher den zweiten Anlaufpunkt auf seiner Runde darstellte. Pünktlich um neun erschien er im B@rbershop und blieb dort häufig bis kurz vor elf, denn dann öffnete der Deerstalker Pub, der praktischerweise nicht weit weg vom Friseursalon lag, nur ein Stück geradeaus, an der Kirche vorbei. Simon, der Wirt vom „Deerstalker“, schien ein wichtiger Kunde zu sein, der wohl immer sehr viel Post hatte, denn dort war Shaun oft bis zum späten Nachmittag anzutreffen.
Die Nächste aus der üblichen Runde war Brigh. Im Gegensatz zu Shaun hatte Brigh, die eigentlich Bridget hieß, sich ihren Morgenkaffee schon verdient.
Brigh entsprach dem Klischee einer Irin. Rotes, wenn auch in ihrem Fall relativ kurzes Haar, Sommersprossen, eine rosige Gesichtsfarbe und ein Faible für Cordhosen. Letzteres war eher typisch für Brigh im Speziellen als für die Irinnen im Allgemeinen, passte aber zum Gesamtbild.
Ihr Alter von vierzig plus x Jahren war ihr deutlich anzusehen, denn Brigh arbeitete viel und hart. Sie hatte sich als Einfraubetrieb auf die Reinigung von Ferienhäusern spezialisiert, von denen es entlang der Küste mehr als genügend gab. Außerdem organisierte sie für die Besitzer eben dieser Häuser diverse Wartungen und Reparaturen und erledigte allerlei sonstige Verwaltungstätigkeiten.
Nach dem Verlust ihres letzten Jobs hatte sie sich aus einer alten Reinigungsmittel-Werbung einen Flyer gebastelt („Mrs. Propper“), den sie überall auslegte.
Die Tatsache, dass sie sich nicht traute, allzu viel Geld zu verlangen, hatte bedeutend zu ihrem Erfolg beigetragen und bald konnte sie sich vor Arbeit kaum noch retten. Als Kind einer irischen Großfamilie hatte sie drei ältere und zwei jüngere Brüder, was von Vorteil war, denn viele der Wartungsarbeiten an den Ferienhäusern wurden durch die handwerklich begabten Brüder erledigt und blieben so in der Familie. Jedoch war somit auch immer mindestens ein Bruder da, um auf seine Schwester aufzupassen und, ob notwendig oder nicht, ihre Ehre zu verteidigen.
Und da ihre Brüder diese Aufgabe sehr ernst nahmen, hatten sie Brighs Ehre bis über das heiratsfähige Alter hinaus verteidigt. Während der Rest ihrer Familie mittlerweile vergeben war und jede Menge Nichten und Neffen für Brigh produzierte, putzte sie eben Häuser.
Die Türglocke klingelte ein weiteres Mal. Auftritt John.
Victoria, Kanada, Herbst 2039
Frank zog die Augenbrauen hoch. „Beim Friseur?“
„In George O‘Sullivan‘s Friseursalon.“ Unbewusst zwirbelte Julia eine Haarsträhne um ihren Zeigefinger. „Ich erinnere mich rein zufällig noch an den Namen des Inhabers. Irische Eltern waren mit der Namenswahl in dieser Generation anscheinend nicht besonders fantasievoll. Ich kenne mindestens vier George O‘Sullivans allein in Kildalough. Dazu einige Patrick Murphys und den ein oder anderen James Kelly.“ Und einen Angus, fügte sie in Gedanken hinzu. „Aber zurück zum Thema. Meine erste Begegnung mit John war beim Friseur. Ein unglaublicher Zufall.“
„Also waschen, schneiden, legen?“
Julia nippte an ihrem Kaffee. „Bei John gab es nicht viel zu waschen, zu schneiden und erst recht nichts zu legen. Der sogenannte B@rbershop war in Kildalough mehr als nur ein Friseursalon, die Leute trafen sich dort.“
„Um …?“ Frank setzte sich interessiert auf.
„Einfach so. Das war ja das Schöne. Sie trafen sich dort ohne besonderen Grund.“
Kapitel 2, Hello (Turn the radio on)
Kildalough, Irland, Herbst 2019
„Kellner. Kaffee.“
George rollte theatralisch mit den Augen. „Beata, du hast schon wieder die Tür nicht abgeschlossen und jetzt haben wir den Pöbel im Laden.“
Julia ahnte, dass dies das übliche Ritual der beiden Männer war. Beata hatte vorausschauend schon einen doppelten Espresso zubereitet und reichte ihn John. Auf der Tasse war ein Aufdruck von Speedy Gonzalez, einem ACME-Karton mit Dynamitstangen und dem Kater Sylvester.
„Julia. John. John ist unser Mann im County Council.“ Er zwinkerte Julia zu. „Und demnächst schicken wir ihn ins Repräsentantenhaus nach Dublin.“
„Hallo, John.“ Sie winkte aus ihrem Friseurstuhl heraus. „Ich habe schon viel von dir gehört.“
Letzteres war nicht einmal gelogen. Da Julia über ein äußerst mittelmä-ßiges Personengedächtnis verfügte, führte sie über verschiedene Leute geistige Karteikarten. Wenn jemand, in diesem Fall George, ihr von jemand anderem, zum Beispiel John, erzählte, bekam die Karte einen Eintrag. Diese holte sie nun imaginär hervor.
Das System funktionierte relativ gut, nur konnte sie nicht genau steuern, welche Informationen letztendlich auf der Karte gespeichert wurden. Um sich Namen besser merken zu können, verknüpfte sie sie immer mit berühmten Persönlichkeiten, in diesem Fall hatte sie „John“ mit „Elton“ verbunden. Ein gewaltiger Irrtum, da die Person, die nun vor ihr stand, kaum einen Hang zu Federboas und extravaganten Brillen hatte. Auch die Statur passte nicht, dieser John war klein, drahtig und schien sich entschlossen zu haben, sein schütter werdendes und kurz rasiertes braunes Haupthaar als gottgegeben hinzunehmen.
Sie rief die Karteikarte weiter ab. „George sagt, du kandidierst für die Grünen.“
John nickte anerkennend. Er hatte wohl nicht erwartet, dass Julia wirklich von ihm gehört hatte. Weitere Informationen poppten in ihrem Kopf auf. Mag keinen Knoblauch. Spielt bei Musik-Sessions im Pub hin und wieder die Trommel, mit viel Begeisterung und weniger viel Talent. Tochter. Ehefrau. Gelegenheitsangler. Unverbesserlicher Romantiker. Da musste irgendwo noch eine sinnvolle Information vorhanden sein. Lehrer.
„Wie läuft der Wahlkampf? Das muss ja ziemlich stressig sein, neben dem Job noch Politik zu machen?“
John wiegelte ab. „George übertreibt wie üblich. Es ist noch ein weiter Weg bis nach Dublin, denn zuerst findet hier noch eine kleine, aber lästige Formalität namens ‚Wahl‘ statt. George, du kommst doch morgen zum Infoabend in der Turnhalle?“
George brummte zustimmend.
„Wir freuen uns natürlich auch über Gäste, die nicht wahlberechtigt sind.“ Letzteres war mit einem Augenzwinkern direkt an Julia gerichtet.
Victoria, Kanada, Herbst 2039
„In der Turnhalle war das Treffen Nummer zwei. Es ging um das Programm von Johns Partei, er war der Kandidat der irischen Grünen für einen Sitz im Repräsentantenhaus. John hatte keine Chance, alle wussten das und trotzdem war die Stimmung gut. Es ging ihm auch nicht um den Sieg.“
Frank wollte gerade zur nächsten Frage ansetzen, als sich eine ältere Dame zögerlich dem Tisch näherte. Sie war sichtlich hin- und hergerissen zwischen der typisch kanadischen Höflichkeit und dem unbedingten Wunsch nach einem Autogramm.
„Für meine Enkelin“, sagte sie nur und deutete auf einen Tisch in der Nähe, an dem ein Teenager mit hochrotem Kopf saß. Frank erfüllte ihr diesen Wunsch gerne und brachte die Autogrammkarte sogar persönlich zum Tisch, wo sich die Gesichtsfarbe der Enkeltochter vor lauter Aufregung von Rot ins Purpurne steigerte.
„Die Wahlveranstaltung …“, sagte er, als er sich wieder zu Julia gesetzt hatte.
„Genau. Es ging ihm nicht um den Sieg.“
„Um was dann?“ „Er wollte eigentlich nur sich selbst treu bleiben und andere von seiner Idee für eine bessere Zukunft überzeugen. Er war kein Machtmensch, er war mehr ein Visionär. Aber um es in der Politik zu etwas zu bringen, waren damals spitze Ellenbogen und ein gutes Netzwerk aus Parteifreunden nötig, die genauso rücksichtslos waren wie man selbst. Dazu gehörten eine gewisse moralische Flexibilität und vage formulierte Grundsätze, die bei Bedarf schnell geändert werden konnten, um von der Bevölkerung gewählt und von der Industrie über Spenden finanziert zu werden.“
„Und dieses Spiel wollte John nicht mitspielen?“
Julia schüttelte ihren Kopf. „Ganz und gar nicht. Ich kann mich noch gut an Johns Rede erinnern. Einige seiner Themen haben mich sehr bewegt. Es war ein starker Auftritt, er stellte ein wohldurchdachtes Programm vor. Und natürlich seinen neuen Wahlkampfslogan …“
Kildalough, Irland, Herbst 2019
„Bier für alle.“ John gab die erste Runde aus. Der erste, offizielle Teil der Veranstaltung war, wie erwartet, recht trocken gewesen. Dafür war der zweite, inoffizielle, aber nicht weniger wichtige Teil feucht-fröhlicher. Er fand dort statt, wo traditionell in Irland alle Wahlen entschieden werden - im Pub.
Julia hatte sich schon gewundert, dass die Tagesordnungspunkte recht zügig und ohne lange Diskussion abgehandelt worden waren. Nun, da alle im Pub ein Glas Bier in der Hand hatten, wurden einige der Dispute mit wesentlich mehr Feuer weitergeführt. Es schien ihr, als hätte es vorher eine stillschweigende Übereinkunft gegeben, die besagte: Lass uns den offiziellen Teil schnell erledigen, die wirklich wichtigen Themen besprechen wir, wenn alle mit Getränken versorgt sind.
Das Deerstalker war der Treffpunkt der alternativen Szene in Kildalough. Eigentlich kannte niemand den Grund, denn rein optisch war es eben ein typisch irischer Pub. Holzvertäfelungen, Spiegel an der Wand, Fotos längst verblichener Stammgäste, die zu ihrer Zeit wohl auch einen gewissen Bekanntheitsgrad innegehabt hatten, und einiges an Trödel waren hier zu finden. Es unterschied sich nicht im Geringsten von den anderen Pubs des Städtchens.
Simon konnte selbst nicht erklären, wieso gerade sein Pub zum Treffpunkt der alternativen Szene geworden war. Aber er war schon lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass so etwas nicht erzwungen werden konnte. Er selbst war eher konservativ, aber letztendlich war Geschäft eben Geschäft und wenn diese Szene Gefallen an seinem Pub gefunden hatte, konnte er durch gelegentliche Zusatzveranstaltungen wie Poetry Slams und Lesungen auch noch einen kleinen Zusatzverdienst generieren.
Neuerdings bot Simon sogar erfolgreich Organic Craft Beer an, das, ganz biologisch-dynamisch, in einem kleinen Familienbetrieb auf den Aran Islands gebraut wurde. Inis Mór Òr oder das Gold von Inis Mór, ein Ale, wie er als angehender Biersommelier wusste, und gefinished im Whiskeyfass.
George holte gerade die nächste Runde Bier und so nutzte Julia die Gelegenheit und versuchte, John über ihn auszuquetschen.
„Ihr kennt euch schon seit der Schule?“
John blickte zur holzvertäfelten Decke, als könne er so alte Erinnerungen abrufen.
„Ja, wir waren zusammen auf der Heartlight Highschool und es ist lustig, dass du danach fragst, denn früher war ich mal seine Julia.“
Julia warf ihm einen vielsagenden Blick zu, dem er nicht allzu lange standhielt.
„Ein Schulprojekt über Shakespeare. Wir inszenierten unsere eigene, durchaus spezielle Interpretation der Balkonszene. Ich hatte eine Wette verloren und musste Julia sein.“
„Du hattest die Wette gewonnen und wolltest Julia sein!“ George hatte sich unbemerkt von hinten genähert. „Angeblich nur, weil ihm Romeos Text nicht gefiel.” George zwinkerte seiner aktuellen Julia zu und setzte sich. „Wir hatten den klassischen Text etwas aufgepeppt. Mit Zitaten aus Popsongs. In Julias Fall von den Spice Girls und bei Romeo mussten die Backstreet Boys dran glauben.“
„Okay, ich verstehe, Shakespeare trifft Pop-Art. Ich hoffe nur, euer Lehrer war offen für spezielle Interpretationen dieser Art.“
Simultan wandten die beiden den Blick von ihr ab. George zog Luft durch die Zähne ein.
„Gerettet hat uns damals das Footballtrikot. Romeo trug eines von Dublin und Julia eines von Belfast, um den Konflikt zwischen den beiden verfeindeten Familien zu symbolisieren. Und da Mr. Parker ein großer Footballfan war, hat er uns gnädigerweise eine Drei gegeben.“
Julia nahm einen Schluck von ihrem Stout. Das dunkle, fast schwarze Bier war nach irischer Sitte bis zum Rand eingeschenkt und hatte nur eine kleine Krone mit weißem Schaum. Mit viel Liebe zum Detail hatte der Wirt mit dem Zapfhahn ein Kleeblatt in die Schaumkrone gemalt und das wiederum war einer der Gründe, wieso sie dieses Land so liebte.
„Ich fand die Idee super, keine Ahnung, was Mr. Parker nicht gepasst hat.“
„Die Idee von Joanne und Tony war besser. Die hatten eine glatte Eins. Die beiden haben den Text von ‚We Didn‘t Start the Fire‘ von Billy Joel auf Shakespeare umgedichtet. Antonius, Cleopatra, Oberon, Puck, Titania, Tale of Two Cities, Richard II, As You Like It, too … und so weiter.“
Jeder starrte für einen Moment in sein Bier, als würde er dort die Erinnerung an eine längst vergangene Zeit finden. George war der Erste, der das Schweigen brach, allerdings schien es, als spreche er mehr zu sich selbst als zu den anderen.
„Auf jeden Fall hatten die beiden ihre Eins und alles, was wir hatten, war ein neuer Spitzname, der sich als äußerst penetrant und langlebig erwiesen hat.“
Julia lächelte. Sie wollte alles wissen. Jetzt. George zierte sich noch etwas, aber sie konnte ihm ansehen, dass das nur vorgetäuscht war.
Die beiden Freunde rückten schließlich von beiden Seiten näher zu ihr heran und George erzählte in konspirativem Tonfall.
„Es war Anfang der Neunziger, meines Erachtens die beste Ära für gute Rock- und Popmusik.“
John nickte zustimmend.
„Genau. MTV hatte noch richtige Musiksendungen im Programm, mit VJs wie Ray Cokes und jeder Menge super produzierter Musikvideos, Michael Jacksons ‚Thriller‘, ‚Zombie‘ von den Cranberries, ‚Drive‘ von REM. Meilensteine der Popkultur.“
„,Thriller‘ war in den 1980ern.“
„,Thriller‘ ist zeitlos, das beste …“
„Jungs.“ Julia warf einen scharfen Blick nach links, dann einen nach rechts. „Zur Sache. Ihr könnt euch nicht rausreden.“
„Na ja“, sagte John, jetzt ein bisschen ruhiger. „Ich fand immer schon, dass viele Liedtexte geradezu philosophisch sind. Man muss nur lernen, richtig hinzuhören. Ich hatte damals eine Liste mit Songtexten, die meines Erachtens einen philosophischen Hintergrund hatten. Ich war jung und brauchte die Aufmerksamkeit und so wurde ich es natürlich nie leid, jedem davon zu erzählen. Platz drei war damals übrigens ‚Enjoy the Silence‘ - Vows are spoken, to be broken. Feelings are intense, words are trivial … Dann kam Aerosmith mit ‚Amazing‘. Life‘s a journey, not a destination … Platz eins war ein One-Hit-Wonder. Sehr erfolgreich damals und bis heute finde ich …“ Er bemerkte ihren ungeduldigen Blick.
„Nun. Life is a strange thing. Just when you think you learned how to use it, it‘s gone.“
Die Textzeile schien Julia vertraut, sie konnte sie aber nicht sofort einordnen. George verkündete monoton und übertrieben unmotiviert: „Ladies and Gentlemen, heute Abend live im Deerstalker: die Shakespeare‘s Sisters.“
Auf dem Nachhauseweg gingen Julia und George am Fluss entlang. Julia hatte sich angewöhnt, die Pubs dann zu verlassen, wenn die Stimmung am besten war, da erfahrungsgemäß kurz danach ein betrunkener Idiot den Abend ruinierte. Die meisten Pubs schlossen gegen Mitternacht, aber genau diese Sperrstunde, die den Alkoholkonsum eigentlich reduzieren sollte, wurde von vielen Iren als Herausforderung angesehen, kurz vorher noch möglichst viel zu trinken.
Sie gingen schweigend nebeneinander her. George redete berufsbedingt den ganzen Tag und hing abends gerne seinen Gedanken nach. Julia summte ein Lied, während sie durch die Lichtkegel der Straßenlaternen schlenderten, die in gleichmäßigen Abständen den Nebel erhellten. Erst nach einer Weile fiel ihr auf, dass sie ein Lied summte, von dem John vorher gesprochen hatte, „Zombie“ von den Cranberries. Als ihr das bewusst wurde, erinnerte sie sich sogar an das bildstarke Musikvideo dazu.
„Glaubst du auch, dass viele Popsongs einen tieferen Sinn haben?“
„Hmm?“ George sah zu ihr hoch. Es war offensichtlich, dass er mit seinen Gedanken ganz woanders gewesen war.
„Entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Ich musste nur darüber nachdenken, was John gesagt hat.“
„Ist schon okay. Ich habe auch gerade an ihn gedacht, an früher.“
Julia runzelte ihre Stirn. „Er hat etwas an sich, ich weiß nur nicht, wie ich es beschreiben soll.“
„Da kann ich dir helfen, ich kenne ihn ja lange genug, es gibt da eine klare Definition. Er ist ein Träumer“, sagte George. „Ein hoffnungsloser Romantiker, der sich im Grunde weigert, erwachsen zu werden und den harten Fakten des Lebens ins Auge zu blicken. Er hängt immer noch seinen alten Ideen nach, Philosophie in Rocksongs, utopische Thesen für eine bessere Gesellschaft und so weiter. Im Grunde verweigert er sich aber schlicht und einfach der Realität, denn eines ist klar: Niemand schafft es, das System zu ändern.“
Schweigend setzten sie ihren Weg durch die Nacht fort, während Julia darüber nachdachte, ob es wirklich so unmöglich sei, das „System“ zu verändern.
Victoria, Kanada, Herbst 2039
Frank blätterte in seinen Notizen, mit denen er sich für jedes Interview vorbereitete.
„Wenn wir zurückgehen könnten in die Zeit vor November 2019, bevor alles seinen Lauf nahm, was würden die Menschen im Dorf über John sagen?“
„Nun, er war schon vorher ein geschätztes Mitglied der Gesellschaft, politisch und sozial engagiert. Er hatte ein offenes Ohr für alle und ihm wurde nachgesagt, er sei mit seiner Philosophie und seinen gesellschaftspolitischen Ansichten seiner Zeit voraus. Ein Visionär eben.“
Die Kellnerin kam an den Tisch und servierte zwei weitere Stücke des berühmten Kuchens mit einer Anekdote. „Wissen Sie, Ringo hatte eine Tante hier in der Stadt und immer, wenn er sie besuchte, kam er nur wegen des Kuchens in unser Café.“
Julia schenkte der Kellnerin ein Lächeln, während Frank sie fragend anblickte. Als sie sich wieder entfernte, fiel sein Blick auf Julia.
„Glauben Sie, dass banale Ereignisse im Laufe der Zeit so verklärt und ausgeschmückt werden können, dass sie einen Kultstatus erreichen?“, fragte er.
„In Bezug auf …?“
„Kuchen. Sind die Beatles wirklich extra für ein Stück Kuchen eingeflogen oder war Ringo nur mal zufällig in der Nähe und hatte Lust auf Süßes?“
„Ich denke, das ist nicht relevant, denn es geht weder um den Kuchen noch um die Beatles. Es geht lediglich darum, dass jemand aus dieser Geschichte einen Vorteil ziehen will. Dafür werden einem verstorbenen Prominenten hier verschiedene Geschichten angedichtet.“ Julia legte den Kopf zuerst nach links, dann nach rechts, als würde sie abwägen, ob ihr diese Tatsache gefiel oder nicht. Sie schien zu keinem eindeutigen Ergebnis zu kommen.
„Mochte John denn Nusskuchen?“
Julia stach beherzt ein Stück des besagten Kuchens ab und bedeckte es mit einem Klecks Schlagsahne.
„John hätte diesen Nusskuchen geliebt.“
Kapitel 3, Wild Horses
Kildalough, Irland, Herbst 2019
Es regnete. Schon seit Tagen. Was Julia nicht davon abhielt, eine Wanderung über die Wiesen und Felder zu machen, denn wer Urlaub (Kur, sie war auf Kur hier!) in Irland machte, durfte nicht zimperlich sein.
Der Regen hielt an, wechselte aber ständig seine Beschaffenheit. Es regnete mal mehr, mal weniger, die Tropfen kamen mal von oben, mal, was Julia besser gefiel, von der Seite, als Sprühregen, Nieselregen, Platzregen, mal sanft, mal kräftig, mal nasser, mal … na ja, der Gedanke an „trockeneren“ Regen war zugegeben etwas verwegen und ließ sie schmunzeln. Julia vermutete, dass es bei so vielen Regenarten wie in Irland grundsätzlich möglich war, auch zwischen nass und trocken zu unterscheiden.
An diesem Gedanken hielt sie sich fest, während sie erneut über eine Mauer aus aufgeschichteten Feldsteinen stieg und weiter querfeldein marschierte. Vor Kurzem hatte sie in der Nähe einige verwilderte Ponys gesehen.
Es hieß, dass es seit der letzten Wirtschaftskrise immer mehr herrenlose Pferde in Irland gab. Die Kosten für den Unterhalt waren vielen Besitzern zu hoch und so wurden die Tiere einfach auf irgendeiner Wiese ihrem Schicksal überlassen. Angeblich wurden abgemagerte und kranke Pferde sogar regelmäßig erschossen, aber in den Medien war so gut wie nichts darüber zu finden. Schließlich wollte niemand das Image der freundlichen Grünen Insel mit ihren meist ebenso freundlichen Insulanern beschädigen.
Die Ponys, die Julia gesehen hatte, machten aber einen wohlgenährten Eindruck. Es war eine Herde mit fünf kleinen, gescheckten Tieren, die sie einige Tage zuvor beim Wandern zum ersten Mal beobachtet hatte. Sie hatten sich auf einer steinigen Ebene kurz vor dem Meer aufgehalten, dem sogenannten „Devil‘s Backyard“, einer felsigen Gegend, die zu karg für die Landwirtschaft war.
Struppig, zottelig und ungepflegt, aber anscheinend gut gelaunt, hatten sie sich gegenseitig mit dem Kopf den Rücken gekratzt oder im Schatten der Ginsterbüsche ein Schläfchen gehalten. Damals war das Motiv „Verwildertes Pony im Regen“ in ihrem Kopf aufgetaucht und da dieser Gedanke sich dort gerade häuslich einrichtete, dabei die Füße auf den Tisch legte und lauthals 1980er-Jahre-Rockballaden sang, war sie nun mit ihrer Spiegelreflexkamera unterwegs.
Sie wanderte schon fast drei Stunden durch die Hügel, aber statt „Verwildertes Pony im Regen“ hatte sie bislang nur „Blumen in Trockenmauer“, Nr. 23, „Nebel in den Hügeln“, Nr. 4 und „Regenbogen über der Grünen Insel“, gefühlte Nr. 1564 – also überhaupt kein spektakuläres Motiv.
So würde sie diesen Gedanken niemals zum Schweigen bringen. Aber es gab Schlimmeres und insgeheim mochte sie Rockballaden.
Auf dem Rückweg zum Dorf ging sie an der zerfallenen Kirche vorbei. Die Einheimischen nannten sie „Abbey“, aber für eine Abtei oder ein Kloster erschien sie Julia ziemlich klein. Es war eine dieser typischen irischen Ruinen: Natürlich fehlte das Dach, einige der Natursteinmauern waren eingestürzt, der Turm stand noch und die ganze Ruine war von einer Reihe von Grabsteinen umgeben, deren Aufschriften nur schwer zu entziffern und deren Tote wohl schon lange vergessen waren.
Auf dem kiesigen Boden im ehemaligen Hauptschiff wuchsen Moose, Efeu rankte über die Mauern und in einem der Seitenschiffe hatte sich stacheliges Gebüsch breitgemacht. An allen vier Ecken wuchsen Eiben. Julia war botanisch nicht besonders bewandert, wusste aber um den hohen Stellenwert, den Eiben in der keltischen Kultur einnahmen. Sie symbolisierten, obwohl oder vielleicht gerade weil sie giftig waren, den Lebensbaum.
Julia hörte ein Flattern und ein krächzendes Geräusch. Ein großer schwarzer Vogel, wahrscheinlich ein Rabe oder eine Krähe, flog zu einem der Turmfenster und, bevor sie auch nur die Gelegenheit hatte, die Kamera zu zücken, auch gleich wieder davon. Doch als sie den Turm genauer betrachtete, fiel ihr auf, weshalb der Vogel herangeflogen war. Ein weiterer pechschwarzer Vogel saß, vermutlich brütend, in seinem Nest.
Das potenzielle Motiv „Brütender Vogel in Nest“ nahm in ihrem Kopf Gestalt an, verdrängte den Gedanken an „Ponys im Regen“ zumindest kurzzeitig und legte an seiner statt die Füße auf den Tisch. Julia blickte durch den Sucher ihrer Kamera, doch die Perspektive gefiel ihr nicht. Sie musste höher hinauf, um einen besseren Blickwinkel zu finden, bevor Bonnie Tyler in ihrem Kopf wieder „Total Eclipse of the Heart“ zum Besten gab.
Julia ging einmal um die Ruine herum in das Nebenschiff und entdeckte dort einen Haufen Geröll, auf dem sie bis zur Außenmauer hochklettern konnte. Hinter einigen Efeuranken versteckt fand sie den idealen Beobachtungsposten. Sie schoss einige Bilder und betrachtete sie auch gleich auf dem Display. Besser.
Der Regen hatte nachgelassen und vereinzelt schienen Sonnenstrahlen durch die Lücken in der Wolkendecke. Sie wollte warten, bis der andere Vogel (insgeheim hatte sie ihm den Namen „Rabenvater“ gegeben) kam und seine brütende Frau mit Futter versorgte. „Brütender Vogel im Turm und Rabenvater“, Nr. 1. Während sie wartete, summte sie leise vor sich hin.
Der Rabenvater ließ sich Zeit und Julia hätte schon beinahe aufgegeben, als sich von der Straße her ein Auto näherte und in einiger Entfernung parkte. Ein Mann stieg aus und kam auf die Ruine zu, was Julias Stimmung trübte. Sie saß seit geraumer Zeit bewegungslos an die feuchte Steinmauer gelehnt und die Chancen, dass sich der Rabenvater noch einmal blicken ließ, stiegen durch eine zweite Person in der Abbey nicht gerade. Dennoch blieb sie regungslos in ihrem Versteck.
Mit Jeans, Sakko und Krawatte wirkte der Mann wie ein Fremdkörper in der Szene aus Steinen, Moosen und Efeu.
Er betrat die Ruine.
Im Eingangsbereich stand ein von Pflanzen überwuchertes schmiedeeisernes Tor offen, das wohl niemals mehr geschlossen werden konnte. Daran kletterte er ein Stück hoch und holte etwas unter dem Efeu hervor. Leider konnte Julia über die Entfernung nicht erkennen, um was es sich dabei handelte.
Der Mann wirkte nervös. Er sah sich um, was Julia dazu veranlasste, sich tiefer hinter den Efeuzweigen zu verstecken. Der Mann ging ein Stück weiter zu der Mauer, die Julias Versteck gegenüberlag. Auch hier kletterte er ein Stück hoch, holte wiederum etwas hervor, um es nach kurzer Zeit wieder gut versteckt an der Mauer zu platzieren. Diesmal schoss Julia, einem Impuls folgend, in kurzem Abstand einige Bilder.
Als der Unbekannte wieder in sein Auto stieg und sich entfernte, verließ Julia neugierig ihren Posten und ging zurück ins Innere der Ruine. Sie sah sich die Stelle in der Mauer genau an. Zuerst konnte sie nichts erkennen, aber dann entdeckte sie einen kleinen Kasten von etwa acht mal zehn Zentimetern in Camouflage mit einem kleinen Objektiv.
Sie vermutete, dass es sich um eine Kamera für Wildtier-Aufnahmen handelte. Zwar hatte sie so etwas noch niemals zuvor gesehen, aber es schien die einzig mögliche Erklärung zu sein. Anscheinend gab es außer ihr noch andere Tierliebhaber, auch wenn sie sich fragte, welche Tiere hier wohl des Nachts vor die Linse laufen könnten, denn die Kameras waren auf den Innenraum gerichtet und nicht auf den Turm mit den brütenden Vögeln.
Es krächzte erneut. Julia sah den Rabenvater gerade noch abfliegen. Die Sonne sorgte für die richtige Kulisse und tauchte den Turm in ein märchenhaftes Licht. Ein großartiger Kontrast, der Turm umgeben von Sonnenstrahlen, die aus einem Meer von dunklen Wolken herausragten. Das war genau ihr Motiv. Und sie hatte es verpasst. Sie würde wiederkommen.
Kapitel 4, Comfortably Numb
Kildalough, Irland, Herbst 2019
Drei Tage später saß Julia vormittags in ihrem Lieblingscafé, dem „Blue Café“ direkt am Hafen, aß warme Scones und las den „Irish Independent“. Sie hatte die dickste Zeitung gewählt, die sie bekommen konnte, und sie las sie von vorn bis hinten akribisch durch. Gerade war sie im hinteren Drittel angelangt und wurde langsam unruhig.
Das lag aber nicht an der Zeitung, nicht an den Artikeln über die irische Wirtschaft, die das Titelblatt dominierten, oder dem Sportteil, den sie komplett durchgelesen hatte. Sie war jetzt informiert über Spieler, deren Namen ihr nichts sagten, und über die Ergebnisse von Hurling und Gaelic Football, wovon sie nicht mal wusste, wie es gespielt wurde.
Sie war außerdem bei ihrem dritten Kaffee und dem zweiten Scone. Bei beidem war ihr schon während der Bestellung klar gewesen, dass sie eigentlich weder das eine noch das andere wirklich wollte. Sie redete sich ein, dass ihr beschleunigter Herzschlag mit eben dieser dritten Tasse Kaffee zusammenhing. Aber der Grund für ihre Nervosität war schlicht und einfach die Tatsache, dass sie sich, sobald sie hier fertig war, um ihre Rückreise nach Liverpool kümmern musste. Diesen Gedanken konnte sie gerade nicht ertragen und hatte deswegen beschlossen, ihn so lange wie möglich zu ignorieren.
Julia halbierte das letzte Viertel ihres Scones, bestrich es mit gesalzener Butter und Marmelade und aß es. Sobald sie ihr Frühstück beendet hatte, würde es ihr nicht länger gelingen, dem Offensichtlichen aus dem Weg zu gehen.
Ihr Mann hatte angerufen. Das Arschloch. Das war er zweifelsohne, er bezeichnete sich manchmal sogar selbst so, mit einem gewissen Stolz. Er sei „geschäftlich eben ein Arschloch, aber ein erfolgreiches“. Nur dass es ihm schon lange nicht mehr gelang, Geschäftliches und Privates zu trennen. Der Fluch eines Familienunternehmens. Morrisons Meat. Trotzdem verurteilte Julia sich selbst für diesen Gedanken.
Nachdem ihr Mann sich oberflächlich nach ihrem Befinden erkundigt hatte, stellte er ihr noch ein paar Fragen über verschiedene Geschäftsvorgänge, deren Antworten er schon längst kannte, darüber hegte sie keinen Zweifel. Die eigentliche Frage, beziehungsweise die Aufforderung „komm zurück“, hing unausgesprochen über dem kurzen und wie üblich sehr emotionslosen Gespräch.
Julia war nicht der Typ Frau, der sich aushalten ließ, sich auf den Haushalt beschränkte und mit gleichgesinnten Damen der besseren Gesellschaft Charity Events organisierte. Sie hatte ihren Platz in der Firma und auch wenn ihr Mann alle wichtigen Entscheidungen traf, kümmerte sie sich darum, dass der Laden reibungslos lief, und um die Löhne und Versicherungen. Alles Aufgaben mit viel Verantwortung und wenig Anerkennung.
Julia hasste es. Obwohl, das stimmte nicht ganz. Sie war in diese Position langsam, aber unaufhaltsam hineingerutscht, ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen. Wenn sie sich Zeit nehmen würde, um ihre Situation zu reflektieren, würde sie sicher zu dem Schluss kommen, dass sie es hasste. Ihren Job, ihre Ehe, die Firma. Aus diesem Grund versuchte sie, bisher relativ erfolgreich, nicht weiter über ihre Situation nachzudenken, denn die Folgen waren für sie nicht absehbar.
Julia halbierte die letzte Hälfte ihres Viertelscones, bestrich ein Stück mit Butter und Marmelade, was gerade noch machbar war, und aß es. Sie wusste natürlich, dass sie sich selbst belog, oder, etwas diplomatischer ausgedrückt, der Realität nicht ins Auge blicken wollte. An manchen Tagen, so wie heute, fühlte sie als Folge ihrer Verdrängungstaktik einen grauen Schleier über sich. Und er wurde langsam dunkler. Positive Gefühle wurden unterdrückt, die negativen hingegen konnten sich frei entfalten. Sie fühlte sich als Person regelrecht eingeschnürt, fast unfähig zu Handlungen jeder Art.
Wenigstens hier machte sie sich nichts vor: Es würde sie direkt in eine Depression führen, wenn sie so weitermachte. Doch das würde sie nicht zulassen. Sie musste sich entscheiden.
Jetzt. Bald.
Ihr Leben in den Griff bekommen, was immer das bedeuten mochte. Sie musste nur den ersten Schritt machen. Sofort. Heute. Gleich nachdem sie ihr Frühstück beendet hatte.
Sie bezahlte, nahm Mantel und Handtasche und ging zur Tür hinaus, hinein in den neuen Tag. Auf ihrem Teller lag noch die halbe Hälfte eines Viertelscones mit einem Klecks Stachelbeermarmelade.
Julia stand vor dem Zebrastreifen an der Abbey Road. Sie musste nach rechts, dort lag das Reisebüro. Von Online-Buchungen hielt sie nicht viel, obwohl sie wusste, dass sie im Normalfall reibungslos funktionierten. Aber sie glaubte eben an Papier, wollte lieber gedruckte Tickets in der Tasche, Seiten in einem Buch und Scheine in der Geldbörse als all die Bits und Bytes der virtuellen Welt.
Ein Auto hielt an. Sie ging geradeaus über den Zebrastreifen und dann links die mit Ahorn gesäumte Mercury Alley hinauf.
Jemand hatte „Fairytale of New York“ in der Jukebox gewählt. Anscheinend hatte sich wieder mal ein Tourist in das Deerstalker verirrt, denn jeder Ire wusste, dass es sich hier um ein Weihnachtslied handelte. Auch wenn in dem Song ordentlich geflucht wurde.
„Wer ist die neue Barfrau?“
Julia hatte John nicht kommen sehen. Sie hatte es anfangs für eine gute Idee gehalten, mit George in den Pub zu gehen, um sich etwas abzulenken. Es gelang ihr aber nicht. In Gedanken hatte sie schon die Irische See überquert, um dann zu realisieren, dass auch der Rest von ihr bald zurück nach England musste.
John setzte sich zu den beiden. Sie hatten einen der begehrten Plätze in der Nische ergattert, direkt am offenen Kamin.
„Anscheinend ein neues Talent hinter dem Tresen, die habe ich hier auch noch nie gesehen.“
George schien die Äußerung seines Freundes in keiner Weise zu irritieren, aber John hatte Julias fragenden Blick bemerkt.
„Simon ist berüchtigt dafür, immer neue ‚Talente‘ für den Barbetrieb zu entdecken. Jedes Mal, wenn er in den Urlaub fährt, bringt er den neuen aufgehenden Stern am Barkeeper-Himmel mit. Das funktioniert in der Regel sechs bis acht Wochen, dann wirds meist wieder düster und er steht allein hinterm Tresen.“
„Erinnerst du dich noch an die Erste, die er von seinem Trip nach Schweden mitgebracht hat? Marie irgendwas …“
„Ja, die mit den kurzen blonden Haaren, die sah immer irgendwie gefährlich aus.“ John schüttelte sich.
„Oder Lola, erinnerst du dich an die?“
„Lola? Das Showgirl mit den gelben Federn im Haar?“ „Nein, Lola aus einem Club in Soho. Die hat er wohl die ganze Nacht mit Champagner abgefüllt, während er selbst dabei angeblich nur Cola getrunken hat. Als sie am nächsten Tag wieder nüchtern wurde, saß sie schon im Flieger nach Dublin.“ George grinste.
„Am besten fand ich die aus Andalusien. Marocana.“
„Macarena!“
„Stimmt. Die konnte sogar Cocktails mixen, nur hat sie dabei immer ihren komischen Tanz aufgeführt, das war irritierend.“





























