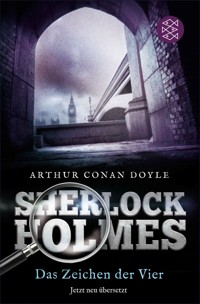
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sherlock Holmes
- Sprache: Deutsch
»Sie sind eine Frau, der Unrecht getan wurde, aber Ihnen soll Gerechtigkeit widerfahren. Bringen Sie keine Polizei mit, sonst wäre alles umsonst. Ihr unbekannter Freund.« Eine schöne Frau erhält diese mysteriöse Einladung und wendet sich in ihrer Not an Sherlock Holmes, der sie verdeckt zum Rendezvous begleitet - und einbeinige Ganoven, verborgene Schätze und Giftpfeile entdeckt. - Der zweite Fall von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Andere Detektive haben Fälle, Sherlock Holmes erlebt Abenteuer - entdecken Sie sie neu in der großartigen Übersetzung von Henning Ahrens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Arthur Conan Doyle
Sherlock HolmesDas Zeichen der Vier
Über dieses Buch
Der zweite Roman Arthur Conan Doyles erzählt von einer schönen Frau, die Sherlock Holmes und Dr. Watson beauftragt, ihren in Indien verschollenen Vater aufzuspüren. Ihre Suche führt die beiden zur East India Company, zu einem gestohlenen Schatz und einem Geheimpakt zwischen vier Strafgefangenen und zwei korrupten Gefängniswärtern. Er endet mit einem furiosen Showdown in London.
Der Roman erschien erstmals im Juli 1890 in dem amerikanischen Magazin »Lippinscott’s Monthly Magazine« unter dem Titel ›The Sign of the Four‹. Arthur Conan Doyle wurde während eines Abendessens von dem Herausgeber des »Lippinscott’s Monthly Magazine« beauftragt, eine Geschichte für eine englische Ausgabe des Magazins zu schreiben. An diesem Abendessen nahm auch Oscar Wilde teil, der daraufhin »Das Bildnis des Dorian Gray « für das Magazin beisteuerte. Conan Doyle bezeichnete diesen Abend später als »golden evening«. Die erste Buchveröffentlichung erfolgte ebenfalls 1890 bei Spencer Blackett.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Arthur Conan Doyle, geboren am 22. Mai 1859 im schottischen Edinburgh, absolviere dort ein Medizinstudium und unterhielt kurzlebige Praxen in Plymouth und Southsea. Aus Patientenmangel begann er zu schreiben, ab 1887 verfasste er Geschichten um die Detektivfigur Sherlock Holmes, die in den 1890er Jahren enorme Popularität erlangten. Außerdem verfasste er zahlreiche historische Romane und ab 1912 auch Science-Fiction. Doyle engagierte sich politisch und sozial, 1902 wurde er geadelt. Er starb am 7. Juli 1930 in Crowborough/Sussex.
Henning Ahrens lebt als Schriftsteller und Übersetzer in Frankfurt am Main. Er veröffentlichte die Lyrikbände ›Stoppelbrand‹, ›Lieblied was kommt‹ und ›Kein Schlaf in Sicht‹ sowie die Romane ›Lauf Jäger lauf‹, ›Langsamer Walzer‹ und ›Tiertage‹. Für S. Fischer übersetzte er Romane von Richard Powers, Kevin Powers, Khaled Hosseini. Zuletzt erschien ›Glantz und Gloria. Ein Trip‹, 2015, der mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet wurde.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de.
Inhalt
EINS Die Wissenschaft der Deduktion
ZWEI Der Fall wird dargelegt
DREI Auf der Suche nach einer Lösung
VIER Die Geschichte des kahlköpfigen Mannes
FÜNF Die Tragödie von Pondicherry Lodge
SECHS Sherlock Holmes führt seine Methoden vor
SIEBEN Die Sache mit dem Fass
ACHT Die Hilfstruppe aus der Baker Street
NEUN Die Kette reißt
ZEHN Das Ende des Eingeborenen
ELF Der große Schatz von Agra
ZWÖLF Die einzigartige Geschichte von Jonathan Small
Editorische Notiz
Zur Neuübersetzung
EINS Die Wissenschaft der Deduktion
Sherlock Holmes griff nach der auf dem Kaminsims stehenden Flasche, holte die Injektionsspritze aus dem Lederfutteral und befestigte die Nadel mit langen, bleichen und sensiblen Fingern auf der Düse. Dann krempelte er die linke Manschette hoch. Sein Blick haftete lange auf Handgelenk und sehnigem Unterarm, beide von vielen Einstichen übersät. Schließlich führte er die Nadel ein, drückte den Kolben nach unten und sank mit einem zufriedenen Seufzer auf den samtbetressten Lehnsessel.
Obwohl ich während der letzten Monate dreimal täglich Zeuge dieser Prozedur geworden war, hatte ich mich nicht daran gewöhnen können, im Gegenteil. Meine Irritation wuchs mit jedem Tag, und nachts quälte mich die Frage, warum ich nicht den Mut hatte, Holmes von diesen Injektionen abzuhalten. Ich hatte mir wiederholt geschworen, aus meinem Herzen keine Mördergrube zu machen, ein Ansinnen, das schon im Vorfeld an der kühlen, sorglosen Art meines Mitbewohners scheiterte. Außerdem trugen sein starkes Ego und die vielen Begabungen und außergewöhnlichen Fähigkeiten, deren Zeuge ich geworden war, dazu bei, dass ich ihm nicht auf die Zehen treten mochte.
Doch an diesem Nachmittag – sei es, weil ich zum Mittagessen einen roten Burgunder getrunken hatte, sei es, weil mich seine penible, ja pedantische Vorgehensweise auf die Palme brachte – konnte ich mich nicht mehr beherrschen.
»Was ist es heute?«, fragte ich. »Morphium oder Kokain?«
Er blickte von dem alten, in Fraktur gedruckten Buch auf, das er zur Hand genommen hatte, und sah mich benommen an.
»Kokain«, antwortete er. »Siebenprozentige Lösung. Möchten Sie auch mal probieren?«
»Nein, auf keinen Fall«, erwiderte ich brüsk. »Ich habe mich immer noch nicht ganz von dem Afghanistan-Feldzug erholt und kann es mir nicht leisten, meinen Körper zusätzlichen Belastungen auszusetzen.«
Meine heftige Reaktion entlockte ihm ein Lächeln. »Sie haben sicher recht, Watson«, sagte er. »Vermutlich schadet es der Gesundheit. In geistiger Hinsicht empfinde ich es allerdings als so anregend und erhellend, dass mir die Nebenwirkungen egal sind.«
»Das kann nicht Ihr Ernst sein!«, beschwor ich ihn. »Bedenken Sie die Folgen! Gut möglich, dass Ihre Gehirnaktivität intensiviert wird, aber es handelt sich um einen krankhaften Prozess, der das Gewebe stark verändert und für anhaltende Schwäche sorgt. Sie wissen doch, wie zerschlagen Sie danach sind. Das Spiel ist den Einsatz nicht wert. Wollen Sie für ein flüchtiges Vergnügen tatsächlich den Verlust Ihrer einzigartigen Fähigkeiten riskieren? Denken Sie daran, dass ich nicht nur als Freund, sondern auch als Arzt zu Ihnen spreche, der eine Mitverantwortung für Ihre Gesundheit trägt.«
Er wirkte nicht beleidigt. Stattdessen stützte er die Ellbogen auf die Sessellehnen und legte die Fingerspitzen aneinander, als hätte er Spaß an diesem Gespräch.
»Mein Geist«, sagte er, »rebelliert gegen Stagnation. Setzen Sie mir ein Problem vor, verschaffen Sie mir Arbeit, konfrontieren Sie mich mit einer abstrusen Geheimschrift oder mit einer hochkomplexen Analyse, und ich bin wieder in meinem Element. Dann kann ich auf künstliche Anreger verzichten. Aber ich verabscheue die öde Routine des Lebens. Ich sehne mich nach geistigen Höhenflügen. Deshalb habe ich mich für meinen Beruf entschieden, ihn besser gesagt erfunden, denn ich bin weltweit ein Einzelfall.«
»Der einzige inoffizielle Detektiv?«, fragte ich und zog die Augenbrauen hoch.
»Der einzige inoffizielle beratende Detektiv«, antwortete er. »Ich bin die höchste und letzte Ermittlungsinstanz. Wenn Gregson, Lestrade oder Athelney Jones mit ihrem Latein am Ende sind – übrigens ihr Normalzustand –, unterbreiten sie mir den Fall. Ich beuge mich als Experte über die Fakten und fälle ein fachmännisches Urteil. Ich verlange keine Anerkennung. Mein Name taucht in den Zeitungen nicht auf. Meine größte Belohnung ist die Arbeit selbst, denn sie ermöglicht mir die Anwendung meiner speziellen Fertigkeiten. Einige meiner Methoden haben Sie ja im Zuge der Ermittlungen gegen Jefferson Hope kennengelernt.«
»Stimmt«, erwiderte ich. »Ich bin nach wie vor tief beeindruckt und habe den Fall sogar in einem Buch mit dem ausgefallenen Titel ›Eine Studie in Scharlachrot‹ geschildert.«
Er schüttelte betrübt den Kopf.
»Ja, ich habe hineingeschaut«, sagte er, »kann Sie aber nicht dazu beglückwünschen. Die detektivische Arbeit ist eine exakte Wissenschaft, sollte dies jedenfalls sein und deshalb möglichst nüchtern und sachlich behandelt werden. Sie haben versucht, ein romantisches Element einzuflechten, was in etwa so ist, als würde man den fünften euklidischen Lehrsatz durch eine Liebesgeschichte verwässern.«
»Die Liebesgeschichte ist keine Erfindung«, versetzte ich. »Sie entspricht den Tatsachen.«
»Manche Tatsachen sollte man ausblenden oder wenigstens ihrer Bedeutung gemäß gewichten. Der einzige nennenswerte Aspekt des Falles besteht in meiner Ermittlungstechnik, die von den Wirkungen auf die Ursachen schließt.«
Ich ärgerte mich über seine Kritik, denn ich hatte das Buch nicht zuletzt geschrieben, um ihm eine Freude zu bereiten. Außerdem nervte mich seine Selbstverliebtheit, die zu verlangen schien, dass sich jede Zeile um seine analytischen Glanzleistungen drehte. Während unserer gemeinsamen Zeit in der Baker Street hatte ich oft bemerkt, dass sich hinter der stillen, selbstsicheren Art meines Mitbewohners eine gehörige Portion Eitelkeit verbarg. Doch ich erwiderte nichts, sondern rieb mein Bein, das vor Jahren durch die Kugel einer Jezail-Flinte verwundet worden war. Es behinderte mich nicht beim Gehen, schmerzte aber stark, wenn das Wetter umschlug.
»Meine Methode wird seit neuestem auf dem Kontinent angewandt«, sagte Holmes nach einer Weile und entfachte seine alte Bruyère-Pfeife. »Letzte Woche erhielt ich eine Anfrage von François le Villard, seit geraumer Zeit einer der bekanntesten Detektive Frankreichs, wie Sie wissen. Als Kelte verfügt er über eine rasche Auffassungsgabe, hat aber noch große Wissenslücken, die er dringend füllen muss, wenn er seine Kunst auf eine höhere Ebene heben will. Der Fall hatte mit einem Testament zu tun und war in mancher Hinsicht nicht ganz uninteressant. Ich konnte ihn auf zwei vergleichbare Fälle hinweisen, der eine 1857 in Riga, der andere 1871 in St. Louis, die ihn auf die Lösung gebracht haben. Hier ist sein heute Morgen eingetroffener Dankesbrief.«
Er warf mir einen zerknitterten Bogen ausländischen Briefpapiers zu. Als ich den Blick darauf senkte, fielen mir sofort zahlreiche lobende Formulierungen ins Auge, garniert mit Worten wie magnifique, coup-de-mâitres und tours-de-force, die von der glühenden Bewunderung des Franzosen zeugten.
»Liest sich wie das Schreiben eines Schülers an seinen Meister«, sagte ich.
»Oh, er überschätzt meine Hilfe«, erwiderte Sherlock Holmes leichthin, »zumal er ein außerordentlich fähiger Mann ist. Er besitzt zwei der drei Eigenschaften, die den idealen Detektiv auszeichnen: Eine herausragende Wahrnehmungsgabe und einen scharfen, analytischen Verstand. Seine Wissenslücken wird er mit der Zeit sicher füllen. Derzeit übersetzt er meine Schriften ins Französische.«
»Ihre Schriften?«
»Ja, wissen Sie das nicht?«, rief er lachend. »Ich habe mehrere Monographien verbrochen, alle zu Themen aus der Praxis. Etwa diese: ›Zur Unterscheidung der Asche diverser Tabake‹. Sie listet hundertvierzig Zigarren-, Zigaretten- und Pfeifentabake auf, dazu gibt es farbige Abbildungen der jeweiligen Asche. Dieses Thema spielt bei Prozessen oft eine Rolle und kann sich als entscheidendes Indiz erweisen. Könnte man zum Beispiel beweisen, dass ein Mord von einem Mann begangen wurde, der indische Lunkah-Zigarren raucht, dann wäre das für die Ermittlungen zielführend. Der Unterschied zwischen schwarzer Tiruchirapalli-Tabakasche und der weißen, flockigen Asche einer englischen Tabakmischung ist für das geübte Auge so groß wie der zwischen einem Kohlkopf und einer Kartoffel.«
»Sie haben einen genialen Blick für Feinheiten«, sagte ich.
»Ich bin mir ihrer Bedeutung bewusst. Hier, dies ist meine Abhandlung über die Erkennung von Fußabdrücken, ergänzt um Hinweise zum Abguss von Spuren mit Alabastergips. Und hier haben Sie ein abseitiges, kleines Werk über den Einfluss der Arbeit auf die Gestalt der Hände, mit Lithographien der Hände von Schieferdeckern, Matrosen, Korkschneidern, Schriftsetzern, Webern und Diamantenschleifern. Ein sehr wichtiges Thema für den wissenschaftlich arbeitenden Detektiv – vor allem, wenn es um die Ermittlung der Angehörigen von Toten oder der Herkunft von Kriminellen geht. Aber ich will Sie nicht mit meinem Hobby langweilen.«
»Das tun Sie nicht«, versicherte ich. »Ich finde es hochinteressant, zumal ich die praktische Anwendung Ihrer Theorien miterlebt habe. Da Sie gerade von Wahrnehmung und Schlussfolgerung gesprochen haben, stellt sich mir jedoch die Frage, ob beides nicht weitgehend miteinander identisch ist.«
»Ganz und gar nicht«, erwiderte er, lehnte sich genussvoll im Lehnsessel zurück und paffte dichten, blauen Rauch. »Meine Wahrnehmung sagt mir, dass Sie heute Vormittag in der Post in der Wigmore Street waren, meine Schlussfolgerung lautet aber, dass Sie dort ein Telegramm aufgegeben haben.«
»Richtig!«, sagte ich. »Beides stimmt! Aber ich muss gestehen, dass ich nicht begreife, wie Sie darauf gekommen sind. Ich bin einem spontanen Impuls gefolgt und habe niemandem davon erzählt.«
»Das war kinderleicht«, erwiderte er und lachte leise über mein Erstaunen, »so unglaublich leicht, dass es eigentlich keiner Erklärung bedarf. Andererseits kann ich Ihnen auf diese Weise die Grenzen sowohl der Wahrnehmung als auch der Deduktion vor Augen führen. Meine Wahrnehmung sagt mir, dass etwas roter Matsch auf der Innenseite Ihrer Schuhe klebt. In der Wigmore Street wurde der Bürgersteig aufgegraben, und wenn man zur Post will, muss man durch die ausgehobene Erde gehen. Diese hat einen rötlichen Ton, der, soweit ich weiß, in unserem Viertel nur in jener Straße vorkommt. Soviel zur Wahrnehmung. Der Rest ist Deduktion.«
»Und wie sind Sie auf das Telegramm gekommen?«
»Da ich Ihnen vormittags gegenüber saß, wusste ich, dass Sie keinen Brief geschrieben haben. Außerdem war Ihr Sekretär offen, und mir fiel auf, dass Sie darin Briefmarken und einen ganzen Stapel Postkarten aufbewahren. Ihr Gang zur Post konnte also nur die Versendung eines Telegramms zum Ziel haben. Man streicht einen Faktor nach dem anderen, und was übrig bleibt, muss die Wahrheit sein.«
»In diesem Fall trifft das eindeutig zu«, sagte ich nach kurzem Nachdenken. »Sie haben allerdings zu Recht betont, dass es sich um einen ziemlich einfachen Fall handelt. Fänden Sie es dreist, wenn ich Ihre Theorien auf eine härtere Probe stellen würde?«
»Ganz im Gegenteil«, antwortete er. »Das würde mich von einem zweiten Schuss Kokain abhalten. Stellen Sie mir ein Problem, und ich denke darüber nach.«
»Sie haben einmal erwähnt, man könne keinen Gegenstand täglich benutzen, ohne dabei Spuren zu hinterlassen, die der geschulte Beobachter zu deuten wisse. Hier ist eine Uhr, die ich noch nicht lange besitze. Wären Sie so freundlich, mir etwas über Charakter und Gewohnheiten des früheren Besitzers zu verraten?«
Ich reichte ihm die Uhr, wobei ich mich insgeheim amüsierte, denn ich glaubte nicht, dass er diese Probe bestehen würde, wollte ihm auch eine Lektion erteilen, weil er immer wieder glaubte, mich belehren zu müssen. Er wog die Taschenuhr in der Hand, unterzog das Zifferblatt einer genauen Betrachtung, öffnete die Rückseite und untersuchte das Uhrwerk, zuerst mit bloßem Auge, danach durch eine starke Lupe. Als er die Uhr wieder schloss und zurückreichte, konnte ich mir beim Anblick seines ratlosen Gesichts ein Lächeln nicht verkneifen.
»Ich finde kaum Anhaltspunkte«, bemerkte er. »Die ergiebigsten Indizien fehlen, weil die Uhr kürzlich gereinigt wurde.«
»Stimmt«, erwiderte ich. »Man hat sie gereinigt, bevor sie an mich verschickt wurde.«
Ich unterstellte meinem Mitbewohner im Stillen, sein Versagen durch die lahmste und banalste aller Ausreden unter den Tisch kehren zu wollen.
»Die Faktenlage ist zwar dürftig, aber nicht hoffnungslos«, sagte er und sah trübe und verträumt zur Zimmerdecke auf. »Ich denke – berichtigen Sie mich bitte –, dass diese Uhr Ihrem älteren Bruder gehört hat, der sie wiederum von Ihrem Vater geerbt hatte.«
»Das haben Sie zweifellos aus den Initialen H.W. auf der Rückseite geschlossen.«
»Richtig. Das W weist auf Ihren Nachnamen hin. Das Datum liegt fünfzig Jahre zurück, und die Initialen sind so alt wie die Uhr. Sie wurde also für Ihre Elterngeneration angefertigt. Schmuck wird meist an den ältesten Sohn vererbt, und dieser trägt üblicherweise den Namen des Vaters. Soweit ich weiß, ist Ihr Vater seit langem tot. Die Uhr muss sich also im Besitz Ihres älteren Bruders befunden haben.«
»So weit, so gut«, sagte ich. »Und weiter?«
»Er war schlampig – sehr unachtsam und nicht besonders reinlich. Er hatte beste Voraussetzungen, wusste seine Chancen aber nicht zu nutzten, hat nur kurze Phasen des Wohlstands erlebt, ist dann verarmt und dem Suff verfallen und schließlich gestorben. Mehr kann ich nicht sagen.«
Ich sprang von meinem Stuhl auf und humpelte aufgewühlt und verbittert durch das Zimmer.
»Wie erbärmlich von Ihnen, Holmes«, sagte ich. »Ich hätte nicht gedacht, dass Sie sich auf dieses Niveau hinabbegeben würden. Sie haben Nachforschungen zu meinem unglücklichen Bruder angestellt und tun jetzt so, als hätten Sie Ihr Wissen aus dem Ärmel geschüttelt. Wollen Sie mir wirklich weismachen, Sie hätten all das anhand seiner alten Uhr herausgefunden? Um ganz offen zu sein, ist das nicht nur frech, sondern dreiste Augenwischerei.«
»Mein lieber Doktor«, sagte er freundlich, »bitte verzeihen Sie mir. Ich habe die Sache als abstraktes Problem aufgefasst und darüber vergessen, dass es sich um eine sehr persönliche und schmerzliche Angelegenheit handelt. Trotzdem versichere ich Ihnen, dass ich über Ihren Bruder nichts wusste, bevor ich die Uhr zur Hand genommen habe.«
»Aber wie zur Hölle sind Sie auf diese Fakten gekommen? Sie stimmen in jeder Hinsicht.«
»Ach, das waren Glückstreffer. Ich habe dargelegt, was ich am wahrscheinlichsten fand, und nicht erwartet, in allen Punkten recht zu haben.«
»Sie haben also nur geraten?«
»Nein, nein, ich rate niemals. Das ist eine entsetzliche Angewohnheit – fatal für das logische Denkvermögen. Sie sind befremdet, weil Sie weder meinen Gedankengang verfolgt noch die Details bemerkt haben, aus denen man tiefergehende Schlüsse ziehen kann. Ich habe Ihren Bruder zum Beispiel als schlampig eingestuft. Bei einer genaueren Untersuchung des Gehäuses würde Ihnen auffallen, dass es am unteren Rand zwei Dellen und außerdem zahlreiche Kratzer aufweist, die die Vermutung nahelegen, dass die Uhr zwischen anderen harten Gegenständen, etwa Schlüsseln oder Münzen, in der Tasche getragen wurde. Wenn jemand so gedankenlos mit einer Uhr umgeht, die fünfzig Guinea wert ist, dann spricht das für Schlampigkeit. Und die Vermutung, dass jemand, der ein so wertvolles Stück geerbt hat, auch in anderer Hinsicht finanziell gut versorgt war, liegt dann ebenfalls nahe.«
Ich nickte, um anzudeuten, dass ich ihm folgen konnte.
»Unter englischen Pfandleihern ist es üblich, die Nummer des Scheins, der für eine angenommene Uhr ausgestellt wird, mit einer Nadel auf die Innenseite des Gehäuses zu kratzen. Das ist praktischer als ein Zettel, weil man die Nummer weder ablösen noch verlieren kann. Durch die Lupe habe ich im Gehäuse sage und schreibe vier solcher Nummern entdeckt. Erstes Fazit: Ihr Bruder war oft knapp bei Kasse. Zweitens: Er ist gelegentlich zu Geld gekommen, sonst hätte er die Uhr nicht auslösen können. Und nun betrachten Sie das Loch, in das man den Schlüssel zum Aufziehen steckt. Wie Sie sehen, ist es von zahlreichen Schrammen umgeben, weil der Schlüssel ständig abgerutscht ist. Einem nüchternen Mann wäre das nicht passiert, bei der Uhr eines Trinkers sind solche Schrammen jedoch normal. Sie wird nachts aufgezogen, und dabei hinterlassen die zittrigen Hände ihres Besitzers Spuren. Finden Sie meine Erkenntnisse immer noch rätselhaft?«
»Nein, sonnenklar«, antwortete ich. »Tut mir leid, dass ich Sie angeblafft habe. Ich hätte größeres Vertrauen in Ihre Fähigkeiten haben sollen. Darf ich fragen, ob Sie derzeit in einem Fall ermitteln?«
»Nein. Darum das Kokain. Ohne geistige Arbeit ist alles sinnlos. Wofür soll man sonst leben? Schauen Sie aus dem Fenster. War die Welt jemals so öde, spröde und unergiebig? Sehen Sie nur, wie der gelbe Nebel durch die Straße wabert und vor den grauen Häusern wogt. Was könnte langweiliger, was weniger inspirierend sein? Wozu große Gaben, Doktor, wenn man sie nicht nutzen kann? Die Verbrechen sind mittelmäßig, das Dasein ist mittelmäßig. Auf dieser Welt regiert das Mittelmaß.«
Ich wollte gerade etwas auf seine Litanei erwidern, als unsere Vermieterin nach forschem Klopfen eintrat und uns auf ihrem Messingteller eine Visitenkarte präsentierte.
»Eine junge Dame möchte Sie sprechen, Sir«, sagte sie zu meinem Mitbewohner.
»Miss Mary Morstan«, las Holmes vor. »Hm! Sagt mir nichts. Bitten Sie die junge Dame herauf, Mrs Hudson. Nein, gehen Sie nicht, Doktor. Besser, Sie bleiben.«
ZWEI Der Fall wird dargelegt
Miss Morstan, blond und zierlich, betrat das Zimmer mit festem Schritt. Sie trug gute Handschuhe, war auch sonst geschmackvoll gekleidet, doch die Schlichtheit der Stücke deutete auf bescheidene Mittel hin. Ihr schmuckloses Kleid war von einem ins Grau spielenden Beige, der farblich dazu passende Turban war seitlich mit einigen weißen Federn geschmückt. Sie hatte weder ebenmäßige Züge noch einen schönen Teint, aber eine gewinnende, offene Miene. Ihre ungewöhnlich mitfühlend und vergeistigt dreinschauenden blauen Augen beeindruckten mich am stärksten. Ich hatte auf drei Kontinenten Erfahrungen mit Frauen unterschiedlichster Nationalitäten gesammelt, aber niemals ein Gesicht gesehen, in dem ein so empfindsames, kultiviertes Wesen zum Ausdruck gekommen wäre. Anfangs hatte sie gefasst gewirkt, doch als sie sich auf den Stuhl setzte, den Sherlock Holmes ihr hinschob, fiel mir auf, dass Lippen und Hände zitterten, Anzeichen tiefer Erschütterung.
»Ich bin gekommen, Mr Holmes«, sagte sie, »weil Sie meiner Dienstherrin, Mrs Cecil Forrester, vor einiger Zeit bei der Klärung eines kleinen, häuslichen Dilemmas geholfen haben. Sie lobt Ihre Freundlichkeit und Ihr Können bis heute in den höchsten Tönen.«
»Mrs Cecil Forrester«, wiederholte Holmes nachdenklich. »Ja, ich konnte ihr einen kleinen Dienst erweisen. Wenn ich mich recht erinnere, war es ein sehr einfach gelagerter Fall.«
»Das sieht sie anders. Und meinen Fall werden Sie ganz sicher nicht einfach gelagert finden, denn rätselhaftere Umstände sind kaum denkbar.«
Holmes rieb sich die Hände, seine Augen funkelten, die scharf geschnittenen, habichtartigen Züge wirkten hoch konzentriert, als er sich auf dem Sessel nach vorn beugte.
»Bitte legen Sie alles dar«, sagte er sachlich.
Ich hatte das unangenehme Gefühl, fehl am Platz zu sein.
»Bitte entschuldigen Sie mich«, sagte ich und stand auf.
Zu meiner Überraschung wurde ich von der jungen Dame mit einer Handbewegung gebremst.
»Ich glaube, Ihr Freund könnte sich als hilfreich erweisen, wenn er bliebe«, sagte sie zu Holmes.
Ich sank wieder auf den Stuhl.
»Ich schildere Ihnen die Fakten in aller Kürze«, fuhr sie fort. »Ich wurde von meinem Vater, der als Offizier in einem indischen Regiment diente, in sehr jungen Jahren nach England geschickt. Meine Mutter war tot, und weil ich keine weiteren Angehörigen habe, kam ich in einem guten Internat in Edinburgh unter. Dort blieb ich bis zum siebzehnten Lebensjahr. 1878 wurde meinem Vater, inzwischen dienstältester Hauptmann seines Regiments, ein zwölfmonatiger Heimaturlaub bewilligt. Er telegraphierte mir aus London, dass er gut angekommen sei, und bat mich, ihn sofort im Langham Hotel zu besuchen. Er hatte sehr liebevoll geschrieben, das weiß ich noch. Ich fuhr nach London, und im Hotel wurde mir bestätigt, dass es einen Gast namens Captain Morstan gebe, nur sei er am Vorabend ausgegangen und noch nicht wieder da. Ich wartete den ganzen Tag vergeblich. Abends setzte ich mich auf Anraten des Hoteldirektors mit der Polizei in Verbindung, und am folgenden Morgen schalteten wir Anzeigen in allen Zeitungen. Die Nachforschungen blieben ergebnislos, und ich habe seither nie wieder etwas von meinem unglücklichen Vater gehört. Er war in der Hoffnung heimgekehrt, Ruhe und Frieden zu finden, und stattdessen …«
Sie schluchzte erstickt, und drückte sich eine Hand an den Hals.
»Das Datum?«, fragte Holmes und schlug sein Notizbuch auf.
»Er verschwand am dritten Dezember 1878 – vor fast genau zehn Jahren.«
»Und sein Gepäck?«
»Blieb im Hotel. Es enthielt nichts, was einen Hinweis gegeben hätte – Kleider, einige Bücher und diverse Kuriositäten von den Andamanen. Er hatte gemeinsam mit anderen Offizieren ein Regiment befehligt, das Sträflinge bewachte.«
»Hatte er Freunde in London?«
»Nur einen, soweit ich weiß – Major Sholto, ein Kamerad aus dem Infanterieregiment 34, Bombay. Der Major war schon im Ruhestand und lebte in Upper Norwood. Wir haben natürlich Kontakt zu ihm aufgenommen, aber er wusste nicht einmal, dass mein Vater in England war.«
»Verrückte Sache«, bemerkte Holmes.
»Das Verrückteste wissen Sie noch nicht. Vor sechs Jahren – genauer am vierten Mai 1882 – wurde in einer Anzeige in der Times nach einer Miss Mary Morstan gesucht, verbunden mit dem Hinweis, dass eine Rückmeldung für sie von Vorteil wäre. Name oder Adresse wurden nicht genannt. Damals hatte ich gerade meine Stelle als Gouvernante in der Familie von Mrs Cecil Forrester angetreten, und diese riet mir, meine Adresse auf der Anzeigenseite zu publizieren. Am gleichen Tag bekam ich mit der Post eine Pappschachtel, die eine sehr große Perle, aber kein einziges Wort enthielt. Seither habe ich jedes Jahr am gleichen Tag eine solche Schachtel mit einer solchen Perle erhalten, stets ohne Hinweis auf den Absender. Laut eines Fachmanns handelt es sich um eine sehr seltene und kostbare Perlenart. Hier, Sie können sich selbst davon überzeugen.«
Sie öffnete eine Schachtel und zeigte uns sechs Perlen von erlesener Schönheit.
»Hochinteressant«, sagte Sherlock Holmes. »Gab es weitere Vorfälle?«
»Ja, und zwar heute. Darum bin ich hier. Heute Morgen erhielt ich einen Brief. Sie sollten ihn besser selbst lesen.«





























