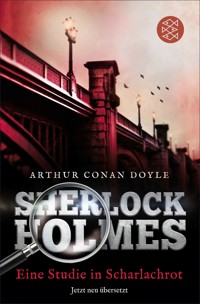
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Sherlock Holmes
- Sprache: Deutsch
»Der scharlachrote Faden des Mordes durchzieht die farblose Oberfläche des Lebens, und unsere Pflicht besteht darin, ihn zu finden und zu isolieren und auf ganzer Länge bloßzulegen.« Das erste Abenteuer von Sherlock Holmes und Dr. Watson, der den »beratenden Detektiv« ruft, um einen rätselhaften Mord aufzuklären: ein scheinbar unverletzter Toter mit einer Schreckensgrimasse, eine Losung als Blutspur an der Wand: »Rache« … Andere Detektive haben Fälle, Sherlock Holmes erlebt Abenteuer - entdecken Sie sie neu in der großartigen Übersetzung von Henning Ahrens
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Arthur Conan Doyle
Sherlock Holmes - Eine Studie in Scharlachrot
Roman
Über dieses Buch
»Der scharlachrote Faden des Mordes durchzieht die farblose Oberfläche des Lebens, und unsere Pflicht besteht darin, ihn zu finden und zu isolieren und auf ganzer Länge bloßzulegen.«
Das erste Abenteuer von Sherlock Holmes und Dr. Watson, der den »beratenden Detektiv« ruft, um einen rätselhaften Mord aufzuklären: ein scheinbar unverletzter Toter mit einer Schreckensgrimasse, eine Losung als Blutspur an der Wand: »Rache« …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Arthur Conan Doyle, geboren 1859 in Edinburgh, studierte Medizin und praktizierte in Plymouth und Southsea. Aus Patientenmangel begann er zu schreiben, 1887 erfand er Sherlock Holmes. Daneben entstanden historische Romane und ab 1912 auch Science-Fiction. Doyle engagierte sich politisch und sozial, 1902 wurde er geadelt. Er starb am 7. Juli 1930 in Crowborough / Sussex.
Henning Ahrens lebt als Schriftsteller und Übersetzer in Frankfurt am Main. Für S. Fischer übersetzte er Romane von Richard Powers, Kevin Powers, Khaled Hosseini. 2015 erschien sein Roman ›Glantz und Gloria. Ein Trip‹, für den er mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet wurde.
Inhalt
Erster Teil Nachdruck aus den Lebenserinnerungen von John H. Watson, Dr. med., Sanitätsoffizier des Heeres a.D.
Eins Mr Sherlock Holmes
Zwei Die Wissenschaft der Schlussfolgerung
Drei Das Rätsel von Lauriston Garden
Vier Was John Rance zu berichten wusste
Fünf Unsere Anzeige beschert uns einen Besucher
Sechs Tobias Gregson zeigt, was er kann
SIEBEN Licht im Dunkel
Zweiter Teil Das Land der Heiligen
Eins In der großen Salzwüste
Zwei Die Blume von Utah
Drei John Ferrier spricht mit dem Propheten
Vier Flucht vor dem drohenden Verhängnis
Fünf Die Rächenden Engel
Sechs Fortsetzung der Lebenserinnerungen von John H. Watson, Dr. med.
Sieben Abschluss
Editorische Notiz
Zur Neuübersetzung
Erster Teil Nachdruck aus den Lebenserinnerungen von John H. Watson, Dr. med., Sanitätsoffizier des Heeres a.D.
EinsMr Sherlock Holmes
1878 schloss ich mein Studium an der University of London als Doktor der Medizin ab und ging nach Netley, um mich im dortigen Militärhospital zum Sanitätsoffizier des Heeres ausbilden zu lassen. Nach dieser Ausbildung wurde ich den Fifth Northumberland Fusiliers als Assistenzarzt zugeteilt. Das Infanterieregiment war damals in Indien stationiert, aber bevor ich es erreichen konnte, brach der Zweite Afghanische Krieg aus. Nachdem ich in Bombay von Bord gegangen war, erfuhr ich, dass mein Korps die Gebirgspässe schon überquert hatte und tief in das Feindesland vorgestoßen war. Trotzdem folgte ich ihm in Begleitung vieler anderer Offiziere, die sich in einer ähnlichen Lage befanden wie ich, und kam wohlbehalten in Kandahar an, wo ich mein Regiment ausfindig machte und sofort meinen Dienst antrat.
Während dieses Feldzugs ernteten viele Männer Ehren und Beförderungen, aber für mich hielt er nur Unglück und Elend bereit. Man versetzte mich aus meiner Brigade zu den Royal Berkshires, mit denen ich in der katastrophalen Schlacht von Maiwand kämpfte. Dort traf mich die Kugel einer Jezail-Flinte in die Schulter, zerschmetterte den Knochen und streifte die Unterschlüsselbeinschlagader. Ohne Murray, meinen treuen und mutigen Offiziersburschen, der mich über ein Packpferd warf und hinter die britischen Linien in Sicherheit brachte, wäre ich den blutrünstigen Ghāzīs in die Hände gefallen.
Von Schmerzen geplagt und geschwächt durch die Strapazen, die ich hatte erdulden müssen, wurde ich gemeinsam mit unzähligen anderen Verwundeten in das Basishospital in Peschawar transportiert. Dort erholte ich mich, konnte bald durch die Stationen schlendern und auf der Veranda etwas Sonne tanken, wurde aber von einer Typhus-Infektion, diesem Fluch unserer indischen Besitzungen, ein weiteres Mal auf das Krankenlager geworfen. Ich schwebte monatelang zwischen Leben und Tod, und als ich mich endlich fing und zu genesen begann, war ich so schwach, dass ein Ärztegremium beschloss, keinen Tag länger zu zögern, sondern mich sofort nach England zurückzuschicken. Ich wurde an Bord des Truppentransporters Orontes gebracht und ging einen Monat später an der Mole von Portsmouth an Land – mit bleibenden gesundheitlichen Schäden, aber wenigstens mit der Genehmigung einer gütigen Regierung, mich während der nächsten neun Monate erholen zu dürfen.
Ich hatte in England weder Kind noch Kegel, war also frei wie der Wind – jedenfalls so frei, wie es ein Mann sein kann, der über ein tägliches Einkommen von elf Schilling und sechs Pence verfügt. Wie sich von selbst versteht, zog es mich nach London, diesen riesigen Strudel, der alle Müßiggänger und Faulenzer des britischen Weltreiches in sich aufsaugt. Dort wohnte ich eine Weile in einem Privathotel in der Strand, führte ein karges und unerfülltes Leben und gab das bisschen Geld, das ich hatte, mit viel zu vollen Händen aus. Schließlich entwickelte sich meine finanzielle Situation so dramatisch, dass mir nur die Wahl blieb, die Metropole zu verlassen und mich irgendwo auf dem Land einzurichten oder meine Lebensweise vollständig umzukrempeln. Ich entschied mich für Letzteres und beschloss, das Hotel zu verlassen, um mir eine angemessenere und günstigere Bleibe zu suchen.
Nach diesem Entschluss, es war noch am gleichen Tag, stand ich an der Bar des Criterion, als mir jemand auf die Schulter tippte, und als ich mich umdrehte, erblickte ich den jungen Stamford, der während meines Medizinstudiums am Bart’s mein Operationsassistent gewesen war. Für jemanden, der einsam durch die Wildnis Londons irrt, kann der Anblick eines vertrauten Gesichtes sehr tröstlich sein. Stamford und ich waren zwar keine engen Freunde gewesen, doch ich begrüßte ihn herzlich, und auch er freute sich über das Wiedersehen. In meinem Überschwang lud ich ihn zu einem Mittagessen ins Holborn ein, und wir fuhren gemeinsam mit einer Droschke dorthin.
»Was zur Hölle hast du angestellt, Watson?«, fragte er mit unverhülltem Erstaunen, während wir durch die verstopften Londoner Straßen rumpelten. »Du bist nur noch ein Strich in der Landschaft und außerdem so braun wie eine Haselnuss.«
Ich fasste meine Abenteuer in aller Kürze für ihn zusammen und war kaum an das Ende gelangt, da hatten wir unser Ziel schon erreicht.
»Armer Teufel!«, sagte er voller Mitleid, nachdem er meiner Unglücksgeschichte gelauscht hatte. »Und was hast du jetzt vor?«
»Jetzt suche ich nach einer Bleibe«, antwortete ich, »und kann nur hoffen, dass ich eine Wohnung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis finde.«
»Sonderbar«, erwiderte mein Begleiter, »diese Formulierung höre ich heute zum zweiten Mal.«
»Wer hat sie zum ersten Mal benutzt?«, fragte ich.
»Ein Mitarbeiter im Chemielabor des Krankenhauses. Er hat sich heute Morgen darüber beklagt, niemanden finden zu können, der sich die Räumlichkeiten mit ihm teilt, die er gern mieten würde, aber nicht allein bezahlen kann.«
»Unglaublich!«, rief ich. »Wenn er wirklich jemanden sucht, der Wohnung und Miete mit ihm teilt, dann bin ich der Richtige. Ich bin viel zu oft allein und hätte gern etwas Gesellschaft.«
Der junge Stamford sah mich über sein Weinglas skeptisch an. »Du kennst Sherlock Holmes noch nicht«, sagte er. »Gut möglich, dass du überhaupt keinen Wert auf seine ständige Gesellschaft legst.«
»Warum? Was ist gegen ihn einzuwenden?«
»Oh, ich habe nicht behauptet, dass es Einwände gibt. Er hat allerdings ein paar fixe Ideen – betätigt sich mit Begeisterung in unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Bereichen. Nach allem, was ich weiß, ist er ganz in Ordnung.«
»Er studiert also Medizin?«, fragte ich.
»Nein, und ich habe keine Ahnung, welche Richtung er einschlagen will. Er scheint sehr gut in Anatomie zu sein, und ein erstklassiger Chemiker ist er auch. Ich bezweifele, dass er jemals systematisch Medizin studiert hat. Seine Studien sind unstrukturiert und exzentrisch, aber das Wissen, das er sich angeeignet hat, ist ebenso umfassend wie entlegen und würde seine Professoren sicher in Erstaunen versetzen.«
»Du hast dich nie erkundigt, ob er sich spezialisieren will?«, fragte ich.
»Nein. Er ist ein verschlossener Typ. Wenn ihm danach ist, kann er allerdings auch sehr redselig sein.«
»Ich würde ihn gern kennenlernen«, sagte ich. »Wenn ich schon mit jemandem zusammenwohnen muss, dann am liebsten mit einer ruhigen und lernhungrigen Person. Ich bin immer noch ziemlich schwach und vertrage deshalb nicht viel Krach oder Aufregung. Beides habe ich in Afghanistan in einem solchen Ausmaß erlebt, dass es für mein restliches Leben reicht. Wo kann ich deinen Freund kennenlernen?«
»Er dürfte im Labor sein«, antwortete Stamford. »Entweder meidet er den Ort über Wochen oder er arbeitet dort von früh bis spät. Wenn du möchtest, können wir nach dem Essen hinfahren.«
»Sehr gern«, erwiderte ich, und danach wandten wir uns anderen Gesprächsthemen zu.
Auf dem Weg vom Holborn zum Krankenhaus versorgte mich Stamford mit weiteren Informationen über den Gentleman, mit dem ich vielleicht bald eine Wohnung teilen würde.
»Solltest du nicht mit ihm klarkommen, dann schieb nicht mir die Schuld in die Schuhe«, sagte er. »Was ich über ihn weiß, habe ich während der gelegentlichen Begegnungen im Labor erfahren. Es war deine Idee, mit ihm zusammenzuziehen. Du darfst mich also nicht verantwortlich machen.«
»Wenn wir uns nicht vertragen, lässt sich die Wohngemeinschaft sicher problemlos auflösen«, erwiderte ich. »Irgendetwas sagt mir allerdings«, fügte ich hinzu und sah meinen Begleiter scharf an, »dass du dich nicht grundlos aus der Verantwortung zu stehlen versuchst, Stamford. Liegt es vielleicht daran, dass der Mann sehr launisch ist? Mach mir nichts vor.«
»Das Unsagbare in Worte zu fassen ist nicht ganz einfach«, antwortete er lachend. »Ich finde, dass Holmes eine etwas zu wissenschaftliche Art hat – sie grenzt schon an Kaltblütigkeit. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er einem Freund heimlich das neueste pflanzliche Alkaloid verabreicht, natürlich nicht aus Bosheit, sondern weil er die genaue Wirkung der Substanz erforschen will. Zu seiner Ehrenrettung muss ich aber hinzufügen, dass er wahrscheinlich ebenso bedenkenlos einen Selbstversuch unternehmen würde. Seine Leidenschaft scheint exaktem und nachprüfbarem Wissen zu gelten.«
»Und das zu Recht.«
»Ja, aber man kann es auch übertreiben. Wenn eine solche Haltung dazu führt, dass man die Leichen in den Seziersälen mit Stockschlägen traktiert, wird die Sache jedenfalls ziemlich bizarr.«
»Er verprügelt Leichen?«
»Um herauszufinden, ob es möglich ist, nach dem Eintritt des Todes Schlagmale hervorzurufen.«
»Obwohl er angeblich kein Medizinstudent ist?«
»Richtig. Ich habe keinen blassen Schimmer, welchem Zweck seine Forschungen dienen. Aber wir sind am Ziel. Du musst dir jetzt eine eigene Meinung bilden.« Während er dies sagte, bogen wir in eine schmale Gasse ein und betraten einen Flügel des großen Krankenhauses durch einen Seiteneingang. Ich musste nicht geführt werden, als wir die kahle Steintreppe hinaufgingen und dann einem langen Flur mit weißgetünchten Wänden und graubraunen Türen folgten, denn das Gebäude war mir vertraut. Hinten im Flur zweigte ein Bogengang ab, der zum Chemielabor führte.
Dieses befand sich in einem hohen Raum. Zahllose Glasgefäße säumten die Wände und standen überall herum. Desgleichen breite und niedrige Tische voller Petrischalen, Reagenzgläser und kleiner Bunsenbrenner mit blauen, flackernden Flammen. In diesem Raum hielt sich nur ein einziger Student auf, der sich, in seine Arbeit vertieft, ganz hinten über einen Tisch beugte. Als er unsere Schritte hörte, schaute er sich um und sprang dann mit einem Freudenschrei auf. »Ich habe es! Ich habe es!«, rief er meinem Begleiter zu und rannte mit einem Reagenzglas in der Hand auf uns zu. »Ich habe ein Reagens entdeckt, das ausschließlich durch Hämoglobin ausfällt.« Die Begeisterung, die aus seinen Zügen sprach, hätte selbst dann nicht größer sein können, wenn er auf eine Goldader gestoßen wäre.
Stamford stellte uns einander vor: »Dr. Watson. Mr Sherlock Holmes.«
»Freut mich sehr«, sagte er herzlich und drückte meine Hand mit einer Kraft, die ich ihm auf den ersten Blick nicht zugetraut hätte. »Wie ich feststelle, waren Sie in Afghanistan.«
»Woher wissen Sie das, Teufel nochmal?«, fragte ich verblüfft.
»Egal«, sagte er und lachte leise in sich hinein. »Wichtig ist jetzt nur die Sache mit dem Hämoglobin. Ich nehme an, dass Sie die Bedeutung meiner Entdeckung erkennen?«
»Chemisch gesehen ist sie sicher interessant«, antwortete ich, »aber in praktischer Hinsicht …«
»Sind Sie blind, Mann? Es handelt sich um die praxistauglichste medizinisch-kriminalistische Entdeckung seit Jahren. Kapieren Sie nicht, dass man mit dieser Methode Blutflecken unfehlbar nachweisen kann? Kommen Sie!« Er packte mich in seinem Eifer bei einem Mantelärmel und zerrte mich zu dem Tisch, an dem er gearbeitet hatte. »Zuerst zapfen wir etwas frisches Blut«, sagte er, stieß sich eine lange Nadel in den Finger und fing den herausquellenden Blutstropfen mit einer Pipette auf. »Jetzt löse ich das Blut in einem Liter Wasser auf. Wie Sie sehen, erweckt die so entstandene Mischung den Anschein reinen Wassers. Der Anteil des Blutes darin dürfte sich auf ein Millionstel belaufen. Trotzdem bin ich mir sicher, dass wir die typische Reaktion erhalten werden.« Während er dies sagte, warf er einige weiße Kristalle in das Gefäß und fügte dann mehrere Tropfen einer farblosen Flüssigkeit hinzu. Das Wasser nahm sofort einen matten Mahagoniton an, auf dem Boden des Glasgefäßes setzten sich bräunliche Partikel ab.
»Ha! Ha!«, rief er, klatschte in die Hände und freute sich wie ein Schneekönig. »Was halten Sie davon?«
»Scheint ein sehr sensibler Test zu sein«, bemerkte ich.
»Großartig! Umwerfend! Der alte Guaiacum-Test war nicht nur umständlich, sondern auch ungenau. Ebenso die Suche nach Blutkörperchen unter dem Mikroskop, das sowieso nichts mehr taugt, wenn die Flecken einige Stunden alt sind. Diese Methode scheint im Gegensatz dazu sowohl bei frischem als auch bei altem Blut zu funktionieren. Hunderte von Tätern, die immer noch frei herumlaufen, würden längst für ihre Verbrechen büßen, wenn dieser Test schon früher erfunden worden wäre.«
»Stimmt!«, murmelte ich.
»Ermittlungen stocken immer wieder an diesem einen Punkt. Man verdächtigt jemanden eines Verbrechens, das vielleicht schon Monate zuvor begangen wurde. Man untersucht seine Bettwäsche oder seine Kleider und entdeckt darauf bräunliche Flecken. Handelt es sich um Blutspuren, Schlammspritzer oder Rostflecken, ist es Obstsaft oder etwas anderes? Zahllose Experten haben sich über dieser Frage den Kopf zerbrochen, und warum? Weil es keinen zuverlässigen Test gab. Aber mit der neuen Sherlock Holmes-Methode steht der genauen Ermittlung nichts mehr im Weg.«
Während dieser Worte funkelten seine Augen, und er legte sich eine Hand auf das Herz und verneigte sich, als hätte er ein applaudierendes Publikum vor sich.
»Ich gratuliere Ihnen«, sagte ich, wunderte mich aber zugleich über seine Begeisterung.
»Vor einem Jahr gab es in Frankfurt den Fall eines Herrn von Bischoff. Hätte man diesen Test damals gekannt, dann wäre der Mann mit Sicherheit gehängt worden. Außerdem war da Mason in Bradford sowie der berüchtigte Muller, Lefevre in Montpellier und Samson in New Orleans. Ich könnte Dutzende von Fällen aufzählen, bei denen diese Methode entscheidend gewesen wäre.«
»Sie sind ja ein wandelnder Katalog der Kriminalfälle«, sagte Stamford lachend. »Zu diesem Thema könnten Sie glatt eine Zeitschrift gründen, vielleicht mit dem Titel ›Alte Hüte aus dem Polizeiarchiv‹.«
»Wäre sicher eine fesselnde Lektüre«, erwiderte Sherlock Holmes, der ein kleines Pflaster auf den angestochenen Finger klebte. »Ich muss aufpassen«, fuhr er fort und drehte sich lächelnd zu mir um, »denn ich experimentiere ziemlich oft mit Giften.« Während er sprach, streckte er eine Hand aus, und mir fiel auf, dass sie über und über von ähnlichen Pflastern bedeckt und durch starke Säuren verfärbt war.
»Wir sind aus geschäftlichen Gründen hier«, sagte Stamford, der sich auf einen hohen, dreibeinigen Hocker setzte und einen anderen mit dem Fuß in meine Richtung schob. »Mein Freund sucht eine neue Bleibe, und da Sie darüber klagten, niemanden finden zu können, der sich eine Wohnung mit Ihnen teilt, kam ich auf die Idee, Sie einander vorzustellen.«
Der Gedanke, mit mir zusammenzuwohnen, schien Sherlock Holmes zu gefallen. »Ich habe eine Wohnung in der Baker Street ins Auge gefasst«, sagte er, »die wie geschaffen für uns wäre. Ich hoffe, Sie haben nichts gegen den Geruch starken Tabaks einzuwenden?«
»Ich rauche die Marke ›Ship’s‹«, antwortete ich.
»Na, bestens. Bei mir stehen oft Chemikalien herum, und ich führe manchmal Experimente durch. Würde Sie das stören?«
»Aber nein.«
»Lassen Sie mich nachdenken – habe ich noch andere Macken? Ich bin ab und zu schlecht drauf, dann spreche ich tagelang kein Wort. Wenn das passiert, dürfen Sie nicht denken, dass ich Ihnen grolle. Lassen Sie mich einfach in Ruhe, es renkt sich bald wieder ein. Und was haben Sie zu beichten? Bevor sich zwei Menschen eine Wohnung teilen, sollten sie wohl über die Schattenseiten des jeweils anderen im Bilde sein.«
Ich lachte über dieses Kreuzverhör. »Ich halte einen Welpen, einen Bullterrier«, sagte ich, »und ich vermeide Streit, weil mein Nervenkostüm angeschlagen ist. Ich stehe zu ziemlich unchristlichen Stunden auf und bin sehr faul. Wenn ich fit bin, kommen weitere Laster hinzu, aber das dürften im Moment die wichtigsten sein.«
»Fällt Geigenspiel auch unter Streit?«, fragte er besorgt.
»Kommt auf den Musiker an«, antwortete ich. »Gekonntes Spiel ist ein Ohrenschmaus, aber schlechtes Spiel …«
»Dann ist ja alles klar«, rief er lachend. »Damit ist die Sache geritzt – vorausgesetzt, die Zimmer gefallen Ihnen.«
»Wann können wir sie besichtigen?«
»Holen Sie mich morgen gegen Mittag hier ab, dann gehen wir gemeinsam hin und regeln alles«, antwortete er.
»Einverstanden – Punkt zwölf Uhr«, sagte ich und schüttelte seine Hand.
Wir überließen ihn seinen Chemikalien und machten uns auf den Weg zu meinem Hotel.
»Ach, übrigens«, sagte ich, blieb unvermittelt stehen und sah Stamford an, »wie zur Hölle konnte er wissen, dass ich kürzlich aus Afghanistan zurückgekehrt bin?«
Mein Begleiter schenkte mir ein rätselhaftes Lächeln. »Das ist seine kleine Eigenart«, sagte er. »Es gibt jede Menge Leute, die gern wüssten, wie er zu seinen Erkenntnissen gelangt.«
»Aha! Ein Geheimnis?«, rief ich und rieb meine Hände. »Sehr reizvoll. Ich finde es wunderbar, dass du uns zusammengeführt hast, denn: Der Mensch ist dem Menschen das Interessanteste.«
»Dann knöpf dir den Mann mal vor«, sagte Stamford, als er sich von mir verabschiedete. »Er wird sich allerdings als harte Nuss erweisen. Ich schätze, dass er mehr über dich herausfindet als du über ihn. Mach’s gut.«
»Auf Wiedersehen«, antwortete ich und schlenderte zum Hotel, voller Neugier auf meinen neuen Bekannten.
ZweiDie Wissenschaft der Schlussfolgerung
Wir trafen uns wie verabredet in der Baker Street, um die Wohnung im Haus Nr. 221B zu besichtigen, die Sherlock Holmes am Vortag erwähnt hatte. Sie bestand aus zwei Schlafzimmern und einem geräumigen, gut zu lüftenden, freundlich möblierten Wohnzimmer, das durch zwei breite Fenster Licht erhielt. Die Zimmer waren so ansprechend, die geteilten Kosten so überschaubar, dass wir an Ort und Stelle Nägel mit Köpfen machten und die Wohnung mieteten. Ich holte noch am gleichen Abend meine Habseligkeiten aus dem Hotel, und am nächsten Morgen folgte Sherlock Holmes mit mehreren Kisten und Koffern. Wir waren ein paar Tage mit dem Auspacken und Einsortieren unserer Sachen beschäftigt, kamen danach langsam zur Ruhe und begannen, uns an die neue Umgebung zu gewöhnen.
Holmes war kein schwieriger Mitbewohner, sondern ein stiller Typ mit festen Gewohnheiten. Er ging gegen zweiundzwanzig Uhr zu Bett, und wenn ich morgens aus den Federn kam, hatte er bereits gefrühstückt und das Haus verlassen. Manchmal verbrachte er den Tag im Chemielabor, manchmal im Seziersaal, und manchmal unternahm er lange Spaziergänge, die ihn in die ärmsten Stadtviertel zu führen schienen. Wenn er von der Arbeitswut gepackt wurde, entwickelte er eine fast beängstigende Energie, aber in Abständen erfolgte eine Gegenreaktion, dann lag er tagelang auf dem Sofa im Wohnzimmer, sprach von morgens bis abends kein Wort, rührte auch keinen Muskel. Während dieser Phasen bemerkte ich in seinen Augen einen so leeren, träumerischen Blick, dass ich geneigt war, ihn der Sucht nach einem Rauschmittel zu verdächtigen, aber in Anbetracht seines maßvollen und geordneten Lebenswandels verbot sich diese Spekulation von selbst.
Im Laufe der Wochen vertieften und intensivierten sich mein Interesse an seiner Person und meine Neugier im Hinblick auf seine Lebensziele immer mehr. Zufälligen Betrachtern musste er schon durch Gestalt und Erscheinungsbild auffallen. Er war über einen Meter achtzig groß, aber so unfassbar mager, dass er noch viel größer wirkte. Sein Blick war scharf und durchdringend, ausgenommen während der bereits erwähnten phasenweisen Trägheit. Seine schmale Adlernase sorgte für eine Aura der Wachsamkeit und Entschlossenheit. Obwohl seine Hände stets von Tintenflecken und Chemikalienspuren übersät waren, besaß er ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl, wie ich beobachten konnte, wenn er mit seinen empfindlichen feinmechanischen Instrumenten hantierte.
Sie werden mich sicher für eine Schnüffelnase halten, wenn ich gestehe, dass dieser Mann eine fast unerträgliche Neugier in mir weckte. Ich versuchte immer wieder, die Verschlossenheit zu durchbrechen, die er in allen persönlichen Angelegenheiten an den Tag legte. Bevor ich ihn beurteile, muss ich allerdings erwähnen, dass ich damals nicht nur mehr oder weniger ziellos dahinvegetierte, sondern dass es so gut wie nichts gab, was meine Aufmerksamkeit gefesselt hätte. Aufgrund meines Gesundheitszustandes konnte ich mich nur bei ungewöhnlich gutem Wetter ins Freie wagen, und ich hatte keine Freunde, die die Eintönigkeit meines Alltags durch Besuche aufgelockert hätten. Aus diesen Gründen beschäftigte ich mich geradezu besessen mit dem kleinen Geheimnis, das meinen Mitbewohner umgab, und verbrachte einen Großteil meiner Zeit mit dem Versuch, es zu enträtseln.
Medizin studierte er nicht. Er hatte die Meinung Stamfords in diesem Punkt auf meine Frage hin selbst bestätigt. Er hatte sich auch für kein anderes Fach eingeschrieben, das zu einem naturwissenschaftlichen Abschluss geführt oder ihm einen allgemein anerkannten Weg in den Wissenschaftsbetrieb eröffnet hätte. Trotzdem hegte er eine Leidenschaft für bestimmte Fachgebiete, und innerhalb der eigenwilligen Grenzen, die er sich setzte, war sein Wissen so außerordentlich tief und breit, dass mich seine Erkenntnisse immer wieder in Erstaunen versetzten. Jemand, der so hart arbeitete und sich ein so detailgenaues Wissen aneignete, musste ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, anders konnte es nicht sein. Planlose Leser zeichnen sich nicht durch eine umfassende Bildung aus. Wer seinen Verstand mit so vielen Details füttert, muss gute Gründe dafür haben.
Seine Unwissenheit war genauso bemerkenswert wie seine Wissensfülle. Er schien kaum Kenntnisse über zeitgenössische Literatur und Philosophie oder aktuelle Politik zu haben. Als ich Thomas Carlyle zitierte, erkundigte er sich mit großer Naivität danach, wer das sei und was er so getrieben habe. Mein Erstaunen erreichte allerdings einen Höhepunkt, als ich durch Zufall herausfand, dass er keine Ahnung von der kopernikanischen Theorie und der Struktur des Sonnensystems hatte. Die Tatsache, dass ein zivilisiertes menschliches Wesen des 19. Jahrhunderts nicht wusste, dass sich die Erde um die Sonne dreht, fand ich ungeheuerlich, ja geradezu unfassbar.
»Sie wirken erstaunt«, sagte er und musste lächeln, weil mir der Mund offenstand. »Und nun, da ich es weiß, werde ich versuchen, es so rasch wie möglich wieder zu vergessen.«
»Sie wollen es vergessen?«
»Wissen Sie«, erklärte er, »das menschliche Gehirn gleicht einem Dachboden, auf dem man nur ausgesuchte Möbel lagern darf. Wer dort jeden Krempel abstellt, den er findet, ist ein Dummkopf, weil das nützliche Wissen unter all den Dingen begraben, im besten Falle so tief zwischen ihnen versteckt werden würde, dass man es nur mit großer Mühe ausfindig machen könnte. Der kluge Arbeiter achtet genau darauf, was er auf seinem Gehirn-Dachboden abstellt. Er lagert dort nur Werkzeuge, die für seine Arbeit nützlich sind, diese aber in großer Auswahl und makelloser Ordnung. Der Glaube, dass dieser kleine Raum elastische Wände hätte und beliebig weit ausgedehnt werden könnte, ist ein Irrtum. Nachdem man einen bestimmten Punkt überschritten hat, führt jedes neue Wissen dazu, dass anderes in Vergessenheit gerät. Man muss also unbedingt dafür sorgen, dass die nützlichen Fakten nicht von den nutzlosen verdrängt werden.«
»Aber das Sonnensystem!«, wandte ich ein.
»Was zum Teufel nützt mir das?«, unterbrach er mich ungeduldig. »Sie sagen, dass die Erde um die Sonne kreist. Aber selbst wenn sie den Mond umkreisen würde, hätte dies weder für mich noch für meine Arbeit auch nur den Hauch einer Bedeutung.«





























