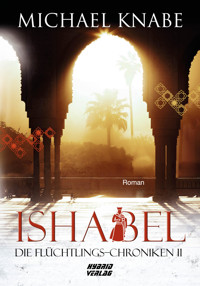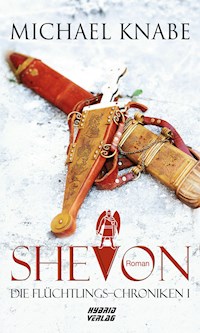
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hybrid Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Regul beugte sich vor, bis sein Gesicht nur eine Handbreit von Shevons entfernt war. Sein Lächeln grenzte an Koketterie. „Ich werde dir jeden einzelnen Tag zur Hölle machen.“ Binnen weniger Tage bricht Shevons privilegiertes Leben in sich zusammen. Seine Heimatstadt wird zerstört und seine Familie ermordet. Auch ein ehemaliger Ziehbruder hat noch eine Rechnung offen und plant, ihn zu töten. Will Shevon der Rache entkommen, muss er sich seinem Todfeind stellen– und einer alten Schuld.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HYBRID VERLAG
Vollständige Ebookausgabe
10/2019
© by Michael Knabe
© by Hybrid Verlag, Homburg
Umschlaggestaltung: © Andrea Gunschera; magi digitalis | media production; www.magi-digitalis.de
Lektorat: Donatha Czichy, Tatjana Reiber
Korrektorat: Nola Reiber
Buchsatz: Sylvia Kaml
Autorenfoto: alex:jung fotografie, Emmendingen
Coverbild ›Das Geheimnis von Talmi’il‹
© 2019 Creativ Work Design; artwork by Mika Jänisen
Coverbild ›Weltenwacht‹
© by Creativ Work Design, Homburg
ISBN 978-3-946-82098-7
www.hybridverlag.de
Michael Knabe
Shevon
Fantasy
für Kirsten und Felix
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil – Die Hauptstadt
Drohung
Reguls Ankunft
Gamons Entdeckung
Frosch
Schuld
Talyon
Gamons Weg
Dala
Flucht
Lirana
Der Berg
Kampf
Mord
Zweiter Teil – Das Landgut
Flucht aus Raydur
Bootsfahrt
Überfahrt
Balancieren
Zwist
Wettstreit
Versteck
Shusan
Tote
Kampf
Flucht aus Culish
Verführung
Gamon
Dritter Teil – Im Feindesland
Wiedersehen
Wendung
Meron
Liranas Leiden
Abschied von Dala
Hochzeit
Anschlag
Sklave
Liranas Besuch
Gamons Nachricht
Nuridor
Reguls Rache
Flucht
Reise
Liste der Personen
Danksagung
DER AUTOR
Erster Teil – Die Hauptstadt
Drohung
Shevon al Yontar schob sich durch das Gewimmel der Großen Tempelstraße. Pilger zerquetschten die Falten seiner Toga, bis nur eine chaotische Knitterlandschaft übrigblieb. Ein Fremder schmiegte sich geradezu an ihn. Shevon fluchte und stieß den Mann von sich, bevor dieser nach seinem Geld angeln konnte. Warum hatte ihm sein Vater auch keine Wachen mitgegeben!
Sklaven, Lastenträger, Sendboten, Straßenverkäufer, Bettler, Stadtwachen und unzählige Besucher des Frühlingsfestes drängelten sich zwischen den Mauern, die zu beiden Seiten die Große Tempelstraße begrenzten. Morgen, wenn das Fest wirklich begann, würde es überhaupt kein Durchkommen mehr geben. Der Gestank der Opferfeuer zog vom Tempel herab und hing wie eine erstickende Decke über dem Senatorenviertel.
Der Finstere Fährmann sollte die Pilger holen! Sie schissen in die Gosse, prügelten sich in den Tavernen und schliefen auf den Straßen ihren Rausch aus. In diesen Tagen stand immer die doppelte Anzahl Wachen vor den Mauern der al Yontars, damit der Pöbel nicht das Anwesen stürmte.
Vater schien das nicht zu stören. Er hätte die Festtage in seiner Sommerresidenz am Meer verbringen können oder in der Jagdhütte oben in den Bergen. Stattdessen verschanzte er sich hinter den Mauern seiner Stadtvilla und schickte seinen Sohn allein ins Getümmel, um Klienten vor Gericht zu vertreten.
Sollte er doch denken, dass er die Menschen um sich herum vollständig im Griff hatte. Eines Tages würde Shevon das alles hier hinter sich lassen.
Sein großer Traum. Sein heimlichster Wunsch. All die Ränke der Patrizier ignorieren und einfach in die Welt hinausziehen. Er würde die bunten Ziegel des sabinoischen Königspalastes in der Sonne glänzen sehen, endlich wieder einmal die freien Königreiche besuchen und vielleicht sogar den Basar von Chean-Al weit hinter den östlichsten Provinzen der Republik.
Nichts als Träume. Solange Vater lebte, musste Shevon folgen, wo auch immer ihn sein Vater hinbefahl. Vorletztes Jahr war er nach Falun abkommandiert worden, Cadrons neuester Eroberung im Namen Levanons. Dort hatte es in einem Jahr mehr geregnet als auf Levanon in seinem ganzen Leben. Reisen auf Vaters Befehl oder in Raydur alt und grau werden – so sahen die Alternativen aus. Die Toga der Senatoren, die in ein paar Jahren auf ihn wartete, wirkte in Momenten wie diesem eher wie das Gewand eines Sträflings, der für den Rest seines Lebens in die Steinbrüche geschickt wurde.
Shevon stieß einen Straßenverkäufer von sich, der ihm mit einem Becher heiligen Wassers vor dem Gesicht wedelte. Eine bräunliche, von Flussschlamm durchsetzte Brühe ergoss sich über seine Toga.
Aufdringliches Gesindel! Gleich konnte er Lärm und Gestank endlich hinter sich lassen und den Erzählungen Meron al Andres lauschen. Der Freund der Familie lebte seit Jahren in Sabinon und hatte immer etwas aus dem Land des Erzfeindes zu berichten. Nicht einmal Vater konnte verhindern, dass Shevon dann in Gedanken nach Sabinon reiste. Keine hundert Schritte mehr bis nach Hause.
Shevon kniff die Augen zusammen. Irgendetwas da vorne stimmte nicht.
Eine Abteilung Bewaffneter kam vom Tempel herab und machte vor Vaters Villa Halt. Empfing er einen weiteren Besucher?
Nein, das waren nicht die üblichen zwei, drei Leibwächter, wie sie jeder Senator in diesen Tagen um sich scharte, sondern mindestens dreißig Männer in der Ausrüstung und Bewaffnung der Legionen. Sie formierten sich Rücken an Rücken zu einer doppelten Mauer aus Stahl. Pilger drängten sich in respektvollem Abstand vorbei.
Ein ungutes Gefühl machte sich in Shevons Magengrube breit.
Er beschleunigte seine Schritte. Wer versuchte da die al Yontars zu provozieren? Sein Vater war einer der mächtigsten Männer der Republik. Niemand behelligte ihn oder seine Familie ungestraft.
Niemand außer ...
Er vermied es, den Gedanken zu Ende zu denken.
Die Soldaten ließen eine Lücke für ihren Herrn frei. Er studierte das Tor der al Yontars und ließ Shevon Zeit, die Wachen einzuschätzen. Kräftige Burschen waren das, mit finsterem Blick, die aussahen wie aus den Hafenkneipen von Gurud im Süden. Sie bestätigten Shevons schlimmste Befürchtung: Al-Gired-Söldner.
Der Feind seines Vaters war zurück.
Mit klopfendem Herzen betrat Shevon den freien Raum zwischen Passanten und Soldaten. Die Leute blieben stehen und stemmten sich gegen den übrigen Pöbel, der von hinten schob. Ein bewaffneter Konflikt auf der Hauptstraße versprach gute Unterhaltung.
Shevon setzte eine gelangweilte Miene auf. »Ich weiß, wir haben ein wunderschönes Tor. Seine zweitwichtigste Funktion ist es übrigens, die Bewohner durchzulassen. Wenn Ihr so freundlich wärt?«
Keiner von ihnen rührte sich. Shevon unterdrückte den Impuls, den Schweiß von der Stirn zu wischen.
Zweiter Versuch. »Lasst mich durch, oder muss erst die Wache meines Vaters euch beibringen, wie man sich in der Hauptstadt angemessen verhält?«
Noch immer rührte sich keiner der Soldaten, aber hinter ihnen reckte sich Gabul, der Hauptmann der Familiengarde. »Herr, lässt Euch dieser Abschaum nicht durch?«
»Es sieht ganz danach aus. Sie müssen etwas an den Ohren haben. Sag mal, können diese Gurud-Fischer überhaupt Levanisch?«
»Wer weiß? Aber das haben wir gleich.« Ein Wink des Hauptmanns und sein Läufer verschwand durchs Tor.
Gebrüllte Befehle und das Trappeln vieler Füße klangen heraus. Mehr und mehr Wachen strömten durch das Tor.
Aber was sollte Gabul schon tun?
Die Belagerung mit Stahl durchbrechen?
Ein Blutbad am Vorabend des Frühlingsfestes, auf der Straße zum Tempel würde der Senat nicht einmal Vater durchgehen lassen. Gabul müsste seine Wachen verdoppeln, nach dem Senator rufen lassen und abwarten.
Vielleicht spekulierte der Herausforderer sogar genau darauf. Kein ungeschickter Spielzug: Entweder machten sich die al Yontars unmöglich, oder sie wirkten schwach.
Endlich kam Bewegung in den Anführer der Belagerer, der die ganze Zeit reglos auf das Tor gestarrt hatte. So langsam wie die Flügel eines Burgtors drehte er sich um und musterte Shevon, dem sich der Magen zusammenkrampfte.
Vor ihm stand der größte Feind der Republik.
Nuridor al Gireds Haupthaar hatte in den Jahren seiner Verbannung den Kampf gegen die Stirnglatze verloren. Sein Schädel sah aus wie ein Dreieck, das man auf die Spitze gestellt hatte. Er wirkte zu groß für das verkniffene Gesicht, das schief daran befestigt schien. Das einzig Lebendige in Nuridors Gesicht waren die Augen, die Shevon voller Verachtung musterten.
»Cadrons Küken. Unverkennbar aus dem gleichen Stall.« Nuridors lederartige Augenlider erinnerten an eine Schildkröte. »Der sieht nicht aus, als ob er Schwierigkeiten machen kann.« Und zu seinem Hauptmann, der neben ihm wartete: »Ist der Läufer aus dem Tempel zurück?«
»Wir erwarten ihn jeden ... Da kommt er, Herr.«
Ein Soldat in Helm, Armeetunika und Rüstung kam die Tempelstraße herabgelaufen. Sein Mantel wehte hinter ihm her. Wer nicht schnell genug auswich, wurde von seinem Brustpanzer aus dem Weg gestoßen.
Als er vor Nuridor salutierte, lief dem Soldaten Schweiß übers Gesicht. War er den ganzen Weg vom Tempel herab gerannt?
»Welche Neuigkeiten bringst du?« Nuridors Gesicht blieb unbewegt.
»Botschaft von unserem Kontakt, Herr. Die Zeichen sind eindeutig. Wir sollen noch heute aufbrechen.«
Eine nachlässige Handbewegung Nuridors schickte ihn zurück ins Glied.
Shevons Wut gewann Oberhand über seine Furcht. »Kaum aus der Verbannung zurück und schon auf Ärger aus! Soll ich dir schon einmal eine nette Insel aussuchen für die nächste Verbannung? Oder brauchst du auch ein Plätzchen für deinen Kontakt?« Er äffte den Tonfall des Boten nach.
Nuridor beobachtete ihn wortlos, aber in seinen Mundwinkeln zuckte es. Die Soldaten zu seiner Seite legten wie ein Mann die Hand ans Heft des Kurzschwertes. Das uniforme Knallen ihrer Armreifen auf den Eisenspangen der Rüstung klang, als ob eine gut geölte Apparatur bedient wurde. Eine Mordmaschine.
Sie würden doch nicht ...? Unwillkürlich trat Shevon einen Schritt zurück. Ein Passant rempelte ihn an und ließ ihn auf würdelose Weise stolpern.
Nuridor beobachtete reglos die kleine Szene und überließ es seinen Soldaten, ihn vor den Wachen der al Yontars abzuschirmen, die aus dem Tor strömten. Wie erwartet, standen die Männer seines Vaters hilflos da. Shevon war allein. Verdammt, wo blieb sein Vater?
Nuridors Blick glitt an ihm herab. »Reden können sie wie die Waschweiber, die al Yontars, und sonst nichts. Ein Frosch gebiert eben immer nur den nächsten Frosch.«
Shevon schnappte innerlich nach Luft. Wusste Nuridor, was das Bild für ihn bedeutete?
Er zementierte mühsam ein Lächeln auf sein Gesicht. »Du suchst Frösche? Geh drunten im Flussschlamm nach ihnen wühlen, anstatt ehrbare Leute zu belästigen. Und jetzt ...« Er machte einen Schritt auf Nuridor zu und hob die Hand. Instinktiv traten die Söldner, die ihn flankierten, vor ihn und zogen die Waffe. Shevon wand sich mit einer schnellen Drehung durch die Lücke, die ihre Bewegung in der Verteidigungslinie aufgerissen hatte. Das Letzte, was er von Nuridor sah, war dessen hochgezogene Augenbraue, dann schlug das Tor hinter ihm zu und der Lärm der Tempelstraße blieb draußen zurück. Er atmete tief aus. Erst jetzt spürte er die Verkrampfung in Armen und Beinen. Der Vorfall hätte auch anders ausgehen können.
Gabul trat vor ihn und salutierte. Der Hauptmann blickte auf Shevons Sandalen, als sähe er sie zum ersten Mal.
»Herr.« Und nach einer Pause: »Die Wache hat versagt.«
Abwesend winkte Shevon ab. »Unsinn. Was hättest du auch tun sollen? Ein Blutbad anrichten?«
»Aber ...«
»Warum ist mein Vater nicht erschienen? Er hätte Nuridor etwas entgegensetzen können!«
Tiefe Röte überzog das Gesicht des Hauptmanns. »Ich habe ihn rufen lassen, Herr!«
»So? Und was hat der Senator geantwortet?«
»Er wollte seinem Gegner nicht auch noch die Ehre eines Gesprächs gewähren und war überzeugt, dass Ihr Euch allein helfen und die Blockade durchbrechen könnt.«
Der Hauptmann hatte immer leiser gesprochen. Shevon versuchte vergeblich, den Stein in seinem Magen zu ignorieren. Was wäre passiert, wenn Nuridors Soldaten sich nicht so einfach hätten übertölpeln lassen? Hätte Cadron al Yontar dann achselzuckend registriert, dass sein einziger Sohn leider auf dem Straßenpflaster verblutete?
Noch unverständlicher war nur der bizarre Auftritt Nuridors. Das Familienoberhaupt der al Gireds tat nie etwas zum Vergnügen. Wenn er am Frühlingsfest vor der Villa seines Erzfeindes auftauchte, verfolgte er einen Plan. Vielleicht wollte er mit seinem Erscheinen nur Unruhe verbreiten. Oder ...
Achselzuckend wandte Shevon sich ab. Vater würde eine Erklärung haben. Vater hatte immer eine Erklärung.
Aber das ungute Gefühl blieb.
Senator Cadron al Yontar hatte mitten in der quirligen Stadt eine Oase aus Stille und Weite geschaffen. Vor Shevon fiel das Grundstück zum Fluss hin ab. Eine Schar Sklaven reinigte auf Knien die Marmorplatten der Auffahrt, die sich um den Vorgarten zur Villa hinabzog.
Ein Sklave eilte herbei und half ihm aus Toga und Sandalen, ein weiterer brachte eine frische Tunika und eine Schüssel mit Rosenwasser.
»Wo ist mein Vater?«
»Der Herr aus Sabinon ist noch bei ihm, Herr. Soll ich Euch anmelden, Herr?«
»Nein, das ist nicht nötig.«
In einer Tunika, die dezent nach Blüten duftete, betrat Shevon den Kiesweg, der sich durch das Rondell schlängelte. Unermüdlich blubberte und plapperte der Brunnen vor sich hin und füllte den künstlichen Bach, der in seinem Marmorbett auf das Haus zufloss. Zwischen den Villen weiter unten am Hang glitzerte das Band des An Dureth in der Sonne. Auf der anderen Seite des Flusses thronte das Zentrum Raydurs. Die Unwetter der vergangenen Tage hatten die Luft so rein gewaschen, dass die Kuppeln des Senats und des Gerichts zum Greifen nahe schienen. Gegen den heiligen Berg Bal Sharman dahinter wirkten sie wie Kinderspielzeug. Die gigantische Scherbe aus Stein beherrschte das Seitental hinter Raydur und ließ die übrigen Gipfel der Balin Giôrad zu Zwergen schrumpfen. Sie sah aus, als hätte ein urzeitlicher Gott das Gebirge mit einem Steinmesser zerteilt und dann sein Werkzeug einfach stecken lassen. Wie der Zeiger einer riesigen Sonnenuhr wanderte ihr Schatten langsam über Raydur.
Seine Heimat. Die schönste Stadt der Welt – und sein Gefängnis, das ihn mit unsichtbaren Fesseln band.
Er warf einen Blick auf die Sonnenuhr, die sein Vater letztes Jahr hatte anfertigen lassen. Das erigierte Glied des Tanzenden Gottes zeigte die Stunde vor dem Mittag an.
Bei Sonnenaufgang war die Welt noch in Ordnung gewesen. Jetzt hing Nuridors Blick wie ein dunkler Schatten über der Stadt.
~
»... und kaum ist er wieder da, plant er den nächsten Krieg gegen Sabinon!« Meron al Andres Faust hieb auf das Polster seiner Liege.
Shevons Vater hob den Blick nicht von dem Dokument vor sich. »Er plant nicht nur, er bereitet ihn längst vor. In seinen Werften herrscht nicht einmal an den Feiertagen Ruhe. Aber solange ich Zensor bin, wird der Senat einem Staatsverräter nicht einen Goldlevany für seine Legion auszahlen!« Und in Shevons Richtung: »Du bist spät.«
Das war alles? Vater ließ ihn allein gegen die Soldaten eines Staatsverräters antreten und beschwerte sich dann, dass er zu spät kam? Sprachlos stand Shevon da.
»Was ist passiert?« Merons Wanst hing über den Rand der Liege wie Sauerteig, der aus der Schüssel gequollen war, doch seine Augen musterten Shevon aufmerksam. »Ist dir der Finstere Fährmann begegnet?« Sein Akzent hatte sich in den letzten Jahren verstärkt. Mittlerweile klang er fast wie ein Sabinoy, der versuchte, Levanisch zu sprechen.
»Der Finstere Fährmann? Er stand vor dem Tor und starrte es an, als ob er unsere Villa kaufen wollte.« Hätte er sich doch nur so souverän gefühlt, wie er vorgab. Seine Stimme drohte zu kippen und noch immer fühlten sich seine Beine an wie nasses Leder.
Immerhin: Der Senator blickte von seinem Schriftstück auf und begutachtete ihn. »Fängst du jetzt an, Gespenster zu sehen?«
»Nur Soldaten und Staatsverräter. Und die hilflose Truppe meines Vaters, der es nicht gelang, mir Zugang zu verschaffen.«
Der Senator runzelte die Stirn, aber er ignorierte Shevons Anklage. »Was ist mit meinem Klienten?«
»Freispruch, Vater. Genau wie ich vorhergesagt hatte. Aber es war nicht billig. Du musst den Gegner verklagen, um dir das Bestechungsgeld zurückzuholen.«
Senator Cadrons Nicken stellte das Äquivalent eines Lobes dar. »Leg dich zu uns und erzähl, was passiert ist.« Ohne weiteren Kommentar wandte er sich wieder seinem Dokument zu.
Meron fingerte rastlos auf dem Tischchen vor sich hin und her, aber auf den Platten fanden sich nur noch ein paar Olivenkerne. »Lass mich raten, Junge. Du meldest uns den nächsten Angriff auf die al Yontars.«
»Kein Angriff, lediglich die Machtprobe vor unserem Tor.« Shevon schilderte in knappen Worten die Begegnung mit Nuridor.
Meron verfolgte die Erzählung, ohne ihn zu unterbrechen. Am Ende zog er die Brauen hoch. »Jetzt kommt Nuridor schon selbst, um euch zu verhöhnen. Cadron, du solltest diese Geschichte endlich ernst nehmen.«
»Ein paar provokante Worte beweisen gar nichts. Wir sollten ihm in der Öffentlichkeit keine Aufmerksamkeit schenken, bis wir etwas gegen ihn in der Hand haben.« Cadron wies Merons Mahnung mit einer abfälligen Handbewegung von sich, aber die Falten auf seiner Stirn vertieften sich weiter.
Fein, dachte Shevon und schwieg. Hätten die Soldaten ihn in Stücke gehauen, dann hätte Vater wohl endlich etwas gegen Nuridor in der Hand.
Meron ließ sich nicht so leicht abspeisen. »Vor elf Jahren hast du nicht auf mich gehört und es wäre beinahe euer Ende gewesen. Jetzt wird es erst recht ernst. Nuridor ist aus der Verbannung zurück und angriffslustig wie eh und je. Du weißt, wen er als nächstes Ziel auswählen wird.«
»Keiner meiner Spione in seinem Palast hat etwas Verdächtiges beobachtet. Im Gegenteil: Er ist nach Raydur gekommen, um zu beten! Nuridor im Tempel, kannst du dir das vorstellen?«
»Und seine Soldaten vor unserem Tor beten wohl auch alle?«, warf Shevon spöttisch ein.
Meron nickte heftig. »Nuridor betet nicht. Eher macht er aus dem Tempel eine Kaserne. Was ist, wenn er deine Spione längst enttarnt hat und gegen dich einsetzt? Er hatte elf Jahre, um seine Rache vorzubereiten. Du willst einfach nicht wahrhaben, dass der nächste Angriff längst begonnen hat!«
Er mochte sich unbekümmert geben, aber er konnte es nicht verbergen: Meron hatte Angst.
So schnell rissen die Wunden der Vergangenheit wieder auf.
Vor elf Jahren hatte sein Vater sich zum Diktator berufen lassen und Admiral Nuridors Legion in offener Feldschlacht besiegt. Aber anstatt sämtliche al Gireds einen Kopf kürzer zu machen, hatte er Nuridor in die Verbannung geschickt und lediglich seine Anhänger verfolgt. Shevon hatte er auf das Landgut seiner Schwester verfrachtet und es ihm mit fünfzehn Jahren überlassen, mit Nuridors Sohn Regul zurechtzukommen.
Regul. Wie sehr hatte Shevon sich gewünscht, nie wieder an seinen ungleichen Bruder im Geiste zu denken. Mit den ersten Worten hatte Regul ihn damals bedroht und mit den letzten zum Finsteren Fährmann gewünscht. Das verkniffene Gesicht stand ihm vor Augen wie in Stein gemeißelt.
Shevon musterte das Spielbrett auf dem Tisch, um sich von den Erinnerungen abzulenken. Eine halb gespielte Partie Cal-shòn wartete dort auf den nächsten Zug. Doch in der Aufstellung der Angreifer klaffte eine Lücke, groß wie ein Stadttor. Auf der Gegenseite boten sich gleich zwei Möglichkeiten, die Phalanx der Verteidiger zu durchbrechen. Offenbar hatten die beiden Herren über ihrer Diskussion das Spiel vergessen. Shevon schloss mit dem Speerwerfer der Angreifer die Lücke.
Das Cal-shòn-Spiel hatte ihm schon immer geholfen, seine Fassung zurückzugewinnen.
Meron griff eine Figur der Verteidiger und verstärkte die Reihen am Tor der aufgemalten Festung. »Was denkst du über Regul?«, fragte er beiläufig.
»Regul?« Shevon hielt inne, die Hand über dem Flügelboten, und versuchte seinen Atem unter Kontrolle zu bekommen. Er sah auf und fand den Blick seines Vaters auf sich gerichtet.
Auch Meron beobachtete ihn. »Regul ist ebenfalls in der Stadt.«
Nicht über Regul nachdenken. Setz deinen Zug. Die Lücke in Merons Verteidigung lud so eindeutig zum Angriff ein, dass sie nur eine Falle sein konnte. Er blickte hoch, aber das Gesicht des ehemaligen Senators war eine regungslose Maske.
Shevon überging Merons Frage. »Warum bist du eigentlich nie mehr aus Sabinon zurückgekehrt?«
»Neidisch auf meine Reisen? Ich könnte es verstehen, nach deinem Jahr in Falun.« Meron drehte sich zu seinem alten Freund um. »Cadron, du kannst froh sein, dass er dir in dem Drecksloch nicht elend am Fieber verreckt ist.«
»Der Junge hält mehr aus, als du denkst.«
Meron lachte. »Junge? Dein Sohn ist längst ein Mann geworden. Gib es zu, seit er Falun auf Vordermann gebracht hat, fließt mehr Silber in deine Tasche, als du ausgeben kannst! Du könntest ihm ruhig etwas mehr Anerkennung zeigen.« Und zu Shevon: »Wetten, seither träumst du von einem Land, das von der Sonne nur so versengt wird?«
Shevon schwieg. Seine Träume gehörten ihm allein.
Wieder lachte Meron. »Ich wusste es! Übrigens bin ich ja zurückgekehrt, wenn auch nur zu Besuch. Und werde dem Sohn meines Freundes eine Lektion im Vergeuden von Chancen geben.« Mit einer nachlässigen Bewegung schob er seinen Flügelboten in die Lücke. Damit war das Spiel so gut wie verloren. Cadron verzog abfällig das Gesicht und nahm sein Schriftstück wieder auf.
Shevon ignorierte den Stein in seinem Magen. »Alle wussten, dass die Anschuldigungen gegen dich haltlos waren.«
»Und warum stand niemand außer deinem Vater für mich auf?«
Wieder antwortete Shevon nicht.
Die Stadt hatte nach Angst gerochen, damals, als Nuridor seine Figuren frei über das Spielfeld zog. Niemand traute dem anderen über den Weg. Jeder fürchtete, das nächste Opfer der namenlosen Assassinen zu werden, die Nacht für Nacht die Häuser der Reichen unsicher machten.
Meron fegte Shevons Angriff mit seinem Sturmhaupt vom Brett. »Du warst noch zu unreif, um all die Finten und Gegenfinten zu verstehen. Aber sag mir, junger Schlaukopf, was hättest du an meiner Stelle getan?«
»Um meinen Ruf gekämpft.«
Meron schnaubte verächtlich. »Wie kämpft man gegen unsichtbare Dämonen? Gegen Gerüchte, die auf einmal überall auftauchen? Stell dir vor, alle behaupten, du hättest Richter bestochen.«
»Aber jeder besticht Richter!«
»Als nächstes hörst du, dass du dir angeblich die Söhne deiner Nachbarn ins Bett holst. Auf einmal halten dich alle für ein Schwein.«
»Ich weiß, dass das erlogen war!«
Meron ließ sich nicht unterbrechen. »Aber das ist noch nicht alles. Junge Männer sterben, immer die Erstgeborenen hoher Familien. Und wen bringt man damit in Verbindung? Immer dich. Du sammelst die Mosaiksteine, einen nach dem anderen, legst sie zusammen, und sie ergeben einen Pfeil, der genau auf dich zeigt. Sag mir, Shevon: Wärst du geblieben?« Mit grimmigem Triumph wischte er die Figuren vom Spielbrett. »Mein Ruf war vollkommen ruiniert. Ich wollte nicht warten, bis ich es selbst war.«
»Aber warum ausgerechnet Sabinon?«
Das klang so halbherzig, wie es sich anfühlte. Hoffentlich ahnte Meron nicht, wie sehr sich Shevon danach sehnte, die bunten Ziegel des sabinoischen Königspalastes in der Sonne blinken zu sehen und die riesigen Prachtstraßen zu durchwandern. Fort von hier, nur fort! Weg von den strengen Augen seines Vaters, die jede seiner Handlungen überwachten – so wie gerade jetzt. Fort aus Raydur, dessen enges Netz aus Verpflichtungen ihn jeden Tag ein wenig mehr strangulierte.
Meron beugte sich vor, bis sein Bauch ihn auf den Boden zu ziehen drohte. »Die Söhne seiner Gegner feige zu ermorden, fiele keinem Sabinoy ein. Das, mein junger Freund, ist aus deiner Heimat geworden!« Und nach einer Pause: »Eure Familie hat Nuridor damals nicht erwischt. Knapp. Wenn ihr dieses Mal nicht handelt, seid ihr die ersten, die fallen. Entweder dein Vater besiegt ihn endgültig oder Regul schleift dich an den Eiern durch die Straßen.«
Regul. Da war es wieder, das verkniffene Gesicht mit der Narbe, die Shevon ihm beigebracht hatte.Augen, die in einem Moment gleichgültig dreinsehen und im nächsten puren Hass versprühen konnten. Ein Klumpen aus Stein zog Shevons Magen nach unten. Stumm musterte er Meron. Cadron schwieg ebenfalls. Das Dokument lag vergessen vor ihm auf der Liege.
Die Ankunft eines Sklaven beendete den Moment der Stille. Shevon hatte den Jungen noch nie gesehen.
»Herr! Herr! Senator! Sie haben ...«
Der Sklave fing den strafenden Blick seines Herrn auf. Erschrocken neigte er den Kopf und wartete auf Erlaubnis zu sprechen.
»Was bringst du?«
»Es geht um Talyon, Herr.« Schon machte der Sklave wieder große Augen. »Man hat ihn verhaftet, Herr! Wegen Gewalt gegen einen Bürger!«
Der Senator holte hörbar Luft. Die Adern auf seiner Stirn traten hervor. »Bei allen Göttern, nimm das bisschen Hirn zusammen, das die Götter dir zugestanden haben, und berichte, was geschehen ist!« Die gepresste Stimme verriet seine Anspannung.
Der Sklave schluckte. »Ja, Herr. Sie haben uns aufgelauert und beschimpft. Dann haben sie angefangen, uns herumzuschubsen. Einer hat Talyon ins Gesicht geschlagen. Als der die Hand vors Gesicht nahm, um sich zu schützen, haben sie ihn gepackt, wegen Angriffs auf einen Bürger. Sie haben ihn verprügelt, bis er sich kaum noch rühren konnte, und dann haben sie ihn zum Gericht geschleift. Herr, sie wollen ihn steinigen lassen!«
Shevon schluckte.
Talyon, der oberste Haussklave, hatte Shevon die ersten Buchstaben beigebracht und später seine Heimatsprache Sabinoisch. Wenn es einen Menschen gab, dem er vertraute, dann Talyon. Und jetzt drohten ihm ein Schnellverfahren und die Steinigung.
Der Angriff hatte begonnen.
Meron wuchtete sich in eine sitzende Position. Sein Gesicht war tiefrot. »Wer hat das getan?«
Der Junge rang verzweifelt die Hände.»Ich kenne sie nicht, Herr!«
»Wie sah er aus?«
»Es waren viele ... Fünf, glaube ich. Einer sehr groß, mit glatten Haaren bis zur Schulter.«
Shevon und sein Vater wechselten einen Blick und schüttelten den Kopf. So jemanden kannten sie nicht.
»Der Anführer war breit gebaut, mit einem Kopf fast wie ein Dreieck. Er hatte eine Narbe auf der Wange, so!« Sein Finger zeichnete eine Linie von der Schläfe bis zum Kinn.
Shevons Magen zog sich zusammen. Unwillkürlich blickte er auf seine Rechte, die damals den Griffel gehalten hatte. »Das ist Regul.«
Meron saß auf seiner Liege, den Blick auf sein Glas gerichtet. Schweiß stand auf seiner Stirn und unter der Sonnenbräune wirkte sein Gesicht grau. »Genauso hat es damals angefangen.« Ächzend stemmte er sich hoch und ging im Raum umher. »Du musst etwas tun, Cadron. Jetzt.«
Der Senator richtete sich auf. Sein Gesichtsausdruck wirkte kalt und hart, wie in Stein gemeißelt.
»Sklave!«
Einer der Jungen vor der Tür stürzte herein und neigte den Kopf.
»Hol Gabul.«
Der Sklave verschwand.
Cadron räusperte sich umständlich. »Shevon, du gehst zurück zum Gericht. Sie werden versuchen, Talyon vor dem Frühlingsfest zu verurteilen. Du musst ihn um jeden Preis freibekommen. Warte!« Er schwang sich von seiner Liege, verschwand aus dem Zimmer und kehrte mit zwei Beuteln zurück. »Der Richter bekommt fünfzig Goldstücke. Wenn er mehr fordert, versprichst du ihm auch das. Du wirst Talyon freibekommen, koste es, was es wolle. Nimm dir zwei von Gabuls Männern mit. Für den Rückweg schicke ich dir eine Eskorte. Hast du verstanden?«
»Ja, Vater.«
Der Hauptmann trat ein und salutierte. »Herr.«
»Was ist am Tor los?«
»Sie sind abgezogen, Herr. In Richtung Tempel. Ich frage mich, wo sie kampieren. Dort oben gibt es keine Kasernen. Ich habe ihnen zwei Männer hinterhergeschickt.«
»Gut. Mein Sohn braucht ebenfalls zwei deiner Männer.«
Gabul salutierte erneut und verließ den Raum.
»Shevon?«
»Ja, Vater?«
Der Senator baute sich vor ihm auf. »Denk daran: Die al Gireds sind Soldaten, aber keine Redner und schon gar keine Anwälte.« Er packte Shevons Schultern. »Sie bringen fünf Bürger als Zeugen. Aber dein Wort zählt mehr als jeder einzelne ihrer Schläger. Du wirst sie an die Wand reden. Mach sie lächerlich, demütige sie bis ins Mark! Ganz Raydur soll sich von ihnen abwenden und sie meiden wie Aussätzige!« Sein Griff auf Shevons Schulter verstärkte sich. »Bei den Göttern, du wirst diesem Lumpenpack zeigen, wer in dieser Stadt das Recht vertritt: Die al Yontars, und nur die al Yontars!«
Meron al Andre schnaubte spöttisch.
»Geh jetzt!«
Shevon hastete los.
Den ganzen Weg zurück zur Basilika hatte er Reguls Gesicht vor Augen.
Reguls Ankunft
Elf Jahre zuvor
»Heute wird Regul al Gired hier eintreffen«, erklärte Tante Rya beim Morgenmahl und Shevon erstarrte, einen Schluck Essigsaft im Mund. »Ich möchte, dass du ihn willkommen heißt.« Sie sagte es im gleichen Tonfall, in dem sie sonst der Küchensklavin erklärte, was sie zum Nachtmahl wünschte.
Shevon prustete den Saft über den Tisch.
Ein Sklave eilte herbei und kümmerte sich um seine Tunika, ein zweiter tupfte das Tischtuch ab.
Shevon überging Tante Ryas tadelnden Blick. »Regul al Gired? Soll das ein Witz sein?«
»Keineswegs. Es ist eine Anordnung deines Vaters.«
Shevon hielt verblüfft inne. Vater lud den Sohn seines Erzfeindes in die Familie ein? Auch wenn Cadron al Yontar seinem Sohn politische Prozesse erläuterte, bezog er ihn niemals in Entscheidungen mit ein. Aber das hier war einfach unmöglich.
Tante Rya beobachtete ihn mit strengem Blick. »Für euch junge Leute sind die Menschen aus dem Süden immer nur Barbaren. Wenn Reguls Besuch hilft, deine Ignoranz etwas zu lindern, haben wir zumindest etwas gewonnen.«
»Du meinst meine Ignoranz bezüglich der Leute, die versucht haben, die Republik zu zerstören?« Aber Shevon konterte nur halbherzig. In Gedanken ging er die politischen Verwerfungen der letzten Monate durch. Gerade hatte sein Vater Admiral Nuridors Armee in offener Feldschlacht besiegt. Doch anstatt kurzen Prozess mit dem Umstürzler zu machen, hatte er ihn lediglich für elf Jahre in die Verbannung geschickt.
Und nun nahm er auch noch dessen Sohn bei sich auf.
Tante Rya reinigte ihre Finger mit Rosenwasser. Das einfallende Licht ließ die Falten um ihren missmutig gespitzten Mund hervortreten, doch sie wählte einen aufmunternden Ton. »Stell dir vor, was passiert, wenn dieser Regul entdeckt, dass wir al Yontars gar nicht die Dämonen sind, von denen man ihm immer erzählt hat. Wenn er ein neues Bild von uns nach Gurud mitnimmt.«
Shevon schwieg.
Den Sohn seines Feindes aufzunehmen, würde auf die Bevölkerung der unterlegenen Provinzen großzügig wirken. Wenn es gelang, Reguls zweifellos schlechte Meinung über die al Yontars abzuschwächen, konnte das sogar das Ende der bitteren Feindschaft zwischen den beiden Familien bedeuten.
Aber das war eben nur eine Seite der Medaille. Gleichzeitig ließ Cadron einen Feind ins Herz der Familie hinein. Regul konnte unter dem Deckmantel seiner Gefangenschaft die Familie nach allen Regeln der Kunst ausspionieren.
»Du selbst spielst in den Plänen deines Vaters die entscheidende Rolle!« Rya klang mittlerweile, als versuchte sie, auf dem Markt faulen Fisch an den Mann zu bringen.
»Und welche Rolle soll das wohl sein?«
Beinahe hätte er Ryas Seitenblick übersehen. Sie verheimlichte ihm etwas. Wenn es nach Cadron al Yontar ging, spielte jeder eine Rolle in seinen Plänen, aber er hatte Shevon seine Aufgabe und die Idee dahinter stets erklärt. Er legte stets großen Wert darauf, Shevons Gespür für politische Arbeit zu fördern.
Rya dagegen verriet ihm nicht einmal die Grundzüge seiner Aufgabe. Solange er ungefragt hinnahm, was sie im Auftrag seines Vaters beschloss, würde sie ihn loben, wie man ein gutes Reitpferd lobt. Nun, er war kein Reitpferd.
»Regul kommt in Geiselhaft und er weiß das. Ich halte es für leichtfertig, mit einem Feind der Republik in einem Haus zu schlafen. Es sei denn, es gibt einen Plan dahinter, den du mir nicht nennst.«
»Du bist der Sohn des Diktators!« Ryas Stimme klang auf einmal schärfer. »Befolge seine Anweisung und kümmere dich um den Jungen.«
Shevon behielt seine Antwort für sich. Tante Ryas Unbehagen vor einem al Gired im eigenen Haus war mit Händen greifbar, aber die ungewohnte Zurechtweisung lag ihm wie verdorbenes Fleisch im Magen.
Am Nachmittag stand er mit abweisender Miene vor der Haustür, als drei Söldner der Familie den Jungen aus dem Reisewagen zerrten. Trotz seiner Handfesseln wehrte er sich aus Leibeskräften. Auf den ersten Blick verriet sein seltsam schiefes, beinahe dreieckiges Gesicht die Familie, aus der er stammte.
»Nimm deine dreckigen Finger von mir! Beim Arsch des Nimmermüden, deine Mutter hat es sich wohl von einem sabinoischen Sklavenschwanz besorgen lassen! Ja, schlag mich nur, elender Feigling! Dein Vater hätte dich in der Viehtränke ersäufen sollen!« Er beugte sich keuchend vornüber, dann rammte er seinem Bewacher eine Schulter in die Magengrube. Der Mann wurde gegen die Kante der Wagentür geschleudert und ging zu Boden. Regul versuchte zu fliehen, doch der Fuß eines der Söldner ließ ihn stolpern und der Länge nach im Kies landen. Der zweite Söldner presste ihn mit dem Knie auf den Boden und hielt ihm einen Dolch ins Genick. Der dritte stand mit erhobenem Kurzschwert bereit. Regul wand sich und knurrte unverständliches Zeug, als hätte er die Wilde Seuche. Die Dolchspitze, die in seine Nackenhaut schnitt, schien er nicht einmal zu bemerken.
Shevon runzelte die Stirn. Hatte niemand die Kombination gesehen, mit der Regul seinen Bewacher erledigt hatte? Der Rammstoß gegen die Brust, der den Mann gegen die Türkante befördert hatte, war exzellent gesetzt. Das Ganze war ein gut inszeniertes Schauspiel. Eine typische al Gired-Schweinerei.
»Er spielt euch nur etwas vor! Die ganze Raserei da ist nur billiges Theater.« Mit knappen Worten erläuterte er den skeptischen Soldaten, was er beobachtet hatte. Regul, der sein Schauspiel aufgegeben hatte und unter dem Knie seines Bewachers lag, musterte Shevon aufmerksam.
»Eine Bewegung und du bist Krähenfutter«, schnauzte ihn der Söldner an, als ob seine Klinge das nicht bereits klar machte.
Tante Ryas Miene hatte sich bei dem Schauspiel verfinstert. »Lasst ihn los. Und löst die Fesseln.«
Verblüfft gehorchten sie und Shevon hielt den Atem an. Dieses wilde Tier von der Leine zu lassen, konnte nur in einer Katastrophe enden.
Reguls Toben und Schreien verstummte. Er lag still da, als könne er selbst nicht glauben, was da geschah. Dann sprang er auf und spuckte seiner Befreierin ins Gesicht.
Ungerührt erwiderte sie seinen Blick, während eine Sklavin ihr den Speichel von der Wange wischte. »Du hast zwei Möglichkeiten, Regul al Gired. Entweder du akzeptierst, dass du hier bist, egal wie sehr du uns hasst. Dann kannst du dich frei bewegen, isst an der Tafel der Familie und bekommst einen Unterricht, der dem Sohn eines Senators angemessen ist. Oder du machst genauso weiter wie jetzt. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dich im Keller an die Weinfässer ketten zu lassen.«
»Ihr könnt mich nicht festhalten!« Regul schob trotzig den Kiefer vor, aber hinter dem Gehabe schien auf einmal seine Unsicherheit durch.
Ein Fünfzehnjähriger allein in den Händen seiner Feinde – für Shevon kam das knapp vor einem Todesurteil.
Rya zuckte die Achseln. »Nur zu! Der Weg dort drüben ist der einzige zum Festland hinüber und führt direkt nach Sosua. Aber bevor du losmarschierst, mach dir klar, dass dies hier Al-Yontar-Land ist. Jeder hier unterstützt meinen Bruder und hasst deinen Vater. Wie ich hörte, hast du auf der Herfahrt ja reichlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Vielleicht findest du es ja heldenhaft, vom nächsten Bauern mit der Heugabel aufgespießt zu werden. Also, wie willst du es haben? Ehrenhafte Gastfreundschaft oder ein Strohsack im Verlies?«
Auf Reguls Gesicht wechselten sich Verblüffung, Misstrauen und der Zorn ab, so ausgespielt zu werden.
Tante Rya wandte sich ab. »In einer Stunde wird im Säulenhof das Abendmahl serviert. Ich schlage vor, dass du dich vorher ein wenig frisch machst und die Spuren des kleinen Dramas beseitigst. In deinem Zimmer liegt Kleidung für dich bereit.«
»Ich trage keine Al-Yontar-Farben!«
Die Tante musterte ihn von oben bis unten. Genau so hatte sie Shevon bei ungezählten Gelegenheiten angeblickt. »Glaubst du, ich habe es nötig, dich mit Kinderspielen zu demütigen? Von einem Patrizier erwarte ich, dass er seinen Kopf benutzt – und auch ein Mindestmaß an Benehmen.«
Damit verschwand sie nach drinnen.
Shevon löste vorsichtig seine Hände vom Geländer. Die Tante musste sich irren. Ein al Gired sollte niemals allein durch die Flure einer Al-Yontar-Villa streifen dürfen! Shevon würde den Gefangenen auf Schritt und Tritt bewachen.
Regul verharrte regungslos. Die Wächter beobachteten ihn mit angespannter Miene und der Hand an der Waffe. Aber Regul schüttelte den Konflikt mit einem Schulterzucken ab wie eine Fliege. Er schlenderte auf den Eingang zu und blieb vor Shevon stehen. Sein Gesicht verzog sich zu einem spöttischen Lächeln. »Der Sohn des Senators, ja? Sehr erfreut.«
»Der Sohn des Verräters, ja? Die Freude liegt gänzlich auf deiner Seite.«
Es dauerte einen Moment, bis Regul die Retourkutsche entziffert hatte. Die Furche zwischen seinen Brauen vertiefte sich. Er packte Shevons Arm und drückte zu, bis Shevon ein Ächzen nicht unterdrücken konnte. Alarmiert traten die Söldner herbei, aber Regul hatte bereits losgelassen. »Nur eine Begrüßung unter alten Feinden«, sagte er lächelnd. »Kein Grund zur Beunruhigung.«
Shevon unterdrückte seinen Schrecken und den Impuls, den Oberarm zu reiben. Ein paar blaue Flecke mehr würden auch nicht auffallen.
»Ist das die Art, wie die al Gireds sich begrüßen? Dann wundert mich deine Visage doch nicht so sehr.«
Die Wachen grinsten.
Reguls Gesicht verfinsterte sich. Einen Herzschlag später hatte er sich wieder unter Kontrolle. Er beugte sich vor, bis sein Gesicht nur eine Handbreit von Shevons entfernt war. Sein Lächeln grenzte an Koketterie.
»Ich werde dir jeden einzelnen Tag zur Hölle machen.«
Gamons Entdeckung
»Du wirst heute den Sonnenstand aufzeichnen.« Die Stimme des Sonnenhirten unterbrach Gamons Verneigung.
Verblüfft richtete sich der junge Mönch auf. »Ich?«
»Ja, du!« Auf der Stirn des Sonnenhirten bildete sich eine Zornesfalte. »Was ist so kompliziert daran, ein paar einfache Zahlen zu schreiben?«
»Nichts, Allergnädigster.« Gamons Mund fühlte sich auf einmal sehr trocken an, die Zunge klebte wie ein Stück Leder am Gaumen. »Mein Widerspruch ist unverzeihlich – aber ich kann doch nicht in die Heilige Rolle ...«
Die Hand des Sonnenhirten knallte gegen seine Wange. »Lüg mich nicht an! Du weißt sehr genau, wie man den Sonnenstand einträgt. Hast du die Observatoren nicht viel zu oft mit deinen Fragen belästigt?«
Gamon keuchte und unterdrückte den Wunsch, die brennende Wange zu berühren. War es Hochmut, zu glauben, er könnte die heiligste aller Aufgaben bewältigen?
Eine weitere Ohrfeige ließ seinen Kopf schwanken.
Als er die Augen wieder öffnete, funkelten die Augen des Sonnenhirten dicht vor ihm. »Beim Fluch des Nimmermüden, es sind ein paar Zahlen, du verdammter Idiot! Ich brauche meine Leute für Wichtigeres als diesen lächerlichen Kram.« Einen Augenblick später hatte der Sonnenhirte sich wieder in der Gewalt und die Wut in seinen Augen wich kalter Verachtung. »Also?«
Gamon vermochte sich nicht zu rühren. Der Oberste der Observatoren, der zweitwichtigste Priester im Tempel beleidigte die Schriftrolle und fluchte wie ein Fuhrmann! Und dieser Mann sollte einmal Hohepriester werden?
Gamon schluckte mühsam. »Ich werde es tun, Allergnädigster.«
»Na bitte.« Der Sonnenhirte blickte über ihn hinweg. »Du gehst in die Schreibstube, holst die Rolle und setzt die Reihe fort, die du vorfindest. Der Vater der Schriftrollen ist unterrichtet. Kein Stöbern, sonst setzt es etwas, hörst du?«
»Sehr wohl, Allergnädigster.«
»Für deine Frechheit, falsche Demut zu heucheln, wirst du außerdem den Rest des Tages die Asche unter den Opferfeuern auskehren.« Die Ungeduld des Sonnenhirten schien mit jedem Augenblick zu wachsen.
»Aber muss ich nicht zuerst die Türme beobachten?«
Eine dritte und vierte Ohrfeige ließ seine Wange brennen. »Noch ein Wort des Widerspruchs und die Peitsche wird dir Gehorsam beibringen! Du trägst die verdammten Zahlen ein und fertig! Und jetzt verschwinde, sonst schleife ich dich an deiner frechen Zunge hinaus!«
Gamon verneigte sich mit Tränen in den Augen und floh.
Noch immer fassungslos stützte er sich wenig später auf das steinerne Geländer der Sonnenterrasse. Die Frühlingssonne zeigte zum ersten Mal ihre Kraft und ließ die Luft über der Stadt flimmern. Vom Hof drang der Lärm unzähliger Pilger herauf. Rauchschwaden aus den Opferfeuern zogen über das Tempeldach und vertrieben die Krähen, die krächzend aufflatterten.
Drunten machte sich der Sonnenhirte auf den Weg in die Stadt. Die Menschen zogen sich vor ihm zurück wie Wasser von einem Tropfen Öl und verneigten sich. Dreißig Soldaten schlossen sich ihm an und geleiteten ihn aus dem Tempelgelände.
Gamon staunte. Dass der Sonnenhirte den Tempel am Tag vor dem Frühlingsfest verließ, um die Stadt zu segnen, war nichts Besonderes. Die Häuser der Reichen konnten gegen eine entsprechende Spende den Segen durch einen der Tempeloberen bestellen. Aber was hatte der Sonnenhirte mit Soldaten zu schaffen? Er sollte sich nicht mit den Männern des Todes umgeben.
Gamon erschrak. Hatte er seinen Oberen infrage gestellt?
Er kniff sich ins Ohr, bis er beinahe aufschreien musste. Der Sonnenhirte stand weit über der Kritik eines einfachen Mönchs. Es war zutiefst sündig, so über ihn zu denken! Stattdessen sollte Gamon lieber einordnen, was er eben erlebt hatte. Der Dienst im Tempel erforderte eiserne Selbstdisziplin, glühende Hingabe und absolute Klarheit im Geist. Shardon al Scossed hatte geklungen, als seien die Aufzeichnungen des Sonnenstandes noch ehrloser als das Leeren des Nachtgeschirrs. Das konnte nicht sein. Also musste Gamon ihn falsch verstanden haben.
Mit neuem Eifer beschirmte er die Augen und verfolgte, wie der Schatten des Heiligen Berges langsamer als eine Schnecke über die Stadt strich. Einer nach dem anderen verschwanden die Markierungstürme in seinem Schatten: Die Holzlände flussaufwärts, die Viertel der Handwerker und Krämer, schließlich Senat und Basiliken. Das Leuchten der goldenen Kuppeln erlosch, und mit ihm der Glanz der Kalendertürme unten in der Stadt. Gelegentlich schielte Gamon in den Hof hinunter, stets bereit, sich hinter die Balustrade zu ducken, falls der Sonnenhirte wieder auftauchte. Er wusste, dass er das Richtige tat. Aber der Gedanke, nach der Kritik von vorhin erneut die Aufmerksamkeit des Sonnenhirten zu erregen, jagte ihm einen Schauer über den Rücken.
Die Häuser Raydurs waren allmählich immer näher an den Tempel herangerückt und hatten die Landmarken verdeckt, an denen früher Sonnenstand und Jahreszeiten abgelesen werden konnten. Vor einigen Jahren hatte der Hohepriester überall in der Stadt Türme errichten lassen, jeden mit einer anderen geometrischen Figur oder einem Tiersymbol auf der Spitze. So verwandelte er die ganze Stadt in einen Sonnenkalender, der durch die Gnade des Nimmermüden anzeigte, wann man das Korn säte und wann der Erntemond begann, wann das Frühlingsfest gefeiert werden musste und wann der Nimmermüde das alte Jahr zum Finsteren Fährmann schickte. Vielleicht war das Mysterium göttlicher Erkenntnis ja tatsächlich verloren. Nach dem Bau der Türme hätte jeder Erntesklave den Kalender ablesen können. Die Menschen wurden eitel und vergaßen in ihrem Stolz, welch ungeheure Veränderung dieser Kalender vor unzähligen Jahren gebracht hatte, als nur die Priester den Jahreslauf lesen konnten.
Der Fluch des Sonnenhirten und sein blasphemischer Spruch über die Heilige Rolle drängten sich Gamon erneut in den Sinn. Konnte sich der Sonnenhirte überhaupt irren? Was, wenn der Dienst im Observatorium tatsächlich ein leeres Ritual geworden war, weil jeder sich neben den Tempel stellen und den Schatten des Berges verfolgen konnte?
Wo war in dieser Welt noch Platz für Schriftrollen?
Nein. Er drängte die Gedanken fort. Die Gnade des Nimmermüden war ohne Anfang und Ende. Der Turmkalender bedeutete lediglich eine andere Form der Hingabe an den Nimmermüden. Es musste etwas Anderes, Größeres gewesen sein, das den Sonnenhirten beschäftigt hatte. Gamon der Mönch war der Letzte, der die Gedanken seiner Oberen anzweifeln durfte. Er riss sich zusammen und verfolgte weiter die Wanderung des Schattens.
~
Die Sonne näherte sich bereits den Gipfeln der Balin Giôrad, als Gamon das Ausmaß der Fehler in den Aufzeichnungen erfasste.
Ein Keuchen entfuhr ihm. Hastig sah er sich um, aber das Scriptorium lag verlassen.
Gamon blickte zum Bal Sharman hinüber, dessen Westflanke im Licht der sinkenden Sonne glühte. Wolkenfetzen schmiegten sich auf halber Höhe um seine Steilwände und Schründe und strahlten, als umgäbe der Oberste der Götter vor dem Beginn des Frühlingsfestes sein steinernes Heiligtum mit einem Schleier aus Licht.
Wohnstatt des Nimmermüden. Heim des Höchsten. Der Anblick des gigantischen Felsens ließ Gamon wie immer in heiliger Ehrfurcht schaudern. Doch dieses Mal mischte sich eine größere Angst darunter. Der Nimmermüde hatte seinen Gläubigen ein Zeichen gegeben und anscheinend wollte es niemand lesen. Niemand außer Gamon al Shelar, dem unwürdigsten seiner Diener.
Er senkte den Blick wieder auf die Schriftrolle.
Die endlose Reihe der Namen, mit denen die Observatoren vergangener Jahrhunderte ihre Beobachtungen unterzeichnet hatten, verschwamm vor seinen Augen. Er hörte die Stimme des Sonnenhirten in seinem Kopf: »Du bringst ihm augenblicklich die Rolle zurück.«
Aber der Vater der Schriftrollen war seit Stunden verschwunden. Vermutlich half er unten im Hof bei den Tieropfern.
Es half alles nichts, Gamon musste erneut nachrechnen. Der Turm des geflügelten Gorgony hätte zum Frühlingsfest für einen Augenblick in der Spitze des Bergschattens verschwinden müssen. Stattdessen hatte das vergoldete Fabeltier mit der Sonne um die Wette gestrahlt.
Gamon durchforstete rückwärtsgehend die Berechnungen des Sonnenstandes. In den letzten zwei Jahren fand er keine Auffälligkeiten. Wo wichen die Beobachtungen zum ersten Mal von den Berechnungen der Sonnenhirten ab? Über zwanzig Jahre war das her, länger als sein eigenes Leben. Seitdem verkürzte sich der Schatten des heiligen Berges Bal Sharman. Alle paar Jahre tauchte ein weiterer Kalenderturm zur Unzeit aus seinem Schatten auf. Und es ging immer schneller – bis zur vorvergangenen Wintersonnenwende. Damals hatte Shardon al Scossed sein Amt als Sonnenhirte angetreten – und die aufgezeichneten Werte entsprachen plötzlich wieder exakt den errechneten. Auf einmal ergaben die Worte, die Shardon vorhin geäußert hatte, einen ganz neuen Sinn. Darum also sollte Gamon nicht beobachten, sondern nur Zahlen eintragen! Die heiligste Schrift des Tempels – eine Fälschung.
Und das war noch nicht alles. Der Bal Sharman rutschte ab und niemand ließ etwas über dieses unerhörte Zeichen des Nimmermüden verlauten. Alles wurde vertuscht und verschwiegen. Wie konnte das sein?
Das Gewicht des Bal Sharman schien auf Gamons Schultern zu lasten. An wen sollte er sich wenden? Vielleicht konnte ihm der Hohepriester helfen, der Hüter göttlicher Weisheit.
An seinem ersten Tag im Tempel hatten seine Eltern und er in einem Gang warten müssen, bis der Hohepriester sie empfing. Das Schluchzen seiner Mutter, die versteinerte Miene seines Vaters: Bis ins Detail hatte sich ihm der Abend eingeprägt, an dem sein altes Leben endete. Der Hohepriester empfing sie auf seiner Liege, von Krankheit gezeichnet, aber sein gütiges Lächeln ließ Gamons Angst verfliegen. Sogar die Eltern, vor Aufregung stammelnd, beruhigten sich in seiner Gegenwart. Schließlich nahm ihn der Hohepriester freundlich lächelnd an der Hand und führte ihn fort von seinen Eltern und in das Labyrinth des Tempels hinein. Gamon wagte nicht, sich noch einmal umzublicken.
Er hatte sie nie wiedergesehen.
Gamon schluckte und drängte die Tränen zurück. Jetzt zählte nichts anderes, als dem Geheimnis der falschen Eintragungen auf die Spur kommen. Er hatte den Hohepriester seither nur noch bei Festzeremonien im Tempel gesehen, wo er sich auf die Schulter eines Priesters stützte. Aber der Hohepriester wäre der Letzte, der Hilfe verweigern würde. Er musste ihm helfen.
Sorgfältig verstaute Gamon die Schriftrolle wieder in ihrem Bleizylinder. Kurze Zeit saß er da und betrachtete das schmucklose Gefäß, das etwa so lang und dick war wie sein Unterschenkel. Niemand, der es nicht kannte, würde ahnen, was es verbarg.
Er sah sich um, holte tief Luft und ließ den Zylinder unter seine Kutte gleiten.
~
Als Gamon den Gang zu den Gemächern des Hohepriesters erreichte, hörte er Schritte. Instinktiv duckte er sich hinter einen der Pfeiler, die den Tempel über ihm stützten. Was, wenn man die Heilige Schriftrolle bei ihm fand, die stets in der Schreibstube blieb? Niemals mehr würde man sie ihm anvertrauen und seine Sehnsucht, das Heilige Amt der Observatoren auszuüben, würde endgültig unerfüllt bleiben.
Der Bleizylinder drückte gegen seine Brust, als wollte er ihn an seine wirkliche Aufgabe erinnern.
Die Schritte kamen näher.
Shardon al Scossed eilte an Gamons Versteck vorüber, gefolgt von zwei Mönchen mit erschrockenem Gesichtsausdruck. Silberne Schlüssel waren auf den Schultern ihrer Roben eingestickt. Die Türwächter des Hohepriesters.
Warum ließen sie ihren Herrn unbewacht?
Gamon drückte sich noch enger an den Pfeiler und wartete, bis der Widerhall der Schritte verklang.
Der Drang, sich irgendwo zu verstecken, wuchs mit jedem seiner rasenden Herzschläge. Aber als Diener des Nimmermüden musste er seine Furcht vor der Welt bezwingen.
Die Tür zu den Gemächern des Hohepriesters war unverschlossen. Niemand kam ohne Erlaubnis an den Türwächtern des Hohepriesters vorbei – normalerweise. Aber die Wächter waren verschwunden und Gamon trug die Heilige Rolle unter seiner Kutte. Er gab sich einen Ruck und klopfte. Keine Antwort. Er klopfte erneut. Wartete.
Stille.
Er trat ein.
Dämmerlicht umfing ihn. Die Luft war stickig von Schweiß und einem Geruch, den er nicht einordnen konnte. Wieder lauschte er, aber kein Laut drang an sein Ohr.
»Allerehrwürdigster?«
Drei Schritte führten ihn weiter in die Gemächer des Hohepriesters hinein. Hier waren sie damals von ihm empfangen worden. Noch immer zeigten die Fresken an der Wand bäuerliche Szenen, die die Jahreszeiten symbolisierten. Auf dem niedrigen Tisch neben der Speiseliege war ein leichtes Abendessen gerichtet: Huhn, Oliven und etwas Getreidebrei. Gamon nahm das alles in der Dauer eines Herzschlags auf. Sein Blick blieb am Kopfende des Tischs hängen.
Der Hohepriester lag zwischen Liege und Tisch. Sein Gesicht und die Zunge, die aus dem Mund ragte, waren blau angelaufen und die leblosen Augen schienen aus ihren Höhlen zu quellen.
»Ehrwürdiger!« Gamon stürzte ans Tischende. Gütigster aller Götter, was sollte er tun? Er stemmte sich gegen die Liege, bis sie mit einem schabenden Geräusch nach hinten rutschte und der Hohepriester auf den Rücken rollte. Der Bleizylinder glitt aus seiner Kutte. Mit zitternden Fingern riss er am Halsausschnitt der Priesterrobe und fuhr zurück, als er die Würgemale am Hals des Hohepriesters erblickte. »Ehrwürdiger! Ehrwürdiger!«
Keine Antwort. Kein Atem. Gamon presste sein Ohr auf die Brust des Liegenden. Stille.
War das sein eigenes Schluchzen?
Hastig stemmte Gamon sich hoch und bemerkte zu spät, dass er sich auf den Hohepriester stützte.
Ein Laut wie ein Seufzen entfuhr der Leiche, als ihr Brustkorb zusammengedrückt wurde, und Gamon stolperte entsetzt zurück. Dann packte er den Bleizylinder und floh.
Er schlug sich mit der flachen Hand auf die Augen, bis weiße Funken vor ihm im Gang tanzten, aber er wusste, dass er sie in seinem ganzen Leben nicht vergessen würde, das grässliche Bild des Erdrosselten – und den Verdacht, dass Shardon al Scossed gerade den Hohepriester ermordet hatte.
Frosch
Elf Jahre zuvor
Shevon seufzte. Das Zirpen der Zikaden und der Chor der Frösche hinter der Gartenmauer füllten die Sommerluft. Der Delyan lag glatt wie ein Spiegel unter der Sonne. Kein Lüftchen regte sich. Die Sklaven erledigten alles, was es zu erledigen gab. Auf ihn wartete keine andere Aufgabe, als im Schatten zu liegen, sich von einem Sklavenmädchen Honigwein bringen zu lassen und sich überflüssig zu fühlen, bis die Hitze nachließ.
Tante Rya zauste ihm im Vorübergehen das Haar. »Du brauchst viel Ruhe, nach allem, was geschehen ist.« Die Tür klappte hinter ihr zu.
»Noch einen Becher«, befahl Shevon. Die junge Sklavin, die neben seiner Liege wartete, verneigte sich und eilte barfuß ins Haus. Shevon blickte ihr hinterher. Ein süßes Ding, mit Waden wie die der marmornen Göttinnen auf Vaters Fresken. Wie war noch einmal ihr Name? Ihr Lachen perlte jeden Tag aus den Kellergängen vor den Sklavenquartieren herauf wie Luftblasen. Mutter hatte so gelacht.
Unversehens stand Shevon das Gesicht seiner Mutter vor Augen: Die Fältchen um ihre Augen, ihr liebevoll-spöttisches Lächeln, ihre Stimme, die in einem Augenblick schneidend sein konnte und im nächsten zärtlich und geheimnisvoll.
Nein! Er schüttelte den Kopf, um das Bild zu vertreiben, und sah sich um. Bummelte die Sklavin? Verstanden hätte er es, im Weinkeller musste es wunderbar kühl sein. Shevon lehnte sich zurück und lauschte den Zikaden. Regul schlenderte pfeifend vorbei und zum Garten hinab. Als er den Liegestuhl passierte, deutete er eine ironische Verneigung an. Shevon schenkte ihm keine Beachtung, aber ein Schatten legte sich über den Tag.
Er schloss die Augen. Wo blieb die Sklavin nur?
Gerade als er nach ihr rufen wollte, kehrte sie zurück und überreichte ihm einen Becher gesüßten Weins. Etwas landete auf seiner Tunika. Hastig zog sie ihre Hand zurück und versteckte sie hinter ihrem Rücken. Eine Spur roter Tropfen zog sich wie eine Perlenschnur über Shevons Tunika.
»Diese Sklavin bittet um Entschuldigung, Herr!«
Shevon wollte sie für ihre Ungeschicklichkeit schelten, aber sie hatte keinen Wein verschüttet. Das war Blut.
Er blickte von seiner Liege hoch. Das Mädchen sah starr zu Boden, aber ihre Mundwinkel zuckten und ihre Pupillen wirkten wie riesige schwarze Löcher. »Was ist passiert?«
»Nichts, Herr.« Nun schwankte sie auch noch. Auf ihrer Stirn standen Schweißtropfen.
»Zeig deine Hand her!«
Die Lippen der Sklavin zitterten. Langsam, als müsste sie gegen strömendes Wasser ankämpfen, streckte sie ihre Hand aus. Eine schöne Hand, schmal und noch nicht durch harte Arbeit ruiniert. Haut und Nägel waren tadellos gepflegt, aber ein Stück der Kuppe des Ringfingers fehlte. Aus dem glatten Schnitt troff das Blut.
»Was ist passiert?«
»Ich war ungeschickt, Herr. Bitte entschuldige meine Tölpelhaftigkeit, Herr.« Ihre Kiefermuskeln traten hervor, als sie die Zähne zusammenbiss.
Shevon setzte sich auf. »Du kommst mit so einem Schnitt aus dem Weinkeller und behauptest, es sei nichts passiert? Das muss versorgt werden!«
»Bitte, Herr ...« In den Augen des Mädchens quollen Tränen auf, die sie noch entzückender machten. »Bitte!«
Also gut. Er musste nicht alles wissen.
»Lauf sofort zu Talyon«, befahl er. »Er soll die Wunde behandeln. Beeil dich! Und sei zukünftig vorsichtiger.«
»Das werde ich, Herr.«
»Eins noch. Wie heißt du?«
»Dala, Herr.«
»Es ist gut, Dala. Geh jetzt.«
Dala war das altlevanische Wort für Schmerz. Ob sie das wusste? Wer gab den Sklaven eigentlich ihre Namen? Vermutlich Tante Rya.
Shevons Blick blieb an den Flecken hängen, die seine Tunika besudelten. Wie gebannt starrte er darauf.
Blut. Blutrot.
Er rang nach Luft und würgte. Verdammte Götter, hörte das denn nie auf?
Er kniff die Augen zusammen, bis seine Umgebung zu bunten Schlieren verschwamm. Er lauschte dem Zirpen der Grillen und versuchte jede einzelne Stimme darin zu erkennen. Er rechnete im Kopf erneut die letzte Mathematikaufgabe durch, die Talyon ihm im Unterricht gestellt hatte.
Nichts davon half. Eine Hand aus Eis schien seine Lunge zusammenzudrücken. Er starrte auf die Blutflecken, unfähig, sich davon zu lösen. Das Bild des glitzernden Sees verschwand, als zöge jemand ein Tuch vor seinen Augen weg. Zwischen zwei Herzschlägen verging der Sommer und eine blasse Sonne schien durch das Oberlicht in der Villa seines Vaters.
Mutters Schreie aus dem elterlichen Schlafzimmer, die kaum etwas Menschliches an sich hatten. Sklavinnen, die mit heißem Wasser, Essig und Leintüchern zu ihr eilten. Die hektischen Anweisungen ihrer Leibsklavin und der irre Gesichtsausdruck seines Vaters, der ihn fortjagte. Shevon floh entsetzt aus der Villa, versteckte sich in den Büschen neben dem Eingang und lauschte auf die Schreie und die entsetzliche Stille, die ihnen folgte. In seinen Ohren summte und rauschte es. Viel zu spät sprang der Chirurg aus seiner Sänfte und verschwand im Haus. Viel zu früh erschien er wieder, nahm seinen Lohn in Empfang und wich mit zu Boden gerichtetem Blick dem Priester des Nimmermüden aus, der seinen Platz einnahm. Jemand rannte durch den Garten und rief Shevons Namen, aber seine Beine gehorchten ihm nicht. Reglos blieb er zwischen den Büschen hocken. Irgendwann tappte er nach drinnen, wo ihn eine in Tränen aufgelöste Leibsklavin hastig an sich drückte.
Sie hatte weder den Haufen blutgetränkter Laken noch die zwei fleischigen kleinen Bündel verbergen können, die seine Brüder hätten werden sollen.
Augen zusammenkneifen! Den Zikaden lauschen! Die Aufgabe nachrechnen, wie war sie noch einmal? Shevon presste die Lippen zusammen und kniff sich in den Arm, bis der Schmerz ihn scharf die Luft einsaugen ließ. Eine Doppelreihe blauer Flecken wuchs dort, und jeden Tag kamen neue dazu. Aber dieses Mal reichte der Schmerz nicht aus, um das Bild der Laken zu verjagen, und keine Zikade der Welt konnte die Schreie seiner Mutter übertönen.
Shevon sprang auf. Sein Herz hämmerte, als wollte es aus dem Brustkorb ausbrechen. Er rannte den Pfad in Richtung des Sees hinab, bis die Gartenmauer in Sicht kam.
Sein Fuß trat ins Leere. Der Boden kam in sausendem Sturz näher und Shevon knallte auf die Wegplatten.
Er setzte sich auf. Die Schreie in seinem Kopf waren verstummt, nur der Lärm der Frösche und Zikaden drang über die Mauer. Von seinen Handballen tropfte Blut auf die Tunika. Sie fühlten sich taub an, als gehörten sie nicht zu ihm. Später würden sie brennen, genau wie die Knie. Rot. Blut. Abwesend pickte Shevon Steinchen und Laub von den aufgeschürften Stellen und sah einem Tropfen zu, der träge an seinem Bein hinabfloss.
Ein Schaben ließ ihn aufschrecken. Er sah sich um. Hinter ihm lagen die Stufen, die er in seiner Hast übersehen hatte. Nur wenige Schritte vor ihm erhob sich die Gartenmauer. Das Tor stand offen. Wer ging in der Mittagshitze zum Delyan hinunter? Shevon erhob sich und spähte durch die Toröffnung hinaus.
Der Pfad schlängelte sich durch die Obstwiese bis zu den Reben. Dort, am Rand des Weinbergs, hockte Regul mit dem Rücken zu Shevon. Er hielt das Gürtelmesser gezückt und starrte auf etwas vor sich, das zuckte und hüpfte.
Shevon hielt den Atem an und schlich sich näher, bis er Regul über die Schulter spähen konnte.
Ein Frosch kämpfte mit verzweifelten Tritten seiner Hinterbeine, um Reguls Griff zu entkommen, doch der hielt ihn fest gepackt. Gerade als Shevon ihn erreichte, durchtrennte Regul mit dem Messer einen Muskel im Oberschenkel des Froschs. Dann ließ er das Tier los. Es wollte sich mit einem Sprung aus der Reichweite seines Peinigers bringen, aber sein Bein gehorchte ihm nicht mehr. Statt ihn voranzutreiben, vollführte es groteske Verrenkungen. Alle Stöße des gesunden Beins ließen den Frosch auf ebenso lächerliche wie erbarmungswürdige Weise im Kreis herumhüpfen.
Regul beobachtete den Frosch mit konzentrierter Miene. Dann packte er das Tier erneut und durchtrennte auch den Muskel des anderen Beins.
»Was soll das? Bist du wahnsinnig?« Shevon wollte nach dem verletzten Frosch greifen, doch ein Blick Reguls schien ihn auf seinem Platz zu bannen.
»Mein Vater ist nicht dumm.« Reguls Stimme klang entspannt, als plauderte er mit Freunden in der Taverne. »Aber er fragt sich immer nur eins: Wie kann ich meine Gegner vernichten?«
Regul ließ den Frosch frei. Der wollte davonhüpfen, doch seine Beine trugen ihn nicht mehr. Hilflos schob er sich auf dem Bauch voran und hinterließ eine Spur aus Blut und Schleim. Regul nickte ihm aufmunternd zu. Ein Hochzucken seiner Hand, und Shevon, der nach dem Frosch greifen wollte, erstarrte wieder, als hätte Regul ihn verzaubert wie in einem billigen Bühnenstück.
»Ich finde das zu einfach. Er verschwendet Material. Männer, Schiffe, Waffen. Die Frage sollte lauten: Was hält mein Gegner aus? Welche Verletzungen kann er noch ausgleichen, und wie schwer muss ich ihn treffen, damit er unheilbar und endgültig vernichtet ist?« Sein Zeigefinger strich über den Rücken des Froschs. Mit einer schnellen Bewegung packte er das Tier und schnitt ihm einen Vorderfuß ab. Noch immer versuchte der Frosch zu entkommen, aber seine Bewegungen wurden schwächer.