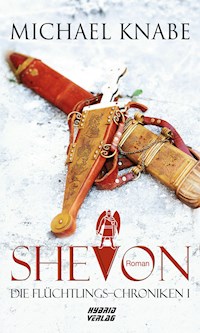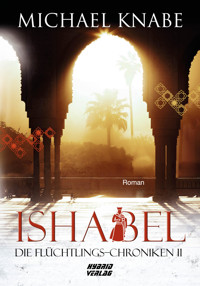
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hybrid Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Herzog Mirash richtete sich auf. „Es gibt schreckliche Krankheiten, Königliche Hoheit. Manche lassen sich nur durch den Tod kurieren. Andere – wie der weibliche Hochmut – mit einer Heirat.“ Das Königreich Sabinon ist nach einer Epidemie entvölkert, sein Herrscher todkrank. Er will seine Tochter Ishabel gegen ihren Willen verheiraten, um die Thronfolge des Königreichs zu sichern. Ishabel dagegen sieht ihre Aufgabe vor allem darin, ihre Heimat gegen die machtgierigen Intriganten am Königshof zu schützen. Doch dazu muss sie mit der Hilfe des Flüchtlings Shevon al Yontar nicht nur eine feindliche Invasion aufhalten, sondern auch einen Verräter in den eigenen Reihen enttarnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HYBRID VERLAG
Vollständige elektronische Ausgabe
11/2020
Ishabel – Die Flüchtlings-Chroniken II
© by Michael Knabe
© by Hybrid Verlag
Westring 1
66424 Homburg
Umschlaggestaltung: © 2020 by Andrea Gunschera;
magi digitalis | media production; www.magi-digitalis.de
Lektorat: Donatha Czichy, Tatjana Reiber
Korrektorat: Nola Reiber
Buchsatz: Lena Widmann
Autorenfoto:alex:jung fotografie, Emmendingen
Coverbild ›Baronica‹ © 2020 Jon Barnis
Coverbild ›Der siebte Sonnenstein‹ © 2020 Creativ Work Design
Coverbild ›Das Geheimnis von Talmi’il‹
© 2019 Creativ Work Design; artwork by Mika Jänisen
Coverbild ›Halbwesen‹ © 2018 by Creativ Work Design
ISBN 978-3-96741-069-3
www.hybridverlag.de
www.hybridverlagshop.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,
Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.de abrufbar.
Printed in Germany
Michael Knabe
Ishabel
-
Die Flüchtlings-Chroniken II
Fantasy
Für Kirsten und Felix,
die wahren Helden meines Lebens
Erster Teil
Drohung
Willkommen
Streit
Brettspiel
Abwehr
Kronrat
Befragung
Fremdenhass
Empfang
Der Hohepriester
Verräter
Verhandlungen
Prinzessin
Styeban
Feuer
Löschen
Anschlag
Versteck
Zweiter Teil
Provinz
Ränkespiel
Verluste
Zweisam
Anstifter
Handel
Vorbereitungen
Tränen
Verbrechen
Flucht
Doppelspiel
Verhaftung
Verfolger
Prügel
Heerschau
Begleiter
Ein Wiedersehen
Dritter Teil
Feinde
Befreiung
Brandstifter
Verteidiger
Verrat
Schatten der Vergangenheit
Gefunden und verloren
Kleine Helfer
Das Stricken eines Plans
Verlieren, um zu gewinnen
Stiche und Siegel
Spielzüge
Abschied
Namensverzeichnis
Danksagung
DER AUTOR
Hybrid Verlag …
Erster Teil
Intrige
Drohung
Bei Sonnenaufgang nahm Prinzessin Ishabel ihren Platz in der Fensternische des königlichen Kabinettssaals ein. Die ersten Strahlen ließen die Fresken auf der gegenüberliegenden Wand aufleuchten. Sie nickte den Dienern zu, die Weinbecher und Leckereien auf dem Besprechungstisch anrichteten.
Ishabel hasste die Nische. Fünf Schritte vom Tisch entfernt musste sie den Beratungen lauschen, ohne sich je zu Wort melden zu dürfen. Wie hatte Mutter es all die Jahre hier ausgehalten?
»Jeder trägt eben seinen Teil der Krone. Dieser ist meiner«, hätte sie wohl geantwortet und sich wieder den Beratern des Königs zugewandt. Wer gehört werden wollte, erwies der Königin seine Reverenz, noch bevor der Herrscher selbst erschien. Ihre Mutter bedachte jeden mit einem herzlichen Lächeln, erkundigte sich nach dem Befinden der Gattin und platzierte ganz nebenbei Bemerkungen, die bei Hof so intensiv diskutiert wurden wie die Dekrete des Königs selbst.
Früher. Ishabels Brustkorb zog sich schmerzhaft zusammen. Früher hatten die Gänge widergehallt von den Stimmen der Herzöge, Freigrafen, Barone und ihres Gefolges. König Badoran hatte einen großen Hof geführt, bevor alle, die es noch konnten, vor dem Bluthusten geflohen waren. Es schien eine Ewigkeit her.
Neben dem Platz ihres Vaters wartete noch immer Brashs Stuhl, als würde er gleich den Saal betreten. Für alle außer Ishabel war er immer der lächelnde, aufmerksame Thronfolger gewesen und sein Bruder Biran der stumme Schatten hinter ihm. Nun stand der Stuhl verwaist und Ishabel saß noch immer in ihrer Ecke.
Eines Tages würde sie dort sitzen, egal was ihr Vater sagte.
Von draußen drangen die Stimmen der Herzöge Mirash und Styeban herein. Zu schade, dass sich nach dem Bluthusten ausgerechnet diese beiden nach Golàbine zurückgewagt hatten. Was wollte der König mit zwei Beratern, die sich mehr mit ihrer Rivalität beschäftigten als mit dem Wohl des Reichs? Gerade heute, wo der König den Boten aus Levanon anhören würde, benötigte er guten Rat besonders dringend. Ein Bote aus Levanon. Wann hatte Sabinon das letzte Mal mit seinem Erzfeind gesprochen? Es musste Generationen her sein.
Der Auftritt der beiden Herzöge unterbrach Ishabels Überlegungen. »Verhandeln, verhandeln«, polterte Mirash. »Fällt Euch niemals etwas anderes ein?«
»Das Gleiche könnte ich Euch fragen. Wann habt Ihr jemals etwas anderes vorgeschlagen als Krieg, Krieg, Krieg?«
Die Schärfe in Herzog Styebans Stimme überraschte Ishabel. Am Hof galt als fraglich, ob der ewig lächelnde Styeban Gefühle überhaupt kannte. Oft erinnerte er Ishabel an einen listenreichen Fuchs, der offenen Konfrontationen stets aus dem Weg ging. Sein rötliches Haar zog sich an den Schläfen schon zurück. Dagegen verweigerten sich Mirashs Stirnlocken jeder Behandlung. Manchmal standen sie nach außen weg wie die Hörner eines Zuchtstiers. Ja, das waren die beiden: Fuchs und Stier. Wie passend, dass Styeban den Fuchs sogar im Wappen führte.
Jetzt entdeckte er sie in ihrer Nische und verneigte sich. Unter seinem Mantel blitzte weiße Spitze auf. Vermutlich verwünschte er noch immer seinen Schneider, der die Unverschämtheit besessen hatte, an der Seuche zu sterben. »Königliche Hoheit, welche Freude, Euch zu sehen.«
»Die Freude liegt ganz auf meiner Seite, Herzog Styeban. Euer Kommen lässt den Saal heller leuchten.«
Ihre übliche Spieleröffnung. Styeban flossen Komplimente von den Lippen wie Wasser aus einer Quelle, besonders wenn sein Konkurrent zuhörte. Ishabel würde niemals so mühelos Antworten finden wie ihre Mutter, doch mit Styeban fiel ihr das Üben leicht. So plauderte sie mit ihm über den Boten aus Levanon und genoss seine Spitzen über Sabinons Erzfeind. Styebans Worte waren schon immer seine schärfste Waffe gewesen.
Mirashs Miene verdunkelte sich. Auch er folgte dem Zeremoniell, aber er wählte die knappste Verneigung, die ihm das Protokoll noch gestattete. Nicht einmal die Königin hatte ihm früher ein Lächeln entlocken können. Vermutlich fühlte er sich nur in seinen Feldlagern zu Hause, wo Offiziere Befehle brüllten und kein Frauenlächeln die Lage verkomplizierte.
Ishabel verkniff sich eine bissige Bemerkung. Dass sich Mirash über ihren Austausch mit Styeban ärgerte, bedeutete Rache genug. Dann betrat ihr Königsvater das Kabinett und sie stellte ihre Überlegungen zurück.
König Badoran nickte ihr knapp zu, schickte alle Diener bis auf einen hinaus und eröffnete ohne Umschweife die Sitzung. »Meine Herren, auf uns wartet die schwierigste Aufgabe seit langem. Der levanische Bote, der draußen wartet, ist nicht nur der Mund, sondern auch das Ohr seiner Meister. Wenn wir ihn im Saal haben, will ich meine Herzöge ohne jedes Murren hinter mir wissen. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
Die beiden nickten.
»Also gut, meine Herren: An die Arbeit.«
***
»Ich kann es nicht glauben«, erklärte der König eine Stunde später, kaum dass sich die Tür des Kabinetts hinter dem levanischen Boten geschlossen hatte. Er kniff die Augen zusammen wie immer, wenn ihn seine Kopfschmerzen plagten. Sollte Ishabel den Hofmedicus rufen lassen? Nein, entschied sie. Die Debatte über den Boten ging vor und das Wohlergehen des Königs musste warten.
»Das ist kein Angebot, sondern eine Falle«, knurrte Mirash.
»Es ist zumindest originell.« Styeban klang hellwach. Man konnte förmlich zusehen, wie er die Information von allen Seiten auf ihren Nutzen hin abklopfte. Levanon, Erzfeind seit Generationen, machte ein Friedensangebot!
Auch Ishabels Herz schlug schneller. Die Levanyi hatten für ihren Vorschlag einen Zeitpunkt gewählt, der einfach misstrauisch machen musste. Warum nahmen sie das Risiko nicht in Kauf und griffen an? Einen Krieg würde Sabinon so kurz nach der Seuche nur schwer überstehen. Stattdessen hatte der levanische Diktator, ohne Sabinons Antwort überhaupt zu erfragen, ein Schiff mit Gesandten losgeschickt, das in ein paar Tagen hier in Golàbine eintreffen würde. Wozu diese Eile?
Styeban lehnte sich zurück. »Majestät, ich würde das Angebot annehmen.«
»Seid Ihr wahnsinnig?«, fuhr Mirash auf. Ein Wink des Königs brachte ihn zum Schweigen und Styeban konnte fortfahren.
»Levanon kennt unsere prekäre Lage genau, davon können wir ausgehen. Wollen die Levanyi den Rücken frei haben, um ihre inneren Streitigkeiten zu lösen? Oder beschäftigt man uns mit Verhandlungen, während man selbst Truppen zusammenzieht? Bei dem Zustand, in dem unsere Armeen sich befinden, wäre das aus Levanons Sicht die interessanteste Möglichkeit. Aber wir wissen es nicht. Wir sollten zuallererst die Absichten unseres Gegners ergründen.«
»Herzog Styeban verrammelt doch schon sein Burgtor, wenn in Levanon jemand einen Furz lässt«, blaffte Mirash übel gelaunt. »Dabei liegt unser Gegner am Boden, nicht wir. Euer Majestät, schickt den Boten weg. Oder besser noch: Lasst ihn aufhängen und erlaubt mir, den Levanyi den Rest zu geben.«
Styeban ignorierte die Beleidigung. »Ob es Euch gefällt oder nicht, wir gewinnen mehr, wenn wir verhandeln. Zum Beispiel Zeit, um unsere Armeen wieder aufzubauen …«
»Mein Heer steht. Ich brauche keine Zeit.«
» … und herauszufinden, was die Levanyi vorhaben. Also sollten wir verhandeln. Es besteht zumindest die vage Möglichkeit, dass sie es ernst meinen.«
Ishabel in ihrer Nische schüttelte den Kopf. Styeban irrte sich. Verhandlungen, die Erfolg haben sollten, brach man nicht übers Knie, sondern bereitete sie durch Diplomaten beider Seiten vor. Das Ganze roch nach einer Falle.
»Verhandeln«, schnauzte Mirash zurück und Ishabel musste ihm widerstrebend recht geben. »Habe ich es nicht gesagt? Einen dümmeren Rat habt Ihr selten gegeben. Wir sollten zuschlagen, so schnell wie möglich. Diese Chance bekommen wir nie wieder. Wenn sich erst der Rest der Herzöge in den Palast zurücktraut, wird nur noch geredet. Anstatt die Levanyi ein für alle Mal auszulöschen, verhandeln wir.«
Natürlich. Mirash wollte wieder einmal draufschlagen – etwas anderes beherrschte er nicht. Ishabel verdrehte entnervt die Augen.
Styeban dagegen lächelte sein spitzes Lächeln. »Ihr wollt also wieder einmal ganz allein entscheiden?«
»Unsinn. Ihr verdreht …«
»Nennt Ihr Eure persönliche Fehde etwa eine Beratung?«
Der König brauchte seine Stimme nicht zu erheben, die beiden Streithähne schwiegen augenblicklich. Mirashs Haltung verriet, wie viel Mühe ihm das bereitete. Ishabels Mutter hatte ihr beigebracht, auf Details zu achten: die Hand, die den Rand des Tischs umklammerte, das Schwellen der Kiefermuskeln, wenn er die Zähne zusammenbiss. Mirash würde keineswegs Ruhe geben. Er wartete nur auf die Gelegenheit zur Rache.
Ishabel ertappte sich dabei, in Gedanken hinaus auf die Terrasse zu wandern und zur Stadt hinabzublicken. Sie senkte den Blick auf ihr Tischchen, in dessen Marmorplatte der Steinmetz ein Cal-shòn-Spiel eingelassen hatte. Akribisch überprüfte sie die Aufstellung der marmornen Figuren, mit denen sie das dichte Geflecht der Intrigen am Hof für sich nachvollzog.
Zwischen den Schwertkämpfern behaupteten sich nur noch König, Sturmhaupt und Zweigesicht auf den verschlungenen Feldern der Spielfläche. Zwei Fürsten, wo früher ein Dutzend gestanden hatte. Ein König, wo drei das Feld beherrscht hatten. Das Spiel war klein geworden. Höchste Zeit, dass die Herzöge zurück an den Hof kamen.
»Diktator Nuridor ist immer noch damit beschäftigt, seine Feinde innerhalb von Levanon zu jagen, Majestät«, versuchte Mirash es erneut. »Mit einem schnellen Vorstoß können wir seine Flotte ausradieren, ehe sie auch nur den Hafen verlassen hat. Aber wir müssen handeln, und zwar sofort. Sobald Nuridor seine Gegner im eigenen Land besiegt hat, ist die Chance für immer vertan.«
Ishabel schob das Zweigesicht ein Feld nach vorn, eine Figur, die sowohl Offizier als auch Attentäter unter den eigenen Figuren sein konnte. Mirash, dachte sie. Der Herzog war ein mächtiger, aber gefährlicher Verbündeter. Er unterhielt nach dem König die stärkste Armee und regierte mit Nepham die zweitgrößte Stadt Sabinons. Wann immer möglich hielt sich Mirash bei seinen Soldaten auf und schlug die Angriffe levanischer Piraten auf seine Küsten zurück. Bei seinen Vergeltungsangriffen auf Levanon bewies er dagegen weit weniger Geschick.
Das schien auch Styeban so zu sehen. »Nuridors Armee mag in Levanon gebunden sein, seine Schiffe sind es keineswegs. Sagt, wie viele Galeeren habt Ihr mittlerweile gegen ihn verloren? Oder habt Ihr lieber aufgehört zu zählen?«
Ishabel zog mit dem Sturmhaupt. In ihrer Phantasie hieß es Styeban und trug weiße Spitze. Das Geflecht aus schwarzen und weißen Figuren löste sich vor ihren Augen in Linien und Flächen auf. Das Zweigesicht – Mirash – stand in Angriffsposition, aber kein Offizier deckte es.
Styeban hatte seinen Gegner bloßstellen können. Dieses Mal würde er den Sieg davontragen. Er war ein glänzender Stratege, aber seit Mirash ihm in der Gunst des Königs den Rang abgelaufen hatte, beschäftigte er sich mehr mit kleinlicher Rache als mit dem Wohl und Wehe des Reichs.
Ishabel griff schon nach der Königsfigur und zog die Hand wieder zurück. Vater würde seine Meinung nicht ändern. Und tatsächlich. Als würde die Figur ihn steuern, erwiderte der echte König knapp: »Die Flotte bleibt unter meinem Befehl. Ich weiß, welchen Blutzoll Ihr gegen Levanon gezahlt habt, Herzog Mirash. Aber Eure eigenen Angriffe haben bislang nichts geändert. Ich werde Euch keine Erlaubnis für einen Feldzug gegen Levanon geben.«
Unsinn. Herzog Mirash hatte keinen Blutzoll gezahlt. Er hatte seinen Angriff geplant wie ein Dilettant.
Sie zog das Zweigesicht ein Feld nach hinten, sah auf und fand die Blicke der drei Männer auf sich gerichtet. Die Stille dröhnte in ihren Ohren. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie ihren Gedanken laut ausgesprochen hatte.
»Ihr gründet Euer Urteil wohl auf die Figürchen da«, schnappte Mirash, dessen Brauen sich bedrohlich zusammengezogen hatten.
Ishabel ignorierte den beleidigenden Ton und das hektische Klopfen ihres Herzens. »Um das zu erkennen, brauche ich keine Figuren, Herzog. Ihr seid ein hervorragender Taktiker bei der Verteidigung Eurer Küsten. Würdet Ihr Euch auf das konzentrieren, was Ihr am besten könnt, dann hätte Levanon weit höhere Verluste zu beklagen. Leider glaubt Ihr, im Angriff allein läge Ehre. Aber so erfolgreich Ihr vor Euren Küsten operiert, so wenig versteht Ihr von der Auswahl der Ziele beim Angriff, von Nachschub und dem richtigen Zeitpunkt für einen Rückzug. Mein Vater tut gut daran, die Flotte in seiner Hand zu behalten.«
Ihr Vater starrte sie verblüfft an. Styebans Augenbrauen wanderten nach oben.
Mirash lief dunkelrot an. Er erhob sich von seinem Stuhl und beugte sich über den Tisch, als wollte er nach Ishabel greifen. Seine Stimme klang gepresst. »Königliche Majestät, von einer Frau, die noch nie im Leben ein Schwert gehalten hat, muss ich mir so etwas nicht sagen lassen. Nicht einmal, wenn diese Frau Eure Tochter ist.«
Auch der König schien das so zu sehen. »Ishabel, dein Platz ist in der Nische, nicht hier am Tisch. Du hast zu lauschen und zu schweigen. Ist das klar?«
»Aber …«
»Ist das klar?«
Nun stieg auch Ishabel die Zornesröte ins Gesicht. »Jawohl, Majestät«, brachte sie heraus.
»Dann halte dich an meine Anweisungen.«
Damit wandte ihr Vater sich ab und führte die Diskussion fort, während Ishabel in der Nische an ihrer Wut zu ersticken drohte. Erst nachdem sie sich in mehreren Varianten vorgestellt hatte, wie Mirash an den Schandpfahl gekettet wurde, konnte sie dem Gespräch wieder folgen. Gerade beugte sich der König vor und erklärte: »Ich habe mich entschieden. Wir werden die levanische Delegation empfangen.«
Mirash holte tief Luft. »Jahrelang haben sie meine Küsten verheert, und jetzt soll ich ihnen in meinem eigenen Land die Hand reichen? Eher spucke ich ihnen ins Gesicht!«
»Das werdet Ihr nicht tun.« Die Stimme des Königs klang eisig. »Entweder Ihr nehmt an den Verhandlungen teil wie die übrigen Herzöge, als Gast in meinem Palast. Oder Ihr zieht Euch nach Nepham zurück, bis die Delegation abgereist ist. Wählt selbst.«
Diesem Ton beugte sich sogar Mirash, registrierte Ishabel zufrieden und schob die Königsfigur nach vorn. Nicht einmal ein Herzog von Nepham durfte sich alles herausnehmen, selbst wenn er sich aufspielte, als wäre er und nicht Badoran der Herrscher Sabinons.
Styeban nutzte seine Chance. »Was wolltet Ihr auch tun? Die Delegation in ihren Betten ermorden? Wer jetzt an Angriff denkt …«
Doch nach der Niederlage von gerade eben ließ sich Mirash erst recht nicht von seinem Konkurrenten vorführen. »Das Einzige, was Levanon jemals interessiert hat, ist die Vernichtung seiner Gegner. Ihr seid ein Dummkopf, wenn ihr das nicht begreift.«
Ishabel versetzte dem Sturmhaupt einen Stoß, der es umkippte. Der echte Styeban verstummte, wie immer, wenn Mirash ihn abkanzelte oder eine Niederlage drohte. So wie im vergangenen Winter, als er mitten in der Epidemie mit einem Heiratsantrag an Ishabel herangetreten war. Sie war vollkommen überrumpelt gewesen und hatte ihn mit ein paar hohlen Phrasen abgespeist. Styeban hatte ihre Zurückweisung lächelnd und mit einer Verneigung zur Kenntnis genommen und nie wieder darüber gesprochen, als hätte er nichts anderes erwartet. Es hatte gewirkt, als ob er sich selbst nicht glaubte. Nein, als ob er einen Zug auf dem Spielbrett ausprobierte und die Taktik wechselte, sobald sie nicht den gewünschten Erfolg brachte. Man unterschätzte ihn viel zu schnell. Schon viel zu oft hatte er Ishabel im Cal-shòn besiegt, weil sie seine defensive Strategie für Schwäche gehalten hatte. Gegen Mirash dagegen verlor er im Rat jedes Rededuell. So gewann man kein Spiel, nicht vor dem Thron.
Vater konnte einem leidtun. Ein Großmaul und ein Intrigant waren seine wichtigsten Berater.
***
»Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, mir zu widersprechen und Herzog Mirash zu beleidigen?«
Vaters beeindruckender Bauch drohte Ishabels Spieltisch umzuwerfen. Die Krankheit hatte ihn viel von seiner alten Stärke gekostet und in letzter Zeit quälten ihn immer häufiger Kopfschmerzen, aber seit einiger Zeit hatte er zumindest wieder den früheren Umfang.
Ishabel verzichtete darauf, den Medicus zu rufen. »Ist es tatsächlich bereits eine Beleidigung, wenn ich eine Einschätzung der Lage abgebe, noch dazu eine präzise?«
Der König schwieg, aber Ishabel hatte auch keine Antwort erwartet. Beide wussten, dass Mirash niemals von einer Frau einen Rat annehmen würde.
Badoran winkte dem Kammerdiener, Wein zu bringen. »Und? Was hast du beobachtet?«
»Das Gleiche wie immer. Styeban rät zu Verhandlungen, Mirash will nichts anderes als dreinschlagen.«
»Wundert es dich?«
»Ausnahmsweise nicht. Levanon war noch nie so schwach wie heute, das weckt Mirashs Gier. Er glaubt tatsächlich, er könnte alte Scharten auswetzen und seinem Feind eine Lektion erteilen. Da kommt ein Friedensangebot eher ungelegen.«
»Also sollten wir zu den Waffen greifen.« Vater verschränkte die Arme, sein übliches Signal für ein Rededuell. Überzeuge mich, forderte er oft, um dann den entgegengesetzten Standpunkt einzunehmen, ganz gleich, wofür sie argumentierte.
Also gut. Resolut räumte sie weitere weiße Figuren vom Spielbrett. »Zu welchen Waffen willst du denn greifen? Wie führt man Krieg ohne eine Armee?«
»Herzog Mirash hat eine starke Hausmacht – zu stark, denke ich manchmal. Es kann uns eigentlich nur recht sein, wenn er seine Männer gegen Levanon richtet und nicht gegen die Reste unserer Garde.«
Beinahe musste Ishabel lachen. »Ein Haufen Bauernjungen und Hirtensöhne? Bis er daraus etwas geformt hat, das den Namen Armee verdient, werden Monate, vielleicht Jahre vergehen. Wenn er sie jetzt in den Krieg schickt, kann er auch gleich die Gräber für sie ausheben lassen.«
Natürlich wusste Vater das. Nirgendwo hatte der Bluthusten so erbarmungslos gewütet wie in der Enge der Soldatenbaracken. In den Reihen der Königsgarde hier in Golàbine klafften riesige Lücken, aber Mirashs Armee hatte es noch viel schlimmer getroffen. Seine Soldaten, die vor Nepham lagerten, waren gestorben wie die Fliegen. Er hatte die Sache auf seine Weise gelöst und abgewartet, bis der Bluthusten sich seine Opfer geholt hatte. Dann hatte er die von der Seuche Verkrüppelten davongejagt und die Baracken bis auf die Grundmauern niederbrennen lassen. Anschließend waren seine Greifer durch die Dörfer gezogen und hatten jeden Mann, der eine Waffe halten konnte, in seine neue Armee gepresst, während die Ernte auf den Feldern verdorrte.
»Also sollen wir auf ihr Angebot eingehen und zusehen, wie Levanon in alter Stärke aufersteht?«, setzte der König seine Erprobung fort.
Ishabel griff in die Figurenschachtel. Mit fliegenden Händen baute sie eine neue Spielsituation auf. Die Schwarzen traten nur mit der Hälfte ihrer Offiziere gegen die weiße Festung an, doch auf der Seite der Weißen klafften noch größere Lücken. Kaum ein Offizier stand noch auf dem Feld und von den Schwertkämpfern und Lanzenträgern auch nicht mehr. Die Figuren reichten gerade aus, um die Festung zu verteidigen.
Sie deutete auf die Schwarzen. »Im vergangenen Jahr haben die Levanyi einander erbarmungsloser bekämpft, als wir das jemals tun könnten. Eine ideale Situation für einen Angriff, könnte man meinen.«
»Mirashs Worte.« Der König musterte ihre Aufstellung.
»Weil er nicht sehen will, wie es um uns selbst steht, Vater. Levanon hat vielleicht keine Offiziere, aber wir besitzen nicht einmal ein Heer.«
»Wir haben unsere Flotte.«
Ishabel lachte spöttisch. »Ja, die Galeeren der Krone möchte unser fabelhafter Mirash nur zu gern gegen Nuridor führen, nachdem er seine eigenen leichtfertig verspielt hat. Wir können von Glück reden, wenn Levanon nicht begreift, wie schwach wir tatsächlich sind. Nichts wäre ihnen lieber, als deine Haut ans Palasttor zu nageln. «
»Mirash sieht das ganz anders.«
Glaubte Vater etwa Mirashs Prahlereien? Ein erschreckender Gedanke. Nein, das musste eine weitere Prüfung sein.
»Er kann noch so laut mit den Stiefeln knallen, seine Armee steht noch schlechter da als unsere. Ich frage mich, Vater, wozu du überhaupt noch Beratungen abhältst. Kennst du die Phrasen deiner Berater nicht schon längst auswendig?«
Das beendete ihre Prüfung. »Gütige Götter, Ishabel, wir werden eine Delegation der Levanyi empfangen! In wenigen Tagen wird der Palast nicht nur von Herzögen überfließen, sondern auch von einer Bande Levanyi. Wie könnte ich in dieser Situation meine engsten Berater ignorieren?«
Ishabel schwieg. Auch sie beide kannten ihre Argumente auswendig.
»Außerdem binde ich sie an mich«, schob er unbeholfen nach.
»Nein, Vater. Du gibst ihrer Eitelkeit eine Bühne und merkst nicht, wie schwach dich das wirken lässt.«
Jetzt hatte sie ihn verärgert. »Zurück zu deinen Beobachtungen«, verlangte er frostig. »Was hast du noch gesehen?«
»Fuchs und Stier«, rutschte es ihr heraus. Er runzelte die Stirn und sie sprach eilig weiter. »Mirash hält sich für ein militärisches Genie. Wenn du es ihm erlaubtest, würde er nicht nur deine Flotte nehmen, sondern auch die Königsgarde, und uns zu Tode siegen. Als Verbündeter ist er wichtig, als oberster Feldherr eine Gefahr für das Reich. Wenn er einen vermeintlichen Sieg vor Augen hat, kann man ihn kaum bändigen.« Sie hielt inne, aber ihr Vater massierte lediglich seine Schläfen. Anscheinend quälten ihn die Schmerzen heute besonders. Abwesend bedeutete er ihr, fortzufahren.
Ishabel überlegte einen Moment. »Styeban hat es beinahe aufgegeben, seine Meinung zu vertreten. Für ihn wäre es gut, wenn jemand Mirash zurückhält, ohne ihn zu beleidigen.«
»Und wer sollte das deiner Meinung nach sein?«
»Die anderen Herzöge. Und ich.«
Badoran ignorierte ihren Vorschlag. »Du hast präzise beobachtet, deine Mutter hätte ähnlich geurteilt. Aber du hast etwas Wichtiges übersehen.«
Natürlich. Wie hatte sie auch annehmen können, ihr Vater würde auch nur ein einziges Mal einen Ratschlag von ihr annehmen? Ishabel spürte ihre Enttäuschung fast körperlich. Sie könnte ihn in vielem genauso gut beraten wie seine Herzöge – und er steckte sie in Mutters Nische und hieß sie Gesichtszüge zu studieren.
Sie schwieg. Ganz sicher würde sie ihm nicht den Gefallen tun, auch noch um Kritik zu betteln.
Der König griff sich eine der Figuren und drehte sie zwischen den Fingern. »Anders als du glaubst, denkt Styeban nicht an Rache. Er versucht, den Herzog für ein paar Tage schlecht aussehen zu lassen, damit ich Mirashs Rat nicht zu schnell folge. Ich weiß es und er weiß, dass ich es weiß. Aber wie immer setzt er seine Figuren und beobachtet die Wirkung seiner Züge. In ein paar Tagen, wenn die Herzöge aus dem Süden anreisen, ist Mirash wieder in der Minderheit. Du wirst sehen, dass Styeban sich dann zurücknimmt.«
Ishabel musterte ihn. »Genau so etwas solltest du mir viel häufiger beibringen.«
Die Miene ihres Vaters verfinsterte sich. »Ich brauche deine Beobachtungen, nicht deine Meinung. Ganz wie deine Mutter es gehalten hat.«
»Ich bin nicht wie Mutter.«
Gütige Götter, warum ärgerte sein Lob sie immer so? Ishabel kannte die Antwort. Mutter hatte ihr ganzes Leben lang nichts getan, als hier zu sitzen und Vater ihre Beobachtungen mitzuteilen.
Badorans Stimme klang scharf. »Niemand ist wie deine Mutter, Ishabel.«
Sie hätte es wissen müssen. Seit die Königin am Bluthusten gestorben war, hatte sie sich in Vaters Erinnerung in eine Heilige verwandelt. Ihr nachzueifern, musste das Lebensziel seiner Tochter sein, unausweichlich und gleichzeitig so unerreichbar wie die Sonne.
»Sagst du nicht immer, wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, Vater? Du hast recht, ich werde es niemals aushalten, still und folgsam im Erker zu sitzen.« Sie zögerte einen Moment. »Und du hast keinen Nachfolger.«
»Ich werde einen auswählen.« Vater klang gereizt.
Ishabels Wangen glühten. »Welch großartige Auswahl du doch hast! Zwischen einem Kriegstreiber, der nur auf deine Armee schielt, und einem Feigling mit spitzer Zunge. Unter deinen Gefolgsleuten gibt es nicht einen, der wie ein König denkt.«
Badoran schwieg und sie konnte fortfahren.
»Ich kann dir nicht nur zeigen, wo Mirashs Feldzug scheitern wird, sondern auch, wo er als König versagen würde. Setz jemand anderen an meinen Platz, um deine Herzöge auszuspähen, und bring mir endlich etwas Neues bei. Um der Liebe zu unserer Heimat willen, bring mir bei, wie man regiert!«
Sie hatte immer lauter gesprochen. Beim letzten Satz schlug sie mit der Hand auf den Tisch, so dass die Figuren auf dem Spielbrett durcheinanderrollten. Gütige Götter, sie wusste, dass sie das Richtige forderte.
»Regieren bedeutet mehr, als ein paar Figuren auf dem Spielbrett zu bewegen.«
Ishabel ignorierte die Zurückweisung. »Was ist, wenn dir etwas zustößt? Wenn dein Thron eines Tages leer steht?«
Der König erstarrte. Dann legte er mit einer kontrollierten Geste seine Hände auf das Tischchen. »Auf dem Thron wird dein Ehemann sitzen. Deinen Brüdern hätten die Herzöge die Treue geschworen. Aber dir? Niemals. Du hast Mirash gehört.«
»Meine Brüder sind tot.« In ihrer Wut packte sie eine Spielfigur und schmetterte sie auf den Boden. »Tot! Ich lebe, Vater, aber du wirfst deinen Herzögen den Thron des Hauses Golàbine vor die Füße, als gäbe es kein Morgen.«
»Deine Mutter gab sich damit zufrieden –«
»Was ist, wenn Mutter genauso unglücklich war wie ich?«
Der Spieltisch zerbarst krachend an der Wand über ihr, Schwertkämpfer und Offiziere regneten auf sie herab. Ishabel schrie auf und schützte ihr Gesicht mit den Armen vor Steinsplittern und Spielfiguren. Gütige Götter, was war in ihren Vater gefahren?
Mit einem Wutschrei warf Badoran die Tischplatte dem Diener hinterher, der sich eilends hinter den Kabinettstisch flüchtete, und trat eine Spielfigur gegen die Wand, wo sie zersplitterte. Lange stand er da und wandte Ishabel den Rücken zu.
»Du wirst niemals wieder so über deine Mutter sprechen, hörst du? Niemals. Sie war die beste Königin, die beste Frau, die jemals …« Die Stimme versagte ihm und seine Schultern zuckten.
Das Weinen ihres Vaters erschreckte Ishabel mehr als sein Wutausbruch. Zum ersten Mal begriff sie, wie sehr Mutters Tod ihn getroffen hatte. Was blieb ihm in diesem Leben? Ein Reich, das der Bluthusten leergefegt hatte, eine Handvoll Herzöge, die auf seinen Thron schielten, und eine Tochter, die ihm nicht mehr gehorchte.
Und Ishabel würde ihm nicht mehr gehorchen, nicht einmal, wenn er mit dem Thronsessel nach ihr warf.
Badoran drehte sich mit geröteten Augen um. »Du glaubst also, du wärst etwas Besseres als deine Mutter.«
»Nein. Ich bin lediglich etwas anderes.«
In Badorans Gesicht zuckte es wie unter einer besonders schweren Schmerzattacke.
»Also gut, Königin Ishabel. Dann beweise mir, was du kannst. Du wirst an den Ratssitzungen teilnehmen. Erkläre du dem Rat, wie du mit Levanon zu verfahren gedenkst. Verweise du meine Herzöge in ihre Grenzen. Ich freue mich schon darauf, zu sehen, wie du Herzog Mirash an die Kandare nimmst.«
Ishabel richtete sich auf. Hatte er das wirklich gesagt? Eine fieberhafte Unruhe bemächtigte sich ihrer. »Vater, ich danke dir. Ich werde mich deiner würdig …«
»Unterdessen spreche ich mit Mirash. Meine Geduld ist am Ende. Sobald die Levanyi abgereist sind, wirst du ihn heiraten.«
»Nein.« Ishabel trat entsetzt einen Schritt zurück. Das konnte nicht wahr sein. »Nein. Du wirst mich nicht mit diesem – diesem Soldatenstiefel verheiraten. Du wirst das Reich nicht einem …«
»Du willst mir befehlen?«
»Nicht ihn.« Ein glühender Knoten zog sich in ihrem Bauch zusammen und unwillkürlich ballte sie die Fäuste. »Niemals. Eher stürze ich mich vom Palastfelsen.«
Sie wartete seine Antwort nicht ab. Vorbei an den Trümmern des Spieltischs rannte sie aus dem Kabinettssaal. Die großen Augen ihrer Zofe Ilya und der Hofdamen ignorierend, erreichte sie die Terrasse, die auf den Golàbine-Fjord hinabsah.Der heiße Wind des Sommermorgens packte ihre Haare und zerriss die kunstvollen Zöpfe, die Ilya hineingeflochten hatte.
Die Brüstung trug noch Reste der Nachtkühle in sich. Ishabels Finger fanden blind die vertrauten Kerben und Scharten. Auf der Geschützbatterie unter ihr kauerten die Wurfmaschinen wie erstarrte Fabeltiere.
»Königliche Hoheit …?«, ertönte die Stimme der Zofe hinter ihr. Mit einer herrischen Handbewegung schickte Ishabel sie fort. Sie brauchte wenigstens einen einzigen Moment Ruhe vor allen, die etwas von ihr wollten.
Allmählich beruhigte sich ihr Atem und die Wut vernebelte ihr nicht mehr den Blick.
Von hier aus sahen die Magazine am Hafen, die Golàbine reich gemacht hatten, kleiner als Schmuckschatullen aus, die Paläste der Kaufleute wirkten wie zierliche Puderdosen und die Schiffe, die fast senkrecht unter ihr den Palast passierten, hätten auf ihrem kleinen Finger Platz gefunden. Golàbine die Goldene, die größte Stadt des Inselrundes. Golàbine, die den Bluthusten abgeschüttelt hatte wie Ishabel die Erinnerung an ihre Brüder, und auferstanden war in ihrer alten Pracht. Und all das sollte Mirash in die Hände fallen? Er würde die Warenlager gegen Kasernen tauschen, die Paläste gegen Festungen, und Golàbines Herrlichkeit vergeuden in nutzlosen Angriffen gegen Levanon.
»Niemals«, flüsterte sie. »Er bekommt dich nicht. Das lasse ich nicht zu, ich schwöre es.«
»Ishabel.« Die Stimme ihres Vaters ließ sie herumfahren. Er lehnte sich neben ihr an die Balustrade. »In einer Sache hast du recht. Wir warten schon zu lange. Der Umsturz in Levanon beunruhigt das Volk. Die Leute wollen wissen, was die Zukunft ihnen bringt.«
»Dann präsentiere ihnen die zukünftige Königin«, fuhr sie auf. »Zeig ihnen, wer sie regieren wird, wenn du einmal nicht mehr bist.«
Doch Badoran ging nicht auf die Herausforderung ein. »Es wird keine Königin geben, Ishabel. Das ist mein letztes Wort. Ich werde ihnen den Mann zeigen, der mir auf den Thron folgen wird, sobald die Levanyi abgereist sind.«
»Nein, Vater.« Tränen schwammen in ihren Augen. Sie ballte die Fäuste, bis ihre Nägel ins Fleisch bissen. Niemals mehr weinen, das hatte sie sich vor langer Zeit geschworen. »Du zeigst ihnen den Mann, an den du den Thron verschleuderst, und denkst, du könntest das Volk mit einer Posse zufriedenstellen.«
Den Blick, den er ihr zuwarf, konnte Ishabel nicht deuten. Darin lag weder Angst noch Zorn, sondern etwas Unbestimmtes, das ihn so unerbittlich von ihr wegzog, als hätte er Angst und Zorn schon lange hinter sich gelassen. Wortlos wandte sich der König ab und ließ sie mit ihrem inneren Aufruhr allein.
Willkommen
Im ersten Licht der Morgendämmerung mühte sich die Westwind einen Wellenrücken empor und glitt ins nächste Tal hinab. Ein warmer Wind schob sie auf Sabinon zu, dessen Küste vor ihnen aus dem Dunst auftauchte. Bald würde Shevon den Fjord erblicken, der das Küstengebirge durchschnitt, den Königspalast auf seinem Felsen, das goldene Golàbine. Er würde die reichste und gierigste Stadt des Inselrundes betreten mit nichts als dem Gürtelmesser seines Vaters und einer Spielfigur in der Tasche.
Bald konnte er durch die Straßen schlendern, ohne darauf zu achten, wer ihm nachblickte, mit dem Finger auf ihn zeigte, ihn an die Stadtwache verriet. In einem Wirtshaus essen, mit dem Rücken zur Tür, einfach so … wenn man ihn überhaupt willkommen hieß und nicht zurück in sein Verderben schickte.
Er begrub den Gedanken bei den Bildern von Blut und Tod, die ihn an Deck getrieben hatten, um Morgenluft und Salz zu riechen. Sabinon hasste Levanon und seinen neuen Herrscher. Sabinon würde ihm helfen.
Sein Blick fiel auf die Galeere.
Sie näherte sich von achtern und holte auf. Das musste einer der Späher sein, von denen sie in Gurud Hunderte bauten. Schlanker Rumpf, Dreieckssegel, zwei Reihen Ruder. Wenn die Galeere sich über einen Wellenberg schob, durchbrach ihr Rammsporn die Wasseroberfläche. Am Bug starrten Falkenaugen über die See. Auch auf dem Segel prangte der Falke, das Wappen der al Gireds. Er bewegte sich mit jeder Bö, als wäre die Galeere ein Raubvogel, der auf Beute lauerte.
Sie hatten ihn gefunden.
Shevon wollte sich in den Schutz des Schanzkleids fallen lassen, doch sein Körper hatte sich in ein Stück der Reling verwandelt, hölzern und unbeweglich. Schweiß brannte ihm in den Augen, aber er konnte die Hand nicht heben, um ihn abzuwischen. Hilflos musste er zusehen, wie die Galeere aufholte, bis sie nur ein paar Steinwürfe entfernt mit der Westwind gleichzog. Der Blick des Falkensegels erfasste ihn.
Das Sausen des Windes, die Rufe der Matrosen, das Poltern der Galeerenruder in ihren Widerlagern, der dumpfe Klang der Pauke, die sie im Takt hielt: Alles wurde leiser und immer leiser. Er stand – nein, lag – in verkrampfter Haltung unter einem Tisch. Kein Segel blähte sich über ihm, keine Morgenröte spiegelte sich in den Wellen. Der Schein unzähliger Kerzen erleuchtete den Thronsaal in Diktator Nuridors Palast. Der Blick des Falkenauges auf dem großen Wappen an der Stirnwand des Saals durchbohrte ihn.
***
Sie haben mich gefunden.
Das Attentat trifft die Festgesellschaft beim Hauptgang. Gardisten des Diktators marschieren in den Saal und schlachten die Senatoren ab, die hilflos sind vom Wein und dem Schlafmittel, das man ihnen hineinmischte. Schwertklingen und Schädel knallen gegen die Tischplatte, von Angst und Wein verzerrte Stimmen flehen um Gnade, gelallte Verwünschungen ersticken in Ächzen. Weg, nur weg!
Ich bin unter einen der niedrigen Tische gekrochen. Gütige Götter, helft mir! Weiter, immer weiter, unter der Festtafel entlang auf den Ausgang zu. Ein fetter Senator fällt auf sein Polster zurück. Lercon? Ist das Lercon? Der Getroffene öffnet den Mund zum Todesschrei. Einen Augenblick später sehen die Federn eines Bolzens daraus hervor. Seine Hand mit dem Siegelring daran baumelt vor mir, baumelt und kommt zum Stillstand, und ich erbreche mich, bis nur noch Galle herauskommt. Draußen neben den Tischen und Liegen bewegen sich Schatten, treten Sandalen auf schlaffe Hände, ergießen sich Rinnsale aus Blut auf den Boden. Das Ensemble auf der Bühne am Rand des Saals ist längst vor dem Totentanz geflohen. Nicht ein Ton dringt zu mir durch, als hätte ich niemals Ohren besessen.
Ein Armbrustbolzen. Genau zwischen den Fingern meiner Hand bohrt er sich in das Holz und ein Tropfen Blut quillt hervor. Sie haben mich gefunden. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Tote, überall Tote. Ihre starren Augen klagen mich an, ihre Beine bilden tückische Fallen. Ich bin allein. So allein.
Das Ende des Tischs. Vor mir eine Wand und die Sandalen der Wachen. Sie erschlagen jeden, der es bis hierher geschafft hat. Blut sammelt sich in einer immer größeren Lache, die träge auf mich zufließt. Ich bin in die falsche Richtung geflohen, in den Saal hinein. Zurück!
Vorn am Ausgang für die Sklaven steht Regul al Gired und versperrt das Eingangsportal. An seiner Hand trocknet das Blut seines Vaters Nuridor, den er vor meinen Augen ermordet hat. Er betrachtet das Massaker mit Kennermiene und nickt, wenn ein gut gesetzter Hieb auf sein Opfer niederfährt. Sein Blick streift umher und findet mich.
Er lächelt.
***
»Shevon!«
Er musste weg. Er musste verschwinden, bevor …
»Shevon, kannst du mich hören?«
Hände hielten ihn gepackt. Er musste sich befreien, er musste hinaus aus dem Saal, aber es war, als hätte ihn jemand gefesselt.
»Shevon, ich bin es, Meron. Sieh dich um, hörst du? Sieh dich um.«
Gleißendes Licht durchbrach den Kerzenschein des Mordgelages. Durch die Stille drangen wie aus großer Ferne die Schreie der Möwen, das Blut roch nach Tang und Salz und seine Hände krallten sich in rissiges Holz. Er versuchte die Hände zu lösen, aber sie schienen mit der Reling verwachsen. Ein Splitter stak im Zeigefinger. Blutstropfen quollen hervor und färbten das graue Holz dunkel. Shevon würgte, aber nichts kam aus seinem Magen.
Wieder schüttelte ihn Meron. »Sieh mich an, Junge. Du bist auf meinem Schiff. Hier ist nur der alte Meron. Niemand tut dir etwas an. Lass die Reling los, du ruinierst dir ja die Finger. Gut so, ja. Sieh mich an.« Merons Augen, graugrün wie das Meer nach einem Sturm, lotsten ihn in die Gegenwart zurück. »Es ist vorbei, Shevon. Vorbei.«
Erst als es Shevon gelang, zu nicken, ließ Meron ihn los. Die Schreie der Möwen vertrieben die letzten Geräusche des blutigen Festmahls.
»Ich … es war …«
»Ich weiß.«
Shevon blickte sich um. »Eine Galeere hat uns passiert, ein Späher. Er kam aus Levanon.«
»Ich weiß. Man trifft sie immer häufiger. Sind verflucht schnell, die Dinger. Und Regul baut immer mehr davon.« Unruhe schwang in Merons Stimme mit.
»Der Steuermann hat mich gesehen. Warum haben sie mich nicht geholt?«
»Warum sollten sie ein Handelsschiff aufhalten?«
Weil Regul alles dafür tun würde, um ihn zu erwischen. Shevon versuchte vergeblich, das Zittern der Hände unter Kontrolle zu bekommen.
Meron schien seine Gedanken zu erraten. »Sie werden dich nicht finden. Sieh dich um. Gleich passieren wir den Königspalast.«
Das offene Meer lag hinter ihnen. Die Westwind manövrierte durch einen Fjord, der zu beiden Seiten von Wänden aus schwarzem Fels begrenzt wurde, mit dem Kot zahlloser Seevögel beschrieben und gekrönt von dichtem Wald.
»Höchste Zeit, dass wir ankommen«, brummte sein Beschützer.
Shevon antwortete nicht. Wortlos lehnte er an der Reling und richtete seinen Blick auf die Basaltsäulen, höher und immer höher, bis er sich an den Mauern des Königspalastes von Golàbine brach. Weiße Türme griffen nach dem Himmel. Brücken wie aus Elfenbein geschnitzt überspannten die Abgründe zwischen den Felspfeilern, auf denen die Gebäude standen. Die bunten Ziegel der Dächer funkelten in der Morgensonne. Der Palast schien über dem schwarzen Felsen zu schweben, als hätte er nichts mit dem Grund gemeinsam, auf dem er stand.
»Ein Märchenschloss.« Meron klang so stolz, als gehörte der Palast ihm. »Mit einer Märchenprinzessin darin, so schön wie der junge Morgen. Manchmal steht sie an der Balustrade und sieht auf ihr Reich herab.«
Shevon kniff die Augen zusammen, doch er konnte niemanden erkennen.
Wusste eine Prinzessin, wie leicht ihre Welt in Trümmer fallen konnte? Der schwarze Fels zerbröckelte vor seinen Augen. Flammen schlugen durch das Dach des Palastes, die weißen Türme schwankten und stürzten ins schäumende Meer …
»Shevon, bleib wach.«
Er schüttelte sich und das Bild verschwand, doch der Schreck blieb. Meron hatte recht, versuchte er sich zu beruhigen. Dies hier war Golàbine, die goldene Stadt, nicht die Ruine seiner alten Heimat. Sabinons Hauptstadt würde unter nichts anderem begraben werden als unter ihrem eigenen Gold.
***
Als die Westwind schließlich am Kai festmachte, stand die Sonne bereits hoch am Himmel. Der Lärm des Hafens schnürte Shevons Kopf ein. Lastenträger und Fuhrleute brüllten durcheinander in einer kehligen Sprache, von der er kein Wort verstand. Was hatte ihm sein sabinoischer Hauslehrer eigentlich beigebracht?
»Hafensprache.« Meron knuffte ihn in die Seite. »Mach dir keine Sorgen. In den Häusern der Kaufleute wirst du jedes Wort verstehen, ganz zu schweigen vom Palast. Du sprichst doch Sabinoisch?«
Shevon nickte, doch das Band um seinen Kopf zog sich weiter zusammen. Mit einem dumpfen Knall schlugen die Bohlen auf der Kaimauer auf.
Meron fluchte. Shevon folgte seinem Blick zur anderen Seite des Hafenbeckens, wo das Falkenauge am Bug der Galeere zu ihm herüberstarrte.
Er musste hier weg. Mechanisch setzte er sich in Bewegung.
Meron packte ihn am Ärmel. »Halt, mein Lieber. Wir verlassen das Schiff erst mit Erlaubnis des Hafenkommandanten, keinen Moment früher.«
Shevon versuchte Merons Hand abzuschütteln, doch der hielt eisern fest. »Immer schön langsam, Junge. Sabinon heißt jeden willkommen, der Geld ins Land bringt – außer er kommt aus Levanon. Warte ab, lass mich reden und halt bloß den Mund, ja?«
Shevon nickte, ohne ein Wort aufzunehmen. Das Falkenauge schien ihm zuzublinzeln und er biss sich von innen in die Backe, bis er Blut schmeckte.
Der Hafenkommandant traf in Begleitung einer Abteilung Uniformierter ein. Das Stöckchen in seiner Rechten verteilte die Männer auf die Frachträume, wo sie jeden Posten auf den Frachtlisten so genau prüften, als hätte das Schiff nicht Gewürze und Getreide, sondern Schwerter und Soldaten geladen. Auch die Kabinen wurden durchsucht.
»Und der da?« Der Kommandant deutete auf Shevon.
»Der Sohn eines Freundes, Exzellenz. Ein tragisches Unglück hat seine Familie ausgelöscht. Ich habe ihn in meine Dienste genommen.«
»Er steht nicht auf der Liste. Also wird er die Stadt nicht betreten.«
Willkommen in der neuen Heimat, dachte Shevon.
Meron lächelte etwas gequält. »Ich bürge für ihn.«
Dunkle Augen musterten Shevon. »Wo soll er wohnen?«
»In meiner Villa in der Oberstadt, Exzellenz.«
»Name?«
»Shevon Madrim al Yontar«, antwortete Shevon leise, bevor Meron ihn unterbrechen konnte. »Ich bin der Sohn des Senators Shacon al Yontar.«
***
»Idiot«, zischte Meron, der neben ihm in der Halle der Hafenkommandantur saß. »Sohn des Senators … Bist du von allen guten Geistern verlassen? Jetzt wird es noch teurer, dich ins Land zu bringen.«
Shevon verstand nicht, was Meron so wütend machte. »Warum haben wir ihm nicht einfach das Bestechungsgeld zugesteckt?«
»Als Levany wirst du hier für Bestechung aufgeknüpft.«
»Als Levany? Du lebst seit über elf Jahren hier.«
Meron lachte bitter. »Glaubst du etwa, das macht mich zu einem Einheimischen? Nein, wir zahlen keine Bestechung. Nur eine etwas höhere Gebühr. Vier Dutzend sabinoische Goldkronen, um genau zu sein.«
»Vier Dutzend, das sind … Moment. Goldkronen?«
»Ich glaube, ich habe mich klar ausgedrückt.«
Achtundvierzig Kronen, nur um den Fuß an Land zu setzen? Shevon schluckte trocken. Die Sabinoyi wussten wirklich, wie man Geld verdiente. Sein Messer hatten sie konfisziert und ihm nach einem abschätzigen Blick die Spielfigur seines Vaters zurückgegeben, die letzte Erinnerung an sein altes Leben, das in Trümmer gefallen war.
Meron stützte die Hände auf die Oberschenkel. »Vermutlich hast du die Kosten für deine Einreise gerade verdoppelt«, erklärte er säuerlich. »Damit kostest du mich sechsundneunzig Goldkronen, bevor du mein Haus auch nur betreten hast. Sieh zu, dass du den Preis nicht noch weitertreibst, ja?«
Die Zeit tropfte zäh wie Pech. In majestätischer Ruhe wanderte der Schatten des Fenstergitters über das Bodenmosaik. Von draußen drangen die Geräusche des Hafens herein, Rufe und Flüche, Hufklappern, das Rumpeln von Rädern auf den Kais und die endlosen Schreie der Möwen, leiser und immer leiser. Um die Hafenkommandantur schien sich ein Kokon der Stille zu legen. Leichen bedeckten das Mosaik. Shevons Hände klebten am Holz der Bank.
»Etwas stimmt hier nicht«, murmelte Meron, und Shevon wäre beinahe aufgesprungen. »Sie halten uns hier schon viel zu lange fest.«
»Was …«
Shevon verkniff sich seine Frage. Der Hafenkommandant erschien an der Spitze einer Abteilung Wachen. Sein Blick blieb an Meron hängen, der augenblicklich aufstand.
Wachen, deren Klingen die letzten Opfer niedermähen. Shevon sprang auf. Merons fleischige Hand legte sich schwer auf seine Schulter.
»Kaufmann Meron al Andre?«
»Der bin ich, Exzellenz«, antwortete Meron, die Hand noch immer auf Shevons Schulter.
»Habt Ihr wirklich alles verzollt, Kaufmann Meron?«
»Nach bestem Wissen und Gewissen, Euer Exzellenz.« Die Hand auf Shevons Schulter verkrampfte sich.
»Nun, Euer Gewissen scheint nicht allzu weit zu reichen, Kaufmann Meron. Meine Männer sind auf Schmuckstücke und eine Gemäldeminiatur gestoßen. In Eurer eigenen Kajüte, Kaufmann Meron.« Von der Hand des Kommandanten baumelte an einer Goldkette ein kleines Medaillon.
»Aber das ist ein Bild meiner Frau, kein Schmuggelgut«, protestierte Meron.
Die Stimme des Hafenkommandanten schnitt durch seinen Protest wie durch weiche Butter. »Ihr werdet diesen Schmuck zum achtfachen Satz verzollen und die übrige Ware ebenfalls.«
Die Schultern seines Retters sackten nach unten. »Sehr wohl, Exzellenz.«
»Ihr könnt gehen, Kaufmann Meron.«
Aufatmend setzte sich Meron in Bewegung und zog Shevon mit sich. Das Stöckchen des Hafenkommandanten fuhr wie eine Peitsche zwischen ihm und dem Kaufmann nieder. »Euer Passagier bleibt hier.«
»Aber – was hat er getan?«
»Verbotene Einreise nach Sabinon. Wir werden ihn befragen. Danach nimmt er das nächste Schiff zurück in seine Heimat. Wenn ich nicht irre, ankert gerade eins im Hafen. Es wird sich schon ein Platz für ihn finden. Ruderer sind immer knapp auf den Galeeren.«
Zurück nach Levanon zu den Pfeilen und Schwertern. Zurück in Reguls Hände.
Shevon duckte sich und rannte, stürmte auf die Tür zu und wurde brutal zurückgerissen. Ein Schlag auf seinen Kopf ließ Funken vor seinen Augen tanzen. Kalter Stahl presste seinen Hals zusammen und er erstarrte. Sie hatten ihn gefunden. Regul würde ihn töten, genau wie er Vater getötet hatte.
Shevon fing einen Blick Merons auf, der von zwei Soldaten zur Tür geschleift wurde. »Hab keine Angst«, rief der Kaufmann. »Ich werde sehen, was ich für dich erreichen kann.«
»Das werdet Ihr nicht tun.« Der Ton des Kommandanten wurde noch schärfer. »Seid froh, wenn ich Euch nicht einfach als feindlichen Ausländer ausweisen lasse. Wenn Ihr in irgendeiner Weise auffallt – zum Beispiel, indem Ihr Euch für illegale Einreisende interessiert – könnt Ihr auf der Streckbank Auskunft über Eure Pläne geben.« Beinahe väterlich fügte er hinzu: »Am besten vergesst Ihr, dass Ihr diesen jungen Mann jemals gesehen habt.«
Streit
Dort kam Vater. Zwei Soldaten warfen ihn aus dem Gebäude der Hafenkommandantur und der Druck auf Malcon al Andres Brustkorb verstärkte sich. Gleich würde Meron einsteigen und zum Abfahren winken, als wüsste er nicht, dass sein Sohn seit Stunden hier im Wagen saß wie ein gemeiner Diener.
Es war immer das Gleiche. Stundenlanges Warten auf den Moment, in dem Vaters weißer Haarschopf in Sicht kam. Erst stellte sich Erleichterung ein und dann Wut – nein, nicht jedes Mal. Nur wenn Vater wieder einmal nach Levanon gesegelt war.
In welcher Verkleidung war er dieses Mal unterwegs gewesen? Gewürzhändler aus Sicona, menellischer Weinhändler, Staatsbediensteter aus Maror Sesal? Völlig gleichgültig, was er anzog. Die Westwind konnte er nicht verkleiden.
Gleich würden sie streiten und Malcons Argumente würden einmal mehr ungehört bleiben. Wie immer würde Meron die Diskussion mit einer wegwerfenden Handbewegung beenden und wortlos aus dem Fenster starren, als säße er allein im Wagen. War es das wert? Lohnten die wenigen Nachrichten, die Malcon ihm entlocken konnte, wirklich den dauernden Streit?
Endlich entdeckte Meron den Wagen, eilte darauf zu und riss den Schlag auf. Er warf sich Malcon gegenüber auf die Rückbank und wartete, bis sein Sohn das Signal zur Abfahrt gab. Dann schwieg er.
Draußen zogen die Paläste der Fernhändler vorbei. Zwei oder drei standen nach der Seuche noch immer leer, aber die meisten präsentierten stolz ihre Arkaden, unter denen sich Luxusgüter aus dem Inselrund stapelten. Auch die Straßen füllten sich mit jedem Tag wieder mehr. Obwohl der Wagenlenker eine der breiten Prachtstraßen nutzte, kamen sie nur im Schritttempo voran. Das würde ja geradezu wundervoll werden. Nun konnten sie sich eine volle Stunde anschweigen, bis vor das Tor der Villa.
»Dir auch einen schönen Tag, Vater.«
»Lass mich nachdenken. Wir sind in Schwierigkeiten.«
»Ach. Ist es wieder einmal soweit?«
»Lass mich nachdenken, habe ich gesagt!«
Das war nicht der übliche Ton, mit dem sie den Streit begannen. Vaters Stimme klang dünn. Er schien in sich gekehrt und reizbar, aber da war noch etwas anderes, das Malcon nicht an ihm kannte. Merons Blick streifte die Häuser, die vorüberzogen, doch er schien nichts wahrzunehmen und der Schweiß auf seiner Stirn kam nicht von dem kurzen Fußmarsch. Meron hatte Angst.
Sie hatten den Talkessel durchquert und begannen den Aufstieg zur Oberstadt. Ein Peitschenknall zwang die Pferde weiter. Malcon stemmte die Füße auf den Boden, um nicht von der Bank zu rutschen, und betrachtete seinen Vater. Wann hatten sich die Lappen gebildet, die neben dem Kinn herabhingen und ihm das Aussehen eines greisen Wachhundes gaben? Wann war seine Haut so teigig, sein Haar so schütter geworden?
Etwas musste sich ändern. Malcon klopfte an die Vorderwand und der Wagen kam am Straßenrand zu stehen.
»Was tust du? Lass weiterfahren.« Meron wollte sich hochwuchten, doch sein Bauch presste ihn in den Sitz.
»Nein, Vater. Wir fahren nicht weiter, bevor du mir nicht gesagt hast, warum wir in Schwierigkeiten stecken.«
»Lass mich nachdenken. Zu Hause erkläre ich dir alles.«
»Das sagst du immer, und dann erklärst du gar nichts.«
»Lass mich endlich …«
Aber Malcon war schon zu oft vertröstet worden. »Keine Ausflüchte. Wirst du verfolgt? Sind wir in Gefahr?«
Meron schüttelte den Kopf. »Jedenfalls nicht direkt.«
»Gut. Dann bleiben wir hier stehen, bis du mir erzählt hast, was passiert ist.«
»Weiterfahren«, brüllte Meron aus dem Fenster. Nichts geschah.
Malcon zuckte die Achseln. »Wagenlenker lassen sich mieten. Er hört nur auf mich.«
Schneller als Malcon ihm zugetraut hätte, öffnete sein Vater den Wagenschlag und stemmte sich hinaus. Der Saum seines Gewandes verfing sich in der Türangel. Beinahe wäre er auf das Pflaster gestürzt. Malcon wollte ihm zu Hilfe kommen, doch Meron schlug ihm die Tür vor der Nase zu und machte sich zu Fuß auf den Weg hinauf ins Villenviertel.
Malcon öffnete eine Klappe hinter sich. »Folge ihm«, befahl er dem Fahrer. Der Wagen ruckte an. Malcon lehnte sich aus dem Fenster und starrte auf den Rücken seines Vaters, der mit grimmiger Entschlossenheit den Hang hinauf keuchte, lächerlich und bewundernswert zugleich. Mehrmals blieb Meron schwer atmend stehen und blickte sich um, doch kein Mietgefährt tauchte auf.
»Verschwinde«, brüllte Meron schließlich. »Nimm den verdammten Wagen mit und lass mich endlich in Ruhe!« Keuchend stützte er sich auf die Oberschenkel und wischte den Schweiß fort, der ihm in die Augen rann.
Malcon ließ den Wagen neben ihm halten und öffnete den Schlag. »Steig ein.«
»Nein. Und wenn es mich das Leben kostet.«
»Dein Wunsch könnte schneller in Erfüllung gehen, als dir lieb ist. Du wirst zusammenbrechen, ehe du das Alte Stadttor erreicht hast. Was bringt dir das? Also steig ein.«
Nach kurzem Zögern schleppte sich Meron die zwei Schritte zum Wagenschlag. Malcons ausgestreckte Hand übersah er. Das Gefährt schwankte unter seinem Gewicht.
Auch ohne Befehl schnalzte der Fahrer mit den Zügeln. Malcon war es egal. Er hatte verloren und wusste es. Wenn sein Vater lieber starb, als zu reden, würde Malcon niemals erfahren, was dieses Mal in Levanon passiert war. Unter dem Klipp-Klapp der Hufe bog der Wagen in die Straße ein, die oben am Rand des Talkessels entlangführte.
»Warum erzählst du mir nie etwas?«, fragte Malcon schließlich. »Du verschleuderst unser Geld für Unternehmungen, die niemals ihre Kosten tragen. Du steckst deinen Kopf in jede Schlinge, die Levanon für dich aufstellt.« Er hasste den Vorwurf in seiner eigenen Stimme. »Warum hast du solche Angst, mich in deine Geheimnisse einzuweihen?«
»Weil es Geheimnisse sind. Meine Geheimnisse, wohlgemerkt, und mein Geld. Und nein, ich habe keine Angst.«
Eine Ohrfeige hätte weniger geschmerzt als diese Zurückweisung. Malcon lehnte sich zurück, entschlossen, für den Rest der Fahrt keinen Ton mehr von sich zu geben. Das war endgültig das letzte Mal, dass er den Alten vom Hafen abholte. Vater wollte ihn nicht einweihen? Dann eben nicht. Das geheime Konto, auf das er die Gewinne seiner eigenen kleinen Unternehmungen eingezahlt hatte, schwoll mit jedem Mondlauf weiter an. Bald, sehr bald würde es für eine größere Expedition reichen, mit genügend Gewinn, um selbst ein Handelshaus zu eröffnen und den Kaufmann, der sich sein Vater schimpfte, seinem Schicksal zu überlassen.
»Der Hafenkommandant«, murmelte Meron.
Malcon schwieg. Vater sprach oft mit sich selbst und wenn man nachfragte, reagierte er noch bissiger als sonst.
»Der Hafenkommandant hat ihn geschnappt.« Dieses Mal gab Meron selbst das Signal zum Halten. Das Rattern der Räder verstummte und die Stille legte sich wie ein Teppich auf die Ohren.
Wovon sprach Vater? Vielleicht von dem jungen Mann, der neben ihm in der Hafenkommandantur verschwunden und nicht wieder erschienen war. Malcon schwieg. Dieses Mal würde er sich nicht zu Fragen drängen lassen.
Meron rieb sich den Schweiß aus dem Gesicht. »Der Mann im Hafen ist Shevon al Yontar.«
Malcon saß mit offenem Mund da. Sein Vater hatte einen al Yontar gerettet? Die Familie galt als ausgerottet.
»Eben der«, bestätigte Meron seine unausgesprochene Frage und begann endlich zu erzählen, wie er Shevon, den letzten Überlebenden einer der ganz mächtigen Familien, aus Levanon herausgeschmuggelt und nach Sabinon gebracht hatte und was an diesem Morgen im Hafen passiert war. »Ich hätte ihn direkt unter den Augen des Hafenkommandanten nach draußen befördert, aber der Idiot hatte nichts Besseres zu tun, als seinen Namen zu nennen.«
»Du sagst, eine levanische Galeere hat euch passiert.« Zu spät erinnerte sich Malcon an seinen Vorsatz, zu schweigen.
»Vier Stunden vor dem Anlegen, ja.« Vater schien von Malcons Kampf nichts zu merken. »Im Hafen lagen sie direkt neben uns und ließen frech ihre Fahne wehen. Was ein levanisches Botenschiff hier in Sabinon zu suchen hat, ist mir schleierhaft. Zu anderen Zeiten hätten sie es mit einem Schuss vom Palast aus versenkt, ohne weiter zu fragen.«
Malcon runzelte die Stirn. »Hast du es etwa nicht mitbekommen?«
»Was, Malcon?«
»Levanons neuer König …«
»Levanon hat keinen König.«
» … will über Frieden verhandeln. Wenn König Badoran zustimmt, landet übermorgen eine Delegation in Golàbine.«
Sein Vater schlug mit der Faust gegen die Wand des Wagens. »Verflucht … Au! Verflucht, verflucht, verflucht!«
»Was ist denn los, Vater?«
»Hast du nicht zugehört? Nuridor ist tot! Shevon war selbst dabei als Regul ihn ermordete und anschließend jeden Senator umbringen ließ, der sich noch gegen ihn stellte. Er hat gesehen, was passiert, wenn dieser Emporkömmling mit seinen Gegnern verhandelt. König Regul, ha! Nur Shevon kann die Verhandlungen noch platzen lassen, und jetzt halten sie ihn im Hafen fest. Verflucht.« Er verstummte und saugte an seinen blutigen Knöcheln. Die Sonne verwandelte den Wagen in einen Backofen.
»Und jetzt?«
»Was wohl? Die schneiden ihm die Kehle durch. Irgendjemand will, dass Shevon verschwindet – oder macht sich bei den Levanyi lieb Kind, indem er ihnen einen Verräter übergibt, ohne dass der König auch nur ein Wort davon erfährt.«
»Aber das wäre Hochverrat.«
»Oder das Gegenteil. Ein Befehl der Krone. Sozusagen ein Willkommensgeschenk an die verdammten Levanyi, ein Friedensangebot vor der Verhandlung. Es kann alles sein.« Die Hitze hatte Vaters Blick für Intrigen nicht trüben können. »So landen wir mitten in der großen Politik. Und wenn das so ist …«
» … dann halten wir den Kopf unten«, unterbrach Malcon. »Vater, wir sind Kaufleute. Wir können uns da nicht einfach einmischen. Das Einzige, was du dafür bekommen wirst, ist ein Strick um deinen Hals – und um meinen.«
»Unsinn. Ich werde nicht zulassen, dass die verdammte Delegation dem König Honig ums Maul schmiert und man diesen Kneipenschläger Regul als Königtituliert. Und zusehen, wie Shevon einfach verschwindet, werde ich schon gar nicht.«
Natürlich. Malcons Meinung war immer Unsinn. Er ignorierte den Bleibarren in seinem Magen. »Hör auf mit deinen Träumen von Macht und Politik. Lass die da oben in Ruhe.«
»Dass jemand Verrat an jenem König begeht, der dich hier gegen das Misstrauen seiner Untertanen in Frieden leben lässt, das interessiert dich auch nicht, was?« Merons Stimme klang immer gereizter.
Egal. Was konnte Malcon jetzt noch verlieren? Er beugte sich vor. »Willst du unser Geschäft aufs Spiel setzen, weil der Sohn eines Freundes den Kommandanten verärgert hat?«
»Du begreifst es einfach nicht, he?« Sein Vater redete sich allmählich in Rage. »Sie bringen ihn um, einfach so – oder Schlimmeres.«
Malcon sprach beruhigend auf ihn ein, als wäre er ein scheues Pferd. »Du hast ihn unter Lebensgefahr aus Levanon herausgeholt, aufgenommen und bis nach Sabinon gebracht. Was sollst du denn noch tun? Dich an seiner Stelle aufhängen lassen? Man kann nicht jedes Unglück verhindern.«
»Ich werde ihn nicht da unten sitzen lassen.« Meron verschränkte die Arme. Wie immer, wenn ihm die Argumente ausgingen, reagierte er mit Trotz.
»Der Kommandant wird ihn den Behörden übergeben. Die werden sich darum kümmern.«
»Kümmern, kümmern. Shevon wird gar nicht erst bei den Behörden ankommen. Ist dir eigentlich klar, dass du gerade jemanden zu Folter und Tod verurteilst, mit dem du als kleiner Junge Soldat gespielt hast? Gütige Götter, Shevon war dein Nachbar!« Meron machte Anstalten aufzuspringen, aber die Hitze und sein Gewicht hielten ihn auf seinem Sitz fest. »Ich werde zu Herzog Styeban gehen und ihn um Hilfe bitten.«
»Damit machst du dir Herzog Mirash zum Feind. Weißt du nicht, wie viel dem der Hafenkommandant schuldet? Vielleicht lässt Herzog Mirash ja selbst Shevon festhalten?«
»Unsinn«, wiederholte Meron.
»Ja, ja, so wie alles, was ich sage«, versetzte Malcon wütend. »Dabei regiert Mirash schon längst am Thron vorbei.«
Sein Vater reagierte nicht. Tief in Gedanken schien er nicht zu merken, wie ihm der Schweiß übers Gesicht rann und sein Atem pfiff und keuchte. Auf einmal bekam Malcon Angst, dass Vater sterben würde, genau jetzt, hier im Wagen. Ein Knoten zog sich in seinem Magen zusammen. Wie er Vaters spontane Entschlüsse hasste. Sie stellten zuverlässig den kürzesten Weg dar, die al Andres in Schwierigkeiten zu bringen.