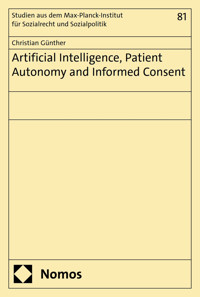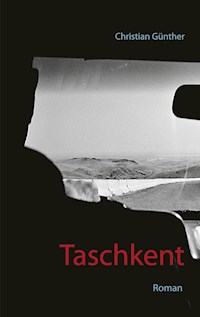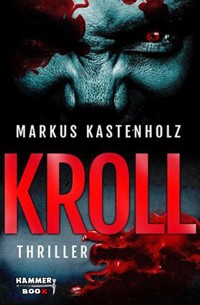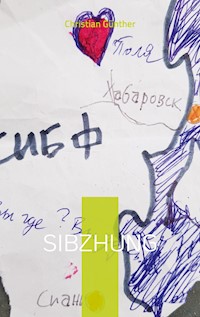
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nordost-Sibirien im Jahr 2061. Die Klimaerwärmung hat weite Teile der Erde unbewohnbar gemacht. Sibirien und Nordchina sind vom Diktator Swerdkov zu einem großen Reich fusioniert worden, zu Sib-Zhung. In der Einsamkeit des Nordens lebt der 18jährige Wanja bei seinem Onkel. Dieser versteckt sich vor dem Regime, seit der Diktator Wanjas Eltern hatte verschwinden lassen. Als sein Onkel gefunden und in den Tod getrieben wird, muss Wanja fliehen. Er lässt seine erste Liebe Polja zurück und reist zu Fuß, dann mit einem Flößer durch das in Schlamm und giftigem Regen untergehende Land nach Chabarowsk. Wie alle "meernahen" Städte weltweit steht Chabarowsk viele Meter unter Wasser. Dort trifft er auf die sprunghafte Tatjana, die ihn verführt. Wanjas Talent, Lieder zu erfinden und zu singen, führt dazu, dass er mit dem Musiker Dima ein Konzert gibt, dessen Protestwirkung dem Diktator gefährlich wird. Tatjana hilft den beiden zu fliehen. Auf einer bewohnten Müllinsel entführt sie einen Hubschrauber und fliegt mit ihnen bis nach Xian, wohin Swerdkov damals Wanjas Mutter verschleppt hatte. Im exzessiven Nachtleben dieser tagsüber unter einer Glashülle gekühlten Stadt begreift Wanja, dass Tatjana, wie die meisten Angehörigen der Elite, süchtig nach dem Wechsel ihrer Persönlichkeit ist. Über ins Gehirn verlegte Slots kann das zuvor per K.I. bearbeitete und gespeicherte Bewusstsein anderer Personen per Stick übernommen werden. Wanja und Tatjana trennen sich im Streit. Zu Fuß gelangt Wanja zu Swerdkovs Anwesen, das unweit von Xian auf dem Ausgrabungsgelände der Terrakotta-Armee liegt. Dort wird er gefangengenommen. Wanjas Reise führt von schmelzendem Schnee, tauendem Permafrostboden und stinkendem Schlamm, in dem die Knochen der Opfer Stalins auftauchen, über Wasserödnisse bis hinein in die flimmernde Hitze der zentralchinesischen Ebene. "Sib-Zhung" ist Cli-Fi-, Road-Movie- und Entwicklungsroman in einem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Um mich der Wald. Ich stapfte durch den Schnee, schaute in den milchiggrauen Himmel, bald schon würde es dunkel werden. Die Energie der Grütze, die der Onkel und ich am Morgen gegessen hatten, war aufgebraucht, ich hatte Hunger. Der Schnee war verharscht, bei jedem Schritt brach ich durch die harte Oberfläche, die Tiere hörten mich schon aus Hunderten von Metern. Ich musste etwas nach Hause bringen, der Onkel lag seit einer Woche mit Grippe im Bett. Eine Suppe mit Rebhuhn, das wäre das Beste. Über mir hörte ich Lesja krächzen und schaute zwischen den verkümmerten Kiefern hinauf. Ihr leichter schwarzer Körper mit den gefransten Flügeln segelte im Wind. Wollte sie mir etwas zeigen? Seit einem Jahr begleitete sie mich auf meinen Wegen. Setzte sich manchmal auf meine Schulter. Ihre glänzend schwarzen Augen in all der Schwärze - „Otschi tschornie“, sang ich leise. Ich folgte ihr, sah sie elegant über die schütteren Baumwipfel hinwegfliegen und ihre Schwingen sahen aus wie Hände, die mit ihren großen Fingern in die Luft griffen. Der schneidende Wind machte ihr nichts aus, sehr kalt war es sowieso nicht. ‚Früher war‘s viel kälter“, sagte der Onkel dauernd, „aber die verdammte Feuchte, die zieht mir in die Knochen.“ Er liebte es, sich zu wiederholen, vielleicht weil er möglichst viel sprechen wollte, er hatte ja sonst niemanden.
Ich sah eine Luchsspur, überquerte einen zugefrorenen Bach, sah durchs Eis das moosbraune Wasser strömen, hörte es glucksen. Danach wurde der Untergrund felsiger, große Schneeverwehungen bildeten schwere Überhänge, die so aussahen, als rutschten sie gleich auf mich herab. Tierspuren waren nicht zu sehen und ich fragte mich gerade, was das Ganze hier sollte, als ich ein Geräusch hörte. Etwa hundert Meter entfernt stieg hinter dichten Sträuchern Atemdampf auf. Und dann sah ich den großen Kopf eines Elchs, das wuchtige Geweih. Er zupfte erstarrte Blätter ab, seine Lippen hatten keine Schwierigkeiten mit den dornigen Zweigen. Ich war zu weit weg und näherte mich, indem ich über die Flanke eines großen Felsblocks kletterte. Ich roch den süßlichen pferdigen Duft, der von ihm zu mir herüberwehte, und nahm mein Gewehr vom Rücken. Als ich die Sträucher endlich ins Visier nehmen konnte, stiegen dort aber keine Wolken mehr auf. Der Elch war fort. Lesja krächzte über mir in einem toten Baum. Sie legte den Kopf schief und schaute mich an. Ich meinte, ein Lächeln um ihren miesmuschelfarbenen Schnabel spielen zu sehen. Einbildung natürlich. Aber sie war sehr schlau. Vielleicht hätte ich ihn sowieso nicht getroffen. Ich war kein guter Jäger und jagte nicht gern. Jetzt fiel mir ein, dass ich vielleicht noch ein paar Rubel in einer meiner Taschen hatte. Ich wühlte etwas und fand tatsächlich ein paar Scheine. Daran hätte ich vorher denken sollen. Vielleicht gab es dafür etwas im Dorf.
Ich kletterte unter Felsvorsprüngen entlang, als mich plötzlich ein Schneebrett unter sich begrub. Mühsam befreite ich mich. Schnee war in meinen Mantel und in meine Filzstiefel eingedrungen, jetzt wurde mir doch richtig kalt. In einer halben Stunde etwa konnte ich im Dorf sein. Von dort würde es noch eine Stunde bis zu unserer Hütte dauern, in der der Onkel vor sich hin hustete und Tee schlürfte. Fröstelnd ging ich auf der anderen Seite des Felsens entlang, hielt mich nah am Fels, weil der Wind stärker geworden war. Ich machte einen Schritt nach vorn auf eine Schneeverwehung, fiel plötzlich, landete hart auf dem Boden. Gekrümmt blieb ich liegen. Schräg von oben drang ein wenig Licht in die Höhle. Doch während ich meinen schmerzenden Hintern betastete, ergriff mich Panik, denn ich roch den Gestank eines Raubtiers. In einem Winkel sah ich einen ungeheuren Fellklumpen, sprang auf: ein Bär im Winterschlaf. Schnell kletterte ich aus der Höhle hinaus, wollte wegrennen, da fiel mir ein, dass ein Bär essbar war. Und dieser Bär war nicht aufgewacht. Ich näherte mich dem Loch und starrte ins Dunkel. Zusammengerollt lag er da. Ich musste den Kopf treffen, zielte auf ihn, hörte sein langsames Atmen. Mit einem Mal aber wurde mir klar, dass ich es nicht tun würde. Auf etwas Schlafendes konnte ich nicht schießen. Also sprang ich vom Felsen, schnallte die Schneeschuhe an, lief los und zog erleichtert die frische, kalte Luft durch meine schmerzende Nase tief in meine Lungen.
Als ich im Dorf ankam, dämmerte es. Außer Atem stapfte ich zwischen den wenigen Holzhäusern hindurch. Gerade wurden ein paar Petroleumlampen in den Häusern angezündet, draußen war niemand. Auf der Veranda der Bulatovs hingen ein paar gefrorene Fische. Ich klopfte und Polja öffnete. Wir kannten uns seit der kurzen Zeit, die ich auf die Dorfschule gegangen war, und hatten letzten Sommer sogar mal zusammen Beeren gepflückt. Ich sah es Polja an, dass sie sich freute, mich zu sehen. Ihre starken Augenbrauen bildeten hohe Bögen, sie zeigte ihre weißen Zähne und fragte mich, ob ich einen Tee trinken wolle. Lesja krächzte oben auf dem Dach. „Nein“, sagte ich, obwohl ich gerne mit ihr Tee getrunken hätte. Ihre dunklen Augen lächelten und ihre Wimpern, die ich schon von Frost glitzernd gesehen hatte, klappten. Ich bewunderte die fast tänzerische Bewegung, mit der sie die Schnur, an der der Fisch baumelte, durchschnitt. „10 Rubel“, sagte sie und drückte mir den gefrorenen Fisch in die Hand. In unsere Atemwolken gehüllt, standen wir auf der Veranda des grasgrünen Holzhauses. Ich klemmte mir den Fisch unter den Arm und wühlte nach dem Geld. Dabei rutschte mir der Fisch unter der Achsel hervor und polterte auf den Dielenboden. Ich hob ihn auf. Sie nahm ihn mir wieder ab. Nun merkte ich, dass ich meine Fäustlinge ausziehen musste. Sie nahm sie ebenfalls. Doch meine Finger waren zu erstarrt, um die Münze in meiner Tasche greifen zu können. Da griff sie mich am Arm und zog mich sanft in Richtung Tür. „Du frierst, komm.“ Ich nickte nur und folgte ihr hinein. „Setz dich.“ Müde ließ ich mich auf eine Bank am Ofen fallen. Polja kochte Wasser auf dem Gasherd, füllte zwei Gläser, gab ein bisschen Tee hinein. Wir warteten und schauten den Dampfwolken zu. Nun rührte sie etwas Honig in den Tee. „Woher hast du denn Honig?“, fragte ich. „Es gibt doch gar keine Bienen mehr.“ „Ich hatte letzten Sommer ein Volk im Wald entdeckt.“ Der Tee schmeckte gut, nach Karamell. Ich war zu müde, um etwas zu sagen. Ich hätte von meinem Abenteuer mit dem Bären erzählen können. Aber es kam mir irgendwie seltsam vor, das einfach zu erzählen, also erzählte ich’s nicht. Über Poljas Oberlippe und an den Fransen ihres Ponys hingen winzige Wasserperlen, es sah wie Tau aus. Der Tee brachte mein Gesicht zum Glühen. Mir sanken die Augenlider herab. „Ich hab dich lang nicht mehr gesehen. Was machst du so?“ „Nichts“, sagte ich. „Und du?“, fragte ich zurück. „Das Übliche“, sagte sie lächelnd. „Wolltest du jagen und hast nichts gefangen?“ Ich sagte schleppend ein paar Worte über den Bären. Meine eiskalten Zehenspitzen schmerzten beim Warmwerden, dann fühlte es sich an, als bissen Ameisen hinein. „Willst du dich kurz auf die Ofenbank legen?“ Ich schüttelte den Kopf. „Ich muss gehen.“ Ich erwähnte den Onkel nicht, denn er hatte mich oft genug gebeten, mit niemandem über ihn zu sprechen. Mühsam richtete ich mich auf, die Muskeln taten mir weh, meine Beine waren steif. Polja öffnete die Tür und ich ging ins kalte Dunkel hinaus. Wieder umgaben uns Wolken aus Atemdampf und ich dachte an den Elch. Ich bückte mich nach dem Fisch, dessen Schuppen vom Schein der Lampe drinnen glänzten. „Danke“, sagte ich und trat von der Treppe in den Schnee, der bei jedem meiner Schritte knirschte. Da rief sie meinen Namen und ich wandte mich zu ihr. „Gut, dass der Bär noch lebt“, sagte sie. „Mach eine Fischsuppe. Warte!“ Sie lief ins Haus, eine strenge Frauenstimme rief etwas, da kam Polja schon wieder heraus und stopfte mir eine Handvoll getrockneter Dill-Stengel und Blätter in die Manteltasche. Ich sah sie zurück ins Haus hüpfen, sie war barfuß, bestimmt, um ihre Filzpantoffeln nicht nass zu machen. Sie winkte mir noch einmal, dann kappte die Tür den Lichtstrahl.
Ich spürte den schneidenden Wind, der meine aufgetaute Kleidung sofort vereiste, so dass mein Mantel ganz starr wurde. Es war nicht völlig finster, der Mond schimmerte durch die Wolken und ich kannte den Weg von dem Jahr her, in dem ich zur Schule gegangen war. Das war, bevor der Onkel und ich in die Wildnis gezogen waren. Danach hatte er mich unterrichtet, unterrichtete mich immer noch gelegentlich. Ich schaute zum Himmel hinauf und sah ein paar Lichtpunkte in den etwas klarer werdenden Himmelsschichten. Ich versuchte mich zu erinnern, wie man Satelliten von Sternen unterscheiden konnte. Wenn sie sich schnell bewegten, waren es Flugkörper, aber Beobachtungssatelliten konnten die Position halten, meinte ich, dann erkannte man sie nur an ihrem Licht. Vielleicht gab es aber auch Satelliten, die sternenähnliches Licht aussandten, um sich zu tarnen?
Als ich etwa eine Stunde später in unsere Hütte trat, fragte der Onkel mürrisch, wo ich mich so lange rumgetrieben hätte. Dann musterte er mich mit seinen grauen Augen „Hast du was getroffen?“ Als ich ihm den Fisch zeigte, hellte sich seine Miene auf. „Für wieviel geangelt?“, fragte er und lächelte.
„10 Rubel.“
„Gut gemacht. Und Dill. Bist’n Prachtbursche. - Zwei prächtige Burschen“, meinte er zufrieden. Dann hielt er inne. „Einer tot.“ Solche Bemerkungen waren typisch für ihn. Hustend ließ er sich auf den Küchenhocker sinken. „Du weißt ja, wo die Zwiebeln und die Kartoffeln sind.“ Er schaute mir zu, wie ich den großen Topf mit Wasser füllte und anfing zu schälen. „Du hast jemanden getroffen.“
„Polja.“
„Wer ist das?“
„Ein Mädchen, das ich noch von der Schule kenne.“
„Bist du verliebt?“
„Nein.“
„Ist sie hübsch?“
„Ja.“
„Beschreib sie mir.“
„Sie hat ein rundes Gesicht, ein paar Sommersprossen, braune Augen, einen großen Mund, blonde Haare ungefähr bis hier …“ Tränen traten mir vom Zwiebelschneiden in die Augen.
„Erzähl weiter.“
Natürlich war er einsam. Er traf niemanden, saß meist nur an seiner Schreibmaschine, einer klapprigen хеброс 1500 … Normales Papier hatte er schon lange nicht mehr, er benutzte inzwischen die Tapete, riss sie in seinem Zimmerchen von der Holzwand, schnitt sie zu und spannte sie ein. Ich hörte es gern, wenn er tippte: das Pling der Rolle, das Weiterdrehen, das Zurückschneppern des Hebels am Ende jeder Zeile, das Herausziehen des Papiers mit viel Schwung … Sogar während ich draußen den Fisch in Stücke hackte, quetschte er mich weiter aus. „Warum zieht sie nicht in eine Stadt?“, rief er durch die angelehnte Tür.
„Ihre Mutter ist krank und will nicht weg.“
„Was hat die Mutter? Wie alt ist sie?“
Sicher vermisste er den Kontakt mit Menschen, fast niemand wusste, wo genau wir wohnten und wer er war: Wolodja Drozdov, Physiker aus Moskau. Ein einziges Mal hatten wir einen Besucher gehabt, einen ehemaligen Kollegen, das war ein Festtag für meinen Onkel gewesen. Seine Augen hatten gefunkelt, er hatte sich die filzigen grauen Haare gewaschen, an seinem Bart herumgesäbelt, er fluchte, sang, kochte und war bester Laune. Irgendwie hatte er sogar Torte aufgetrieben. Sonst lebten wir ja von Grütze und Kartoffeln, im Sommer war‘s besser. Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht hatten die beiden diskutiert und am Ende nur noch eingelegte Tomaten und Gurken aus Einmachgläsern gegessen und Wodka und Tee getrunken. Ich weiß nicht, was bei dem Treffen herauskam. Der Onkel sprach mit mir nicht über seine Arbeit. „Besser du weißt nichts davon“, sagte er immer nur.
Jetzt knabberten wir an einem harten Stück Brot und warteten. Die Suppe duftete köstlich. Schließlich füllte ich zwei Teller und wir begannen zu essen. Schnell war der Topf leer bis auf ein wenig Sud, in den wir trockene Brotkanten tunkten, um alles aufzusaugen. Satt und von Wärme durchströmt, machten wir es uns auf dem Diwan bequem.
„Spiel mir doch ein bisschen was vor“, sagte Wolodja.
Ich war zwar müde, griff aber nach der Gitarre. Während ich die Saiten zupfte, fing ich an zu singen, erzählte vom Elch und vom Bären. Doch vielleicht weil ich so müde war, entwickelte sich eine andere Geschichte daraus: In einem Wald geriet ich in einen Schneesturm und fiel in die Höhle eines schlafenden Mädchens. Es war schummrig dort, gemütlich warm und das Mädchen schlief weiter. Ich wunderte mich, dass sie nicht aufwachte, und schaute sie im Schein eines flackernden Streichholzes an. Sie lag auf dem moosigen Boden, ihr Gesicht war blass. Um sie herum viele Bücher, manche aufgeschlagen. Vorsichtig berührte ich ihre Hand und erschrak, sie war eiskalt, ich küsste ihre Stirn: ebenfalls furchtbar kalt. Ich zog eins ihrer Lider nach oben und sah ihre verdrehten Augen. Da wurde mir klar, dass sie ohnmächtig war. Schnell drückte ich meinen Mund auf ihre kalten Lippen und blies meinen Atem in ihre Lungen. Ich presste beide Handballen stark auf ihren Brustkorb, wechselte zwischen Herzmassage und Mundzu-Mund-Beatmung ab. Plötzlich krümmte sie sich und hustete ein Stück Pilz hervor. Vielleicht war er giftig. Schließlich öffnete sie die Augen und sah mich an. „Wer bist du?“ An dieser Stelle fiel mir nichts mehr ein, ich summte nur noch weiter. Außerdem merkte ich, dass ich Schneewittchen abgekupfert hatte. Ich sah zum Onkel hin. Er war eingeschlafen. Ich legte eine Decke um ihn, damit er nicht fror. Sein Gesicht sah im Schlaf viel älter und trauriger aus, als wenn er wach war.
Ich legte mich auf meine Pritsche, schloss die Augen, konnte aber nicht einschlafen. Ich sah den Wald im Schnee vor mir, den Bären, das Gesicht Poljas, ich dachte an meine Eltern, die schon so lange verschwunden waren. Ein warmer Ton, eine Stimme hüllte mich ein, es musste die meiner Mutter sein. Sie saß am Feuer und sang. Funken stoben auf von rotglühendem Holz. Waren meine Eltern noch am Leben? Warum fanden sie keinen Weg zu mir? Der Onkel wollte zwar nichts sagen, aber ich würde trotzdem am nächsten Tag wieder einmal versuchen, etwas aus ihm herauszulocken.
Am nächsten Morgen weckte er mich mit einer Tasse Tee, einem Stück Brot und Marmelade. „Zieh dich an. Unterricht in einer halben Stunde.“ Während ich die varenje mit etwas abgekühltem Tee aus der Untertasse schlürfte, legte der Onkel, dem es scheinbar besser ging, die Bücher bereit. Ich fragte mich, welche Fächer er wählen würde. Er konnte eigentlich alles. Besonders gut war er in Mathematik und den Naturwissenschaften, aber er unterrichtete mich auch in praktischen Dingen wie Ackerbau und Kampfsport. Heute machte er Übungen zum binären System und sprach mit mir über Künstliche Intelligenz. Wieder einmal erklärte er mir, wie weit fortgeschritten die Überwachung der Menschen sei und dass er nicht geortet werden dürfe. Wie so oft fragte ich, wer ihn denn verfolge, und anstatt, wie sonst, abzublocken, begann er diesmal ein wenig zu erzählen. Er schilderte die extreme Erwärmung der Erdatmosphäre, die zum Tod von mehreren Milliarden von Menschen geführt habe. „Die Machthaber in den noch bewohnbaren nördlichen Ländern“, sagte er, „haben ihre Grenzen rücksichtslos abgeschottet. Die Bevölkerung wird bewusst verdummt, manipuliert und reduziert. Und unser Metzger ist einer der Schlimmsten.“
„Verfolgt er dich?“
Der Onkel nickte.
„Hat er auch meine Eltern verfolgt?“
Wieder nickte er.
„Leben sie noch?“
„Ich weiß es nicht.“ Und plötzlich begann er zu erzählen. „Deine Mutter war wie ein blühender Kirschbaum. Wunderschön, duftend. Und sie war furchtlos. Wenn sie von etwas überzeugt war, konnte niemand sie aufhalten. Sie reiste durch Sibirien, sah die Veränderungen, das Auftauen des Permafrostbodens, die abgesackten, eingestürzten Häuser, den Schlamm, die Mücken, roch den Gestank der aufsteigenden Gase. Sie sah auch die Lager, die Toten …“ Er verbarg seine Augen, Tränen liefen unter seiner Hand hervor. „Zusammen mit deinem Vater stellte sie ein unterhaltsames Aufklärungsprogramm auf die Beine und die beiden tourten damit durchs ganze Land. Bei den Auftritten spielte dein Vater Swerdkov, den deine Mutter mit ihren Fragen und Rechercheergebnissen in die Enge trieb. Dabei machte dein Vater Swerdkov zur lächerlichen Figur. Die Leute lachten über den Metzger und das gefiel ihm nicht. Dann verschwanden deine Eltern …“ Er wischte sich die Tränen fort.
„Sie sind also nicht einfach so verschwunden, wie du immer gesagt hast“, warf ich ihm vor.
„Nein.“
„Heißt das, Swerdkov hat sie verschwinden lassen?“
„Ja.“
„Sind sie tot?“
„Entweder das oder in einem Gefangenenlager. Hunderttausende sind verschwunden.“
„Und warum hast du mir nie wirklich etwas davon erzählt?“
Der Onkel furchte die Stirn. „Zu gefährlich. Hab ich dir doch gesagt.“
„Deshalb sind wir hierhin in die Wildnis gezogen, so weit weg von allem?“
Er nickte.
„Und warum erzählst du‘s mir jetzt?“
„Weil ich denke, jetzt bist du alt genug. Und ich …“ Er wollte mir über den Kopf streichen, aber ich wich aus. „Es tut mir leid“, sagte er.
Erst jetzt wurde mir bewusst, was das bedeutete. Vielleicht lebten meine Eltern doch noch. Das traurige, verblasste Bild meiner Eltern – wie oft hatte ich in den ersten Jahren geweint! Wie lange nicht mehr? – wurde lebendig. Es musste möglich sein, Spuren zu finden. Genau das war es, was mein Onkel vorausgesehen hatte: dass es mir keine Ruhe lassen würde. Vorher war ich wie betäubt gewesen, nun war ich wach.
„Was weißt du?“
Er seufzte. Es war ihm klar, dass er mich nicht aufhalten konnte. Er holte eine Landkarte aus der Schublade hervor. „Bevor ich mit dir untergetaucht bin und aufgehört habe, das Internet und das Telefon zu benutzen, hab ich herausgefunden, dass sie zuletzt in Chabarowsk waren. Ist sechs Jahre her. Seitdem ist alles immer noch entsetzlicher geworden.“
Am nächsten Morgen packte ich einen Rucksack mit einem T-Shirt und einer Unterhose. Ich hatte keine Ahnung, wie ich nach Chabarowsk kommen sollte, aber irgendwie würde ich es schon schaffen. Der Onkel gab mir Pemmikan, Zwiebeln, ein selbstgebackenes Brot und sein letztes Geld mit. Dann setzten wir uns hin, schwiegen und sahen uns an.
„Nimm Lesja mit und sei vorsichtig“, sagte er zum Abschied.
Wir umarmten uns. Die Sonne schien.