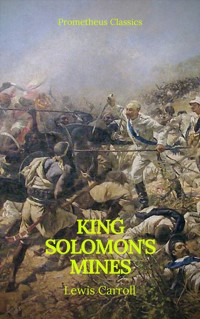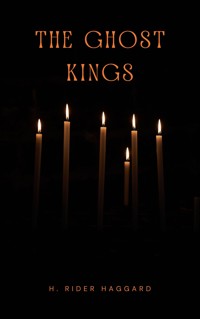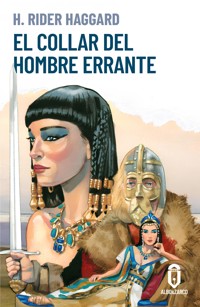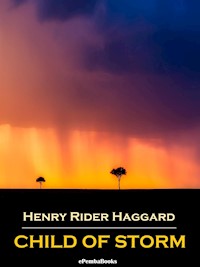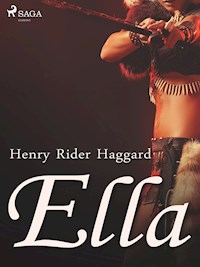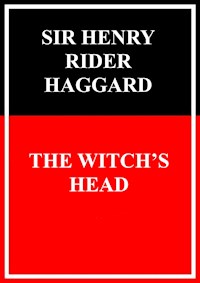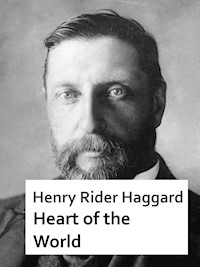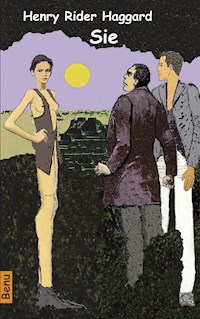
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Durch die geheimnisvolle Inschrift auf einer alten Scherbe inspiriert begibt sich der junge Leo Vincey zusammen mit seinem väterlichen Freund Horace Holly auf die Suche nach der geheimnisvollen Königin einer längst als untergegangen gewähnten Kultur im Innersten Afrikas. Unwegsames Gelände überquerend dringen sie tief in unerforschte Gebiete ein, müssen schier unvorstellbare Hindernisse überwinden und entkommen mehrere Male mit knapper Not dem Tode. In der verlassenen Totenstadt von Kôr, dem Überbleibsel einer Zivilisation, die schon lange vor der Blüte des Alten Ägyptens untergegangen ist, begegnen sie schließlich der ebenso schönen wie grausamen Königin Ayesha, die in Leo Vincey ihren Geliebten aus einem weit zurückliegenden Leben wieder zu erkennen glaubt. Von der schönen »Herrin des Todes« unwiderstehlich angezogen, werden die Helden in ein lebensgefährliches Abenteuer verstrickt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Durch die geheimnisvolle Inschrift auf einer alten Scherbe inspiriert begibt sich der junge Leo Vincey zusammen mit seinem väterlichen Freund Horace Holly auf die Suche nach der geheimnisvollen Königin einer längst als untergegangen gewähnten Kultur im Innersten Afrikas. Unwegsames Gelände überquerend dringen sie tief in unerforschte Gebiete ein, müssen schier unvorstellbare Hindernisse überwinden und entkommen mehrere Male mit knapper Not dem Tode. In der verlassenen Totenstadt von Kôr, dem Überbleibsel einer Zivilisation, die schon lange vor der Blüte des Alten Ägyptens untergegangen ist, begegnen sie schließlich der ebenso schönen wie grausamen Königin Ayesha, die in Leo Vincey ihren Geliebten aus einem weit zurückliegenden Leben wieder zu erkennen glaubt. Von der schönen »Herrin des Todes« unwiderstehlich angezogen, werden die Helden in ein lebensgefährliches Abenteuer verstrickt.
Der Autor
Henry Rider Haggard (1856 – 1925) trat 1875 in den britischen Kolonialdienst in Südafrika. Dort machte er sich mit der Zulu-Kultur vertraut und hatte eine Affäre mit einer afrikanischen Frau, – eine tiefe Beziehung, die seine Darstellung von Frauen beeinflusste und später psychoanalytische Interpretationen seiner Romane nach sich zog. 1881 kehrte Haggard nach England zurück, wo er seine juristischen Examina ablegte und weiter für die Regierung tätig war. Seinen Lebensunterhalt aber verdiente er vor allem als produktiver und erfolgreicher Schriftsteller, dessen Abenteuerromane durch seinen Aufenthalt in Afrika sowie sein Interesse an antiken Kulturen und an allem Okkulten nachhaltig geprägt worden sind.
Inhalt
Einleitung
1 Ein nächtlicher Besuch
2 Die Jahre entschwinden
3 Die Amenartasscherbe
4 Die Bö
5 Der Negerkopf
6 Ein Brauch der ersten Christenheit
7 Ustane singt
8 Ein Fest und seine Folgen
9 Ein zierlicher Fuß
10 Irdisches Grübeln
11 Die Ebene von Kôr
12 Die Herrin des Todes
13 Ayescha legt den Schleier ab
14 Eine Seele in Qualen der Hölle
15 Ayescha auf dem Richterstuhl
16 Die Gräber von Kôr
17 Am Wendepunkt
18 Hinweg mit dir!
19 Ein Tanz
20 Triumph
21 Der Tote und der Lebende
22 Job ahnt Unheil
23 Der Tempel der Wahrheit
24 Über die Schlucht
25 Der Geist des Lebens
26 Was wir sahen
27 Wir springen
28 Über den Berg
Einleitung
Indem ich die nachfolgenden einzig dastehenden Erlebnisse der Öffentlichkeit übergebe, muss ich vorweg bemerken, dass ich nicht der Verfasser, sondern der Herausgeber bin.
Und das kam so:
Als ich vor mehreren Jahren in Cambridge zu Besuch weilte, fielen mir eines Tages auf der Straße zwei Herren auf, die Arm in Arm spazieren gingen. Der eine war eine stattliche Gestalt mit vornehmer Haltung. Das klassische Ebenbild seiner schönen, jugendfrischen Züge ließ auf große Herzensgüte schließen, und als er eine vorübergehende Dame begrüßte, sah ich, dass sein Haar aus einer reichen Fülle kurzer, goldblonder Locken bestand.
»Ach, Arthur«, sagte ich zu meinem Freunde, »sieh doch einmal dieses Bild männlicher Schönheit! Der reine Apoll, wie eben vom Olymp gestiegen.«
»Ja, Henry, das ist unser ganzer Stolz, der schönste Mann in Cambridge. Vincey heißt er; wir nennen ihn aber den ›Griechengott‹. Nun sieh dir mal den anderen an, seinen Vormund! Den nennen wir ›Charon‹ – soll übrigens ein heller Kopf sein.«
Dieser »Charon«, etwa vierzig Jahre alt, schien mir bei näherem Hinsehen auf seine Art nicht minder interessant zu sein als der jugendliche Apoll. Er war mindestens ebenso hässlich wie dieser schön war; mit seinen krummen Beinen nur von mittlerer Größe, hatte er ungewöhnlich lange Arme, eine breite Brust und auffallend kleine Augen. Das volle, dunkle Haar wuchs ihm bis mitten auf die Stirn herab, und der Vollbart reichte bis zur Stirn hinauf, so dass von seinem Gesicht nicht viel zu sehen war. Ich musste an einen Gorilla denken; doch bei alledem machten seine Augen einen recht sympathischen Eindruck und verrieten, dass der Mann kein Dummkopf war. Ich gab meinem Freund zu verstehen, dass es mich freuen würde, seine Bekanntschaft zu machen.
»Nichts leichter als das. Komm, ich stelle dich vor. Vincey kenne ich.«
Gesagt, getan. Bei der gegenseitigen Vorstellung erfuhr ich, dass »Charon« in Wirklichkeit Holly hieß. Dann standen wir eine Zeitlang beisammen und plauderten von den Zulus; ich war nämlich kurz zuvor aus Südafrika zurückgekommen.
Als während dieses Gesprächs eine Dame mit einem niedlichen Backfisch vorbeikam, schoss Vincey, der beide offenbar gut kannte, sogleich auf sie los und ging mit ihnen eine Strecke weiter. Holly aber setzte eine verkniffene Miene auf, blickte dem »Griechengott« vorwurfsvoll nach, brach das Gespräch ab und schritt, uns hastig zunickend, kurz entschlossen zur anderen Seite der Straße hinüber.
Nachher erzählte mir mein Freund, Holly sei ein ausgemachter Weiberfeind, und vor jungen Damen gar habe er eine Scheu, wie andere Leute vor tollen Hunden. Vincey hingegen schien dem weiblichen Geschlecht nicht abhold zu sein; jedenfalls erinnere ich mich noch, dass ich zu meinem Freunde sagte: »Weißt du Arthur, wenn ich noch verlobt wäre – dem jungen Mann würde ich mit meiner Braut aus dem Wege gehen; dem müssen die Herzen der Mädchen ja nur so zufliegen.« Und dabei schien dieser »Griechengott« ganz frei von jener Selbstgefälligkeit zu sein, die sonst bei schönen Männern so unangenehm berührt und die sie bei anderen ihres Geschlechts unbeliebt macht.
Noch am selben Abend fuhr ich nach London zurück und hatte die ungleichen Freunde bald vergessen. Nie habe ich sie wieder gesehen und werde auch schwerlich jemals Gelegenheit dazu haben.
Vor vier Wochen jedoch erhielt ich durch die Post einen Brief und zwei Pakete; das eine enthielt ein dickes Manuskript; der Brief aber trug die Unterschrift Horace Holly – ein Name, der mir im ersten Augenblick nicht mehr gegenwärtig war – und hatte folgenden Wortlaut:
»Cambridge, 1. Mai 18 --, College.
Sehr geehrter Mr. Haggard!
Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich mir trotz unserer nur oberflächlichen Bekanntschaft erlaube, einige Zeilen an Sie zu richten. Erinnern Sie sich noch, dass wir, mein Adoptivsohn Leo Vincey und ich, vor fünf Jahren die Ehre hatten, Ihnen hier in Cambridge auf der Straße vorgestellt zu werden? Doch ich will mich kurz fassen. Neulich las ich mit großer Spannung ein Buch von Ihnen über ein Abenteuer im Inneren Afrikas, das vermutlich aus Wahrheit und Dichtung gemischt ist. Wie dem aber auch sei, es hat mich auf einen guten Gedanken gebracht. Mit meinem Adoptivsohn habe ich nämlich vor kurzem selber ein Abenteuer in Afrika erlebt, ein echtes Abenteuer, das noch viel wunderbarer ist. Offen gestanden, ich scheue mich fast, es Ihnen vorzulegen; ich fürchte, Sie werden uns wenig Glauben schenken. Dennoch übersende ich Ihnen in den beiliegenden Paketen mein Manuskript sowie die Amenartasscherbe, die Pergamente und den Skarabäus »Sohn der Sonne«. Im Manuskript werden Sie lesen, dass wir beschlossen hatten, unsere Geschichte, solange wir leben, nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. Diesem Entschluss wären wir auch treu geblieben, wenn sich nicht kürzlich etwas ganz Besonderes ereignet hätte. Aus gewissen, hiermit zusammenhängenden Gründen, die Sie vielleicht, wenn Sie alles gelesen haben, erraten werden, wollen wir bald wieder auf die Reise gehen; dieses mal aber ins Innere Asiens, wo vielleicht wahre Weisheit zu finden ist. Ob wir von dort zurückkommen werden, ist sehr die Frage. Ist es daher nicht unsere Pflicht, das Schweigen zu brechen? Dürfen wir der Menschheit ein Erlebnis von so gewaltiger Bedeutung noch länger vorenthalten? In diesem Zwiespalt bin ich, wie gesagt, durch Ihr Buch auf den Gedanken gekommen, Ihnen, geehrter Herr, meine Niederschrift zu übersenden und es Ihnen anheim zu stellen, ob Sie diese veröffentlichen wollen oder nicht. Wenn Sie es tun, so bitten wir Sie nur, unsere Namen zu verschweigen und natürlich keine Änderung vorzunehmen, die die bona fides unserer Erzählung beeinträchtigen könnte.
Weiter habe ich nichts hinzuzufügen. Nur gebe ich Ihnen noch die Versicherung, dass ich alles genauso geschildert habe, wie es sich zugetragen hat. Auch über Ayescha1 habe ich nichts hinzuzufügen. Tatsächlich bedauern wir es sehr, die Gelegenheit zur Belehrung durch sie nicht besser ausgenutzt zu haben. Oft fragen wir uns: Wer mag sie gewesen sein? Wie mag sie einst die Höhlen von Kôr entdeckt haben? Was mag ihre wahre Religion gewesen sein? Auf alle solche Fragen haben wir noch keine Antwort gefunden und werden wohl auch keine mehr finden; vorläufig sicher nicht. Doch was nutzt es, sich noch darüber den Kopf zu zerbrechen?
Also, verehrtester Mr. Haggard, wollen Sie es wagen? Wir lassen Ihnen volle Bewegungsfreiheit. Ihren Lohn finden Sie vielleicht – wenn es nicht anmaßend ist, so von unserer Geschichte zu sprechen – in dem Ruhm, der Welt ein solches mitgeteilt zu haben. Glauben Sie mir, so romantisch auch manches erscheint, die Geschichte ist trotzdem durchaus kein Roman. Ich habe alles noch einmal für Sie abgeschrieben. Lesen Sie es also, bitte, und benachrichtigen Sie baldigst
Ihren Sie hochachtungsvoll grüßenden
L. Horace Holly.
P.S. Wenn Sie sich zur Veröffentlichung entschließen sollten und durch den Vertrieb des Werkes einen Überschuss erzielen, so verfügen Sie hierüber nach Belieben! Kommen Sie aber nicht auf Ihre Kosten, so werden Sie von meinen Anwälten, den Herren Geoffrey und Jordan, entschädigt werden. Die Amenartasscherbe und den Skarabäus behalten Sie wohl in Aufbewahrung, bis wir Sie vielleicht einmal um die Rückgabe bitten.«
Dieser Brief setzte mich natürlich in nicht geringes Erstaunen; als ich aber, durch dringendere Arbeiten verhindert, nach vierzehn Tagen endlich dazu kam, das Manuskript zu lesen, sollte ich noch viel mehr erstaunen. Mein Entschluss zur Veröffentlichung stand sogleich fest, und ich teilte dies Mr. Holly umgehend mit. Acht Tage darauf aber sandten mir seine Anwälte meinen Brief zurück mit dem Vermerk, dass ihr Klient mit Mr. Leo Vincey nach Tibet gereist und ihre gegenwärtige Anschrift ihnen unbekannt sei.
Das ist alles, was ich, der Herausgeber, vorauszuschicken habe. Ich übergebe dem Leser die Geschichte so, wie ich sie erhalten habe, mit alleiniger Ausnahme der erwähnten geringen Änderungen, was die Namen und Persönlichkeiten der beiden Hauptpersonen betrifft, die ja unerkannt zu bleiben wünschen.
Auch jedes erläuternden Zusatzes will ich mich enthalten. Zuerst hielt ich die Geschichte dieser Frau in der majestätischen Würde ihrer ungezählten Jahre für eine gewaltige Allegorie, deren tiefere Bedeutung mir freilich verborgen blieb. Heute aber muss ich sagen, dass die Geschichte für mich den Stempel der Wahrheit trägt; ihre sachliche Erklärung freilich muss ich anderen überlassen.
Auf einen Umstand, der mir erst bei erneutem Lesen auffiel, möchte ich hinweisen. Vinceys Charakter – soweit wir ihn hier kennen lernen – ist nach meinem Dafürhalten eigentlich nicht dazu angetan, eine Frau wie Ayescha dauernd an sich zu fesseln. Vielleicht aber berühren sich auch hier die Gegensätze, so dass es sie trieb, die rein körperliche Schönheit eines Mannes zum Gegenstand ihrer Verehrung zu machen. Noch besser ist vielleicht eine andere Deutung: Ayescha, tiefer blickend als wir Sterblichen und in der Seele des Geliebten einen – wenn auch nur leise glimmenden – Funken geistiger Größe erkennend, war überzeugt, dass, wenn er gleichfalls eine unbegrenzte Lebensdauer erlangte und, von ihrer weisen Hand geführt, stets bei ihr weilte, dieser Funke bald immer heller erglühen und schließlich die Welt mit einem Meer von Licht erfüllen werde. Eine Entscheidung jedoch maße ich mir durchaus nicht an.
Nachstehend findet der Leser alle Tatsachen genau, wie Holly sie schildert, und muss sich danach selbst sein Urteil bilden.
1 Sprich: Escha.
1 Ein nächtlicher Besuch
Manche Ereignisse prägen sich uns mit allem Drum und Dran so fest ein, dass wir sie kaum vergessen können. So geht es mir mit einem Erlebnis, das sich vor mehr als zwanzig Jahren zugetragen hat, und das mir noch heute so klar vor Augen steht, als wäre es erst gestern gewesen.
Ich, Ludwig Horace Holly, stand wenige Tage vor der Dozentenprüfung, für welche mein Tutor und meine Kameraden mir ein glänzendes Ergebnis vorausgesagt hatten. Spät abends saß ich auf meiner Stube in Cambridge und quälte mich mit einer mathematischen Aufgabe. Endlich, schon ganz abgespannt, warf ich das Buch in die Ecke, ging zum Kamin und stopfte mir eine der dort stehenden Pfeifen. Auf dem Kamin stand auch eine brennende Kerze und hinter ihr ein schmaler, länglicher Spiegel. Beim Anreißen des Streichholzes fiel mein Blick auf mein Bild im Spiegel, und statt die Pfeife anzubrennen, versank ich in tiefes Nachsinnen.
»Na«, sagte ich endlich zu mir selber, »was da am Kopf dran ist – damit ist nicht viel Staat zu machen, aber vielleicht kommt dir mal das, was drin ist, zustatten.«
Zum besseren Verständnis sei bemerkt, dass ich meine körperlichen Mängel im Sinne hatte. Andere junge Männer von zweiundzwanzig Jahren pflegen wenigstens etwas Anziehendes im Äußeren zu haben, ich aber hatte nichts dergleichen. Klein und untersetzt hatte ich eine unförmig breite Brust und lange, sehnige Arme; mein grobknochiges Gesicht hatte plumpe Züge, und die kleinen grauen Augen lagen tief in ihren Höhlen. Am meisten aber verdross mich meine niedrige Stirn, deren obere Hälfte durch einen Wulst dichter, schwarzer Haare verdeckt war. Kurz, ich sah schon damals, vor fünfundzwanzig Jahren, fast abstoßend hässlich aus und habe mich seitdem nicht viel zum Besseren verändert. Die Natur hatte mir eine ungewöhnliche Hässlichkeit, andererseits aber auch stählerne Kraft und nicht geringe geistige Fähigkeiten in die Wiege gelegt. Meine stets schmucken Kameraden mochten sich nicht mit mir zusammen sehen lassen, meine Kraftleistungen beim Sport jedoch bewunderten sie rückhaltlos. War es ein Wunder, dass ich die Menschen hasste und zu keiner rechten Lebensfreude kam? War es ein Wunder, dass ich mich in meine Gedanken einspann und immer allein bei der Arbeit hockte? So genannte Freunde hatte ich höchstens einen, sonst aber war ich zur Einsamkeit verdammt, und Trost fand ich nur am Busen der Natur.
Dem weiblichen Geschlecht gar war ich ein garstiger Anblick; noch kurz zuvor hatte ich zufällig gehört, wie ein junges Mädchen, das meine Anwesenheit nicht ahnte, mich das »Scheusal« nannte und offen sagte, mein Aussehen habe sie zur Theorie der Affenabstammung bekehrt. Ein einziges Mal hatte mich ein Mädchen seiner Liebe versichert, und ich hatte alle aufgespeicherte Zärtlichkeit an sie verschwendet. Dann aber ging mir ein kleines Vermögen, auf das ich gerechnet hatte, verloren, und sofort wandte sie mir den Rücken zu. Ich bettelte, wie ich nie in meinem Leben gebettelt habe; denn ich war in ihr süßes Gesicht wie vernarrt und liebte sie von ganzem Herzen. Sie aber führte mich vor einen Spiegel, stellte sich neben mich und sagte: »Nun sagen Sie mal ehrlich, Mr. Holly, wenn man mich schön nennt, wie nennt man Sie dann wohl?« Und ich war doch erst zwanzig Jahre alt.
In den Anblick meines Spiegelbildes versunken, stand ich also am Kamin, und da ich keine Verwandten hatte, weder Eltern noch Geschwister, so beschloss ich mit einem Anflug von Galgenhumor, fortan nur noch mir selber zu leben.
Plötzlich klopfte es. Da es schon fast Mitternacht war, hatte ich keine Lust mehr, noch Freunde einzulassen und öffnete nicht sogleich, sondern stand erst noch da und horchte. Ich hatte, wie gesagt, nur einen Freund, und der war im selben College wie ich – vielleicht war er es. Da hustete der Betreffende draußen. Diesen Husten kannte ich nur zu gut; nun öffnete ich die Tür. Er war es tatsächlich.
Dieser, mein einziger Freund, war ein stattlicher Mann von dreißig Jahren, der einst gewiss eine Schönheit gewesen war, jetzt aber nur noch die letzten Spuren dieser Schönheit besaß. Eilends trat er ein, unter der Last eines eisernen Kastens keuchend, den er am Griffe trug. Als er den Kasten auf den Tisch gestellt hatte, befiel ihn ein grässlicher Hustenanfall, so dass er im Gesicht ganz dunkelrot wurde. Schließlich warf er sich auf einen Stuhl und begann Blut zu speien. Ich reichte ihm einen Kognak; er trank und schließlich erholte er sich ein wenig.
»Warum lässt du mich so lange warten?«, fragte er verdrießlich. »Du weißt doch, Zug ist reines Gift für mich.«
»Konnte ich ahnen, dass du es bist? Du kommst sehr spät.«
»Ja, und es wird wohl das letzte Mal gewesen sein. Es geht zu Ende, Holly. Den Morgen erlebe ich nicht mehr.«
»Ach was, dummes Zeug, ich hole lieber den Arzt.«
»Nein, Holly, es ist mir bitterer Ernst, ich brauche keinen Arzt mehr. Ich habe selber Medizin studiert, und weiß, woran ich mit mir bin. Mir kann doch keiner mehr helfen. Seit Monaten schon halte ich mich nur noch wie durch ein Wunder am Leben. – Aber nun höre mal ganz genau zu! Seit zwei Jahren sind wir doch gute Freunde, nicht wahr? Nun sage mal, was weißt du eigentlich von mir?«
»Na, ich weiß, du hast Geld, und hast dein Studium in einem Alter begonnen, wo andere damit fertig sind. Dann weiß ich, dass du eine Frau gehabt hast, und sie dir gestorben ist. Vor allen Dingen aber weiß ich, dass du mein bester Freund bist und überhaupt mein einziger.«
»Weißt du auch, dass ich einen Sohn habe?«
»Nein.«
»Er ist jetzt fünf Jahre alt. Durch seine Geburt habe ich meine Frau verloren. Das habe ich ihm nie verzeihen können; es hat mir seinen Anblick verleidet. – Holly, du musst sein Vormund werden!«
»Was, ich?«, rief ich, emporfahrend.
»Ja, du, Holly. Ich habe dich nicht zwei Jahre lang umsonst studiert. Seit ich weiß, dass es zu Ende geht, suche ich jemand, dem ich den Jungen anvertrauen kann, den Jungen – und dieses hier.«
Dabei tippte er auf den eisernen Kasten.
»Du bist der Rechte, Holly; bist ein knorriger Baum und bist kerngesund. Also höre! Mein Junge ist der letzte Spross einer der ältesten Familien der Welt. Lache nicht, eines Tages wirst du den sonnenklaren Beweis in Händen haben, dass mein fünfundsechzigster oder sechsundsechzigster direkter Vorfahre, obgleich von Geburt ein Grieche namens Kallikrates2, ein ägyptischer Priester der Isis gewesen ist. Sein Vater war griechischer Söldner eines Pharaos der neunundzwanzigsten Dynastie, von dessen Schönheit und Tod in der Schlacht bei Platää Herodot3 erzählt. Als das Pharaonenreich unterging, um 339 vor Christus, brach dieser Kallikrates sein Priestergelübde und entfloh mit einer Prinzessin, die sich in ihn verliebt hatte. An der afrikanischen Küste, in der Gegend der heutigen Delagoa-Bucht, wahrscheinlich nördlich derselben, erlitten sie Schiffbruch. Die ganze Besatzung ging zugrunde, nur ihm und seiner Frau gelang es, sich zu retten. Hier standen sie viel Mühsal aus, wurden aber schließlich von der mächtigen Königin eines wilden Volksstammes im Inneren des Landes aufgenommen. Diese Königin, eine weiße Frau von ganz besonderer Schönheit, hat nachher meinen Vorfahr, diesen Kallikrates, ermordet. Auf die näheren Umstände der Tat kann ich jetzt nicht eingehen, aber du wirst sie vielleicht eines Tages durch das, was sich in diesem Kasten befindet, erfahren. Kallikrates` Frau jedoch entkam den Händen der Mörderin und gelangte mit ihrem inzwischen geborenen Sohn nach Athen. Diesem Sohn gab sie den Namen Tisisthenes, der ›starke Rächer‹. Aus nicht mehr festzustellenden Gründen siedelte die Familie gut fünfhundert Jahre später nach Rom über, wo fast alle den Beinamen Vindex, ›der Rächer‹, annahmen. In Rom waren sie dann weitere fünfhundert Jahre ansässig, worauf sie sich in die Lombardei begaben; jedenfalls waren sie im Jahr 770, als Karl der Große nach Italien zog, schon dort sesshaft. Als der Kaiser aber über die Alpen zurückkehrte, schloss sich ihm das damalige Familienoberhaupt meines Geschlechts an und schlug seinen Wohnsitz schließlich in der Bretagne auf. Dessen direkter Nachkomme, acht Generationen später, zog mit Eduard dem Bekenner nach England und hat es dort unter Wilhelm dem Eroberer zu einer angesehenen Stellung gebracht. Von da an bis zum heutigen Tage habe ich meinen Stammbaum ohne jede Lücke festgestellt. Im Übrigen aber haben sich die Vinceys – so nannten sie sich nachher in England – nicht gerade ausgezeichnet. Einige waren beim Militär, andere trieben Handel, und im Großen und Ganzen waren es lauter achtbare, aber nicht eben hervorragende Bürger unseres Vaterlandes. Von der Zeit Karls II. bis gegen 1800 haben alle dem Kaufmannstand angehört. Um 1790 erwarb mein Großvater durch den Betrieb einer Brauerei ein ansehnliches Vermögen, mein Vater aber hat das meiste verschwendet und mir, als er vor zehn Jahren starb, nur noch eine Jahresrente von zweitausend Pfund hinterlassen. Daraufhin unternahm ich eine mit dem Kasten da zusammenhängende Reise, die aber nicht den gewünschten Erfolg hatte. Auf der Rückreise kam ich auch nach Athen. Dort lernte ich meine Frau kennen, die sich, ganz wie mein Urahne Kallikrates, durch besondere Schönheit auszeichnete. Wir heirateten, und ein Jahr später schenkte sie mir einen Sohn, dessen Geburt sie aber das Leben gekostet hat.«
Er hielt inne und stützte den Kopf in die Hand. Endlich fuhr er fort: »Meine Heirat hatte mich von einem gewissen Plan, auf den ich jetzt nicht eingehen kann, abgelenkt. Wenn du die Vormundschaft übernimmst, wirst du eines Tages alles Nötige erfahren. Nach dem Tode meiner Frau erwog ich den Plan von neuem. Erst musste ich aber die orientalischen Sprachen lernen, insbesondere das Arabische; wenigstens hielt ich das für nötig, und nur deshalb bin ich nach Cambridge gekommen. Bald aber wurde ich krank – und jetzt ist es aus mit mir.«
Wie zur Bekräftigung bekam er einen neuen Hustenanfall. Nachdem er sich durch einen Schluck Kognak wieder erholt hatte, fuhr er fort: »Meinen Sohn habe ich nicht wieder gesehen, seit er in der Wiege lag; sein Anblick war mir verleidet. Er soll aber ein hübscher, aufgeweckter Junge sein. In diesem Brief hier, der deine Anschrift trägt, habe ich kurz ausgeführt, wie ich mir seine Erziehung denke. Sie ist ein bisschen eigenartig, einem Fremden kann ich sie nicht anvertrauen. Daher habe ich an dich gedacht, und du wirst mich hoffentlich nicht im Stich lassen.«
»Aber ich muss doch erst wissen, was ich alles zu tun habe.«
»Schön. Du sollst den Jungen bei dir behalten, bis er fünfundzwanzig Jahre alt ist, und ihn nicht zur Schule schicken; vergiss das nicht! An seinem fünfundzwanzigsten Geburtstag hört deine Vormundschaft auf. An diesem Tage eröffnest du mit diesen Schlüsseln, die ich dir hiermit übergebe, den eisernen Kasten.«
Er legte einige Schlüssel auf den Tisch.
»Dann muss Leo, so heißt mein Junge, alles, was darin ist, sorgfältig prüfen und sich entscheiden, ob er die bewusste Fahrt unternehmen will oder nicht; aber wohlgemerkt, verpflichtet ist er nicht dazu. – Und nun zum geschäftlichen Teil. Mein jährliches Einkommen beträgt jetzt zweitausendzweihundert Pfund. Die Hälfte davon, vorausgesetzt, dass du die Vormundschaft übernimmst, habe ich dir auf Lebenszeit vermacht und zwar tausend Pfund jährlich für dich selbst, da du dich ja ganz der Erziehung des Jungen widmen musst, und hundert Pfund jährlich für den Unterhalt des Jungen. Die andere Hälfte bleibt, bis er fünfundzwanzig Jahre alt ist, auf Zinsen stehen, damit er, falls er die Fahrt unternimmt, die nötigen Mittel dazu besitzt.«
»Wenn ich aber inzwischen sterbe?«
»Dann muss das Vormundschaftsgericht sich seiner annehmen, und er muss sehen, wie er allein fertig wird. Vergiss aber nicht, ihm den Kasten zu vermachen! In fremde Hände darf der Kasten nicht gelangen. Also nochmals Holly, schlage es mir nicht ab! Es wird dir nicht zum Schaden gereichen. Sonst bist du ja doch nur zu einem Einsiedlerleben verurteilt. Bald wirst du hier angestellt und kannst dich dann mit deiner Pfründe und dem, was ich dir vermache, zusammen mit Leo ganz der Gelehrsamkeit widmen. Selbst deinen geliebten Sport kannst du dabei nach Herzenslust betreiben.«
Er sah mich erwartungsvoll an, aber ich konnte mich immer noch nicht zum entscheidenden Ja entschließen.
»Tu es doch, mir zuliebe! Sieh mal, wir sind doch gute Freunde, und anderweitig kann ich mich nicht mehr umsehen.«
»Na schön, meinetwegen. Aber nur, wenn in dem Brief da nichts steht, was mich anderen Sinnes machen könnte.«
»Danke, Holly, vielen Dank! Nein, da steht nichts dergleichen drin. Schwöre mir also, dass du meinem Leo ein guter Vater sein willst und meine Erziehungsgrundsätze genau befolgen wirst.«
»Ich schwöre es«, antwortete ich feierlich.
»Danke, lieber Holly! Vergiss auch nicht, dass du mir einst Rechenschaft ablegen musst! Wenn ich auch tot und vergessen bin, glaube mir, ich lebe dennoch. Es gibt keinen Tod, nur den Wechsel der Dinge. Ich persönlich bin sogar überzeugt, und auch du wirst vielleicht noch die Erfahrung machen, dass unter Umständen selbst dieser Wechsel sich auf unbestimmte Zeit hinausschieben lässt.«
Und wieder befiel ihn ein Hustenanfall.
»Na«, sagte er endlich, »nun muss ich gehen. Den Kasten hast du, und mein Testament ist unter den Papieren. Daraufhin wird dir der Junge übergeben werden. Ich verlange es ja nicht umsonst – und du bist ein Ehrenmann. Wenn du deinen Eid aber doch brichst, so lasse ich dir auch im Grabe keine Ruhe.«
Ich war sprachlos.
Dann hielt er die Kerze empor und sah auf sein Spiegelbild. »Fraß für die Würmer! Bei dem Gedanken, dass man bald auf der Bahre liegt, wird einem doch recht sonderbar zumute. Na, auch gut, die Reise ist zu Ende, das Spiel ist aus. Ach Holly, das Leben ist all die Mühsal nicht wert, wenigstens nicht ohne Liebe. Vielleicht hat mein Junge mehr Glück – wenn es ihm nur nicht an Glauben und Mut fehlt. Lebe wohl, lieber Holly!«
Er umarmte mich noch und wandte sich dann gleich zur Tür. »Hör mal, Vincey«, sagte ich nun, »wenn du wirklich so krank bist, dann laufe ich doch lieber schnell zum Arzt.«
»Nein, nein, versprich mir, das nicht zu tun! Ich lege mich jetzt zum Sterben nieder und will allein sterben – und unbelästigt.«
»Ach Unsinn, du wirst doch so etwas nicht tun!«
Er aber sagte nur noch: »Vergiss nicht!«, – und draußen war er.
Ich setzte mich hin und rieb mir die Augen. War es nicht ganz undenkbar, dass er seinen eigenen Sohn in den ersten fünf Lebensjahren nicht hatte wieder sehen wollen? Dass er seinen Stammbaum so weit zurückverfolgen konnte? Dass er seinen Tod so bestimmt voraussehen konnte? Er hatte wohl ein Glas zuviel getrunken oder war überhaupt nicht mehr ganz zurechnungsfähig.
Endlich gab ich das Raten auf, steckte den Brief nebst Schlüsseln in meine Dokumentenmappe und den Kasten in einen Reisekoffer, und schlief bald darauf den Schlaf des Gerechten.
Plötzlich hörte ich meinen Namen rufen. Ich fuhr empor – es war heller Tag.
»Nanu, John, wie siehst du aus?«, fragte ich unseren Collegediener, der auch bei Vincey die Aufwartung hatte. »Hast du Gespenster gesehen?«
»Nein, Mr. Holly, viel Schlimmeres! Eben wollte ich Mr. Vincey wecken, und da lag er tot auf dem Bett.«
2 Der Schöne und Starke. L.H.H.
3 Herodot, IX 72. L.H.H.
2 Die Jahre entschwinden
Vinceys Tod erregte großes Aufsehen. Da man aber von seiner langen Krankheit wusste und der Arzt unbedenklich den Totenschein ausschrieb, stellte niemand weitere Nachforschungen an, und ich selbst sagte natürlich nichts weiter, als dass er noch am letzten Abend bei mir gewesen war.
Am Begräbnistag kam ein Anwalt aus London, gab meinem armen Freund das letzte Geleit und fuhr dann mit den Nachlasspapieren wieder ab. Eine Woche lang hörte ich nichts von dem Ereignis, denn meine Aufmerksamkeit war durch die Prüfung in Anspruch genommen, so dass ich selbst weder an dem Begräbnis teilnehmen noch mit dem Anwalt sprechen konnte. Endlich war die Prüfung beendet, und ich machte es mir zu Hause bequem – in dem schönen Gefühl, tatsächlich mit Auszeichnung bestanden zu haben.
Nun fing ich auch wieder an nachzugrübeln, und meine Gedanken kehrten zu der Nacht von Vinceys Tod zurück. Ich fragte mich, was das alles zu bedeuten hatte und ob ich wohl noch etwas von dieser Sache hören würde, und falls nicht, was ich dann mit dem merkwürdigen Eisenkasten anfangen sollte, der sich in meinem Besitz befand. Ich saß da und dachte über die Vorkommnisse nach, bis mir ganz wirr im Kopf wurde: über den geheimnisvollen mitternächtlichen Besuch, über den feierlichen Eid, den ich geleistet hatte, und über die seltsame Andeutung meines Freundes, dass er in der anderen Welt Rechenschaft von mir verlangen würde. Hatte Vincey womöglich Selbstmord begangen? Fast sah es danach aus! Und von welcher Suche hatte er gesprochen?
Die ganzen Umstände waren so unheimlich, dass ich, obwohl ich eigentlich kein ängstlicher Mensch bin, es mit der Angst zu tun bekam und mir zu wünschen begann, nichts mit der Sache zu tun zu haben. Und um wie viel mehr wünsche ich mir das heute; mehr als zwanzig Jahre danach!
Während ich noch dasaß und grübelte, klopfte es plötzlich an der Tür, und ein Brief in einem großen blauen Umschlag wurde mir überbracht. Ich sah sofort, dass der Brief von einem Anwalt kam, und mein Instinkt sagte mir: Aha, nun geht es also los! Und richtig, der Brief hatte folgenden Wortlaut:
»Mr. L. H. Holly, Cambridge, College.
Unser früherer Klient, der am 9. des Monats zu Cambridge verstorbene Mr. L. Vincey, hat ein Testament hinterlassen, zu dessen Vollstreckern wir ernannt worden sind und von dem wir Ihnen anbei eine Abschrift übersenden. In diesem Testament hat der Verstorbene Ihnen, falls Sie über seinen einzigen, gegenwärtig fünfjährigen Sohn Leo Vincey die Vormundschaft übernehmen, die Hälfte seines jetzt in Staatspapieren angelegten Vermögens hinterlassen. Hätten wir besagtes Dokument nicht nach Mr. Vinceys klaren und ausführlichen Angaben eigenhändig angefertigt, und hätte er uns hierbei nicht versichert, dass er triftige Gründe habe, so müssten wir Ihnen jetzt eröffnen, dass besagte Bestimmung höchst ungewöhnlich ist und dass wir die Aufmerksamkeit des Obervormundschaftsgerichts auf sie lenken würden, um eventuell die Zurechnungsfähigkeit des Erblassers nachprüfen zu lassen. Da wir den Erblasser jedoch als Mann von klarem Verstand und großem Scharfsinn gekannt haben, und da nachgewiesen ist, dass tatsächlich keine Anverwandten des Erblassers mehr am Leben sind, denen besagte Vormundschaft übertragen werden könnte, so müssen wir von derartigen Schritten Abstand nehmen.
Ihren gefl. Entscheidungen entgegensehend zeichnen wir in vorzüglicher Hochachtung, Geoffrey und Jordan.«
Nun überflog ich die Abschrift des Testaments. Dem Juristenstil zufolge war es sicher nach dem Buchstaben des Gesetzes abgefasst worden. Soviel ich daraus entnehmen konnte, enthielt es dasselbe, was mein Freund mir schon auseinandergesetzt hatte. Also hatte alles seine Richtigkeit: Ich musste den Knaben zu mir nehmen.
Da fiel mir Vinceys Brief wieder ein. Ich holte ihn hervor und öffnete ihn. Er enthielt nur die mir schon bekannte Anweisung betreffs der Öffnung des Kastens an Leos fünfundzwanzigstem Geburtstag und die Richtlinien für seine Erziehung, die auch Griechisch, die höhere Mathematik und Arabisch umfassen sollte. Am Schluss kam noch eine Nachschrift: Falls Leo vor seinem fünfundzwanzigsten Geburtstag stürbe, sollte ich selbst vom Inhalt des Kastens Kenntnis nehmen und nach eigenem Ermessen handeln. Gedächte ich den darin enthaltenen Anweisungen nicht zu folgen, so sollte ich den Inhalt des Kastens vernichten, auf keinen Fall aber in fremde Hände gelangen lassen.
Da dieser Brief keinen Anlass gab, Einspruch zu erheben, teilte ich den Anwälten mit, ich sei zum Antritt der Vormundschaft bereit, und zwar in acht Tagen.
Dann ging ich aufs Sekretariat und erzählte von meiner Geschichte soviel ich für nötig hielt, worauf die Herren ein Auge zudrückten und mir, falls ich angestellt würde, die Erlaubnis gaben, das Kind zu mir zu nehmen. Nur musste ich dann natürlich mein Zimmer im College aufgeben. So ging ich denn auf Wohnungssuche, und bald war eine Wohnung, die mir zusagte, gefunden.
Dann hieß es, jemand zur Bedienung meines Mündels zu gewinnen. Und da raffte ich mich zu einem kühnen Entschluss auf, nämlich dem, keine weibliche Person ins Haus zu nehmen, da eine solche mir vielleicht die Zuneigung des Knaben entziehen könnte. Er war ja auch alt genug, um ohne weiblichen Beistand fertig zu werden. Nach längerem Suchen machte ich einen kräftigen jungen Mann namens Job aus achtbarer Familie ausfindig, der bei einem Rennstallbesitzer gedient hatte, mit sechzehn Geschwistern aufgewachsen war, und daher mit Kindern gut Bescheid zu wissen behauptete. Da er bereit war, seinen Dienst sogleich bei Leos Ankunft anzutreten, wurden wir schnell einig. Dann fuhr ich mit dem Eisenkasten nach London, deponierte ihn in meiner Bank und kaufte mir einige Bücher über Kinderpflege. Diese las ich zu Hause erst selbst durch, las dann Job das für ihn Wichtigste daraus vor und erwartete die Ankunft des Knaben.
Endlich kam mein Mündel an und zwar unter der Obhut einer ältlichen, in Tränen schwimmenden Kinderfrau. Mit seiner hohen Stirn, seinen grauen Augen und dem niedlichen Gesicht, dessen Züge schon damals so ebenmäßig und fein geschnitten waren wie die einer Gemme, war er in der Tat ein ganz reizendes Kind. Das Schönste an ihm aber waren seine wie Gold schimmernden und den edel geformten Kopf in dichten kurzen Locken bedeckenden Haare. Als die Alte sich schließlich von ihm losriss, brach auch er in Tränen aus.
Ein köstliches Bild: Die Sonnenstrahlen umspielten seine goldenen Locken; ein Auge mit der Hand bedeckend, musterte er uns mit dem anderen. Von meinem Stuhl aus streckte ich ihm die Hand entgegen, während Job, um ihn zu trösten, wie ein Huhn gackerte und ein Schaukelpferd auf- und nieder galoppieren ließ. Endlich streckte der Junge beide Ärmchen aus, kam auf mich zugelaufen und umarmte mich. »Dich mag ich leiden! Hübsch bist du nicht, aber hübsche Augen hast du.«
Kurze Zeit darauf erhielt ich meine Anstellung, und Leo war bald der erklärte Liebling des ganzen College. Trotz aller gegenteiligen Verordnungen ging er dort ein und aus, und man wetteiferte förmlich, ihn durch Geschenke zu verhätscheln. Mit einem als griesgrämiger Kinderfeind verschrienen alten Professor hatte ich seinetwegen einmal eine ernste Auseinandersetzung. Da Leo sich nämlich mehrmals den Magen verdorben hatte, passten wir genau auf ihn auf, und richtig, Job entdeckte, dass jener Alte ihn zu sich ins Zimmer lockte, dort mit Likörbonbons fütterte und ihm dabei einschärfte, ihn ja nicht zu verraten. Job war außer sich und sagte ihm gründlich seine Meinung: Er solle sich schämen, solche Streiche zu machen, noch dazu bei seinem Alter, wo er längst Großvater sein könnte, wenn er seine Pflicht getan hätte – was natürlich heißen sollte, wenn er sich verheiratet hätte. Und dann geriet auch ich mit dem Alten zusammen.
Doch bei diesen köstlichen Zeiten darf ich hier nicht lange verweilen. Die Jahre entschwanden, und mit ihnen wuchs unsere gegenseitige Zuneigung. Aus dem Knaben wurde ein Jüngling, aus dem Jüngling ein Mann, und je mehr der unerbittlichen Jahre dahin flossen, desto größer wurden Leos körperliche und geistige Vorzüge. Als Jüngling hieß er im College nur noch Adonis, während ich mich des Namens »der Affe« erfreute. »Adonis und der Affe«, so hieß es bei unseren täglichen Spaziergängen. Eines Tages stürzte sich Leo wutentbrannt auf einen stämmigen Fleischergesellen, der dies hinter uns her gerufen hatte, und verprügelte ihn, bis er um Gnade bat.
Später legte man uns neue Namen bei. Ihn hieß man jetzt den »Griechengott«, mich aber nannte man »Charon«. Über meinen eigenen Beinamen will ich bescheiden hinweggehen, Leos Name aber war so treffend wie nur möglich, und mit einundzwanzig Jahren hätte er für eine Apollostatue Modell stehen können – und war sich dabei seiner Schönheit völlig unbewusst.
Er hatte einen klaren, hellen Kopf, zum Gelehrten aber taugte er nicht; dazu fehlte es ihm leider an Ausdauer und Beharrlichkeit.
Das Unterrichtsprogramm seines Vaters hielt ich gewissenhaft ein, und mit seinen Fortschritten, besonders in den Sprachen, war ich voll und ganz zufrieden. Um ihm im Arabischen helfen zu können, musste auch ich diese Sprache erlernen, aber nach fünfjähriger Beschäftigung mit ihr war er darin mindestens ebenso beschlagen wie ich, ja, fast ebenso wie unser gemeinsamer Dozent. Da ich ein großer Sportsfreund bin – meine einzige Leidenschaft – gingen wir in jedem Herbst auf die Jagd und auf den Fischfang, bald in Schottland, bald in Norwegen; einmal reisten wir sogar nach Russland. Ich bin selbst kein schlechter Schütze, aber auch im Schießen war er mir bald überlegen.
Mit achtzehn Jahren ließ sich Leo immatrikulieren, so dass ich jetzt wieder meine alte Wohnung beziehen konnte. Mir einundzwanzig Jahren bestand er die Prüfung als Bakkalaureus. Da erzählte ich ihm zum ersten Mal von seiner eigenen Geschichte und von dem auf ihn harrenden Geheimnis. Natürlich hätte er gern mehr erfahren, aber den Gefallen durfte ich ihm ja nicht tun. Dann schlug ich ihm, um die Zeit hinzubringen, das Studium der Rechte vor. Er war es zufrieden und hörte jetzt auch juristische Vorlesungen.
Sorgen hatte mir mein Leo nie gemacht, es sei denn dadurch, dass fast alle jungen Mädchen sich auf den ersten Blick in ihn verliebten; doch auf die dadurch entstehenden Verdrießlichkeiten brauche ich hier nicht einzugehen. Mit seinem Verhalten war ich stets durchaus zufrieden – und dass will viel sagen.
So erreichte er endlich seinen fünfundzwanzigsten Geburtstag, den Tag, an welchem diese seltsame und in mancher Hinsicht unheimliche Geschichte ihren Anfang nimmt.
3 Die Amenartasscherbe
Am Tag zuvor fuhren wir nach London und holten den vor zwanzig Jahren deponierten Kasten ab, mit dem wir am Abend wieder zurückfuhren. In dieser Nacht konnten wir vor Aufregung kaum ein Auge schließen, und Leo wollte schon in aller Herrgottsfrühe ans Werk gehen. Ich aber verwies ihm solche unziemliche Neugier, und so musste er bis nach dem Frühstück warten.
Endlich wurde abgeräumt. Job, der von unserer Aufregung angesteckt schon meine schöne Sèvres-Tasse zerbrochen hatte, musste den Kasten holen und stellte ihn behutsam, fast ängstlich auf den Tisch. Als er schon an der Tür war, sagte ich, einer plötzlichen Eingebung folgend: »Warte mal, Job! Du kannst doch schweigen? Wenn Mr. Leo nichts dagegen hat, so möchte ich auch einen unparteiischen Zeugen dabei haben.«
»Ganz meine Meinung, Onkel Horace«, antwortete Leo; denn ich hatte ihm beigebracht, mich ›Onkel‹ zu nennen; in besonders guter Stimmung nannte er mich zuweilen auch sein ›Onkelchen‹ oder ›alter Junge‹.
Nach einem militärischen Gruß als Dank für das Vertrauen verschloss Job die Tür, und dann entnahm ich meiner Dokumentenmappe die mir von Leos Vater anvertrauten Schlüssel. Es waren ihrer drei: Der größte war ein ganz gewöhnlicher, moderner; der zweite war schon ein recht altes Inventar; der dritte aber war ein ganz eigenartiges Ding. Ein längliches Stück massiven Silbers mit mehreren Kerben und einer als Griff dienenden Querstange; ich hätte es eher für einen vorsintflutlichen Schraubenschlüssel gehalten.
»Fertig?«, fragte ich dann, als ob es eine Mine zu entzünden gelte.
Da alles schwieg, bestrich ich den Bart des modernen Schlüssels mit Salatöl, steckte ihn ins Schlüsselloch des Kastens und drehte um, worauf Leo mit beiden Händen den schweren Deckel mühsam aufklappte; die Scharniere waren offenbar verrostet. Im Inneren stand ein zweiter, mit dickem Staub bedeckter Kasten, den wir heraushoben und säuberten. Er war aus Ebenholz und von flachen Eisenbändern umschlossen. Stellenweise war das Holz schon ganz morsch und zerbröckelt, der Kasten musste also sehr alt sein.
Dann führte ich den zweiten Schlüssel ein. Er drehte sich, ich klappte den Kasten auf – und sogleich erschall ein dreifaches »Ah«. Innen stand ein silbernes Schmuckkästchen, etwa dreißig Zentimeter im Quadrat, zwanzig Zentimeter hoch, dessen gewölbter Deckel eine Sphinx trug und dessen Füße gleichfalls sphinxartig geformt waren, das also offenbar aus Ägypten stammte. Infolge hohen Alters hatte es den Glanz verloren und war vielfach verbeult, sonst aber gut erhalten. Ich hob es heraus und fuhr mit dem eigenartigen Silberding ins Schlüsselloch. Nach einigen vergeblichen Drehversuchen gab das Schloss nach, und das Kästchen stand geöffnet vor uns, bis zum Rand mit uns unbekannten braunen Pflanzenfasern gefüllt. Nach Entfernung der obersten Schicht stieß ich auf einen versiegelten Briefumschlag mit der Aufschrift »An meinen Sohn Leo« in der mir unvergesslichen Handschrift meines toten Freundes. Leo betrachtete die Aufschrift eine Weile, legte dann den Brief beiseite und winkte mir zu, fortzufahren.
Zuerst fand ich ein sorgfältig zusammengerolltes Pergament. Beim Aufrollen zeigte sich, dass es gleichfalls mit Vinceys Schriftzügen bedeckt war. Die Überschrift lautete: »Übersetzung der griechischen Unzialen auf der Scherbe«.
Dann fand ich ein zweites, stark vergilbtes und zerknittertes Pergament. Beim Aufrollen ergab sich, dass es nach der Überschrift eine lateinische Übersetzung derselben griechischen Unzialen enthielt, jedoch in gotischen Lettern, deren Form auf den Anfang des 16. Jahrhunderts hinwies. Unter dieser Rolle, auf einer neuen Schicht des Faserstoffes, lag in gelbe Leinwand gehüllt ein harter, schwerer Gegenstand. Vorsichtig wickelten wir ihn aus und fanden eine große, schmutzig gelbliche Scherbe, die einst einer mittelgroßen Amphora angehört haben musste. Sie war gut fünfundzwanzig Zentimeter lang, etwa zwanzig Zentimeter breit und fast einen Zentimeter dick. Die gewölbte Seite war mit vielen Reihen frühgriechischer Unzialen bedeckt, welche zwar hier und da etwas verblichen, aber meist noch ganz gut lesbar waren. Die Schrift war offenbar mit größter Sorgfalt angefertigt worden und zwar vermittels einer Rohrfeder, wie sie bei den Alten in Gebrauch gewesen war. Diese Scherbe war in zwei Stücke geborsten, aber mit Zement und acht langen Nieten wieder zusammengefügt worden. Auch die Innenseite war ganz mit Schriftzügen bedeckt, die aber sehr ungleichmäßig und ganz verschiedenartig waren, also wohl aus sehr verschiedenen Zeiten und von ganz verschiedenen Händen herrührten.
»Ist noch mehr drin?«, flüsterte Leo aufgeregt.
Ich suchte weiter und brachte etwas Hartes zum Vorschein, das in einen kleinen Leinenbeutel eingenäht war. Diesen trennte ich auf und holte ein hübsches elfenbeinernes Miniaturbild und einen ganz kleinen schokoladenbraunen Bild-Skarabäus hervor mit nachstehender Zeichnung:
Wie wir späterhin feststellten, bedeuten diese Hieroglyphen: »Suten se Rā«, d. h. Sohn des Ra, Sohn der Sonne.
Das Miniaturbild stellte Leos Mutter dar, eine reizende Griechin; auf der Rückseite stand nämlich in Vinceys Handschrift: »Mein geliebtes Weib.«
»Das ist alles«, sagte ich nun.
»Schön«, sagte Leo, betrachtete das Bildnis und rief dann: »Nun zu dem Brief!«
Ohne Zögern erbrach er das Siegel und las folgendes vor:
»Mein Sohn Leo!
Wenn du dieses Schreiben öffnest, hast du das Mannesalter erreicht, ich selbst aber bin längst tot und vergessen. Beim Lesen dieser Zeilen bedenke jedoch folgendes: Auch ich habe einst gelebt und lebe vielleicht noch – wer kann es wissen? In diesem Brief reiche ich Dir über den Abgrund des Todes hinweg die Hand, so dass jetzt aus der Stille des Grabes meine Stimme an Dein Ohr klingt. Wenn ich auch tot bin, so weile ich in dieser Stunde dennoch bei Dir. Seit dem Tag Deiner Geburt habe ich Dich nicht wieder gesehen. Verzeih mir das, mein Sohn! Dein Leben kostete das Leben einer Frau, die mir über alles lieb und teuer war, und mein Schmerz hält heute noch an. Bei längerem Leben hätte ich meine törichte Abneigung gegen Dich vielleicht überwunden, aber es sollte nicht sein. Meine Leiden übersteigen meine Kraft, und sobald meine Vorkehrungen für Dein Wohlergehen erledigt sind, gedenke ich, ein Ende zu machen. Ist es Sünde, so möge Gott mir verzeihen. Ein Jahr höchstens könnte ich doch nur noch am Leben bleiben.«
»Er hat sich das Leben genommen!«, rief ich aus, »ich habe es mir gleich gedacht.«
»Doch jetzt genug von mir dem Toten«, las Leo unbeirrt weiter, »jetzt zu Dir, mein Sohn! Mein Freund Holly, der hoffentlich Deine Erziehung übernommen hat, wird Dir schon von dem ungewöhnlich hohen Alter Deines Geschlechts erzählt haben. In diesem Kästchen findest Du die Beweise. Die Scherbe mit der Inschrift Deiner fernen Ahnfrau hat mir mein Vater auf seinem Sterbebett übergeben. Sie hat meine Phantasie gewaltig angeregt, so dass ich schon mit neunzehn Jahren die Wahrheit zu erforschen beschloss, ebenso wie einer unserer Ahnen zur Zeit Elisabeths, dem dieses Vorhaben jedoch zum Verderben gereichte. Auf meine Erlebnisse dabei brauche ich hier nicht einzugehen. Doch höre, was ich mit eigenen Augen gesehen habe: An der Küste Afrikas, nördlich von Sambesi, in noch unerforschter Gegend, gibt es ein Vorgebirge, auf dessen äußerstem Vorsprung ein Fels emporragt, in Gestalt eines Negerkopfes, ganz wie ihn die Inschrift schildert. Dort bin ich gelandet und habe von einem umherziehenden Eingeborenen, den sein Stamm ausgestoßen hatte, erfahren, dass landeinwärts zwischen großen, unabsehbaren Sümpfen hohe Ringgebirge mit großen Höhlen liegen. Er erzählte mir auch, dass der dort wohnende Stamm arabisch spricht und unter der Herrschaft einer schönen weißen Frau steht, die sich ihrem Volke aber nur selten zeigt und die über alles Lebende und Tote Gewalt haben soll. Zwei Tage nach diesem Gespräch erlag er dem Sumpffieber, und ich selbst musste aus Mangel an Lebensmitteln und der Anzeichen einer nahenden Krankheit wegen zu meiner Dau zurückkehren. Bei Madagaskar erlitt ich Schiffbruch und wurde einige Monate später von einem englischen Schiff aufgenommen. So kam ich nach Aden und von dort nach England zurück. Unterwegs, in Athen, lernte ich noch Deine geliebte Mutter kennen. Omnia vincit amor.4 Wir heirateten, und dort wurdest Du geboren, und dort ist Deine Mutter gestorben. Damals befiel mich mein jetziges Leiden. Ich kehrte nach England zurück, um in der Heimat zu sterben. Die Hoffnung aber gab ich dennoch nicht auf, sondern ich fing an, arabisch zu lernen, um vielleicht doch noch nach Afrika zurückzukehren und dort das große Geheimnis zu lösen. Ich bin aber leider nicht gesund geworden, und damit ist dies für mich erledigt.