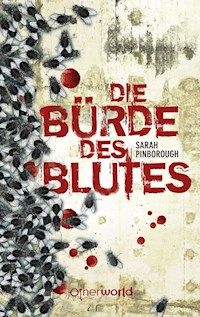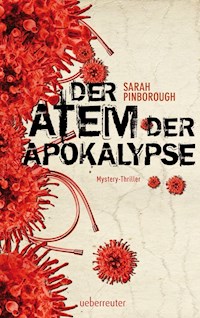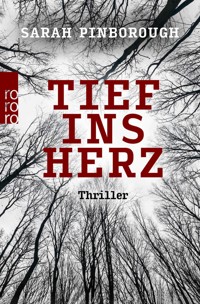9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der internationale Bestseller - Jetzt als Netflix-Serie Beinahe wäre Louise mit dem netten Mann aus dem Pub im Bett gelandet. Ein paar Tage später dann der Schock: David ist ihr neuer Chef. Und verheiratet. Kurz darauf lernt Louise auf der Straße durch Zufall eine Frau kennen. Seine Frau. Bald sind die beiden Freundinnen. Keine gute Idee. Adele ist sehr schön und sie wirkt sehr verletzlich. Nach und nach verrät sie Luise Erschreckendes über ihre Ehe. Und Louise spürt: Sie hat sich in eine heikle Lage gebracht. Was sie nicht weiß: Die Begegnung mit Adele war kein Zufall. Adele hat einen Plan. Doch es ist keine Intrige aus Eifersucht. Es ist viel, viel schlimmer. "Verdammt brillant" Stephen King
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Sarah Pinborough
Sie weiß von dir
Thriller
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Drei Menschen können ein Geheimnis bewahren, wenn zwei von ihnen tot sind.»
Benjamin Franklin
Für Tasha
Mit Worten kann ich es nicht ausdrücken. Ich kann nur sagen: Danke für alles, die nächste Runde geht auf mich.
Erster Teil
1Damals
Mich einmal in der Stunde selbst kneifen und sagen ICH BIN WACH.
Meine Hände ansehen. Meine Finger zählen.
Auf die Uhr sehen, kurz wegsehen, noch einmal hinsehen.
Ruhig und konzentriert bleiben.
An eine Tür denken.
2Später
Es tagte bereits, als es endlich vollbracht war. Das erste Grau des Morgens überzog streifig die Leinwand des Himmels. Dürres Laub und Matsch hafteten an seiner Jeans, und sein schwacher Körper schmerzte, während sein Schweiß in der feuchtkalten Luft abkühlte. Es war etwas getan worden, was nicht mehr rückgängig zu machen war. Eine schreckliche, notwendige Tat. Ein Ende und ein Anfang, nunmehr für alle Zeit untrennbar miteinander verknüpft. Halb rechnete er damit, dass die Welt jetzt eine andere Färbung annehmen würde; die Erde und der Himmel jedoch sahen im Dämmerlicht aus wie immer, und auch die Bäume erzitterten nicht vor Zorn. Ringsum nichts als Stille. Kein klagender Windhauch, kein Geheul von Polizeisirenen in der Ferne. Der Wald war einfach nur Wald, und die Erde war einfach nur Erde. Er stieß langsam die Luft aus, die er unwillkürlich angehalten hatte, und das fühlte sich verblüffend gut an. Sauber. Ein neuer Morgen zog herauf. Ein neuer Tag.
Er wandte sich um und stapfte los, zurück zu den Überresten des Hauses in der Ferne. Er sah sich nicht um, kein einziges Mal.
3Jetzt, Adele
Ich habe noch immer Erde unter den Fingernägeln, als David endlich nach Hause kommt. Tief eingedrungen ins Nagelbett, in die empfindsame Haut dort, es brennt. Mein Magen krampft sich zusammen, als die Haustür ins Schloss fällt, ich bekomme Herzklopfen, und kurz blicken wir uns wortlos an durch den langen Flur unseres neu bezogenen Hauses aus viktorianischer Zeit mit dem blank polierten Holzboden, ehe er, leicht schwankend, ins Wohnzimmer geht. Ich atme tief durch, dann setze ich mich in Bewegung. Zucke innerlich bei jedem Schritt zusammen, weil meine Absätze so laut auf die Holzdielen knallen. Ich darf keine Angst haben. Ich muss das kitten. Wir müssen das wieder kitten.
«Ich habe zu Abend gekocht», sage ich, darum bemüht, nicht allzu bedürftig zu klingen. «Nur ein Stroganoff. Es hält sich auch bis morgen, falls du schon gegessen hast.»
Er wendet sich nicht zu mir um. Steht da und starrt unsere Bücherregale an, die die Leute von der Umzugsfirma vollgeräumt haben. Ich versuche, nicht daran zu denken, wie lang er fortgeblieben ist. Ich habe die Glasscherben zusammengekehrt, den Boden gefegt, gewischt und mich um den Garten gekümmert. Alle Spuren des Wutausbruchs sind beseitigt. Nach jedem Glas Wein, das ich in seiner Abwesenheit getrunken habe, habe ich mit Mundspülung gegurgelt, um nicht nach Alkohol zu riechen. Er mag es nicht, wenn ich trinke. Höchstens mal ein Glas oder zwei, in Gesellschaft. Niemals allein. Heute Abend aber konnte ich nicht anders.
Auch wenn ich meine Nägel nicht restlos sauber bekommen habe, ich habe geduscht und mich für ihn hübsch gemacht. Ich trage ein puderblaues Kleid mit passenden Pumps und bin sorgfältig geschminkt. Keine Tränen mehr, kein Streit. Ich möchte, dass wir das alles fortspülen. Ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Das ist unser Neuanfang. Es muss unser Neuanfang sein.
«Ich hab keinen Hunger.» Jetzt wendet er sich zu mir um, und bei dem stillen Abscheu, der aus seinen Augen spricht, muss ich mir von neuem die Tränen verbeißen. Diese Kälte tut so weh, sie ist schlimmer als sein Zorn. Alles, was ich unter so großen Mühen aufgebaut habe, droht wieder einzustürzen. Dass er wieder mal betrunken ist, stört mich nicht. Er soll mich einfach so lieben wie früher, das ist alles, was ich mir wünsche. Er nimmt gar keine Notiz davon, was ich unternommen habe, um alles wiedergutzumachen, seit er aus dem Haus gestürmt ist. Wie alles glänzt und blinkt. Wie ich aussehe. Wie viel Mühe ich mir gebe.
«Ich gehe schlafen.» Bei diesen Worten sieht er mich nicht an, und ich weiß, dass er damit das Gästezimmer meint. Unser Neuanfang ist gerade zwei Tage alt, und er will nicht das Bett mit mir teilen. Ich spüre, wie die Kluft zwischen uns von neuem aufreißt; bald wird sie für uns nicht mehr zu überbrücken sein. Als er zur Tür geht – dabei macht er bewusst einen Bogen um mich –, würde ich ihn zu gern am Arm berühren, doch ich beherrsche mich, aus Angst vor seiner Reaktion. Er scheint Ekel vor mir zu empfinden. Vielleicht ekelt er sich auch vor sich selbst, und das ist es, was in meine Richtung abstrahlt.
«Ich liebe dich», sage ich leise. Ich hasse mich dafür. Er geht in keiner Weise darauf ein, stapft wortlos die Treppe hinauf, ein wenig unsicher, als wäre ich Luft. Ich höre, wie er durchs Obergeschoss wankt, dann wird eine Tür geschlossen.
Wie betäubt starre ich zu der Stelle, wo er eben noch gestanden hat, und dabei ist mir, als würde mein mühsam geflicktes Herz in Stücke gehen. Dann gehe ich in die Küche und schalte den Herd aus. Ich werde das Stroganoff nicht für morgen aufbewahren. Die Erinnerung an heute würde seinen Geschmack verderben. Das Essen ist ruiniert. Wir sind ruiniert. Bisweilen frage ich mich, ob er mich umbringen und damit allem ein Ende machen will. Um sich der Bürde zu entledigen, die ich für ihn bin. Mir geht es mitunter nicht anders, dann kommen auch mir Mordgedanken.
Ich überlege, ob ich noch ein Glas verbotenen Wein trinken soll, widerstehe aber der Versuchung. Weil ich auch so schon den Tränen nahe bin und mich einer weiteren Auseinandersetzung nicht gewachsen fühle. Vielleicht ist ja morgen früh alles wieder in Ordnung. Ich werde die angebrochene Flasche ersetzen, dann merkt er nicht, dass ich heimlich getrunken habe.
Ich blicke noch einmal hinaus in den Garten, ehe ich die Außenbeleuchtung ausschalte und mich meinem Spiegelbild im Fensterglas stelle. Ich bin eine schöne Frau, keine Frage. Ich pflege mich, achte auf mein Äußeres. Warum kann er mich nicht einfach lieben, so wie früher? Warum kann unser Leben nicht so sein, wie ich es mir immer erhofft und gewünscht habe, nach allem, was ich für ihn getan habe? Wir stehen finanziell gut da. Er hat die Karriere, die er sich erträumt hat. Ich habe mich immer bemüht, die perfekte Ehefrau zu sein und ihm ein perfektes Leben zu bieten. Warum kann er die Vergangenheit nicht einfach ruhen lassen?
Ich schwelge einige Minuten in Selbstmitleid, während ich die Granitflächen in der Küche abwische und auf Hochglanz poliere. Dann atme ich tief durch und reiße mich zusammen. Ich brauche Schlaf. Richtigen Schlaf. Am besten, ich nehme eine Tablette. Morgen ist ein neuer Tag, morgen wird alles anders. Ich werde ihm verzeihen. So wie immer.
Ich liebe meinen Mann. Liebe ihn, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, und werde auch nie aufhören, ihn zu lieben. Das gebe ich nicht auf. Niemals.
4Louise
Keine Namen, okay? Kein ödes Gerede über Berufe oder unser Alltagsleben. Unterhalten wir uns über das, was wirklich zählt.
«Das hast du wirklich gesagt?»
«Ja. Oder nein», berichtige ich mich. «Das waren seine Worte.»
Mein Gesicht glüht vor Scham. Vor zwei Tagen hat sich das noch romantisch angehört, bei einem ersten unerlaubten Negroni, nachmittags um halb fünf. Jetzt aber klingt es eher abgedroschen, wie aus einer billigen Liebeskomödie mit tragikomischem Einschlag. Eine Frau von vierunddreißig kommt in eine Bar und lernt den Mann ihrer Träume kennen, der sich dann als ihr neuer Chef entpuppt. O Gott, wie peinlich. Was für ein Schlamassel. Ich möchte am liebsten im Erdboden versinken.
«Klar, dass er das gesagt hat.» Sophie lacht und bemüht sich dann umgehend, wieder ernst zu werden. «Kein ödes Gerede über Berufe oder unser Alltagsleben. Wie etwa, öh, keine Ahnung, die unbedeutende Kleinigkeit, dass ich verheiratet bin.» Da bemerkt sie meinen Gesichtsausdruck. «Entschuldige. Klar, es ist nicht komisch, genau genommen, aber irgendwie eben doch. Und klar, du bist aus der Übung, was Männer und all das betrifft, aber wie konntest du daraus nicht folgern, dass er verheiratet ist? Dass er außerdem dein neuer Chef ist, lasse ich dir durchgehen. Das ist einfach nur Riesenpech.»
«Es ist wirklich nicht komisch», beharre ich, muss aber schon wieder selber lächeln. «Zumal verheiratete Männer eher deine Spezialität sind, nicht meine.»
«Stimmt.»
Auf Sophie ist Verlass, ich habe gewusst, dass sie meine Laune heben würde. Wir verstehen uns großartig und haben immer unseren Spaß zusammen. Sie ist gelernte Schauspielerin – wobei wir nie ein Wort darüber verlieren, dass sie, von zwei Rollen als Fernsehleiche abgesehen, seit Jahren nicht mehr in ihrem Beruf gearbeitet hat – und, ungeachtet ihrer zahlreichen Affären, seit Urzeiten mit ihrem Mann verheiratet, einem gefragten Musikproduzenten. Kennengelernt haben wir uns seinerzeit bei der Schwangerschaftsgymnastik und uns spontan angefreundet, obwohl wir auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben. Das ist nun sieben Jahre her, und wir treffen uns noch immer zum Weintrinken.
«Aber jetzt bist du genau wie ich», sagt sie mit einem fröhlichen Augenzwinkern. «Schläfst mit einem verheirateten Mann. Du. Willkommen im Club. Da fühle ich mich ja gleich viel besser.»
«Ich habe nicht mit ihm geschlafen. Und ich hatte ja keinen Schimmer, dass er verheiratet ist.» Letzteres entspricht nicht ganz der Wahrheit; am Ende des Abends schwante mir in der Hinsicht nichts Gutes. Die drängende Art, wie er sich an mich presste, als wir uns küssten, beide vom Gin beschwipst. Dann sein jähes Zurückweichen. Der Blick, mit dem er mich ansah, voller Schuldbewusstsein. Die kleinlaute Entschuldigung. Tut mir leid, das geht nicht. Die Warnzeichen waren eigentlich nicht zu übersehen.
«Na gut, Schneewittchen. Ich finde es eben aufregend, dass du um ein Haar flachgelegt worden wärst. Wie lange bist du jetzt schon allein?»
«Darüber möchte ich jetzt nicht nachdenken. Die Lage, in der ich stecke, ist schlimm genug, da kann ich zusätzliche Depressionen wirklich nicht gebrauchen», stelle ich klar und trinke noch einen Schluck. Ich würde gern noch eine rauchen. Adam liegt im Bett, er schlummert friedlich und wird erst wieder munter werden, wenn es Zeit fürs Frühstück und für die Schule ist. Um ihn brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Er leidet nicht unter Albträumen. Schlafwandelt nicht. Und das ist schon sehr viel wert.
«Außerdem, das ist alles Michaelas Schuld», fahre ich fort. «Wenn sie mir abgesagt hätte, ehe ich zu unserem Treffen kam, wäre all das nie passiert.»
Ganz unrecht hat Sophie allerdings nicht. Es ist lange her, seit ich das letzte Mal mit einem Mann geflirtet, geschweige denn in nicht ganz nüchternem Zustand mit einem herumgeknutscht habe. Ihr Leben ist anders. Immer umgeben von neuen und interessanten Leuten. Kreativen Typen mit ungezwungenem Lebensstil, die bis tief in die Nacht in Bars und Clubs abhängen und trinken, wie Teenager im Grunde. Als alleinerziehende Mutter in London, die sich als Teilzeitsekretärin in einer psychiatrischen Praxis mehr schlecht als recht über Wasser hält, kann ich es mir dagegen nicht erlauben, alle Bedenken in den Wind zu schlagen und jeden Abend auszugehen, in der Hoffnung, jemanden Nettes kennenzulernen; und vor Dating-Apps wie Tinder oder Match schrecke ich, offen gesagt, zurück. Also habe ich mich mehr oder weniger daran gewöhnt, allein zu sein. Habe all das vorläufig zurückgestellt und auf Eis gelegt. Inzwischen aber bin ich schon so lange Single, dass sich daraus langsam ein unfreiwilliger Dauerzustand entwickelt.
«Das hier bringt dich auf andere Gedanken.» Sie greift in die Brusttasche ihrer roten Cordjacke und bringt einen fertiggerollten Joint zum Vorschein. «Wenn wir erst breit sind, siehst du alles von der lustigen Seite, garantiert.» Mein anfänglicher Widerwille steht mir wohl ins Gesicht geschrieben. «Na komm, Lou», sagt sie grinsend. «Zur Feier des Tages. Weil du dich selbst übertroffen hast. Du hast mit deinem neuen Chef rumgeknutscht, der noch dazu verheiratet ist. Wirklich genial. Nicht zu toppen. Das sollte ich von jemandem zu einem Drehbuch verarbeiten lassen. Dann könnte ich dich spielen.»
«Na schön», willige ich ein. «Das Geld kann ich gut gebrauchen, wenn ich erst gefeuert bin.» Ich kann mich Sophie nicht widersetzen und will es eigentlich auch gar nicht, und bald schon sitzen wir draußen auf dem kleinen Balkon meiner winzigen Wohnung, mit Wein, Chips und Zigaretten zu unseren Füßen, und lassen kichernd den Joint zwischen uns hin- und hergehen.
Im Gegensatz zu Sophie, die sich viel von einem Teenager bewahrt hat, gehört Kiffen wirklich nicht zu meinem Alltag; dazu habe ich weder die Zeit noch das Geld. Lachen aber ist allemal besser als Trübsal blasen, und so nehme ich einen tiefen Zug von dem süßen, verbotenen Rauch.
«So was kann wirklich nur dir passieren», sagt sie. «Du hast dich versteckt?»
Ich nicke und lächle bei dem Gedanken, wie saukomisch diese Begebenheit auf Außenstehende, in diesem Fall Sophie, wirken muss. «Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Also bin ich in die Toilette geflitzt und habe mich dort eingesperrt. Als ich mich wieder rausgewagt habe, war er gottlob nicht mehr da. Er fängt erst morgen an, deswegen. Dr. Sykes hat mit ihm bloß eine erste Runde durch die Praxis gedreht, um ihm alles zu zeigen.»
«Und seine Frau war auch dabei.»
«Ja. Die war auch dabei.» Ich rufe mir vor Augen, wie gut die beiden zusammen aussahen, in jenem kurzen, schrecklichen Moment, als ich ihn wiedererkannte. Ein schönes Paar, keine Frage.
«Wie lange bist du im Klo geblieben?»
«Zwanzig Minuten.»
«Du liebe Güte.»
Kurz bleibt es still, dann brechen wir beide, angeheitert vom Wein und nun auch noch zunehmend bekifft, in kreischendes Gelächter aus und können eine Weile nicht mehr aufhören.
«O Mann», schnauft Sophie. «Dein Gesicht hätte ich ja zu gern gesehen.»
«Ja. Wobei, ich freue mich nicht gerade darauf, sein Gesicht zu sehen, wenn er mich wiedererkennt.»
Sophie zuckt mit den Schultern. «Er ist es doch, der verheiratet ist. Die Schande trifft also nur ihn. Dir kann er keine Vorwürfe machen.»
Trotz der Absolution, die sie mir erteilt, machen mir weiter leise Schuldgefühle zu schaffen. Zusammen mit dem Schock. Der Schlag in die Magengrube, als ich die Frau an seiner Seite erblickt habe, ehe ich mich Hals über Kopf in Sicherheit brachte. Seine hinreißend schöne Frau. Elegant. Dunkelhaarig, mit olivfarbener Haut, vom Typ her wie Angelina Jolie. Auch mit einer ähnlich mysteriösen Aura. Und auffallend schlank. Gertenschlank. Das Gegenteil von mir. Ihr Bild hat sich mir regelrecht eingebrannt. Unvorstellbar, dass diese Frau je in Panik geraten und sich in einer Toilette verstecken könnte, vor wem auch immer. Ihr Anblick versetzte mir einen Stich, weit schmerzhafter, als durch einen feuchtfröhlichen Nachmittag in einer Bar zu rechtfertigen; und das nicht nur, weil mein Selbstvertrauen ohnehin angeknackst ist.
Das Problem ist, ich hatte ihn nett gefunden. Richtig nett. Aber das behalte ich für mich. Wie gut es mir tat, nach so langer Zeit mal jemandem wie ihm über den Weg zu laufen, das braucht Sophie nicht zu erfahren. Wie sehr es mir Auftrieb gab, mit jemandem zu flirten, der zurückflirtete. Wie beglückend es war, wieder einmal zu spüren, wie sehr einen die Aussicht auf etwas Neues beflügeln und in Hochstimmung versetzen kann. Mein Leben folgt sonst dem immer gleichen, einförmigen Trott. Ich mache Adam morgens fertig und bringe ihn zur Schule. Wenn ich arbeite und früh anfange, setze ich ihn unterwegs im Frühstücksclub ab. An Tagen, an denen ich frei habe, stöbere ich vielleicht mal ein Stündchen oder zwei in Second-Hand-Geschäften nach gebrauchter Designerkleidung, die in das exklusive Nobelambiente der Praxis passt. Danach heißt es Kochen, Putzen, Einkaufen, bis Adam von der Schule nach Hause kommt. Wenn er seine Hausaufgaben erledigt hat, bekommt er Abendbrot, dann geht es ab in die Wanne, anschließend bringe ich ihn zu Bett und lese ihm noch eine Gutenachtgeschichte vor. Nach dem einen oder anderen Glas Wein gehe ich selbst zu Bett und schlafe schlecht. Wenn er übers Wochenende bei seinem Vater ist, unternehme ich nicht viel; bleibe in der Regel lange im Bett liegen und lasse mich dann vom schlechten Fernsehprogramm berieseln, weil ich von der Woche so fix und fertig bin. Bei der Aussicht, dass es in dem Stil weitergehen könnte, bis Adam etwa fünfzehn ist, graut mir im Stillen, daher verdränge ich diesen Gedanken, so gut es geht. Die Begegnung mit dem Mann in der Bar aber hat mich aus meinem Trott gerissen. Hat mir nachdrücklich in Erinnerung gerufen, wie gut es tut, etwas zu fühlen. Als Frau. Ich habe mich lebendig gefühlt. Tags darauf habe ich sogar ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, mich abends noch einmal in diese Bar zu setzen, auf die Möglichkeit hin, dass auch er noch einmal dort auftauchen könnte, in der Hoffnung, mich wiederzusehen. Aber das Leben ist natürlich keine romantische Liebeskomödie. Und er ist verheiratet. Und es war idiotisch von mir, mich zu etwas hinreißen zu lassen. Verbitterung empfinde ich keine, ich bin eher traurig. All das kann ich Sophie nicht erzählen, weil sie mich dann nur bedauern würde, und das möchte ich nicht; obendrein ist es einfacher, das Ganze von der heiteren Seite zu sehen. Denn lustig ist es ja schon, irgendwie. Außerdem sitze ich nicht jeden Abend zu Hause und beweine mein Dasein als Single, als würde ich mich ohne Mann unvollständig fühlen. Eigentlich bin ich mit meinem Leben ganz zufrieden, alles in allem. Es könnte mir auch weit schlechter gehen. Die Sache mit ihm und mir war ein Fehler, mehr nicht. Ich bin kein kleines Kind mehr, damit muss ich zurechtkommen.
Ich klaube eine Handvoll Tortilla-Chips aus der Schale, und Sophie folgt meinem Beispiel.
«Weibliche Rundungen sind das neue dünn», sagen wir wie aus einem Munde, ehe wir uns die Chips einverleiben und wieder in prustendes Gelächter ausbrechen, bis wir beide rot anlaufen. Ich denke noch einmal daran, wie ich mich vor ihm in der Toilette versteckt habe, fassungslos und in heller Panik. Ja, das ist komisch. Alles ist komisch. Gut, morgen früh, wenn ich mich der Realität stellen muss, könnte es mir nicht mehr ganz so komisch vorkommen, vorläufig aber kann ich darüber lachen. Und solange man noch über das eigene Missgeschick lachen kann, ist die Welt noch in Ordnung.
«Was ist der Grund dafür?», frage ich später, als die Weinflasche restlos geleert zwischen uns steht und sich der Abend langsam dem Ende zuneigt. «Für deine Affären, meine ich. Bist du mit Jay nicht glücklich?»
«Natürlich bin ich mit ihm glücklich», erwidert Sophie. «Ich liebe ihn. Und außerdem habe ich ja nicht ständig was mit anderen Männern.»
Vermutlich stimmt das. Sie ist eben Schauspielerin; da wird sie bei manchen Geschichten etwas dicker auftragen, dem Effekt zuliebe.
«Aber was ist der Grund? Warum überhaupt fremdgehen, wenn du mit ihm glücklich bist?» Es ist das erste Mal, dass ich das Thema von mir aus anschneide, sonst reden wir eigentlich kaum darüber. Sie weiß, dass mir dabei nicht ganz wohl zumute ist, und zwar nicht wegen der Tatsache, dass sie fremdgeht – das ist ihr Bier, geht mich nichts an –, sondern weil ich Jay kenne und gern mag. Er tut ihr gut. Ohne ihn wäre sie ziemlich aufgeschmissen. Realistisch betrachtet.
«Ich bin sexuell aktiver als er», stellt sie nach kurzem Nachdenken fest. «Und Sex ist ja in einer Ehe ohnehin nicht die Hauptsache. Freundschaft geht vor, dass man gemeinsam durch dick und dünn geht, als beste Freunde. Und Jay ist mein bester Freund. Wir sind nun seit fünfzehn Jahren zusammen. Ganz normal, dass die Leidenschaft in einer Beziehung mit der Zeit abflaut. Ich meine, wir schlafen noch miteinander, hin und wieder, aber es ist nicht mehr so wie früher. Und durch ein Kind ändert sich auch vieles. Wenn man sich jahrelang als Eltern mit gemeinsamer Verantwortung wahrgenommen hat, weniger als Liebespaar, lässt sich die alte Leidenschaft nur schwer wieder zum Leben erwecken.»
Ich denke an meine eigene kurzlebige Ehe zurück. Von nachlassender Leidenschaft konnte bei uns eigentlich nicht die Rede sein. Was ihn jedoch nicht davon abhielt, mich nach vier Jahren zu verlassen, einer anderen wegen, als unser Sohn kaum zwei Jahre alt war. Womöglich hat Sophie ja recht. Als besten Freund habe ich Ian, meinen Ex, glaube ich, nie empfunden.
«Es kommt mir bloß ein bisschen, na ja, traurig vor.» Besser kann ich es nicht ausdrücken.
«Weil du an wahre Liebe glaubst, wie sie nur im Märchen vorkommt, und sie lebten glücklich miteinander bis ans Ende ihrer Tage. So läuft es aber im Leben nun mal nicht.»
«Und Jay?», hake ich nach. «Hat er dich auch schon mal betrogen?»
«Den einen oder anderen Flirt hat er schon gehabt, auf jeden Fall», sagt sie. «Da gab es mal eine Sängerin, mit der er zusammengearbeitet hat, ist schon länger her. Kann sein, dass die beiden was miteinander hatten, eine Zeitlang. Aber auf uns als Paar hatte das keine Auswirkungen, was auch immer da gelaufen sein mag. Nicht wirklich.»
Bei ihr hört sich das alles so vernünftig an. Ich aber kann nur an den Schmerz denken, die tiefe Kränkung über Ians Verrat, als er mich damals sitzengelassen hat. Wie sehr mein Selbstbild darunter gelitten hat. Wie minderwertig ich mir in der ersten Zeit vorkam. Wie hässlich. Dass die Sache zwischen ihm und seiner neuen Flamme schon bald wieder in die Brüche gegangen ist, war da nur ein schwacher Trost.
«Ich glaube nicht, dass ich das je verstehen werde», sage ich.
«Jeder hat seine Geheimnisse, Lou», entgegnet sie. «Und es sollte auch jeder seine Geheimnisse haben dürfen. Man kann über einen anderen Menschen nie alles wissen. Sollte es auch besser gar nicht erst versuchen, um darüber nicht den Verstand zu verlieren.»
Später, nachdem sie sich verabschiedet hat, denke ich beim Aufräumen darüber nach, ob es vielleicht Jay war, der in ihrer Ehe mit dem Fremdgehen angefangen hat. Ob das die banale Erklärung für Sophies ständige Affären ist: dass sie es Jay mit diesen heimlichen Schäferstündchen in irgendwelchen Hotels heimzahlen will und gleichzeitig Bestätigung bei anderen Männern sucht. Wer weiß. Kann sein, dass ich da zu viel hineindeute, das kann ich gut. Jedem das Seine, rufe ich mir in Erinnerung. Sie wirkt glücklich, und nur darauf kommt es an, letzten Endes.
Es ist gerade mal halb elf, aber ich bin hundemüde. Ehe ich schlafen gehe, werfe ich einen Blick in Adams Zimmer; er liegt auf der Seite, klein zusammengerollt unter seiner Star-Wars-Bettdecke, mit seinem Teddybären unter dem Arm, und schläft friedlich, ein Anblick, der etwas ungemein Tröstliches hat. Dann schließe ich leise die Tür und ziehe mich in mein Zimmer zurück.
Es ist finster, als ich im Badezimmer aufwache, vor dem Spiegel, und ehe ich noch richtig registriert habe, wo ich mich befinde, spüre ich das schmerzhafte Pochen im Schienbein, weil ich gegen den kleinen Wäschebehälter in der Ecke gestoßen bin. Ich habe Herzrasen, und meine Stirn ist schweißnass. Während sich die Wirklichkeit um mich herum verfestigt, verflüchtigt sich die Nachtangst und hinterlässt nur noch Bruchstücke in meinem Kopf, Fetzen. Es ist immer derselbe Traum.
Ein riesiges Gebäude, wie ein altes Krankenhaus oder Waisenhaus, das nicht mehr genutzt wird. Adam sitzt irgendwo in dem Gebäude fest, und ich weiß, ganz sicher, dass er sterben muss, wenn ich es nicht schaffe, ihn zu finden. Er ruft nach mir, immer wieder, voller Angst. Als würde ihm etwas Schlimmes drohen. Ich haste über düstere Flure, immer seiner Stimme nach, und von den Wänden und Decken greifen Schatten nach mir, als wären sie Teil eines furchtbaren Übels, das in dem Gebäude nistet, und umschlingen mich wie Tentakel, sodass ich nicht mehr vom Fleck komme. Während ich verzweifelt versuche, mich aus ihrer Umklammerung zu befreien, höre ich Adam die ganze Zeit weinen, doch es ist, als hätten es die dunklen, klebrigen Stränge darauf abgesehen, mich um jeden Preis von ihm fernzuhalten, mich zu ersticken und mit sich in die endlose Finsternis zu zerren. Es ist ein grauenvoller Traum. Ich werde ihn einfach nicht los, er haftet an mir wie die Schatten, die in dem Traum nach mir greifen. Die Einzelheiten mögen sich von Nacht zu Nacht geringfügig ändern, der Kern aber bleibt immer derselbe. Und der Traum verliert nie seinen Schrecken für mich, egal, wie oft er mich nachts heimsucht.
Die Nachtängste fingen nicht erst mit Adams Geburt an – schlecht geträumt habe ich immer schon, wobei ich früher nur um mein eigenes Leben kämpfen musste. Was weniger schlimm war, aber das konnte ich damals noch nicht wissen. Die Nachtängste sind der Fluch meines Lebens. Sie machen jede Aussicht auf erholsamen Schlaf zunichte, wo ich als alleinerziehende Mutter doch schon Tag für Tag an meine Grenzen stoße.
Diesmal bin ich im Schlaf eine längere Strecke gewandelt als sonst immer. Normalerweise stehe ich neben meinem oder auch Adams Bett, wenn ich verwirrt aufwache, nicht selten mitten in einem unsinnigen, erschrockenen Satz in meinem Traum. Das kommt so oft vor, dass es ihn schon gar nicht mehr stört oder beunruhigt, wenn er aufwacht und mich neben sich stehen sieht. Aber kein Wunder, er ist ein sachlicher, praktischer Typ, ganz wie sein Vater. Von mir hat er gottlob den Sinn für Humor geerbt.
Ich schalte das Licht an, blicke in den Spiegel und stöhne auf. Die Ringe unter meinen Augen sind dunkler denn je, sie werden sich wohl auch mit Make-up nicht ganz abdecken lassen. Nicht bei Tageslicht. Na großartig. Um mir Mut zu machen, schärfe ich mir ein, dass es keine Rolle spielt, was der Mann aus der Bar alias o verdammt, das ist mein neuer Chef, der noch dazu verheiratet ist von mir denkt. Wenn ich Glück habe, ist ihm die Sache so peinlich, dass er mich den Tag über einfach ignoriert. Trotzdem krampft sich mir beim Gedanken an ihn vor Nervosität der Magen zusammen, außerdem dröhnt mir der Schädel vom Wein und von zu vielen Zigaretten. Kopf hoch, reiß dich zusammen, ermahne ich mich. Nach einem Tag ist die Sache vergessen. Sei professionell und mach einfach deine Arbeit.
Es ist erst vier Uhr früh. Ich trinke etwas kaltes Wasser, dann schalte ich das Licht im Bad aus und kehre in mein Bett zurück, in der Hoffnung, zumindest noch ein bisschen zu dösen, bis um sechs der Wecker klingelt. Ich versuche, nicht daran zu denken, wie sich sein Mund auf meinem angefühlt hat. Wie bei unserem Kuss dieses spontane Verlangen in mir aufgeflammt ist, wie wundervoll es war, kurz diese Verbindung zu jemandem zu spüren. Während ich daliege, die Wand anstarre und erwäge, ob ich Schäfchen zählen soll, wird mir auf einmal klar, dass ich nicht nur nervös bin, sondern auch eine gewisse Aufregung verspüre. Vorfreude, ihn wiederzusehen. Ich knirsche mit den Zähnen und verwünsche mich dafür. Idiotisch. Ich bin nicht dieser Typ Frau.
5Adele
Ich verabschiede ihn mit einem Lächeln und winke ihm nach, als er zu seinem ersten richtigen Arbeitstag in der Praxis aufbricht, und die alte Dame von nebenan, die gerade aus dem Haus kommt, um ihr ebenso ältliches, gebrechliches Hündchen Gassi zu führen, blickt herüber und nickt wohlgefällig. Nach außen hin wirken wir immer wie das absolute Bilderbuchpaar, David und ich. Das gefällt mir.
Trotzdem seufze ich erleichtert auf, als ich die Tür schließe und das Haus endlich für mich habe. Wenngleich sich das anfühlt wie ein kleiner Verrat. Ich habe David hier sehr gern um mich, doch zwischen uns geht es noch nicht wieder so holperfrei zu, wie wir das kennen. Die Atmosphäre hat etwas Drückendes, weil so vieles zwischen uns unausgesprochen bleibt. Glücklicherweise ist das neue Haus so geräumig, dass er sich in sein Arbeitszimmer verziehen kann und wir so tun können, als wäre alles in Ordnung, während wir uns geflissentlich aus dem Weg gehen.
Doch es geht mir schon etwas besser als an dem Abend neulich, als er betrunken nach Hause kam. Wir haben am nächsten Morgen kein Wort darüber verloren, natürlich nicht, denn wirkliche Gespräche finden zurzeit zwischen uns nicht statt. Stattdessen habe ich ihn seinen Unterlagen überlassen und habe uns beide bei dem hiesigen, nicht gerade billigen Fitnessclub angemeldet. Anschließend unternahm ich einen Spaziergang durch unser schickes, neues Viertel, um alles in mich aufzunehmen. Ich mache mich mit Örtlichkeiten nämlich gern gründlich vertraut. Um in der Lage zu sein, sie wirklich sehen zu können. Mir ist dann wohler zumute. Es hilft mir, mich zu entspannen.
Fast zwei Stunden war ich unterwegs, um mir Geschäfte, Bars und Restaurants einzuprägen, bis ich sie sicher im Kopf gespeichert und jederzeit visuell abrufbereit hatte, und zum Schluss habe ich eingekauft – Brot beim örtlichen Bio-Bäcker sowie Oliven, Schinken, Hummus und sonnengetrocknete Tomaten im Feinkostladen, alles so sündhaft teuer, dass dafür ein großer Teil meines Haushaltsgelds draufging –, um uns ein leichtes Picknick zu Mittag zuzubereiten. Aber für innen, obwohl es schon warm genug war, um im Freien zu sitzen. Doch ich glaube nicht, dass er schon nach draußen in den Garten will.
Gestern waren wir zusammen in der Praxis, und ich habe bei Dr. Sykes, dem Seniorpartner, und den diversen anderen Ärzten und Sprechstundenhilfen, die uns begegnet sind, meinen Charme spielen lassen. Es mag eitel klingen, aber mit Schönheit kann man immer punkten. Geschworene, hat David mir mal erzählt, neigen dazu, attraktiven Menschen eher Glauben zu schenken als solchen, die nur durchschnittlich aussehen oder gar hässlich sind. Gewiss, es mag bloß eine geglückte Kombination von Haut und Knochen sein. Und doch entfaltet Schönheit einen Zauber, dem sich meiner Erfahrung nach kaum ein Mensch entziehen kann. Man braucht nicht einmal viel zu sagen, bloß zuzuhören und zu lächeln, schon fliegen einem alle Herzen zu. Ich genieße es, schön zu sein, immer schon, alles andere wäre gelogen. Und ich tue einiges dafür, mir meine Schönheit zu erhalten, David zuliebe. Alles, was ich tue, tue ich ihm zuliebe.
Davids neues Büro ist, soweit ich es beurteilen konnte, das zweitgrößte in der Praxis, genau die Sorte Behandlungszimmer, die er vermutlich hätte, wenn er in der Harley Street praktizierte; ausgelegt mit cremefarbenem, flauschigem Teppichboden und mit einem großen, angemessen imposanten Schreibtisch. Der Empfangsbereich ist sehr stilvoll und elegant. An dem Tisch dort saß eine attraktive Blondine – wenn man auf diesen Typ Frau steht –, die davonhuschte, ehe wir einander vorgestellt werden konnten, sehr zu meinem Verdruss. Wovon Dr. Sykes jedoch kaum Notiz zu nehmen schien, während er auf mich einschwafelte und vor Freude errötete, als ich über seine missglückten Witzchen lachte. Dafür, dass mir noch immer schwer ums Herz war, habe ich mich, glaube ich, sehr gut geschlagen. Auch David war offenbar zufrieden mit mir, denn danach schien er wieder ein wenig zugänglicher.
Wir sind heute Abend bei Dr. Sykes zum Essen eingeladen, eine zwanglose Willkommensgeste. Ich habe bereits das Kleid herausgesucht, das ich tragen werde, und mir überlegt, wie ich mein Haar frisiere. David soll allen Grund haben, stolz auf mich zu sein. Ich kann die Mustergattin verkörpern, kein Problem. Die Frau des neuen Partners in der Praxis. Trotz meiner gegenwärtigen Sorgen fühle ich mich so ruhig wie seit unserem Umzug nicht mehr.
Ich sehe zu der Wanduhr hoch, deren Ticken laut in der Stille des Hauses widerhallt. Erst acht Uhr. Wahrscheinlich kommt er gerade in der Praxis an. Seinen ersten Anruf hier erwarte ich erst um halb zwölf. Ich habe also Zeit. Ich gehe nach oben in unser Schlafzimmer und strecke mich auf der Tagesdecke aus. Ich werde nicht schlafen. Aber die Augen schließe ich schon. Denke über die Praxis nach. Über Davids Büro. Diesen flauschigen, cremefarbenen Teppich. Seinen Schreibtisch aus glänzendem Mahagoni. Den winzigen Kratzer in der einen Ecke. Die beiden schmalen Couches. Sehr fest gepolstert. Die Einzelheiten. Ich atme tief durch.
6Louise
«Hui.» Sue mustert mich anerkennend, nachdem ich meinen Mantel abgelegt und in den Personalraum gehängt habe. «Du siehst ja hübsch aus heute.» Es klingt fast verblüfft. Das Gleiche habe ich schon von Adam zu hören bekommen, in demselben Tonfall, voller Erstaunen über meine feine Seidenbluse, ein Neuerwerb aus dem Second-Hand-Laden, und den Umstand, dass ich mir das Haar geglättet hatte, als ich ihm am Morgen einen Toast in die Hand gedrückt habe, ehe wir zur Schule aufgebrochen sind. O Gott, es fällt also auf, dass ich mir heute mehr Mühe als sonst gegeben und mich besonders schick gemacht habe. Aber das habe ich nicht seinetwegen getan. Eher zum Selbstschutz. Gegen ihn. Eine Art Kriegsbemalung oder Maske, um mich dahinter zu verbergen. Außerdem konnte ich nicht wieder einschlafen und musste mich irgendwie beschäftigen.
An einem Morgen wie diesem hätte ich Adam normalerweise im Frühstücksclub abgesetzt, um als Erste in der Praxis zu sein und schon mal Kaffee zu kochen, ehe die Kollegen eintrudeln. Heute aber war natürlich einer dieser Tage, an denen Adam morgens übellaunig ist und endlos herumquengelt. Dann war auch noch sein linker Schuh verschwunden, sodass ich es nur hektisch und abgehetzt geschafft habe, ihn rechtzeitig an der Schule abzuliefern.
Ich setze ein Lächeln auf. Mir ist ein wenig übel, vor Nervosität habe ich feuchte Hände. Auf dem Weg von der Schule zur Praxis habe ich drei Zigaretten geraucht. Normalerweise versuche ich, mir die erste Zigarette des Tages erst in der Kaffeepause zu gönnen. Na ja, theoretisch zumindest. Das ist mein guter Vorsatz. Tatsächlich ist es so, dass ich meist schon auf dem Weg zur Arbeit eine rauche.
«Danke. Kann sein, dass ich nach Feierabend was trinken gehe. Adam ist übers Wochenende bei seinem Vater.» Einen Drink werde ich nach der Arbeit vermutlich bitter nötig haben. Ich nehme mir vor, bei Sophie per SMS anzufragen, ob sie Lust hat, sich später mit mir zu treffen. Ganz sicher, wie ich sie kenne. Weil sie vor Neugier darauf brennen dürfte, wie sich diese Komödie der Irrungen weiterentwickelt. Ich bemühe mich um einen beiläufigen Tonfall, aber meine Stimme klingt mir seltsam im Ohr. Mein Gott, das ist doch lächerlich. Ich muss mich zusammenreißen. Für ihn dürfte es viel schlimmer sein als für mich. Er ist schließlich verheiratet, nicht ich. Lauter berechtigte Einwände, sicher, die mich aber auch nicht wirklich aufmuntern. Weil ich so etwas sonst nicht tue. Weil ein solches Verhalten für mich, anders als etwa für Sophie, einfach nicht normal ist. Ich komme mir billig und töricht vor, schwanke zwischen Wut und Schuldgefühlen, obwohl ich an der Lage, objektiv gesehen, vollkommen unschuldig bin. Da bahnt sich zum ersten Mal seit einer halben Ewigkeit so etwas wie eine Romanze an, und dann dieses böse Erwachen. Aber trotz allem, und trotz der Erinnerung an seine bezaubernde Frau, bin ich auch aufgeregt, ihn wiederzusehen. Kurzum, ich fühle mich wie ein unreifer Teenager, albern und unentschlossen.
«Sie sind alle bis halb elf in einer Besprechung. Laut Elaine jedenfalls», sagt sie. «Wir können uns also entspannen.» Sie öffnet ihre Tasche. «Und ich habe nicht vergessen, dass heute ich an der Reihe bin.» Sie bringt zwei fettige Papiertüten zum Vorschein. «Schinkenbrötchen zum Freitag.»
Ich bin froh, noch ein paar Stunden Aufschub zu haben, und nehme mein Brötchen strahlend in Empfang – obwohl es schon bedenklich ist, dass ich dieses Frühstück am Freitag als Glanzpunkt der Woche empfinde, weil mein Leben ansonsten in so öden, gleichförmigen Bahnen verläuft. Trotzdem, gegen gekochten Schinken ist nichts einzuwenden, da gibt es unangenehmere Routinen. Ich gönne mir einen großen Bissen, genieße den Geschmack von buttrig-warmem Brötchen und salzigem Fleisch. Wenn ich nervös bin, beruhige ich mich gern mit Essen. Tatsächlich esse ich eigentlich in jeder Lebenslage gern. Zum Entspannen, zum Trost, wenn ich fröhlich bin. Es macht keinen Unterschied. Anderen Leuten schlägt eine Scheidung auf den Appetit, und sie nehmen sechs, sieben Kilo ab. Bei mir war es umgekehrt.
Wir haben noch zwanzig Minuten Zeit, ehe unser Arbeitstag offiziell beginnt. Also setzen wir uns an einen kleinen Tisch, beide mit einem Becher Tee, und Sue erzählt mir von ihrem Mann, der unter Arthritis leidet, und von dem Schwulenpärchen, das bei ihnen nebenan wohnt und anscheinend pausenlos Sex hat. Ich höre ihr lächelnd zu und versuche, nicht jedes Mal zusammenzuzucken, sobald ich einen Schatten durch die Tür fallen sehe, wenn jemand draußen im Flur vorbeigeht.
Dann passiert das Malheur: Ketchup tropft aus dem Brötchen und landet knallrot auf meiner cremefarbenen Bluse, mitten auf der Brust. Sue tritt sofort in Aktion, tupft erst mit einigen Papierservietten und dann mit einem feuchten Lappen an dem Fleck herum, der sich jedoch nicht restlos entfernen lässt; es bleibt ein schwach hellroter Umriss zurück, und zu allem Überdruss ist der durchnässte Teil des dünnen Stoffs, an dem sie herumgetupft hat, so gut wie durchsichtig. Ich bekomme einen heißen Kopf, und die Seide klebt mir am Rücken. Ein schlechtes Omen für den Rest des Tages, das spüre ich.
Ich wehre lachend ihre gut gemeinten Versuche ab, mich weiter zu säubern, und ziehe mich ins WC zurück, wo ich die Bluse unter Verrenkungen wiederholt unter den warmen Luftstrom des Handtrockners halte. Ganz trocken bekomme ich den Stoff zwar nicht, aber zumindest der – leicht grau verwaschene – Spitzenbesatz meines BHs ist nicht länger zu erkennen. Na ja, besser als nichts.
Ich muss über mich selbst lachen. Wem will ich denn etwas vormachen? Mit Adam über die neuesten Wendungen in den Trickfilmserien zu fachsimpeln, die er regelmäßig schaut, das liegt mir. Eine gepflegte, damenhafte Erscheinung abzugeben: eher nicht. Schon jetzt merke ich, wie mir die Füße weh tun, weil ich es nicht gewohnt bin, Pumps zu tragen. Sich mühelos in Stöckelschuhen zu bewegen und sich stets stilvoll und mit Geschmack zu kleiden – ich dachte immer, das wären Fähigkeiten, die man ganz automatisch entwickelt. Und es gab bei mir eine Phase, bis Mitte zwanzig, als ich abends regelmäßig ausgegangen bin, in der ich mich immer sehr sorgfältig zurechtgemacht habe. Heute aber sind Jeans, Pullis und Converse-Turnschuhe mein Standardaufzug, dazu ein praktischer Pferdeschwanz und der stille Neid auf all jene, die nach wie vor Aufwand um ihr Äußeres treiben. Stiller Neid auf jene, die einen Anlass haben, diesen Aufwand zu treiben.
Sie trägt bestimmt täglich Stöckelschuhe, denke ich, während ich vor dem Spiegel meine Kleidung zurechtzupfe. Selber schuld, dass ich heute keine Hose mit flachen Schuhen trage wie sonst immer.
Die Telefone schweigen heute Morgen, und um mir die Zeit bis halb elf sinnvoll zu vertreiben, hebe ich im Computersystem die Patientenakten für die Termine am Montag farbig hervor und erstelle eine Liste all jener Patienten, die kommende Woche einen Termin bei ihm haben. Für einige – die komplexeren Fälle – hat er bereits Kopien der Akten erhalten, doch ich möchte gern meine Tüchtigkeit unter Beweis stellen, daher sorge ich dafür, dass er die gesamte Liste vollständig vorfindet. Danach drucke ich zunächst verschiedene E-Mails aus, die meiner Einschätzung nach nützlich oder wichtig oder von der Praxisleitung vergessen worden sein könnten, und außerdem eine Liste wichtiger Telefonnummern, Krankenhaus, Polizei und verschiedene andere Organisationen, die er benötigen könnte. Zum Schluss laminiere ich sie noch. Eine beruhigende Tätigkeit, alles in allem. Der Mann aus der Bar schwindet langsam aus meinem Kopf und wird ersetzt durch mein Chef, obwohl sein Gesicht dabei auf verstörende Weise mit den Zügen des alten Dr. Cadigan verschmilzt, dessen Nachfolger er in der Praxis ist.
Um zehn gehe ich in sein Büro hinüber, um ihm die Ausdrucke auf den Schreibtisch zu legen und schon mal die Kaffeemaschine in der Ecke anzuschalten, damit er bei seiner Rückkehr eine frische Kanne vorfindet. Ich schaue nach, ob die Putzfrauen frische Milch in den kleinen Kühlschrank geräumt haben, der in einem Schrank verborgen ist, ähnlich wie eine Hotel-Minibar, und ob auch das Zuckerschälchen gefüllt ist. Danach, ich kann nicht anders, wandert mein Blick wie automatisch zu den drei silbergerahmten Fotos, die auf seinem Schreibtisch stehen. Zwei Porträtaufnahmen von seiner Frau, dazu ein Foto, offenbar schon älter, von ihnen beiden. Dieses Bild erregt mein Interesse, ich nehme es in die Hand. Er sieht darauf ganz anders aus. So jung. Höchstens Anfang zwanzig, nicht älter. Sie sitzen Arm in Arm auf einem großen Küchentisch und lachen über irgendetwas. Sie sehen sehr glücklich aus, beide so jung und unbekümmert. Er sieht sie mit einem Blick an, als wäre sie für ihn das Wichtigste auf der ganzen Welt. Anders als auf den beiden anderen Fotos trägt sie ihr langes Haar auf diesem Bild nicht zu einem Knoten frisiert, sondern offen und sieht selbst in Jeans und T-Shirt einfach nur hinreißend aus. Mir krampft sich kurz der Magen zusammen. Ketchup tropft ihr bestimmt nie aufs Oberteil, jede Wette.
«Hallo?»
Vor Schreck über die Stimme mit dem leicht schottischen Akzent, die unvermittelt zu mir herüberdringt, fällt mir beinahe das Foto aus der Hand, und als ich es fahrig wieder an seinen Platz zurückstelle, fege ich dabei fast die ordentlich aufgereihten Unterlagen vom Tisch. Er steht in der offenen Tür, und bei seinem Anblick wird mir flau im Magen. Meine Güte, ich hatte ganz vergessen, wie gut er aussieht. Annähernd blondes Haar mit einem seidigen Glanz, um den ich ihn heftig beneide. Vorne so lang, dass man mit den Fingern hindurchfahren kann, aber trotzdem perfekt geschnitten. Strahlende, durchdringend blaue Augen. Haut, die man einfach nur berühren möchte. Ich schlucke mühsam. Er ist einer dieser Männer. Ein atemberaubender Mann. Ich spüre, wie ich puterrot anlaufe.
«Sie sollen doch bis halb elf in einer Besprechung sein», sage ich hilflos und würde vor Scham am liebsten im Boden versinken. Ich bin in seinem Büro und schaue mir Fotos seiner Frau an wie eine Art Stalkerin. O Gott.
«O Gott», sagt er und stiehlt mir damit die Worte. Er wird bleich und reißt ein wenig die Augen auf. Sieht schockiert aus, entsetzt und benommen, alles zusammen. «Du bist es.»
«Hören Sie», bricht es aus mir hervor, «es war wirklich nichts, wir waren beide betrunken und haben uns hinreißen lassen, und es war ja nur ein Kuss, und ich werde niemandem je ein Sterbenswort davon erzählen, Ehrenwort, und wenn wir diesen Vorfall beide einfach vergessen, besteht kein Grund, warum wir nicht miteinander klarkommen sollten, und es wird nie jemand was davon erfahren …» So plappere ich blindlings drauflos, kann meinem Wortschwall kaum Einhalt gebieten. Dabei wird mir so warm, dass ich merke, wie mir unter dem Make-up der Schweiß aus den Poren quillt.
«Aber» – er sieht halb verwirrt, halb beunruhigt aus, als er eilig die Tür hinter sich zuklinkt, und ich kann es ihm nicht verübeln – «was machst du denn hier?»
«Oh.» Das Wichtigste habe ich bei meinem Redeschwall ganz vergessen. «Bleiben wir lieber beim Sie, das ist hier in der Praxis wohl angemessener. Ich bin Ihre Sekretärin und Empfangsdame. Drei Tage in der Woche zumindest. Dienstags, donnerstags und freitags. Ich habe Ihnen gerade ein paar Unterlagen auf den Schreibtisch gelegt, und dabei fiel mein Blick auf …» Ich deute mit dem Kopf auf die Fotos. «Ich, na ja …» Ich verstumme kleinlaut. Weil ich wohl kaum sagen kann: Ich habe mir das Foto von dir und deiner zauberhaften Frau mal so richtig eingehend angeschaut, wie es auch eine Verrückte täte.
«Du bist meine Sekretärin?» Er sieht aus, als hätte ihm jemand einen Schlag in die Magengrube versetzt. «Ich meine, Sie?» Vielleicht auch einige Handbreit tiefer. In diesem Moment tut er mir sogar ein bisschen leid.
«Ja, ich weiß.» Ich tue mein Bestes, ein komisches Gesicht zu ziehen. «Wie hoch stehen die Chancen?»
«Als ich letzten Monat hier war, um mit Dr. Cadigan zu sprechen, war eine andere Frau hier. Nicht Sie.»
«Etwas älter, ein wenig verkniffen? Das wird Maria gewesen sein. Die ist an den übrigen beiden Tagen hier. Sie ist jetzt halb im Ruhestand, arbeitet aber schon ewig hier, und Dr. Sykes liebt sie heiß und innig.»
Er steht noch immer an der Tür. Hat offensichtlich Mühe, das alles zu verarbeiten.
«Ich bin wirklich Ihre Sekretärin», sage ich, schon ruhiger als zuvor. «Keine Stalkerin. Glauben Sie mir, für mich ist das auch nicht toll. Ich hab Sie gestern gesehen, als Sie hier waren. Ganz kurz. Dann habe ich mich versteckt, mehr oder weniger.»
«Sie haben sich versteckt.» Mehr sagt er nicht. Scheint noch immer vollauf damit beschäftigt zu sein, das alles zu begreifen.
«Ja.» Beschämt setze ich hinzu: «In der Toilette.»
Danach bleibt es länger still.
«Na ja», sagt er schließlich, «das hätte ich vermutlich auch getan. Ehrlich gesagt.»
«Aber es hätte wohl irgendwie seinen Zweck verfehlt, wenn wir uns beide im Klo versteckt hätten.»
Er lacht kurz auf, ganz unvermutet. «Ja, das kann schon sein. Sie haben viel Humor, ich erinnere mich.» Jetzt endlich setzt er sich in Bewegung. Tritt zu mir hinter den Schreibtisch, um sich anzusehen, was ich ihm dort alles hingelegt habe, und ich mache ihm reflexhaft Platz.
«Jedenfalls, der oberste Ausdruck ist eine Liste der Akten, die Sie für Montag durchsehen sollten. Kaffee läuft auch schon durch –»
«Ich muss mich wirklich entschuldigen.» Er blickt mit diesen umwerfend blauen Augen zu mir auf. «In Ihren Augen muss ich doch der letzte Mistkerl sein. Ich komme mir ja selber unglaublich mies vor. Das ist sonst nicht meine – na ja, ich war nicht dort in der Bar, um Frauen aufzureißen, und ich hätte das nicht tun dürfen. Was dann vorgefallen ist. Ich fühle mich schrecklich. Ich kann es nicht erklären. Das ist sonst wirklich nicht meine Art, und mein Verhalten ist durch nichts zu entschuldigen.»
«Wir waren eben betrunken, mehr nicht. Es ist ja weiter gar nichts vorgefallen. Wirklich nicht.»
Tut mir leid, das geht nicht. Ich erinnere mich an die Scham in seiner Stimme, als er sich von mir losmachte und dann davonging, Entschuldigungen murmelnd. Vielleicht kann ich ihm deswegen nicht so richtig böse sein. Schließlich war es nur ein Kuss, mehr nicht. Nur ich in meinem einfältigen Wunschdenken habe mehr daraus gemacht. «Sie haben selbst aufgehört, und das zählt. Es war weiter nichts. Ehrlich nicht. Vergessen wir’s einfach. Fangen wir heute noch einmal neu an. Damit wir hier im Job unbefangen miteinander umgehen können.»
«Sie haben sich in der Toilette versteckt.» Seine blauen Augen sind klar und voller Wärme.
«Ja, und es würde mir schon viel von meiner Befangenheit nehmen, wenn wir das bitte nie wieder erwähnen würden.» Ich grinse. Ich finde ihn immer noch nett. Ihm ist ein dummer Fehler unterlaufen, ganz impulsiv. Es hätte auch schlimmer kommen können. Wenn er etwa noch mit zu mir nach Hause gekommen wäre. Ich stelle es mir einen Moment lang vor. Gut, kurzfristig wäre das ganz wundervoll gewesen, langfristig gesehen aber eine Katastrophe.
«Okay», sagt er. «Seien wir Freunde.»
«Ja. Seien wir Freunde.» Auf einen Handschlag verzichten wir. Weil es für Körperkontakt noch viel zu früh ist. «Ich bin Louise.»
«David. Nett, Sie kennenzulernen. So richtig, meine ich.» Wieder tritt eine kurze, betretene Stille ein, dann reibt er sich die Hände und wendet seine Aufmerksamkeit wieder den Unterlagen auf seinem Schreibtisch zu. «Sieht aus, als wollten Sie mich ganz schön auf Trab halten. Sind Sie zufällig hier aus der Gegend?»
«Ja. Das heißt, ursprünglich nicht. Aber ich wohne seit über zehn Jahren hier.»
«Meinen Sie, Sie könnten mir ein bisschen was erzählen? Einen groben Überblick liefern, über Probleme, Brennpunkte, soziale Schieflagen, all so etwas? Ich wollte mal eine Runde im Auto drehen, aber das muss vorerst warten. Ich habe heute Nachmittag eine weitere Besprechung mit jemandem vom Krankenhaus, und heute Abend bin ich beim Seniorpartner zum Essen eingeladen.»
«Eine groben Überblick kann ich Ihnen auf jeden Fall liefern», sage ich. «Aus der Sicht einer Laiin, sozusagen.»
«Gut. Genau das schwebt mir vor. Weil ich an Wochenenden gern Sozialarbeit leisten würde, hin und wieder, hier vor Ort, ehrenamtlich. Da wäre es optimal, die Ansichten einer Einheimischen zu möglichen Ursachen für Suchtprobleme zu erfahren, die spezifisch für diese Gegend hier sind. Das ist nämlich mein Fachgebiet.»
Ich bin sprachlos. Von Sozialarbeit war bei den anderen Ärzten hier noch nie die Rede. Es handelt sich um eine teure Praxis für Privatpatienten. Was für Probleme unsere Kunden auch haben mögen, unterprivilegiert jedenfalls sind sie nicht, und die Partner sind alle Spezialisten auf ihren Fachgebieten. Härtefälle nehmen sie selbstverständlich auch an, bei entsprechender Überweisung, aber sie suchen keine anderen sozialen Milieus auf, um ihre Dienste umsonst anzubieten.
«Nun, das hier ist Nord-London, also alles in allem eine sehr bürgerliche Gegend», sage ich. «Aber bei mir in der Nähe, weiter südlich, gibt es eine große Sozialsiedlung. Da liegt auf jeden Fall einiges im Argen. Viele arbeitslose Jugendliche, Drogen, das alles.»
Er holt seine Aktentasche unter dem Tisch hervor, öffnet sie und nimmt einen Stadtplan heraus. «Gießen Sie uns doch bitte Kaffee ein, dann mache ich in der Zeit Platz für den Plan. Wir können alle Orte markieren, die ich mir ansehen sollte.»
Wir unterhalten uns fast eine Stunde lang, während ich auf die Schulen und Praxen zeige, auf die übelsten Pubs und die Unterführung, in der es innerhalb eines Jahres dreimal zu Messerstechereien gekommen ist und um die alle Kinder auf Geheiß ihrer Eltern einen Bogen machen müssen, weil dort mit harten Drogen gedealt wird und Junkies sich ihren Schuss setzen. Ich bin selbst überrascht, wie gut ich mein Viertel tatsächlich kenne, und ebenso sehr überrascht es mich, wie viel von meinem eigenen Leben mit einfließt, während ich ihm eine kleine Stadtführung gebe. Als er schließlich auf die Uhr sieht und mich bremst, weiß er nicht nur, dass ich geschieden bin, sondern auch, dass ich einen Sohn namens Adam habe und auf welche Schule er geht und dass meine Freundin Sophie in der Nähe der schönsten Mittelschule wohnt, in einem der Mietshäuser dort gleich um die Ecke.
«Tut mir leid, hier muss ich Schluss machen», sagt er. «Aber es war sehr faszinierend.» Der Plan ist überall mit Kugelschreiber markiert, dazu hat er sich Notizen auf einem Blatt Papier gemacht. Seine Schrift ist grauenhaft, fast unleserlich. Eine echte Arztklaue.
«Tja, hoffentlich auch sachdienlich.» Ich nehme meinen Becher vom Tisch und trete ein paar Schritte zurück. Erst jetzt wird mir bewusst, wie dicht wir die ganze Zeit nebeneinandergestanden haben. Als wäre ein Bann verflogen, kehrt auch die Befangenheit zurück.
«Ganz großartig. Vielen Dank.» Er sieht abermals auf die Uhr. «Ich müsste jetzt bloß meine …» Er hält kurz inne. «Ich muss jetzt zu Hause anrufen.»
«Sie können ruhig von Ihrer Frau sprechen.» Ich lächle. «Keine Sorge, ich werde nicht gleich in Flammen aufgehen.»
«Entschuldigung.» Er fühlt sich noch unbehaglicher als ich, das ist nicht zu übersehen. Ganz zu Recht im Übrigen. «Und danke. Dafür, dass Sie mich nicht für den letzten Schuft halten. Oder es sich zumindest nicht anmerken lassen.»
«Gern geschehen», sage ich. «Nichts zu danken.»
«Bin ich denn ein Schuft, in Ihren Augen?»
Ich grinse bloß vielsagend. «Ich bin an meinem Platz, falls irgendwas ist.»
«Peng. Das habe ich verdient.»
Na also, überlege ich, als ich an meinen Schreibtisch zurückgekehrt bin und darauf warte, dass mein Gesicht wieder abkühlt, das ist doch ganz glimpflich abgelaufen. Und ich muss erst wieder am Dienstag arbeiten, bis dahin hat sich alles eingependelt, und unser kleiner gemeinsamer Fehltritt ist unter den Teppich des Lebens gekehrt, auf Nimmerwiedersehen. Ich gelobe mir, fortan keinen Gedanken mehr daran zu verschwenden. Am Wochenende werde ich es mir dafür mal so richtig gut gehen lassen. Werde lange im Bett liegen bleiben. Mir eine billige Pizza und massenhaft Eiscreme gönnen und mal sehen, was es bei Netflix an guten Serien gibt. Mir vielleicht eine ganze Staffel hintereinander reinziehen.
Nächste Woche ist die letzte Schulwoche, dann stehen die großen Sommerferien vor der Tür, und meine Tage werden vorwiegend aus grässlichen Spieltreffen bestehen. Ich werde mein schmales Einkommen an den Tagen, an denen ich arbeite, für eine Kinderbetreuung aufwenden, mir für Adam immer neue Zeitvertreibe einfallen lassen – denn mit einem iPad oder Smartphone, auf dem er endlos Spiele daddelt, mag ich ihn nicht abspeisen – und mich dabei wie eine schlechte Mutter fühlen, während ich versuche, gleichzeitig alles andere zu erledigen, was so an Arbeiten anfällt. Aber Adam ist ein tolles Kind, gottlob. Er bringt mich immer zum Lachen, jeden Tag, und ich liebe ihn über alles. Sogar wenn er mal einen seiner Wutanfälle hat. So sehr, dass mir das Herz dabei weh tut.
Der Mann in meinem Leben ist Adam, denke ich, während ich zu Davids Bürotür hinüberschaue und mich frage, was für Koseworte er seiner Frau gerade am Telefon ins Ohr flüstern mag. Da ist für einen anderen kein Platz mehr.
7Damals
Das Gebäude erinnert Adele in vieler Hinsicht an das Haus ihrer Familie. An ihr Zuhause, wie es früher war zumindest. Allein der Lage wegen; wie es, einer Insel gleich, einsam aus dem Ozean aufragt. Die Ärzte, die Anwälte ihrer toten Eltern, selbst David – hat denn das niemand mitbedacht, ehe man sie für einen Monat hierherverfrachtet hat, in die Abgeschiedenheit der Highlands? Ist auch nur einem von denen in den Sinn gekommen, wie sehr dieses abgelegene Haus sie an das Zuhause erinnern würde, das sie verloren hatte?
Es ist alt, dieses Haus, sie weiß nicht genau, wie alt, aber errichtet aus robustem grauem Mauerwerk, typisch für Schottland, das die Jahrhunderte überdauert. Irgendwer hat es wohl dem Westlands-Trust vermacht, vielleicht gehört es auch jemandem aus dem Vorstand, weiß der Geier. Sie hat nicht danach gefragt, und es interessiert sie eigentlich auch nicht weiter. Seltsame Vorstellung, dass hier einst eine einzige Familie gewohnt hat. Vermutlich haben sie letzten Endes nur einige der vielen Räume genutzt, so wie ihre Familie in ihrem Haus. Große Träume, kleines Leben. Niemand braucht ein so riesiges Haus. Womit kann man es füllen? In einem Zuhause muss man die Liebe spüren, doch mitunter reicht die Liebe einfach nicht aus, um ein großes Gemäuer mit Wärme zu erfüllen. Bei ihnen etwa war es so. In dem Haus hier, in dem nun ein Therapiezentrum untergebracht ist, werden all diese Räume zumindest sinnvoll genutzt. Sie denkt daran, wie sie früher beim Versteckspielen frei und ungebunden durch Flure und Treppenhäuser gerannt ist, übermütig lachend, ein halb vergessenes Kind, ehe sie diese Kindheitserinnerungen entschlossen beiseitewischt. Ihr Haus, redet sie sich ein, war einfach zu groß. Erfundene Wahrheiten sind allemal angenehmer als echte Erinnerungen.
Es ist drei Wochen her, und sie ist noch immer wie betäubt. Sie müsse trauern, rät man ihr von allen Seiten. Aber deswegen ist sie nicht hier. Sie ist hier, weil sie Schlaf braucht. Sie weigert sich nämlich zu schlafen. Ehe man sie hergeschickt hat, hat sie sich rund um die Uhr wach gehalten, tage- und nächtelang, mit Kaffee, Red Bull und was sie sonst noch an Wachmachern auftreiben konnte. Ihr Verhalten sei nicht «normal», hieß es, für jemanden, der kürzlich seine Eltern verloren hat. Wobei ihre Schlafverweigerung nur ein Symptom war. Woher diese Leute so genau wussten, welches Verhalten in dieser Situation «normal» ist, darüber rätselt sie noch immer. Wie kommen sie zu dieser Einschätzung? Wie dem auch sei, jedenfalls möchte man, dass sie schläft. Wie soll sie ihren Standpunkt bloß verständlich machen?
Schlaf ist die Erlösung, die sich gegen sie gewendet hat, wie eine bissige Schlange in der Nacht.
Sie ist zu ihrem eigenen Besten hier, anscheinend, doch als Verrat empfindet sie es trotzdem. Sie hat sich bloß darauf eingelassen, weil es Davids Wunsch war. Sie mag nicht mitansehen, wie er sich um sie sorgt, und diesen Monat wenigstens ist sie ihm schuldig, nach dem, was er für sie getan hat. Ihr Held.
Trotz der Versprechungen, die sie David und den Anwälten immer wieder macht, hat sie bisher in keiner Weise versucht, sich anzupassen. Sie nutzt die Beschäftigungsräume, das schon, und sie redet mit den Therapeuten – oder hört ihnen hauptsächlich zu, besser gesagt –, obwohl ihr immer wieder leise Zweifel kommen, wie qualifiziert diese Leute sind. Alles hier kommt ihr ein bisschen hippiemäßig vor. Distanzlos, hätte ihr Vater es wohl abfällig genannt. Dieser Ansatz ging ihm schon vor all den Jahren gegen den Strich, bei ihrer ersten Therapie; daher ihr Zögern, sich vollauf darauf einzulassen. Um ihn posthum nicht zu enttäuschen. Ein richtiges Krankenhaus wäre ihr lieber gewesen, aber das hielten ihre Anwälte, ebenso wie David, für eine schlechte Idee. Weil es der Firma ihres Vater schaden könnte, wenn bekannt würde, dass sie Zeit in einer Heilanstalt verbringen musste. Westlands hat eher etwas von einem Rückzugsort mit spiritueller Note, deswegen ist sie jetzt hier. Ob es ihrem Vater gefallen hätte oder nicht.
Nach dem Frühstück findet eine Wanderung statt, wobei den Gästen, oder Patienten oder wie man sie auch nennen will, die Teilnahme freigestellt ist. Es ist ein schöner Tag für so etwas, nicht zu warm, nicht zu kalt, sonnig und wolkenlos, mit angenehm frischer Luft. Kurz bekommt sie Lust, sich der Gruppe anzuschließen, ganz hinten als Schlusslicht, doch dann sieht sie die Vorfreude in den Gesichtern der Leute, die sich an der Treppe vor dem Haus versammelt haben, und überlegt es sich wieder anders. Sie hat es nicht verdient, fröhlich zu sein, glücklich. Wohin hat das ganze Glück schließlich geführt? Hinzu kommt, die körperliche Bewegung würde sie ermüden, und sie möchte nicht länger schlafen müssen als unbedingt nötig. Vom Schlaf wird sie hier draußen ohnehin viel zu leicht übermannt.
Sie wartet noch ab, bis Mark nach draußen gekommen ist, der langhaarige Gruppenleiter mit dem Pferdeschwanz («wir sind hier alle per du, Adele»), um seine enttäuschte Reaktion zu beobachten, als sie stumm den Kopf schüttelt. Dann wendet sie sich von der Gruppe ab und geht ums Haus herum auf die Rückseite, wo sich der See befindet.
Sie bummelt langsam um das Gewässer herum. Etwa auf der Hälfte des Weges entdeckt sie ihn. Er sitzt unter einem Baum, fünf, sechs Meter von ihr entfernt, und ist damit beschäftigt, eine Kette aus Gänseblümchen aufzufädeln, ein Anblick, bei dem sie spontan lächeln muss – ein schlaksiger Teenager in Jeans und einem langärmeligen Shirt, dem das dunkle Haar in einer Tolle ins Gesicht fällt, während er sich mit Hingabe einer Sache widmet, die sonst nur kleine Mädchen tun, es sieht zu ulkig aus –, und sie bekommt sofort ein schlechtes Gewissen. Weil sie nie wieder lächeln sollte. Kurz steht sie da und zögert, überlegt, ob sie kehrtmachen soll, und da blickt er auf und sieht sie. Winkt ihr mit kurzer Verzögerung zu. Nun bleibt ihr nichts übrig, als zu ihm zu gehen, aber es macht ihr nichts aus. Er ist der Einzige hier, der sie interessiert. Sie hat ihn schon öfters gehört, nachts. Seine Schreie, das wirre Gebrabbel, das keinen Sinn ergibt. Das Poltern, wenn er gegen irgendwelche Möbel läuft. Dann die Stimmen der Schwestern, die im Laufschritt herbeieilen, um ihn wieder ins Bett zu bringen. All das ist ihr vertraut, sie kennt es aus eigener Anschauung. Nachtängste.
«Du hattest also keinen Bock auf Gruppenumarmungen im Moor?», fragt sie, als sie bei ihm angelangt ist.
Sein Gesicht ist mager und kantig, als wäre er noch nicht ganz hineingewachsen. Er ist ungefähr in ihrem Alter, ein Jahr älter vielleicht, achtzehn oder so.
«Nö. Du anscheinend auch nicht, oder?» Er lispelt ein wenig. Vermutlich wegen der festen Zahnspange, die er noch immer trägt.
Sie schüttelt etwas unbeholfen den Kopf. Seit sie hier ist, hat sie von sich aus noch kein einziges Gespräch begonnen, bloß um zu reden.
«Kann ich verstehen. Ich möchte dem guten Mark auch ungern zu nahe kommen. In diesem Pferdeschwanz wimmelt es bestimmt von Läusen. Letzte Woche hat er drei Tage hintereinander dasselbe Hemd getragen. Mit Sauberkeit nimmt der es nicht so genau.»
Wieder muss sie lächeln, aber diesmal wehrt sie sich nicht dagegen. Dann setzt sie sich zu ihm, obwohl sie gar nicht vorhatte zu bleiben.