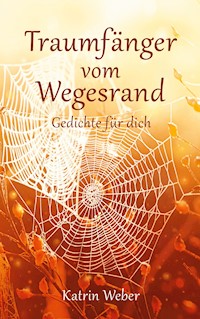9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Zwischen Cremetöpfchen und Fettnäpfchen.
Die wirklich ganze Wahrheit über die lustigste Frau Sachsens.
Katrin Weber ist einer der hellsten Sterne am sächsischen Kabaretthimmel. Zusammen mit Bestsellerautor Stefan Schwarz plaudert sie aus ihrem Leben zwischen den Gipfeln und Abgründen des Bühnenlebens – größtenteils ehrlich und umwerfend komisch. Sie werden lachen. Garantiert.
»Katrin Weber ist auf der Bühne eine Diva, die blitzschnell in die Komik kippen kann. Eben ist sie noch eine Frau, die sich total daneben benimmt, und schon glänzt sie als Grande Dame. Ich habe noch nie mit jemandem so viel gelacht wie mit ihr.«Bernd-Lutz Lange.
»Herrlich komisch und höchst spannend.«Das Magazin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über Katrin Weber
Katrin Weber geboren in Plauen (Vogtland), studierte an der Hochschule für Musik in Dresden. Zahlreiche Hauptrollen, u. a. in »My Fair Lady«, »Cabaret« und »Evita«. Neben ihren Kabarett-Soloprogrammen ist sie im MDR als Sängerin und Moderatorin zu sehen.
Stefan Schwarz wurde mit Kolumnen und Satire-Romanen über das zeitgenössische Familienleben aus der Sicht von Männern bekannt (»Hüftkreisen mit Nancy«, »Die Großrussin«). Schwarz lebt in Leipzig.
Informationen zum Buch
Zwischen Cremetöpfchen und Fettnäpfchen: Die wirklich ganze Wahrheit über die lustigste Frau Sachsens
Katrin Weber ist einer der hellsten Sterne am sächsischen Kabaretthimmel. Zusammen mit Bestsellerautor Stefan Schwarz plaudert sie aus ihrem Leben zwischen den Gipfeln und Abgründen des Bühnenlebens – größtenteils ehrlich und umwerfend komisch. Sie werden lachen. Garantiert.
Die kleine Katrin hatte es schwer. Zu dick, zu langsam, zu dusselig: Stehen, Laufen, Sprechen, Singen, die Liebe - mit allem war sie später dran als ihre Altersgenossen. Bis aus dem hässlichen Entlein im Kindergarten des VEB Narva Glühlampenwerkes Plauen der strahlend schöne Schwan im Scheinwerferlicht der sächsischen Bühnen wurde. Mit Witz, Charme und sächsischer Schnauze glänzt Katrin Weber nach ihrer Gesangsausbildung und zahlreichen Musical- und Fernsehrollen heute überwiegend im Kabarett. »Schwarze Augen – Eine Nacht im Russenpuff«, »Solo« und »Nicht zu fassen« heißen ihre umjubelten Programme. Außerdem steht sie als Entertainerin und Sängerin auf der Bühne. In ihrem ersten Buch erzählt Katrin Weber von den Gipfeln und Abgründen des Showlebens.
»Katrin Weber ist auf der Bühne eine Diva, die blitzschnell in die Komik kippen kann. Eben ist sie noch eine Frau, die sich total daneben benimmt, und schon glänzt sie als Grande Dame. Ich habe noch nie mit jemandem so viel gelacht wie mit ihr.« Bernd-Lutz Lange
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Katrin Weber
mit Stefan Schwarz
Sie werden lachen
Größtenteils schonungslose Erinnerungen
Inhaltsübersicht
Über Autorvorname Autornachname
Informationen zum Buch
Newsletter
Frank oder Katrin? Eine kleine, aber vielsagende Vorgeschichte von Stefan Schwarz
Geboren − angefroren
Westend Girl
Mit dem Muttiheft im ungeheizten Klo
Ungeküsst am Wasserflohteich oder Sie suchten Liebe und fanden nur Stecknadeln!
Die Nachtigall vom Comeniusberg
Bandkasper oder Was rasselt nachts durch Plauen?
Was stimmt mit dieser Stimme nicht?
»Wat ham’se dir eijentlich in der Schule beijebracht?«
Der erste Bus fährt ohne mich − und der zweite auch
Na, dann! Herzlichen Glückwunsch!
Das Licht geht aus
Jesuslatschen und Zahnlücken
Eine Nacht im Russenpuff
»Hammor nich’n scheen’ Beruf?«
Nachwort
Impressum
Frank oder Katrin?
Eine kleine, aber vielsagende Vorgeschichtevon Stefan Schwarz
Es war einmal ein Spermium, das hieß Frank. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich formuliert, aber es trifft doch den Kern der Sache. Denn natürlich hieß das Spermium nicht so, sondern das, was aus ihm geworden wäre, hätte später Frank geheißen. Sie merken aber schon an dieser seufzenden Wortwahl, dass es mit dem Spermium, das später Frank geheißen hätte, nicht gut ausgehen wird. Hängen Sie also nicht Ihr Herz dran!
Außerdem war es ja auch nicht das einzige Spermium, das später Frank geheißen hätte. Viele ebenso Einzigartige waren mit ihm zusammen unterwegs, um später, wenn möglich, Frank zu heißen. Sie müssen sich mal die Verwirrung vorstellen, die ausbrach, als ein Spermium das andere fragte: »Und du? Weißt du schon, was du später mal werden willst?«, und das so Angesprochene stolz antwortete: »Ich will ein Junge werden und Frank heißen!« Ein paar Millionen Köpfe gingen in diesem Moment herum und alle schrien los: »Hä? Ich will aber auch ein Junge werden und Frank heißen!« Und kaum, dass sie es geschrien hatten, drängelten sie los. Jeder wollte der Erste sein.
Lassen Sie dieses Bild ruhig einmal auf sich wirken. Ist es nicht ein Gleichnis unseres ganzen Lebens? Obwohl alle Menschen gleich sind, wollen alle was Besonderes sein. Verrückt, nicht?
Aber zurück zu unserem Spermium, denn dieses war nach langem Drängeln und Schwänzeln ganz vorne dran. Schon flimmerte das Rund der Eizelle vor ihm, und das Spermium wusste jetzt, es würde sie als Erster und damit auch als Einziger befruchten, um ein Frank zu werden! Es hatte diesen mörderischen Wettbewerb gewonnen! Alle anderen würden sterben! Es würde leben. Als Frank. Immer schlank und niemals krank. Der Frank. Der mit dem Geld auf der Bank. Der mit dem Anzug im Schrank. Der mit dem Sprit im Tank. Einfach Frank.
Aber in diesem Moment hörte das Spermium, das später Frank geheißen hätte, eine Stimme. Keine dieser murmelnden, nuschelnden Stimmen, die es in den Stunden zuvor gehört hatte. Nein, eine Stimme wie eine singende Säge, stählern und kapriziös, pöbelte hinter ihm herum: »Sie brauchen überhaupt nicht so beleidigt zu gucken! Ich habe Sie höflich gebeten, etwas beiseite zu schwimmen, und mir nicht mit Ihrem Hinterteil in meinem Gesicht herumzuwedeln! Eine Zumutung! Doch! Das ist mir zu dicht! Ich möchte das nicht! Ich muss etwas Abstand gewinnen! Ja, ich bin auch erschöpft. Reden Sie nicht: Ich bin genauso lange unterwegs wie Sie! …«
Ungläubig sah sich unser Möchtegern-Frank um. Und dann sah er es: Ein aufgeregt zappelndes Spermium drängelte sich durch die vordersten Reihen. Ein völlig neurotisches, aber offenbar nicht sehr schüchternes Spermium, das offenbar an Platzangst litt! Hatte es so was schon mal gegeben? Fassungslos starrte unser Spitzenspermium, das Sie hoffentlich nicht doch schon ein bisschen liebgewonnen haben, auf das Zickenspermium hinter ihm. Und wie es so starrte, merkte es gar nicht, wie sich seine Schwimmbewegungen verlangsamten und es ein bisschen aus der Spur geriet. Erst als die riesige runde Eizelle wie ein Planet an ihm vorüberglitt, begriff das Spermium, dass aus ihm nicht der beste Frank aller Zeiten werden würde, sondern es endgültig vom Kurs abgekommen war. Das Letzte, was es hörte, war der Koloratursopran des Zickenspermiums, das ihm hinterherrief: »Hallo junger Mann, wo wollen Sie denn hin? Hier spielt die Musik! Hat man da noch Worte! Schwimmt der einfach vorbei! Na gut, dann mache ich das hier mal klar, oder? Was dagegen? Wär itze aah ä weng spät!«
Meine Eltern ahnten natürlich von dem Drama, das sich zwischen dem Spermium, das später vielleicht Frank geheißen hätte, und dem, was später mal eine etwas komplizierte Zeitgenossin namens Katrin werden sollte, nichts. Absolut nichts. Die machten einfach miteinander rum. Aus Neugier. Und wegen der Hormone.
Wenn zwei junge Menschen mit zu viel Neugier und zu vielen Hormonen aufeinandertreffen, dann passiert das. Das ist eine ganz gefährliche Konstellation.
Meine Eltern waren jedenfalls noch sehr jung, als sie mich machten. Etwas zu jung für meinen Geschmack. Meine Eltern waren nämlich so jung, dass ich ihnen verboten hätte, mich zu machen, wenn ich schon was zu sagen gehabt hätte. Die waren noch nicht mal ganz volljährig! Wer will denn junge Eltern! Das ist ganz schlecht für ein Kind. Junge Eltern haben noch Nerven, aber kein Geld. Andersrum ist es entschieden besser. Keine Nerven und viel Geld. Jedes Kind will alte Eltern, die sofort sagen: »Nerv nicht, hier, kauf dir ein Eis!«
Sagen wir mal: Zehn Jahre später hätten sie mich gerne haben können. Dann wäre ich jetzt zehn Jahre jünger. Ganz ohne Kosmetik, einfach nur, weil Mutti und Vati sich mit was anderem die Zeit vertrieben hätten als mit sich.
Aber egal. Der Käse ist gegessen.
Denn dann hatten sie mich – und nie wieder Langeweile, was übrigens erklärt, warum ich ein Einzelkind bin.
Geboren − angefroren
Meine Geburt ging schon sehr unlangweilig los. Neun Monate später sagt nämlich meine pralle Mutti zum Vati: »Ich glaube, es geht los!« Und was macht der Vati? Er geht los. Und kommt nicht wieder. Meine Mutti liegt in den Wehen, und die Abstände werden immer kleiner, und ihre Sorge wird immer größer. Wo bleibt ihr Klaus? Er wollte doch nur telefonieren gehen?? Einen Krankenwagen holen??? Das kann doch nicht so lange dauern????
Aber halten wir mal kurz inne: Es ist der 15. Januar 1963. Klirrekalter Vogtlandwinter. Nicht so ein verlängerter Herbst wie heutzutage. Dachlawinen verschütten jeden, der die Haustür zu hart ins Schloss fallen lässt. Meterlange Eiszapfen hängen wie Damoklesschwerter von den Regenrinnen. Ist Klaus beim Stapfen durch den Schnee auf eine liegengebliebene Schneeschaufel getreten und liegt nun ohnmächtig in den Schneewehen, während seine Liebste in den ihren liegt? Oder hat er trotz der Stiefel kalte Füße bekommen? Klaus ist noch jung, und so ein Kind heißt ja nicht nur Frank oder Katrin, sondern auch Verantwortung. Ist ihm plötzlich alles zu viel geworden? Will er womöglich rübermachen? In den Westen? Das ostdeutsche Plauen liegt dreißig Kilometer von der westdeutschen Grenzstadt Hof entfernt.
Nein, Vati ist noch da. In der Telefonzelle. Dornenhecken aus Eisblumen haben die Scheiben überwuchert, und das ist auch gut so, denn der angehende Vati verhält sich etwas seltsam. Er krümmt sich und biegt sich. Er knurrt und flucht.
Was hat er denn nur?
Folgendes war geschehen: Schweißnass vor Aufregung und Eile war der Vati in die Telefonzelle gestürmt, hat den Telefonhörer ans Ohr gepresst und die Vermittlung angerufen, und die Vermittlung hatte ihn zum Krankenhaus vemittelt, die Zentrale vom Krankenhaus hatte ihn an die Gynäkologie und die Gynäkologie zur Rettungsstelle weiterverbunden. Aber da war es schon zu spät. Als Vati erleichtert den Telefonhörer sinken lassen wollte, sank der Telefonhörer nicht. Er war nämlich angefroren. Am schweißnassen Ohr. Das war jetzt aber blöd! Beim Notarztrufen selber zum Notfall geworden. Das ist ja, als wenn der Koch in die eigene Suppe fällt. Als wenn ein Metzger sich selber durch den Fleischwolf dreht. Als wenn ein Polizist sich selbst beim Verbrechen ertappt.
Jetzt nicht durchdrehen, lieber Vati. Ein Kind bekommen und dabei ein Ohr verlieren ist ein schlechter Handel. Ohne Ohr ist alles nur halb so schön, und die Brille sitzt immer schief. Doch die Zeit drängt, denn zu Hause hechelt sich die Liebste durch die Wehen und sorgt sich kalten Schweiß auf die Stirn.
Was wird er tun?
Über das Ende dieser Kalamität existieren verschiedene Berichte. Die einen sagen, Klaus Weber habe den Telefonhörer kurzerhand abmontiert und sei mit ihm am Ohr wieder nach Hause gelatscht, wo er eine Viertelstunde am Kachelofen habe horchen müssen, bis er wieder frei war. Andere meinen, der mit allen Wassern gewaschene Elektroinstallateur habe den ganzen verdammten Apparat kurzgeschlossen, um die Hörmuschel zum Glühen und damit zum Abfallen zu bringen.
Ich denke, das war ein Vorzeichen. Wir kennen das von Heiligen. Bei deren Geburt fliegen Kometen vorbei, oder das Lamm legt sich zum Löwen. Und bei mir friert dem Vati erst mal das Telefon ans Ohr. Wie sich herausstellen sollte, war das kein Zufall. Es würde so weitergehen. Es wird Missgeschicke prasseln und Peinlichkeiten, dicht an dicht. Und alles nur für einen höheren Zweck.
Was Sie hier in der Hand halten, ist ja nicht nur eine kleine Lebensbeichte, es ist auch ein Stückchen Weisheit. Dieses Buch will Ihnen sagen: Wenn etwas schiefgeht oder Sie vom Weg abkommen, dann manchmal nur, damit Sie nicht geradewegs in Ihr Unglück rennen! Wer dauernd in Fettnäpfchen tritt, bei dem läuft es irgendwann wie geschmiert! Wenn Sie eine einzige Katastrophe sind, dann haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal! Also lehnen Sie sich zurück, und genießen Sie meine Lebensreise vom Dussel zur Diva.
So. Erst mal sagen aber alle »Nu wo isse denn? Nu wen hammor denn do?« zu dem kleinen fetten, schwarzen Wonneproppen, der nicht zu übersehen ist, weil ihn Mutti sechsmal am Tag mit dem ostdeutschen Milchpulver Babysan volltankt. Bis zum Rand. (Für alle Spätgeborenen: Nicht aus Not! In den Sechzigern galt es als altmodisch und ungesund, seinem Neugeborenen das olle Zeug aus der Brust anzubieten.) Ich bin bald so pausbäckig, dass ich kaum noch die Augen aufkriege. Meine Schlitzaugen lassen den Vati kurz zweifeln, ob nicht doch eher ein durchreisender Chinese die Zeugung für sich beanspruchen kann. Mehr noch: Babysan-Katrin ist bald so moppelig, dass man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, ich hätte schon im ersten Lebensjahr das Gewicht bekommen, das ich heute noch habe.
Ein Nebeneffekt dieser reichhaltigen Ernährung ist, dass meine Polsterbeine nur schwer in Gang zu bringen sind. Da kann Mutti noch so willkommen in der Zimmermitte hocken und »Komm zur Mutti! Nu komm ner mal her ze mir« locken, Katrin Specki Polsterrolle klammert an der Kommode und weiß, wenn sie jetzt loslässt, liegt sie auf der Gusche. Ein Baby-Rollator, das wär’s jetzt! Bald werde ich einen haben. In Gestalt des Puppenwagens. Wo immer ich ab jetzt hingerufen werde, erscheine ich mit dem Puppenwagen. Überall erzählt man sich, die kleine Webern sei rein närrisch mit ihren Puppen. Aber das stimmt natürlich nicht. Ich brauche einfach was zum Festhalten! Mich muss die Mutti im Garten nicht lange suchen. Entweder stehe ich an einem Baum. Oder ich stehe an der Bank oder an einem Zaun. Ich bin niemals freihändig unterwegs.
Selbst in der Krippe wird man mich noch im Haltegriff an der Kinderwagenseite finden, finster mit den fetten Beinen nebenherstampfend, während alle anderen Krippenkinder brav aufgereiht im Krippenwagen sitzen, die Sonnenmützchen unterm Kinn festgebunden, und das Geschobenwerden genießen wie erst in achtzig Jahren wieder. Ist es nicht eine schreiende Ungerechtigkeit, dass ich, die Einzige weit und breit mit einer veritablen, nicht altersgerechten Gangunsicherheit, nebenherlaufen muss?
Na ja, nicht unbedingt. Das kleine Wuchtbrummelchen ist ä weng unverträglich. Im Krippenwagen sitzen möchte ich schon, aber nicht mit dem anderen Kleinkinderpack. Die sollen gefälligst raus. Neben mir und vor mir hat gleich überhaupt niemand zu sitzen. Und während die Krippentante noch dem letzten Zögling die Jacke zuknöpft, habe ich im Krippenwagen schon die anderen weggedrückt und weggeschoben, bis alle möglichen Beisitzer im Dreck liegen und plärren. Deswegen muss ich jetzt nebenherlaufen wie die Bodyguards am Cabriolet des Präsidenten.
Als wäre das nicht schon schlimm genug, baumeln die Handschuhe an der Strippe, die durch meine Jackenärmel gezogen ist, weil ich sie sonst immer verliere. Und im Nacken kratzt das Etikett. Alles etwas unschön, finde ich, was deutlich an meiner finsteren Miene abzulesen ist. Ist so das Leben? Dass immer etwas zwickt und kratzt?
Sagte ich schon, dass dies eine Wochenkrippe ist? Ich muss in die Wochenkrippe, weil Mutti Weber von Montag bis Freitag zehn Stunden und Samstag bis Mittag arbeitet und Vati Weber zur Armee eingezogen wurde, um mit der Waffe in der Hand das Land zu beschützen, in dem Muttis ihre Kinder in die Wochenkrippe geben können, um von Montag bis Samstag zu arbeiten. Das ist so ein bisschen wie Kinderheim mit Unterbrechung. Gerade, wenn man vergessen hat, dass man aus einer Familie stammt, holen die Eltern einen ab und machen das ganze Wochenende Spaß mit einem, damit man am nächsten Montag so richtig die Krise kriegt, wenn es wieder für fünf unendliche Tage in die Wochenkrippe geht. Wochenkrippen sind das Geschenk des Ostens an die Psychotherapeuten des Westens.
Gott sei Dank kommt Vati nach anderthalb Jahren zurück von der Armee, und ich kann ganz normal in den Kindergarten gehen. Gemeinsam gehen Mutti und Katrinchen morgens um sechs durch das Werktor, und es gibt ein Küsschen. Die meisten Muttis gehen dann nach rechts und die Kinderchen nach links. Der Kindergarten befindet sich nämlich auf dem Werksgelände. Der rote Klinkerziegelbau mit dem Charme einer kaiserlichen Frankieranstalt führt den seriösen Namen »Kindergarten des VEB NARVA Glühlampenwerks Plauen«. Nicht etwa »Die süßen Leuchtkäfer« oder »Glühwürmchen«, nein, »Kindergarten des VEB NARVA Glühlampenwerks Plauen«! Unnötig zu sagen, dass er nicht den Geist von Maria Montessori atmet. Zweck dieser Tagesstätte ist die trockene und ordnungsgemäße Aufbewahrung des Kindes bis zum Zeitpunkt der Rückforderung durch den rechtmäßigen Eigentümer. Lernziele sind das Stillsitzen und das Stillliegen. Bei Bedarf können Grünpflanzen in einem illustrierten Pappbuch betrachtet werden. Nötiger Sauerstoff wird beim geführten Spaziergang rund um das Fabrikgelände eingeholt. Wer nicht brav ist, kommt in die Gruppe der grausligen Kindergärtnerin Frau Schaarschmidt, bei der man sogar noch den Apfelgriebsch mitessen muss. Sie fragen sich jetzt, woher ich das so genau weiß? Ich war so oft bei Frau Schaarschmidt in der Gruppe, dass ich bis heute zwanghaft die Kerngehäuse von Äpfeln mitesse.
Der »Kindergarten des VEB NARVA Glühlampenwerks« ist der passende Ort für meine sich dynamisch entwickelnden Neurosen, immerhin komme ich schon leicht überspannt aus der Wochenkrippe. Ich bin noch nicht lange Kindergartenkind, als ich schluchzend und schnotternd in der Garderobe sitze, weil meine Sonnenbrille weg ist.
»Mei Sonnebrill is weg. Isch hab scho überall gesucht. In dor Dasch isse aah net«, plärre ich die Kindergartentanten an, die sichtlich nicht bereit sind, mein Leid zu teilen, und stattdessen amüsiert mit verschränkten Armen in der Tür stehen. »Die scheene Sonnebrill! Die ho isch gestern erst gekrischt! Jetzt kriesch isch net so schnell widdor aane!«, kantiliere ich schmerzensreich zur Zimmerdecke, während die Tanten mit den eisernen Herzen noch Kolleginnen heranholen, um sich an meinem Unglück zu weiden. Schließlich sammeln sich sogar Kinder an ihren Beinen, um mit Fingern auf mich zu zeigen. Kleine, schadenfrohe Wichte! Garstiges Gesindel! Schande des Vogtlands!
Nach zwei, drei Minuten beginnt mich der seltsame Kontrast zwischen meiner und ihrer Verfassung aber dann doch zu irritieren, und ich komme nicht umhin, ihren Blicken und Fingerzeigen Achtung zu schenken.
Denn: Die Sonnenbrille sitzt auf meinem schwarzen Nischel, dem damischen.
Nun, es handelt sich hier um eine früh erkennbare Neigung zum Charakterfach! Es mag ja Kinder geben, die gern alles in sich reinfressen. So bin ich nicht. Wozu hat uns der Herrgott Miene und Gebärde gegeben, wenn nicht um ausdrucksvoll zu verzweifeln? Die Erzieherinnen müssen nicht lange nachdenken, wer beim Singspiel »Dornröschen war ein schönes Kind …« oder »Hänsel und Gretel« die böse Fee oder die böse Hexe geben muss. »Das macht unsere Katrin, der klaane schwarze Deifl, die kaa des gut.«
An dieser Stelle wäre es Aufgabe meiner Eltern gewesen, mir den Glauben an den eigenen Liebreiz zurückzugeben. Chancen gab es genug.
Ich sage nur Fasching. Wir alle wissen, dass Fasching für Kinder nicht das Fest ist, wo sie sich besonders originell verkleiden wollen. Fasching ist für Kinder das Fest, wo die Jungs entweder als Cowboy oder Indianer und die Mädchen entweder als goldfarbene oder rosafarbene Prinzessin erscheinen wollen. So will es das ungeschriebene Gesetz der Kinderseele.
Schon Wochen vor dem Fasching bete ich, dass meine Mutter diesmal erst kurz vor knapp daran denken, dann schnell ins Kaufhaus eilen und dort den handelsüblichen Prinzessinnenkram einkaufen möge. Vergeblich. Das unerbittliche Schicksal eines Einzelkindes erwartet mich. Meine allzu jungen Eltern rafften jeden Februar all ihre Originalität und Kreativität zusammen und nähten und bastelten los. Das Ergebnis hätte unerwünschter nicht sein können. Während am Faschingsdienstag zwei Dutzend allerliebste Prinzessinnen zarten Fußes mit viel Knicks und Hoheit in den Kindergarten treten, ganz geschwächt vom Entzücken über die eigene Schönheit, muss ich, als buntscheckiges Kasperle, als gestiefelter Kater, schließlich sogar als Chinese (Sie erinnern sich gnädigerweise an meine Schlitzaugen!) mit einem Pappdeckel als »Strohhut« verkleidet, unter den Luftschlangen hindurch. Hineingezwängt in maskuline Rollenbilder, schmachte ich nach elektrostatischen Kunststoffperücken und billigem Tüll. Es ist, als wenn Frank, das Spermium, am Ende doch noch gewonnen hätte. Und dann passiert auch noch ein Unglück! Bei der Polonaise, dieser sterbenslangweiligen, per Schultergriff gefügten Menschenkette, fällt mir mein Chinesenfächer aus den Patschehändchen! Das einzige Accessoire, das mir etwas galt! Ein Viertelchen bedrucktes Faltenpapier, mit dem ich mir bei Bedarf etwas Femininität zufächeln konnte! Er fällt zu Boden und die vogtländischen Kindertrampel mit ihren karierten, gepolsterten Fußkloben stampfen achtlos darüber hinweg und darauf herum. Natürlich plärre ich los, und natürlich werde ich beiseitegezogen, damit mein Plärren das Schlurfen und Schleppen der dämlichen Polonaise nicht stört.
Es ist ein Vorfall von so alptraumhaften Ausmaßen, dass ich wahrscheinlich an jenem Tag beschließe, eine Diva zu werden! Jemand, der seine Existenz als feine Dame mit Zähnen und Klauen verteidigt. Ich werde Abstand halten von den Grobianen und mich in Sphären aufhalten, wo der Handkuss und der galante Arm praktiziert werden! Dass ihr es nur wisst …!
Einmal, ein einziges Mal darf ich als Rotkäppchen gehen. Nicht als Schneewittchen mit meiner Haut wie Schnee und meinem Haar wie Ebenholz, das lag wohl zu nahe. Nein, als Rotkäppchen. Offenbar ist meinen Eltern entgangen, dass ich vor allem, was Rot ist, panische Angst habe. Es ist ja die Zeit der ersten industriell hergestellten Weihnachtsmannmasken, und niemand kann ermessen, welchen Schrecken diese Pappmachélarven in das Herz eines kleinen Mädchens senken. Mit der Maske sieht der Weihnachtsmann aus wie ein mit Watte umwickelter Schweinskopf mit Beulenpest, und auch wenn dieses Ungeheuer ungeheuer nett sein soll und kleinen Kindern angeblich Geschenke bringt. Nicht mit mir! Mein Vater braucht in der Adventszeit nur aus Spaß von unten an den Tisch klopfen, um das weihnachtliche Türpochen nachzuahmen, und schon renne ich schreiend davon.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich als einziges Kind des Kindergartens zum Nikolausfest eine Rute im Stiefel habe. Nicht weil ich besonders unartig bin. Ich bin genauso unartig wie all die kleinen Racker im Kindergarten des VEB NARVA Glühlampenwerks Plauen.
Ich bin nur – langsamer. Und ungeschickter.
Die Grobmotorik, der langsame Antritt, die ungehorsamen Beine, nun ja, ich sprach bereits davon. Wenn also beim illegalen, also unbeaufsichtigten Um-den-Tisch-Rennen jemand ausrutscht und gegen die Wand kracht, worauf das Bildnis des Großen Freundes aller Kinder, des Genossen Walter Ulbricht, abfällt und am Boden zerspringt, was glauben Sie, wer am Ende noch verdattert davorsteht, wo alle anderen Schlingel schon wieder lieb irgendwo in den Ecken mit ihren Bausteinen spielen? De klaane Webern.
Dafür gibt es dann zum Nikolaus die Rute in den Stiefel und keine Süßigkeiten.
Meine Angst vor Rot und Rute ist außerordentlich unpassend, denn eigentlich bin ich wie gemacht für den Nikolaus oder den Weihnachtsmann. Eines kann ich nämlich wirklich gut: Auswendig aufsagen. Gedichte, Verse, Sketche – ich memoriere alles, was kommt. Wenn andere Kinder meines Alters noch überlegen müssen, ob sie Kirsten oder Karsten heißen, gebe ich auf Verlangen den amüsierten Küchentanten schon mit vier Jahren ganze Sketche von der Eberhard-Cohrs-Platte meiner Eltern zum Besten. Oder ich singe Schlager, wie zum Beispiel »Ein Student aus Uppsala«, den ich im Radio gehört, aber natürlich nicht ganz verstanden habe, denn mir ist mit meinen vier Jahren weder geläufig, was ein Student ist, noch habe ich je von Uppsala gehört. So singe ich dann einen Text, der besser zu meiner kindlichen Vorstellungswelt passt, nämlich »Ein Strumpf hängt aus Obstsalalala-lalalalala-lalalalalat«, und kann überhaupt nicht begreifen, warum alle lachen, wo ich doch so schön singe.