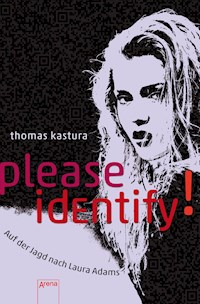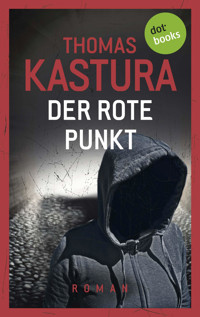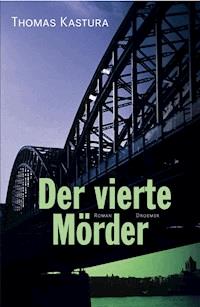Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Wieder begeben sich Staatsanwalt Brandeisen und Kommissar Küps auf Verbrecherjagd ... mit ungewöhnlichen Methoden und jeder Menge Humor. Die beiden Bamberger Ermittler haben es mit einem scheinbar perfekten Mord zu tun, stellen schweißtreibende Nachforschungen in der Sauna an und werden sogar Zeugen eines Gefängnisausbruchs während der Sandkerwa. Ob im Kurhotel, auf dem Tennisplatz oder in einem Glockenstuhl – Brandeisen und Küps scheuen keine Mittel und Mühen, Kriminelle festzusetzen. Mit der Realität nehmen sie es in dem Bestreben, wenigstens einmal einen ganz großen Fall lösen, manchmal nicht so genau. Dann sind ihnen selbst sieben Tote nicht genug ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Kastura
Sieben Tote
sind nicht
genug
Brandeisen & Küps ermitteln
kriminalgeschichten
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage Oktober 2017)
© 2017 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Dr. Felicitas Igel
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: mauritius images / imageBROKER / mp
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-857-2
Inhalt
Vorwort
Das perfekte Verbrechen
Genug ist genug
Sieben Tote sind nicht genug
Das Loch, in Hoffmanns Manier
Fluchtpunkt Sandkerwa
Alle Neune auf Norderney
Bei Aufguss Mord
Wem die Erlöserglocke schlägt
Kurschaden
Kommando Herodes
Gutes Neues
Truffle Royale
Mord mit Doppelfehler
Der kleine Eisenbahnraub
Der unvollständige Mister Van der Belt
Das letzte Komma
Der Jungbulle
Textnachweis
Der Autor
Vorwort
Seit 2006 ermitteln Staatsanwalt Brandeisen und Kommissar Küps nun schon, zumeist in Bamberg, aber auch in anderen Teilen Frankens, Deutschlands, Europas. Als die beiden ihren ersten Fall lösten, steckte der Regionalkrimi vielerorts noch in den Kinderschuhen. Zwischenzeitlich gibt es kaum eine Stadt oder einen Landstrich, wo keine literarischen Verbrechen begangen werden. Auch über Franken ist eine wahre Flut an Regio-Krimis hinweggeschwappt – und schwappt immer noch.
Aber sind all diese Schandtaten ernst zu nehmen? Eigentlich nicht, und deshalb spielen Ironie und Parodie bei Brandeisen und Küps stets die Hauptrollen. Die beiden geraten in alle möglichen Situationen, wobei die unmöglichen, die verrückten, fantastischen überwiegen. »Das Loch, in Hoffmanns Manier« hat zum Beispiel so gut wie gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die Geschichte ist frei erfunden, wenn auch eingebettet in reale Schauplätze und Begebenheiten. Gleiches gilt für die anderen Storys. In Zeiten von »Fake News« muss man das – leider – ausdrücklich betonen.
Deshalb meine Bitte an die geneigten Leserinnen und Leser: Nehmen Sie das Ganze mit Humor. Brandeisen und Küps haben davon reichlich.
Thomas Kastura
Bamberg, im März 2017
Das perfekte Verbrechen
Kommissar Küps schwitzte. Der Kopfhörer drückte. Langsam bekam er Ohrensausen, was zum einen an der stickigen Luft im Studio lag, zum anderen am selbstgefälligen, nicht enden wollenden Redeschwall von Staatsanwalt Brandeisen.
»Und den Fall des gestohlenen Kunigunden-Rubins habe ich ganz allein gelöst«, schwadronierte jener. »Leider ist der Juwelendieb entkommen. Wenn mein Ermittlungspartner früher eingegriffen hätte ...«
Küps warf ihm einen strafenden Blick zu. »Es läuft halt net immer so wie im Fernsehen. Manchmal sind uns die Spitzbuben einen Schritt voraus.«
Die Radiomoderatorin nickte. »Vielen Dank, die Herren. Da haben Sie uns ja allerhand spannende Geschichten aus der Praxis verraten. Aber jetzt kommen endlich Sie zum Zug, liebe Hörer. Nach einer kurzen Werbepause können Sie Brandeisen und Küps Fragen stellen. Unsere beiden Studiogäste werden nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Vielleicht wollten Sie schon immer mal erfahren, wie man zum Beispiel ... den perfekten Mord begeht?« Sie lachte etwas künstlich und gab die Telefonnummer durch: »... quasi unsere Crime-Hotline. Rufen Sie an!« Dann betätigte sie einen Regler, Reklame wurde eingespielt.
»Und? Wie waren wir?«, fragte Brandeisen ungeduldig.
»Gar nicht schlecht – für ein Live-Interview.« Die Moderatorin nahm einen Schluck Cola.
»Gar nicht schlecht?«
»Nein, im Ernst, wie Sie sich gegenseitig die Bälle zuspielen, einfach wunderbar. Bühnenreif! Der Besserwisser und der Begriffsstutzige – als hätten Sie das geübt.«
»Aber ... wir sind auch in natura so!«, beteuerte Brandeisen.
Küps betrachtete angewidert sein Wasserglas. »Ohne Bier kann ich nicht arbeiten. Haben Sie wirklich nichts Vernünftiges zum Trinken da?«
»Bedaure, nein.«
»Ich war mal Statist am Stadttheater, als ich noch jünger war. Hinter den Kulissen stand immer ein Kasten Keesmann Herren Pils ...«
Brandeisen begriff, worauf Küps hinauswollte. »In der Regel ziehen wir Spezial-Rauchbier vom Fass vor. Das hält die grauen Zellen in Schwung. Bei den vielen Interviews, die wir tagtäglich geben, haben wir das bitter nötig.« Er kehrte die Diva heraus. Dieses Privatradiomäuschen sollte merken, dass sie es nicht mit Anfängern zu tun hatte. Ohne Starallüren brachte man es nicht zu Ruhm und Ansehen, zumal in einer Stadt wie Bamberg, wo sich die Menschen nur allzu gern blenden ließen von großtuerischem Gehabe. »Beim Bayerischen Rundfunk war es kein Problem, ein Bier zu bekommen«, setzte er pikiert hinzu. »Da kümmert man sich noch um das Wohlergehen der Gäste.«
»Na gut, ich sehe, was ich tun kann.« Über Kopfhörer erkundigte sich die Moderatorin beim Aufnahmeleiter. Ihr Gesicht hellte sich auf. »Echt? Wir haben noch Werbegeschenke vom Tag des deutschen Bieres? Her damit!«
Kurz darauf erschien eine Praktikantin mit einer reichen Auswahl an gekühlten Flaschen. Küps entschied sich für ein Zwergla der Brauerei Fässla, ein hervorragendes Dunkelbier, und Brandeisen nahm ein helles Schlenkerla Lagerbier, seine Hausmarke. Glaskrüge wurden kredenzt und befüllt.
»Zufrieden?«, fragte die Moderatorin, nicht ohne Ironie. »Wär doch gelacht, wenn uns der BR in puncto Prominentenbetreuung aussticht.«
»Danke, wir wissen das zu schätzen.« Brandeisen stieß mit Küps an. Sie tranken und fühlten sich angemessen gepampert, wie es bei ihrem Bekanntheitsgrad nur recht und billig war. Die Praktikantin entfernte sich.
»So, die Werbepause ist zu Ende.« Die Moderatorin fummelte an der Technik herum. »Gleich sind wir wieder on air.« Ein Tastendruck. »Willkommen zurück, liebe Hörer. Heute haben wir exklusiv für Sie: Staatsanwalt Brandeisen und Kommissar Küps, die Schrecken aller fränkischen Kriminellen, Bambergs erfolgreichstes Ermittlerteam. Der erste Anrufer ist schon in der Leitung. Marlene Malz aus Waizendorf möchte etwas fragen.«
»Hallo, verstehen Sie mich?«, ertönte eine hohe, ältlich klingende Frauenstimme.
»Klar und deutlich.«
»Also, das mit dem perfekten Verbrechen, das würde mich interessieren. Gibt es so etwas überhaupt?«
»Durchaus!«, preschte Brandeisen vor. »In Deutschland bleiben jährlich über eintausend Morde unentdeckt. Das liegt aber nicht an genialen Straftätern, sondern schlicht und ergreifend an Schlamperei. Sie werden es kaum für möglich halten, wie viele Mediziner sich bei der Leichenschau täuschen und einen natürlichen Tod bescheinigen – obwohl vielleicht Zweifel bestehen. In solchen Fällen erfolgt keine Obduktion. Und keine Ermittlung! Wir treten gar nicht erst in Aktion.«
»Stell dir vor, es war Mord, aber niemanden juckt’s«, ergänzte die Moderatorin. »Kein angenehmer Gedanke.«
»So kann man das nicht sagen.« Küps räusperte sich. »Unerfahrenheit, Überlastung ... da unterläuft den Ärzten schon mal ein Fehler.«
»Heißt das, wenn man es unauffällig anstellt, kommt einem die Polizei gar nicht drauf?«, fragte Frau Malz.
»Nur, wenn es keine Verdachtsmomente gibt«, erwiderte Küps.
»Verdachtsmomente?«, kam es zögerlich zurück.
»Sind Sie verheiratet, Frau Malz?«
»Äh, ja.«
»Nur mal angenommen, Sie möchten Ihren Mann umbringen ...«
»Ich? Wie meinen Sie das jetzt?«
»Keine Sorge, das ist nur ein Beispiel«, schaltete sich Brandeisen ein. Er zwinkerte der Moderatorin zu, die ihm eingeschärft hatte, bildlich zu argumentieren, aus dem Leben gegriffen, damit die Hörer alles nachvollziehen konnten. »Gehen wir für einen Augenblick davon aus, Ihr Gatte habe ein schwaches Herz. Möglicherweise ist er schon siebzig, in so einem Alter kann leider viel passieren. Falls Sie, liebe Frau Malz, aus irgendwelchen Gründen beschließen sollten, das Ableben Ihres Angetrauten zu beschleunigen, sagen wir, weil er ein furchtbarer Tyrann ist und seine Pantoffeln immer genau so hinstellt, dass Sie darüber stolpern ...«
»Ja, seine Pantoffeln ...«
»Dann könnten Sie ihm doch Gift ins Bier träufeln! Eine toxische Substanz, die er nicht herausschmeckt – das Internet ist voll davon. Meistens beschleunigen solche Gifte den Herzschlag und erhöhen den Blutdruck.«
»Atemnot, Sehstörungen – habe ich von der Nachbarin gehört.«
»Genau! Und die Folge? Herzstillstand! So, und jetzt zeigen Sie mir den Arzt, der bei einem Risikopatienten, der durch Kammerflimmern ohnehin gefährdet ist, einen Mord mutmaßt!«
»Aber die moderne Medizin hat doch Mittel und Wege ...«
»Hat sie, natürlich. Der Mageninhalt wandert ins Labor, das Blut wird analysiert, ebenso der Urin, Gewebeproben von Leber, Nieren, Muskeln, sogar die Haare. Die Frage ist: Kommen diese forensischen Verfahren auch zur Anwendung? Bei einem kerngesunden Dreißigjährigen – sehr wahrscheinlich. Bei einem bemoosten Haupt – eher nicht. Da neigen unsere Äskulapjünger zu der Diagnose: Irgendwann musste es so weit kommen. Friede seiner Asche.«
»Aha.«
»Außerdem ist so eine Obduktion teuer«, fügte Küps hinzu. »Wir müssen auch an die Kosten denken.«
Die Moderatorin hatte schon den nächsten Anrufer auf ihrer Liste. »Vielen Dank, Frau Malz. Wer hätte das gedacht? Perfekte Verbrechen sind gar nicht so selten. Hoffentlich konnten wir helfen.«
»Moment, ich wollte noch wissen ...«
»Tut mir leid, wir möchten auch anderen Hörern die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen.« Mit einem Mausklick flog Frau Malz aus der Leitung. »Als Nächstes gehen wir nach Pettstadt. Hallöchen, Herr ... Rausch? Ist das richtig?«
»So heiß ich, ja.« Ein unwirsch klingender Männerbass.
»Was liegt Ihnen denn auf dem Herzen?« Die Moderatorin ergriff die Gelegenheit zu dem Sprachspiel. »Ich nehme an, Ihr Herz schlägt noch munter vor sich hin? Kleiner Witz, Sie verstehen?«
»Ich schließ mich meiner Vorrednerin an.«
»Ach ja? Dann legen Sie mal los.«
»Des mit dem Bier ... Wenn man da ein Gift reintun würd ... Bei welchem Bier fällt des am wenigsten auf?«
»Unsere Hörer stecken ja voller krimineller Energien!«, freute sich die Moderatorin und schickte erneut ein Radiolachen über den Äther, das zwischen Hundegebell und Asthmaanfall changierte. »Wie es der Zufall will, sind unsere beiden Ermittler wahre Experten in Sachen Bier.« Brandeisen und Küps prosteten sich gerade zu. »Wer von Ihnen würde gern ...«
Küps wischte den Schaum mit dem Ärmel ab. »Gute Frage, Herr Rausch! Sie planen aber keinen Mord, gell?«
»Ach woher!« Pause. »Ich frag nur.«
»Also, Gift im Bier ... Mir fallen da sofort die großen Industriebrauereien ein, die Massenmarken, vor allem die billigen. Das Zeug schmeckt wie Spülwasser mit Hopfenaromen, das ist toterhitzt wegen der Haltbarkeit. Aweng Gift fällt da gar net auf.«
»Meinen Sie ...«
»Bitte keine Namen nennen!« Die Moderatorin sah schon eine Prozesswelle auf den Sender zurollen.
Küps nickte ihr zu. »Einigen wir uns auf ein minderwertiges Discount-Bier, der Kasten unter zehn Euro. Damit können Sie nichts falsch machen.«
»Und des klappt garantiert?«, beharrte Herr Rausch. »Auch wenn der ... der Todeskandidat, wenn der normalerweise nur gescheites Bier trinkt, zum Beispiel a U vom Mahr? Wird der net skeptisch bei einer billigen Brüh? Und denkt die Polizei dann net später, dass da was faul ist, wenn die einen toten Bierliebhaber findet, der so einen Mist in sich reingeschüttet hat?«
»Es gibt eine Alternative.« Brandeisen hatte eine Idee. »Vielleicht haben Sie schon von Craft Beer gehört. So nennt man handwerklich hergestelltes Bier von kleinen Brauereien. Es enthält oft natürliche Aromen und Zusätze, die vom Reinheitsgebot abweichen. India Pale Ale gehört dazu, ein fruchtiges Bier, stammt ursprünglich aus England. Oder ein tiefschwarzes Porter, stark malzig, erinnert an Schokolade. Der Geschmack dieser Biere ist manchmal so intensiv, dass er Giftstoffe mit Leichtigkeit überdeckt. Wäre das etwas für Sie?«
»Im Prinzip schon. Ist des teuer?«
»Craft Beer hat leider seinen Preis wegen der höheren Produktionskosten. Mit fünf Euro pro Flasche sollten Sie mindestens rechnen.«
»Heilandsack!«
»Aber, mein lieber Herr Rausch, was sind schon fünf Euro für einen unentdeckten Mord? Da sollte man nicht am falschen Ende sparen.«
»Auch wieder wahr.«
»Herzlichen Dank nach Pettstadt für diese ganz spezielle Frage«, sagte die Moderatorin. »Zum Glück haben wir Fachleute im Studio. Apropos – würden Brandeisen und Küps es denn bemerken, wenn ihr Bier mit Gift versetzt wäre?«
»Todsicher!«, antwortete Küps. »Es reicht schon, wenn ich eine Flasche erwisch, die einen leichten Stich hat, also wo das Haltbarkeitsdatum überschritten ist. Dann wird meine Zunge ganz pelzig, und es kribbelt in meinem großen Zeh.«
»Im großen Zeh?«
»Meine alte Pilsverletzung. Ich hab mal aus Versehen ein warmes Pils aus dem Raum Nürnberg getrunken. Geschüttelt hat’s mich da, des war nicht mehr feierlich. Fast wär’s mir wieder hochgekommen. Und danach war mein großer Zeh einen Tag lang taub.«
»Sie Armer!«, bedauerte ihn die Moderatorin. »Da sieht man mal: Ein falsches Bier kann bleibende Schäden hinterlassen.« Sie wandte sich an Brandeisen. »Wie steht’s mit Ihnen, Herr Staatsanwalt? Können auch Sie Fremdstoffe im Bier ausfindig machen?«
»Natürlich, meine Liebe. Ich habe nicht nur das absolute Gehör, sondern auch einen jahrzehntelang geschulten Gaumen, der es mir gestattet, feinste Unterschiede zu registrieren. Nehmen Sie nur das zum Brauen verwendete Wasser. Ich kann Ihnen genau sagen, ob es aus Bamberg stammt oder aus der Fränkischen Schweiz, von der Gegend rund um den Staffelberg oder vom Aischgrund.«
»Kaum zu glauben!«
»Dilettantische Vergiftungsversuche, etwa mit Arsen oder Zyankali, würden mir zwingend auffallen. Arsen, oder genauer: Arsen(III)-oxid, schmeckt leicht süßlich, Zyankali erinnert an Bittermandeln. Allerdings gibt es ja auch geruch- und geschmacklose Gifte, wie bereits erwähnt. Die kann selbst ich nicht erkennen.«
»Sind solche Gifte wirklich problemlos im Internet zu bekommen?«, wollte die Moderatorin wissen.
»Sicher«, fuhr Brandeisen fort, »auch hier gilt: alles eine Frage des Geldbeutels.«
»Und ich habe immer gedacht: Umsonst ist nur der Tod.«
»Heutzutage kriegt man selbst den nicht geschenkt. Aber auch Mörder müssen sparen, vor allem in Oberfranken, wo die Euros bekanntlich nicht auf den Bäumen wachsen. Wer kein Krösus ist, kann schwer nachweisbares Gift selbst herstellen. Rizin wird aus den Samen des Rizinus gewonnen, für Palytoxin braucht man Krustenanemonen, das sind Korallen. Von dem guten alten Fingerhut ganz zu schweigen, der wächst in der freien Natur, ebenso Tollkirsche, Stechapfel, Maiglöckchen ...«
»Das sind ja ganz tolle Tipps! Bamberg – Gärtnerstadt, sag ich da nur.« Die Moderatorin schraubte ihr Gute-Laune-Level weiter hoch. »Der nächste Anruf erreicht uns aus Obergreuth. Herr Zapf, Sie haben das Wort.«
»Grüß Gott in die Runde. Das mit dem Gift ist mir jetzt klar. Aber wenn man es jemandem ins Bier geschmuggelt hat, könnte man den Betreffenden beim Trinken ja zusätzlich ablenken. Dann merkt der ganz sicher nicht, dass etwas nicht stimmt.«
»Guter Vorschlag«, sagte Küps. »Wir Kriminaler sprechen bei einer Ermittlung immer von Motiv, Mittel und Gelegenheit. Wenn wir alles drei herausgefunden haben, sind wir einen großen Schritt weiter und bringen die Strafsache meistens zügig zum Abschluss.«
»Kombiniere!« Die Moderatorin liebte Rätselraten, so etwas hielt die Hörer bei der Stange. »Das Mittel wäre in unserem Fall Gift. Und das Motiv?«
»Die Pantoffeln, die immer im Weg stehen, hatten wir ja schon«, meinte Brandeisen. »Häufig sind es die kleinen Dinge, die das Fass zum Überlaufen bringen und Mordgelüste freisetzen. Ein gebrauchtes Ohrenstäbchen auf dem Badewannenrand. Oder lebhafte Darmtätigkeit nach dem Verzehr einer Wurst mit Musik. Ich würde das unter ›eheliche Abnutzungserscheinungen‹ subsumieren.«
»Und die Gelegenheit, das sind Umstände, unter denen das Gift verabreicht wird«, erklärte Küps. »Fällt Ihnen dazu etwas ein, Herr Zapf?«
»Schafkopf«, kam es wie aus der Pistole geschossen zurück. »Beim Karteln ist man ja voll konzentriert, man zählt die Stiche und die Augen mit, achtet darauf, welche Trümpfe schon gefallen sind und so weiter. Bei einem wichtigen Solo vergisst man alles andere und trinkt, ohne darüber nachzudenken, was man gerade im Krug hat.« Herr Zapf schien jünger als Herr Rausch zu sein. Er sprach Hochdeutsch und hatte sich offenbar in die Materie eingearbeitet.
»Wie lautet das fachliche Urteil von Brandeisen und Küps?«, fragte die Moderatorin, um Spannung aufzubauen. »Wäre Schafkopf die richtige Gelegenheit für einen Giftmord?«
»Eventuell«, erwiderte Küps, »vor allem in Franken. Ansonsten hätte ich gesagt: Frauen sind auch eine geeignete Ablenkung – oder Diskussionen über Autos. Oder über Fußball. Das gilt natürlich vor allem für männliche Opfer, aber inzwischen vermischt sich das ja immer mehr.«
»Über Fußball kann ich mich stundenlang unterhalten!«, protestierte die Moderatorin. »Männer und ihre Lieblingsklischees ... Was meinen Sie dazu, Herr Staatsanwalt?«
»Klischees sind bedauerlich. Aber noch bedauerlicher ist es, dass sie so häufig zutreffen.« Brandeisen lächelte schwach, seine Aphorismen waren schon besser gewesen. »Zurück zum Schafkopf. Vergiftungserscheinungen wie Alkohol- und Nikotinabusus sind dabei weit verbreitet, Körperverletzung ist fast an der Tagesordnung, und Tötungsdelikte kommen auch schon einmal vor, etwa in Form von eingeschlagenen Schädeln. Doch Giftmorde beim Schafkopf sind extrem selten. Bislang hatten wir es nur ein einziges Mal mit so einer Vorgehensweise zu tun, damals waren die Karten präpariert1, eine überaus raffinierte Tötungstechnik. So etwas geschieht aber nur alle Jubeljahre, und genau darauf könnte ein ausgefuchster Täter spekulieren.«
»Das ist jetzt etwas kompliziert«, sagte die Moderatorin.
Brandeisen schüttelte nachsichtig den Kopf. »Denken Sie noch einmal an den Arzt, der zu einem Todesfall gerufen wird. Er stellt eine natürliche Todesursache fest, weil er ein unwahrscheinliches Szenario wie Giftmord beim Schafkopf nicht in Betracht zieht. Oder er geht davon aus, dass dergleichen wohl kaum zweimal vorkommt. Ergo werden Kommissar Küps und ich gar nicht erst verständigt.«
»Dann stimmen Sie mir also zu?«, fragte Herr Zapf.
»Unbedingt«, gab Brandeisen zurück. »Gesellschaftsspiele sind eine ideale Ablenkungstaktik für eine ganze Reihe von Straftaten. Noch ein Hinweis: Wenn Sie mit einem Mord aus rein emotionalen Motiven liebäugeln, sollten Sie nur um geringe Geldbeträge spielen, sonst könnten zusätzliche Verdachtsmomente entstehen. Dann kommt Habgier als Motiv hinzu, Neid, rücksichtsloses Gewinnstreben und so weiter.«
»Und achten Sie darauf, dass alle Mitspieler außer dem Opfer in Ihren Plan eingeweiht sind«, sagte Küps. »Das verringert die Gefahr unvorhergesehener Zwischenfälle. Und Sie müssen keine unliebsamen Zeugen beseitigen.«
»Ich werd’s mir merken«, beteuerte Herr Zapf.
»Aber nicht nachmachen!«, scherzte der Staatsanwalt.
Allgemeines Gelächter.
Die Moderatorin strahlte. »Tja, liebe Hörer. Damit hätten wir unser perfektes Verbrechen beieinander – alles rein hypothetisch, versteht sich. Leider ist die Zeit fast um. Ich bedanke mich bei allen Anrufern und unseren Studiogästen für diesen amüsanten und informativen Ausflug in die Welt der Kriminalität. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, dann geht es um Kochrezepte und die Frage: Welche Gerichte kann man mit dem Bamberger Hörnla zubereiten?«
Ein Jingle wurde eingespielt. Brandeisen und Küps nahmen die Kopfhörer ab und tranken ihre Krüge aus. Die Moderatorin begleitete die beiden nach draußen.
»Möchten Sie noch eine paar Biere mitnehmen?«, fragte sie mit Blick auf die restlichen Flaschen, die am Empfang bereitstanden. »Wir haben noch Klosterbräu, Kaiserdom, Ambräusianum und Greifenklau.«
Küps nahm ein Greif, Brandeisen verzichtete, da er nicht gierig erscheinen wollte. »Die Stunde verging ja wie im Flug«, sagte er.
»Kein Wunder, bei so netten Gästen ...«, schmeichelte ihm die Moderatorin und überlegte, ob sie die unbezahlten Strafzettel ansprechen sollte, die sich bei ihr angesammelt hatten. Eigentlich war dafür das Straßenverkehrsamt zuständig, doch vielleicht konnte dieser verknöcherte Jurist trotzdem was drehen.
Der Aufnahmeleiter kam hinzu und bedankte sich ebenfalls. »Komische Namen hatten diese Anrufer«, wunderte er sich und grinste. »Malz, Rausch, Zapf ... Schon witzig, wie die Leute heißen. Hat jedenfalls super gepasst zum Thema Bier.«
»Stimmt«, pflichtete Küps ihm bei. »Und alle kamen aus derselben Gegend südlich von Bamberg. Zufall über Zufall.«
»In unserem Metier erlebt man die seltsamsten Sachen«, sagte Brandeisen. »Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, irgend so ein Schreiberling würde unsere Abenteuer erfinden. Aber die Wirklichkeit schlägt die Fantasie um Längen. Es gibt nichts, was es nicht gibt.«
Mit diesen Worten verabschiedete sich das Duo. Die Moderatorin versuchte noch, Brandeisen mit einer Reportage über die schönsten Höchststrafen, die er durchgesetzt hatte, zu ködern. Doch der winkte huldvoll ab. »Erscheint alles in meiner Autobiografie.« Sie blieb auf ihren Strafzetteln sitzen.
Eine Woche später blätterte Kommissar Küps im Fränkischen Tag, wie er es jeden Morgen tat, bevor er sich den rosa Pappordnern von der Staatsanwaltschaft zuwandte, die stets mit dem Vermerk »dringend« versehen waren, wenn sie von Brandeisen stammten. Seine bevorzugte Lektüre waren die Todesanzeigen. Wer war denn gestorben?
Nun besaß er zwar einen gesunden Respekt vor dem Sensenmann – man wusste ja nie, wann es einen selbst erwischte. Aber manchmal konnte er eine gewisse berufliche Befriedigung nicht verhehlen. »Wieder einer, der keinen Ärger mehr macht«, dachte er bei dem einen oder anderen polizeibekannten Kunden.
So auch bei Josef Schluck aus Höfen, einem Tunichtgut, dessen mehr schlecht als recht ausgeführte Straftaten der Bamberger Polizei seit Jahrzehnten auf die Nerven gegangen waren: Holzdiebstahl, Versetzung von Grenzsteinen, Rosstäuscherei, Zechbetrug, fortgesetztes Urinieren in die Aurach, Zerschmeißen von Bierflaschen auf der Hauptstraße und vieles mehr. Außerdem hatte Schluck seine Frau und seinen Sohn mit allerlei Marotten schier in den Wahnsinn getrieben. Seine Pantoffelsammlung, die er jedem Besucher vorführte, galt im Landkreis als viel belächeltes Kuriosum. Auch seine Tischmanieren und die Körperhygiene hatten gerüchteweise zu wünschen übrig gelassen.
Küps strich die Zeitungsseiten glatt. Viel zu früh, hieß es in dem schwarzumrandeten Kasten, sei der geliebte Ehemann, Vater und Freund aus dem Leben geschieden. Die Hinterbliebenen hatten ihm zu Ehren ein Gedicht verfasst:
Sein letztes Spiel war ein Solo Rot,
Jetzt ist der Sepper tot.
Das Herz, es wollt nicht mehr,
Sein Krug war auch schon leer.
Vom Himmel noch ertönt sein Schrei:
»Schütt’s nei, schütt’s nei!«
Ein würdiger Nachruf. Der Kommissar mochte Reime – bei so viel Ungereimtem in der Welt.
Das Telefon klingelte.
»Haben Sie’s schon gelesen?«, fragte Brandeisen. »Schluck ist hinüber.«
»Endlich sind wir den Burschen los.«
»Ich habe ja nichts gegen Volksdichtung. Aber dieses Versmaß ... entsetzlich!«
»Höfen ...«, überlegte Küps. »Das liegt doch genau zwischen Waizendorf, Pettstadt und Obergreuth.«
»Und?«
»Erinnern Sie sich an die drei Anrufer in der Radiosendung?«
»Glauben Sie, da gibt es eine Verbindung?«
»Alles passt zusammen«, sagte Küps. »Als ob die nach unserem Auftritt zur Tat geschritten wären. Frau Malz hat das Ganze ins Rollen gebracht. Herr Rausch hat das Bier und das Gift besorgt. Und Herr Zapf hat den armen Teufel beim Karteln abgelenkt. Die dämlichen Namen haben die sich auf die Schnelle einfallen lassen.«
»Verstehe ich das richtig?«, fragte Brandeisen. »Sie denken, wir hätten ein Mordtrio dazu inspiriert, diesen Nichtsnutz von Schluck ins Jenseits zu befördern?«
»Die haben uns ausgehorcht. Ohne uns wären die nie draufgekommen, wie man so was genau anstellt.« Küps stutzte. Langsam begriff er das Ausmaß der Folgen ihrer leichtsinnigen Radioplauderei. »Wenn’s blöd läuft, sind wir wegen Beihilfe dran. Ist Ihnen das klar?«
Stille in der Leitung. Es war förmlich zu hören, wie Brandeisens Gehirn arbeitete. »Ruhig Blut, mein Lieber. Sie müssen lernen, was es heißt, im Rampenlicht zu stehen. Prominente wie wir sind so etwas wie Vorbilder. Was können wir dafür, wenn niedere Geister Honig aus unserer Weisheit saugen?«
»Häh?«
»Hat der zuständige Arzt irgendetwas Irreguläres festgestellt?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Da haben Sie’s!«, jubelte Brandeisen erleichtert. »Was diesen Schluck betrifft, würde ich also sagen: fort mit Schaden.«
»Keine Ermittlung?«
»Lassen wir die Toten ruhen. Ist das nicht einer Ihrer Schafkopfsprüche?«
»Das bedeutet, man darf keine älteren Stiche als den letzten anschauen«, erklärte Küps.
»Schlucks letztes Spiel war ein Herzsolo. In diesem Sinne ...«
1 »Solo für den Staatsanwalt« in: Fünf Leichen zu viel. Brandeisen & Küps ermitteln
Genug ist genug
Die Totenglocke auf dem Mühlendorfer Friedhof schickte ein monotones Bimm, bimm in den wolkenverhangenen Dezemberhimmel. Es war der Samstag vor dem zweiten Advent, und es regnete, unablässig und ergiebig, als wollten unbekannte Mächte das Begräbnis, schon bevor es vollzogen war, in die feuchten Tücher des Vergessens hüllen. Sogar die Krähen schwiegen.
Fred Dennert trat seine letzte Reise an. Er war vielleicht der unbeachtetste Schriftsteller Frankens, eines Landstrichs, der mit verhinderten, mit verkannten und vor allem sich verkannt fühlenden Autorinnen und Autoren reich gesegnet war. Außer dem Priester folgten nur wenige Trauergäste dem Sarg.
Da waren die Kartelbrüder des Verblichenen, drei an der Zahl. An jedem Samstagabend hatte er mit ihnen Schafkopf gespielt. Nicht wegen des geselligen Miteinanders, sondern um auf dem Fluss seines ereignislosen Lebens zumindest einmal in der Woche eine Insel der Unwägbarkeit anzulaufen. Einer Unwägbarkeit freilich, die in engen Bahnen verlief, da der Gewinn oder Verlust eines Schellen-Solos nicht gerade über Leben und Tod entschied.
Dennerts Zugehfrau, die für das schwere Geläuf die falschen Schuhe trug und mit ihren Lackpumps bei jedem Schritt im aufgeweichten Boden stecken blieb, war es nie gelungen, die Beziehung zu ihrem Arbeitgeber zu vertiefen. Stets hatte er ihr gegenüber die Haltung eines wenn auch liebenswürdigen, so doch distanzierten Schrats bewahrt. Dies hatte sie ihm nicht übel genommen, da sie wusste, welch imaginären Geliebten er in Wahrheit verfallen war: der Kunst und ihrer launenhaften Schwester, der Inspiration.
Staatsanwalt Brandeisen begrüßte es sehr, dass er einen ausladenden, handgefertigten Regenschirm der Londoner Firma James Ince & Sons mit sich führte. Als einziger Freund Dennerts, den er noch aus der Gymnasialzeit kannte und zum Zwecke geistreicher Konversation einmal im Monat in Mühlendorf besucht hatte, hielt er die Grabrede.
Dennert war nichts näher, nichts höher gestanden als das Schreiben. Keine Ablenkung hatte er geduldet, weder durch die Bande zwischenmenschlicher Liebe noch durch die Aufnahme einer wissenschaftlichen Karriere. Stattdessen war er in das »Bleistiftgebiet« vorgedrungen, in dem schon der Schweizer Autor Robert Walser sein Dasein zugebracht hatte, wenn auch überwiegend in der Obhut geschlossener Anstalten. Doch Walser hatte ein gedrucktes Œuvre hinterlassen, das nach seinem Tod in die Geschichte eingegangen war.
Anders Dennert. »Unser lieber Fred«, führte Brandeisen aus, »schrieb seit seinem Abitur jedes Jahr einen Roman, ohne dass eine Menschenseele davon erfuhr. Abgesehen von mir, der ich die Ehre hatte, die Manuskripte kritisch zu kommentieren, kennt die Welt keine einzige Zeile aus seiner Hand. Er hinterlässt dreißig Romane, die er jedoch unter keinen Umständen publiziert sehen wollte. Er schrieb für niemanden. Sobald er ein Manuskript für beendet erklärte, wollte er schon nichts mehr davon wissen. Nichts lag ihm ferner als konventioneller Ruhm, den er – wie schon Balzac – für ein Gift hielt, das der Mensch, wenn überhaupt, nur in kleinen Dosen verträgt.«
Brandeisen machte eine Pause. Es war still auf dem kleinen Friedhof am Rande des Dorfes. Kein Auto fuhr, niemand zeigte sich auf der regennassen Straße.
»Aus Ihren gespannten Gesichtern schließe ich, dass Sie mehr hören wollen«, fuhr der Staatsanwalt fort. »Erlauben Sie mir, die Verdienste des Toten zumindest einmal zu würdigen und mich posthum vor Dennerts Genius zu verbeugen, obwohl er darauf bestimmt keinen Wert gelegt hätte. Seine künstlerische Leistung bestand in einem großen Thema, das er unermüdlich beackerte wie der brave Landmann die Scholle. Jeder seiner Romane spielte am Weihnachtsabend.«
Brandeisen schaute in die durchnässte Runde. Leider zeigte keiner der Anwesenden eine Reaktion auf diese Enthüllung. »Etwas unspektakulär, werden Sie jetzt vielleicht sagen und befürchten, dass Dennert zu sentimentalen Anwandlungen neigte. Weit gefehlt, denn er machte sich nichts Geringeres zur lebenslangen Aufgabe, als die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens nachzuerzählen.«
Ein weiterer prüfender Blick auf Priester, Kartelbrüder und Zugehfrau, die wie Erstklässler wirkten, denen man die Relativitätstheorie erläuterte. Hier war wohl Aufklärung vonnöten.
»Bestimmt kennen Sie A Christmas Carol. Ein alter Geizhals namens Scrooge erhält in einer Nacht Besuch von seinem verstorbenen Teilhaber sowie von drei weiteren Geistern, die ihn schließlich dazu bringen, sein Leben zu ändern. Das klingt beschaulich und sozialkritisch, typisch für Dickens – doch was machte Dennert daraus? Er variierte den Stoff. Am Anfang seines Schaffens verwandelte er die Weihnachtsgeschichte in ein existenzialistisches Drama à la Beckett: Der Geizhals wartet auf die Geister, aber keiner erscheint. Als Nächstes wandte sich Dennert dem nouveau roman zu und beschrieb alle Details ausführlichst, während er die Geister als unnatürliche und daher unbeschreibbare Phänomene wegließ. In seinem dritten Roman stellen dann auf einmal alle Geister Nazis dar und treten in SS-Uniformen auf – eine Reminiszenz an das deutsche Regietheater der 1970er- und 1980er-Jahre. Daraufhin hielt sich Dennert eine Zeit lang an die Klassiker: Scrooge stirbt nach einem Fechtduell durch einen vergifteten Schürhaken – Hamlet. Scrooge geht einen Pakt mit dem Teufel ein und verführt das Zimmermädchen – Faust.«
Brandeisen hielt inne. Seine Zuhörerschaft machte mittlerweile einen recht angeschlagenen Eindruck, wie sie da vor dem frisch ausgehobenen Grab stand und zum Aurachtal hinunterstierte.
Der Staatsanwalt redete weiter. »Anfang der 1990er-Jahre entschloss sich Dennert, seine Kunst auf die Genres Science Fiction und Fantasy auszuweiten. Also wurde Scrooge von Außerirdischen entführt und kämpfte gegen allerlei dunkle Weltenherrscher. Schlussendlich entdeckte Dennert den Krimi und zeichnete Scrooge als schräge Ermittlerfigur, die ungeklärte Fälle löst.«
Der Geruch frisch aufgeworfenen Erdreichs vermischte sich mit Weihrauchschwaden. Unvermittelt spendete der Priester Applaus, was Brandeisen als Aufforderung verstand, zum Schluss zu gelangen.
»So viel zum Werk von Fred Dennert«, sagte er. »Doch als tragisch – und auch als metaphorisch – erweist sich die Tatsache, dass er beim Auswechseln einer Glühbirne starb. Er brach sich das Genick, nur wenige Tage nach seinem 50. Geburtstag, als er aus ungeklärter Ursache von einer handelsüblichen Trittleiter fiel. War es die Trittleiter der Erkenntnis, auf deren oberster Stufe er ins Straucheln geriet? Oder ereilte ihn einfach nur ein Schwächeanfall während einer aufopferungsvollen Nacht im Bergwerk der Fantasie? Möge er in Frieden ruhen.«
Brandeisen holte A Christmas Carol aus der Manteltasche. Er warf das Buch auf den Sarg, schaufelte Erde darauf und trat zur Seite, damit die anderen Trauergäste Gelegenheit zum letzten Abschied bekamen.
Während er so sinnierte über die Fallstricke des schnöden Alltags, hörte er nahebei Motorengeräusche. Ein schwerer Geländewagen, zuvor in Parkposition abgestellt, setzte sich mit pietätlos hoher Drehzahl Richtung Ortsmitte in Bewegung. Brandeisen versuchte, das Kennzeichen zu entziffern, aber die Sicht war durch den Regen stark eingeschränkt.
»Wissen Sie, wer das war?«, fragte er den Priester.
»Wahrscheinlich irgendein junger Raser, der angeben will.«
»Kam mir etwas abrupt vor, dieser Kavalierstart, gerade nachdem ich meine Rede beendet hatte. So etwas gehört sich nicht.«
Der Geistliche zuckte mit den Schultern. »Jedenfalls hochinteressant, was Sie da über Fred Dennert erzählt haben. Ich hatte ja keine Ahnung ...«
Im Schutz des schwimmbadähnlich verfliesten Friedhofskirchenvorbaus unterhielt sich der Staatsanwalt noch eine Weile mit den Trauernden. Die Zugehfrau überreichte ihm den Hausschlüssel zu Dennerts Bungalow. Sie hatte die Leiche vor einer Woche gefunden und den Notarzt verständigt. »Tod durch Bruch des Fortsatzes des zweiten Halswirbels (Axis) und Zerstörung des Atemzentrums« lautete der Obduktionsbefund.
Brandeisen dankte allen für die Anteilnahme und fuhr zurück nach Bamberg, um seiner Sekretärin ein paar saftige Anklageschriften zu diktieren. Trauerfälle im Freundeskreis machten ihn immer ein wenig ungnädig. Außerdem nahte das Wochenende, bis dahin wollte er das lästige business as usual vom Tisch haben. Er hatte nämlich eine wahre Herkulesaufgabe vor sich: Freds literarischen Nachlass zu sichten und zu ordnen.
Am nächsten Morgen schlug er den Fränkischen Tag auf und staunte nicht schlecht: Im Bamberg-Land-Teil der Zeitung erschien ein Nachruf auf Dennert, freilich nur ein Einspalter ohne Bild, aber immerhin. Offenbar hatte der Priester nach Brandeisens Grabrede ein paar Zeilen an die Presse gegeben. Das wäre Fred zwar nicht recht gewesen, hatte er doch in die Grube fahren wollen, ohne einen Fußabdruck in der Lokalhistorie zu hinterlassen. Doch Perfektion war etwas für Oberlehrer und Psychopathen, fand Brandeisen und machte sich auf den Weg nach Mühlendorf.
Es war ungewöhnlich still am Ende der kleinen Nebenstraße. Über den angrenzenden Äckern hingen Nebelschwaden. Mit klopfendem Herzen betrat Brandeisen Dennerts Haus, ein in den 1960er-Jahren erbautes Flachdachgebäude im Stile des Kanzlerbungalows in Bonn. Die Inneneinrichtung war der klassischen Moderne verpflichtet, viel Glas, Stahl und rechte Winkel. Brandeisen ging ins Arbeitszimmer. Dort befanden sich ein Schreibtisch mit einem Laptop darauf und hohe Bücherregale, nach dem Abtransport der Leiche war nichts verändert worden. Der Hebel der Terrassentür war wie immer nach unten gedrückt, sodass man von außen jederzeit eintreten konnte – eine Nachlässigkeit, die er Fred häufig zum Vorwurf gemacht hatte. In der Mitte des Raumes unter einer halbkugelförmigen Deckenleuchte stand die fatale Trittleiter.
Andächtig verharrte er eine Weile. Kontemplative Strenge und Reduktion herrschten hier, die Einsamkeit einer Dichterklause. Dann nahm Brandeisen auf Freds Drehstuhl Platz und startete den Computer.
Es fühlte sich ein bisschen seltsam an, darauf zu warten, dass die Technik gleichsam ein ganzes Lebenswerk preisgab. Nichts wussten Prozessoren und Schaltkreise von den Geistesanstrengungen, die der prosaischen Tipperei vorausgegangen waren.
Brandeisen fragte sich, wie am besten zu verfahren sei. Sollte er es Max Brod gleichtun, der Kafkas Schriften gegen dessen Willen posthum herausgegeben hatte? Oder war seine Aufgabe die eines Konservators, der einfach nur den Bestand sicherte? Er konnte sich auch für einen Mittelweg entscheiden, alles auf einer externen Festplatte speichern und dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach schicken. Oder er löschte sämtliche Texte unwiderruflich. Wäre das nicht am ehesten im Sinne seines toten Freundes?
Brandeisen verschaffte sich im Dateimanager einen Überblick. Schon bald kam er zu einem überraschenden Schluss: Es gab gar nichts zu ordnen. Fred war eine Art Zen-Meister der Selbstorganisation gewesen. Manuskripte, Vorstudien, Exposés, Recherchefrüchte – alles war fein säuberlich auf Verzeichnisse und Unterverzeichnisse verteilt und leicht nachvollziehbar gegliedert. Die Endfassungen der Romane schienen druckreif zu sein.
Für einen Lektor auf der Suche nach dem nächsten Bestseller musste dieses Vermächtnis eine wahre Schatzkiste darstellen: freie Auswahl für jede erdenkliche literarische Mode, die gerade die höchsten Verkaufszahlen versprach. Brandeisen stieß sogar auf einen frühen erotischen Thriller, Scrooge als Casanova – nur Fred konnte auf so etwas kommen.
Dann fiel sein Blick auf das E-Mail-Postfach. Erneut schlug ihm das Gewissen. Durfte er auch in private Mitteilungen Einsicht nehmen?
Nach ein paar Mausklicks wurde er eines Besseren belehrt. Auch Briefe gehörten zum Werk eines Schriftstellers. Vor allem mit Kollegen aus der Region führte sein Freund rege Korrespondenzen ...