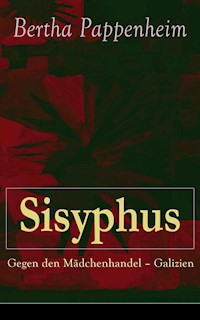
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Dieses eBook: "Sisyphus: Gegen den Mädchenhandel - Galizien" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Bertha Pappenheim (1859-1936) war eine österreichische Frauenrechtlerin. Sie war Gründerin des Jüdischen Frauenbundes. Bekannt wurde sie darüber hinaus als Patientin Anna O. Die von Josef Breuer zusammen mit Sigmund Freud in den Studien über Hysterie veröffentlichte Fallgeschichte war für Freud Ausgangspunkt für die Entwicklung seiner Theorie der Hysterie und damit der Psychoanalyse. Der Schwerpunkt ihrer Schriften lag aber auf der Aufklärung, insbesondere über die soziale Situation jüdischer Flüchtlinge und den Mädchenhandel. 1930 publizierte sie ihr bekanntestes Buch, die Sisyphus-Arbeit, eine Studie über Mädchenhandel und Prostitution in Osteuropa und dem Orient. Aus dem Buch: "Viele Fehler, mancher Fehltritt, solche, die gut zu machen sind und solche, die nie mehr ungeschehen gemacht werden können, erklären sich aus diesem unklaren und doch so berechtigten Wunsche nach einem Eigenleben in irgend einer Form." Inhalt: Die "Immoralität der Galizianerinnen" Die sozialen Grundlagen der Sittlichkeitsfrage Zur Lage der jüdischen Bevölkerung in Galizien. Reiseeindrücke und Vorschläge zur Besserung der Verhältnisse Zur Sittlichkeitsfrage Zustände in Galizien Der jüdische Frauenbund und die Königin von Rumänien Über die Verantwortung der jüdischen Frau Reise-Eindrücke von einer Orient-Reise Reisebriefe aus Galizien, Polen und Rußland Die weibliche Großstadtjugend Das Interesse der Juden an der Bekämpfung des Mädchenhandels Entwurf eines Internationalen Flugblattes Schutz der Frauen und Mädchen. Das Problem in allen Zeiten und Ländern Jüdische Teilnehmer am Weltkongreß gegen Unsittlichkeit International-jüdische Frauen- Mädchen- und Kinderschutzarbeit Gibt es einen Mädchenhandel? Gefährdeten-Fürsorge
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sisyphus: Gegen den Mädchenhandel - Galizien
Eine Studie über Mädchenhandel und Prostitution in Osteuropa und dem Orient
Inhaltsverzeichnis
Das Wort Mädchenhandel ist eigentlich nicht richtig. Handeln kann man mit einem Huhn oder mit Stiefeln. Es ist eben nicht ein Verkauf in dieser Form. Wir müssen uns vielmehr fragen: Welches sind die entsetzlichen Möglichkeiten, die junge Mädchen dem Dirnentum zuführen?
Bertha Pappenheim
Die »Immoralität der Galizianerinnen«
Sie sprachen und sprechen von der »Immoralität der Galizianerinnen«, als ob das eine ganz exceptionelle für sich bestehende Abnormität einer besonderen Menschenklasse wäre. Ja, wissen die Herren nicht oder wollen sie es nicht wissen, daß unter den deutschen, hier heimatberechtigten jüdischen Mädchen dasselbe Sinken des moralischen Niveaus zu bemerken ist – dasselbe Sinken wie unter allen Mädchen, die durch die bestehenden sozialen Verhältnisse moralisch haltloser und schwächer geworden sind? Einst war es ein unerhörtes Ereignis, wenn ein jüdisches Mädchen außerehelich ein Kind gebar, – ein Ereignis, das so wie die Abtrünnigkeit vom Glauben, die Taufe einen Romanen- oder Novellenstoff bildete. Heute sind das gar nicht seltene, sondern sehr oft wiederkehrende Fälle.
Die Sittlichkeit der jüdischen Frauen und Mädchen, dieser Pfeiler, auf dem die unauslöschliche Ausdauer und Regenerationskraft unseres Volkes beruht, sie ist tatsächlich bedroht – aber nicht von den Galizierinnen allein.
Die Herren sprachen auch in beiden Sitzungen von einer drohenden Gefahr, von Schutzmaßregeln, abwehrenden und vorbeugenden, den Galizierinnen gegenüber. Nach dem Grunde und der Ausdehnung des Übels fragte Niemand. Das ist aber kein guter Arzt, der die Symptome kurieren will und nicht nach Art und Sitz der Krankheit forscht.
Wenn man sich nun die Mühe gibt, so im allgemeinen nach der Ursache der zunehmenden Immoralität unter den Frauen und Mädchen zu forschen, dann lautet die Antwort der Geistlichen aller Konfessionen meist: es ist der Mangel an Frömmigkeit. Im ersten Augenblick erscheint der Grund auch stichhaltig. Bei näherem Zusehen aber kann man erkennen, daß es die reaktionäre Partei ist, die unter dem Ruf nach Sittlichkeit die persönliche und Glaubensfreiheit unterdrückt, um ihre Privat-, ihre politischen und Spezialinteressen dabei zu verfolgen. Sehr augenfällige Erscheinungen, die von den Bekennern strengster Observanz in allen Konfessionen nicht geleugnet werden können, sprechen dagegen, daß die abnehmende »Frömmigkeit« die zunehmende Immoralität bedingt. Und so sehen wir denn auch, daß Galizien, das Reservoir der jüdischen Orthodoxie, seit vielen Jahren an Ungarn, Rumänien, London und viele Städte Amerikas einen bedeutenden Teil ihres Bedarfs an Mädchen »liefert«. Die Frömmigkeit, wie sie die orthodoxe Geistlichkeit verlangt, scheint nach dieser Richtung hin kraftlos zu sein und machtlos bleibt auch ihr Einfluß in den Asylen und Magdalenenhäusern, die mit ihren Besserungsversuchen recht klägliche Resultate aufweisen.
Ein einziges Haus in Chicago, das sich die Rettung gefallener jüdischer Mädchen ohne jeden religiösen Zwang zur Aufgabe macht, hat relativ den anderen confessionellen Einrichtungen gegenüber bessere Resultate. Als zweiten Grund nach der landläufigen Auffassung nennen die Herren – die Damen in ihrer behaglichen Indolenz befassen sich mit so schmutzigen Dingen nicht – also die Herren in ihrer patentierten Logik sagen: »Die Mädchen sind schlecht, weil sie schlecht sind.«
Nun, das ist einfach nicht wahr. Daß es viele zügellose, schlechte Elemente in der Gesellschaft gibt, und wenn nicht energisch dagegen gearbeitet wird, späterhin noch viel mehr geben wird, ist wahr. Aber die Mädchen, die heute schlecht sind, sind schlecht, weil die Gesellschaft sie schlecht werden ließ und ihnen, so lange sie schwankten, so lange sie auf der Scheide zwischen gut und schlecht standen, nicht half, gut zu werden.
Unter helfen verstehe ich natürlich keine Hilfe im Sinne von Wohltätigkeit, sondern ich verstehe darunter: Rat, Schutz, Förderung und das Zugeständnis aller rechtlichen und politischen Mittel, deren jeder Mensch, Mann und Frau, zur Aufrechterhaltung seiner physischen und sittlichen Existenz bedarf. Verfolgen Sie doch einmal den Lebenslauf eines solchen Geschöpfes, über das die satte ungeprüfte Wohltätigkeit den Stab bricht (Fälle, in denen übermäßige Wohltätigkeit ganze Familien üppig und träge macht, nehme ich natürlich aus). Ein Mädchen, gleichviel ob es in Whitechapel, in einem Hinterhaus in Berlin oder in einem galizischen Dorfe ist, kommt zur Welt. Erlassen Sie es mir, Ihnen das Milieu zu schildern. Körperlich ungepflegt nehmen die Sinne nur Wahrnehmungen auf, die der gesunden Entwicklung des Kindes nach jeder Richtung hinderlich sind. Die Schlafräume sind überfüllt, und das Ringen zur Existenz und um die Existenz spielt sich als einziger Lebensinhalt vor dem Kinde ab. Auch wie es um Unterricht und Ausbildung, um Erziehung und Beaufsichtigung bestellt ist, wissen Sie. – Alles ungenügend im Verhältnis zu den Anforderungen, die das Leben späterhin unweigerlich stellt. Was der Staat in Deutschland bietet, ist der Schulzwang bis zum 14. Lebensjahre. Daß in diesem Alter ein Mädchen geistig reif zur Selbstbestimmung und erwerbsfähig sein kann, wird niemand ernstlich behaupten können, und doch ist mit dem zurückgelegten 14. Lebensjahre gesetzlich das Schutzalter für Mädchen überschritten und in vielen tausend Fällen tritt mit demselben Augenblick auch die Notwendigkeit des Broterwerbes an das Mädchen heran. Aber nehmen Sie auch die günstigeren Fälle an, in denen den Mädchen eine Lehrzeit zugestanden wird als Näherin, Schneiderin, Modistin, Ladnerin etc. etc., auf allen Erwerbsgebieten, von der Fabrikarbeiterin bis zur Lehrerin und Beamtin, ist die Arbeit der Frau bei gleicher Leistung noch schlechter bezahlt als die des Mannes. Es gibt Lohnsätze und Gehälter, die geradezu empörend sind. Wenn nun ein nach jeder Richtung schwaches, mangelhaft erzogenes, ungenügend vorgebildetes Mädchen bemerkt und erfährt, daß es einen Erwerb gibt, der ihr mühelos ein sorgloses, bequemes Dasein unter verlockenden Äußerlichkeiten bietet, da ist es nur zu begreiflich, ja entschuldbar, wenn sie das Martyrium der Anständigkeit nicht länger auf sich ladet.
Für die galizischen Mädchen liegen die Verhältnisse noch schlechter. In Galizien gibt es keinen Schulzwang. Die Mädchen, nicht nur sozial, sondern auch religiös minderwertiger als die Knaben, dürfen zwar in die Schule gehen, es geschieht aber nur sehr unregelmäßig, und soweit überhaupt von Unterricht die Rede sein kann, ist er ganz planlos. Dazu kommt noch, daß die Mädchen im Kindesalter schon verlobt werden. Empfinden sie dann heranwachsend einen Widerwillen gegen den ihnen bestimmten Mann, dann nehmen sie entweder die Zuflucht zur Taufe, oder sie laufen in die weite Welt, um endlich auf illegalem Wege demselben Schicksal zu verfallen, dem unter legaler Form sie zu entrinnen hofften.
Was ich ihnen bis jetzt in allerdings nur sehr flüchtigen Strichen zu zeichnen versuchte, ist die soziale Begründung jener Erscheinungen, die als »zunehmende Immoralität« die Veranlassung zu vielfachen Erwägungen gibt. Vielleicht haben sie zwischen meinen Erörterungen die verzweigten Wurzeln der Frauenfrage gesehen, vielleicht auch in dämmriger Ferne die Ziele der Frauenbewegung.
Die extremsten Erscheinungen, die stellenweise auf der Oberfläche des Gemeinlebens erscheinen, erschrecken zum Glück auch wohlmeinende Männer. Sie sehen und erkennen die Größe der Gefahr, die die Häufung dieser Erscheinungen für die Gesamtheit ergibt, und aus ihren Reihen erwachsen den Frauen und ihren Bestrebungen heute schon eine recht stattliche Zahl von Mitarbeitern, allerdings meist nur so weit es sich um gewisse äußere Reformen handelt.
Der Zusammenhang der Sittlichkeitsfrage mit der Wohnungsfrage, mit der Lohnfrage, mit der Erziehungsfrage ist ja leicht zu fassen.
Aber wenn man sich in der Behandlung der Sittlichkeitsfrage nur auf diese äußeren Reformen beschränkt und dabei auf dem Standpunkt der doppelten Moral stehen bleibt, dann wird man fortfahren, die Krankheit zu verschleppen. Die Herren des Israelitischen Hilfsvereins sind nicht die ersten und nicht die einzigen, denen die zunehmende Prostitution unter den Mädchen bedenklich erscheint. Und wie aus ihrer Mitte kürzlich lakonisch der Rat erteilt wurde: »Fort mit dem Gesindel«, so ist auch diese, allerdings nicht sehr weitherzige Auffassung, keine vereinzelte. Merkwürdig ist nur, daß seitens der Männer, selbst kaufmännisch gebildeter, das Gesetz von Angebot und Nachfrage zur Durchleuchtung dieser Sache keine Anwendung findet.
Diese jüdischen Hausierinnen und Artistinnen, die Kellnerinnen, die Ladnerinnen, Modistinnen, Probiermamsellen, Balletteusen und Choristinnen, ja, sie verkaufen sich. »Man« ist sittlich entrüstet darüber – aber könnten sie sich denn verkaufen, wenn keine Käufer da wären? Die furchtbare Ungerechtigkeit liegt eben darin, daß, wenn zwei Menschen gemeinsam ein Verbrechen begehen, dem einen von ihnen alle Schuld beigemessen wird, während der andere in den Augen der Welt als makellos gilt. Ich sage absichtlich: in den Augen der Welt makellos, denn straflos nach den unwandelbaren Naturgesetzen geschieht es ja nicht.
Die sozialen Grundlagen der Sittlichkeitsfrage
Wenn ich zu dem durch mein Thema bezeichneten Problem das Wort ergreife, so geschieht es nicht, um eine Lösung der Frage in dem Sinne, der so oft zum Mittelpunkt der Sittlichkeitsfrage gemacht wird, zu versuchen, nämlich ob die Reglementierung, ob die Aufhebung der sittenpolizeilichen Maßregeln geeigneter sei, gewisse verderbliche Erscheinungen unseres Gesellschaftslebens zurückzuhalten. In dieser Frage dürften nur Fachleute eine volle Kompetenz beanspruchen.
Ich gedenke sie zu betrachten von dem Standpunkte meines Faches und Berufes als Frau, jenes Berufes, der uns allen die Pflicht auferlegt, sich nach Kraft und Gelegenheit in den Dienst der Gesamtheit zu stellen.
Es ist durch viele, dem Thema der Sittlichkeitsfrage anhaftende Details begreiflich und erklärlich, daß eine teils angeborene, teils anerzogene Scheu besteht, sich mit ihr zu beschäftigen, oder sie gar öffentlich zur Sprache zu bringen. Ich selbst habe in meiner Bildung als »höhere Tochter« und im Sinne von Gabriele Reuter1 »aus guter Familie« alle Phasen dieser Scheu in mir selbst durchlebt. Ich weiß, daß es zwischen den Momenten naiven Erstaunens und entsetzten Begreifens eine lange Stufenleiter quälender und bedrückender Empfindungen giebt, die man wohl in seinem ganzen Leben nicht los wird. Hat man sich aber erst klar gemacht, daß es Verhältnisse und Vorkommnisse giebt, deren Erwähnung moralisch empfindende Menschen, auch wenn sie verheiratet sind, höchst peinlich berührt, dann ist der Schluß doch nahe, welch furchtbare Kämpfe gegen Scham, Schande und Erniedrigung von vielen Tausenden menschlicher Geschöpfe durchgefochten werden, ehe sie so »gesunken« sind, daß andere ein Recht zu haben glauben, heuchlerisch über sie zu schweigen.
Was zu denken uns peinlich, was vorzustellen uns schaurig ist, das wollen wir andere erleben lassen, gleichmütig, ruhig?
Ich glaube, wenn die Sittlichkeitsfrage nichts andres bedeuten würde, als jenen moralischen Kampf des einzelnen, dessen eventuelles Unterliegen weiter keine Bedeutung für die Gesamtheit hätte, – auch dann wäre es grausam, dem Ringen und langsamen Sinken von Menschen mit Achselzucken zuzusehen.
Aber die Prostitution als moralisches Siechtum oder Tod des einzelnen Individuums ist nicht die Sittlichkeitsfrage. Sie ist nur ein furchtbares Symptom dafür, daß es soziale Verhältnisse giebt, die solche antisoziale Folgeerscheinungen hervorbringen und fördern.
Einblick in diese antisozialen Folgeerscheinungen können wir bei verschiedenen Gelegenheiten erwerben. In krasser Deutlichkeit z.B. können wir sie erkennen, wenn wir Zahlen lesen, wie sie die Statistik aus Polizeilisten und Krankenkassen veröffentlicht. Wir erschrecken, wir denken, der Druckfehlerteufel habe mit den Nullen gespielt und einige zu viel hingestreut. Aber nein, die Zahlen sind richtig; die Zahlen verfolgen uns. Nach und nach gewinnen sie an Bedeutung, sie illustrieren sich gleichsam mit Bildern des Jammers und des Elends, körperlichen und geistigen Verfalls, und gerade auf dem Boden der Scheu vor jener vielgestaltigen Verkommenheit wächst unaufhaltsam, übermächtig das Mitleid empor.
Kein schwächliches Mitleid, das seufzt und sich abwendet, sondern ein Mitleid, das hört und sieht mit Herz und Verstand, und das die Scheu überwindet, wo es nötig ist und zu tapferer Arbeits- und Hilfsbereitschaft wird. Derartige Vorgänge erleben viele in sich selbst. Sie können sich ohne alle Sentimentalität heftig oder weniger heftig bemerkbar machen. Je nach der Individualität zeigen sie sich mehr nach der Gefühls- oder nach der Verstandesseite betont. Man kann diese Vorgänge als das Erwachen des sozialen Gewissens bezeichnen.
Eigentümlich ist, daß die Frage, die das erwachte soziale Gewissen eindringlich und unabweislich stellt, die soziale Frage, nicht durchgängig als wichtigste Gesamt-Interessenfrage, als Menschheitsfrage, aufgefaßt wird, sondern daß sie, in Teilfragen aufgelöst, häufig zu einem Kampf zwischen Mann und Frau verflacht. Durch Streitigkeiten und kleinliches Geplänkel auf dem Wege wird das Ziel, die Förderung der Gesamtheit, oft ganz vergessen. Diese Hemmungen kann man besonders deutlich auf der ganzen Linie der Frauenfrage beobachten, in der männlichen Opposition gegen Frauenerwerb, Frauenstudium, politische und kommunale Rechte der Frau.
Nun bestehen ja, soweit sich die Opposition auf dem Boden der Konkurrenz und des Broterwerbs bewegt, Scheingründe, die den männlichen Interessenten und den Kurzsichtigen unter den Unbeteiligten noch lange als stichhaltig gelten werden. Und wenn z.B. ein Arzt die Ärztin als Konkurrentin fürchtet, so kann ich mir Verhältnisse für den einzelnen im Existenzkampf denken, die dem Manne das Frauenstudium als gefährlich oder gar verderblich erscheinen lassen. Es gehört eben schon eine gewisse Abstraktionsfähigkeit, unterstützt von äußerer Unabhängigkeit, dazu, um den Wettbewerb der Geschlechter vom Standpunkte der Fortentwicklung des Geschlechtes als einen Vorteil anzuerkennen.
Anders verhält es sich auf dem Gebiete der Sittlichkeitsfrage als ethisches Moment. So wie es nur eine Wahrheit giebt, so giebt es nur eine Sittlichkeit. Wir nennen im Sinne der hier zu erörternden Frage »sittlich« jenes Thun oder Lassen, was vielleicht den einzelnen eine Überwindung oder ein Opfer kostet, aber der Allgemeinheit nützt. Wir nennen unsittlich, was vielleicht einzelnen ein Genuß oder eine Freude ist, aber der Allgemeinheit schadet. Da die Allgemeinheit eine untrennbare und unlösliche Interessengemeinschaft beider Geschlechter darstellt, so kann eine einseitig geschlechtliche Auffassung der Sittlichkeitsfrage niemals logisch oder gerecht sein.
Und so ist denn thatsächlich die zwiefältige Auffassung der Sittlichkeitsfrage die unter dem Kennwort der doppelten Moral landläufig geworden ist, eine der größten Ungerechtigkeiten, deren sich die Civilisation zu schämen hat.
Die Zunahme der »schlechten Krankheit«, wie in Rußland die verheerenden Folgeübel der Prostitution mit einem diskreten Sammelnamen bezeichnet werden sollen, ist die nächste Ursache für die Aufmerksamkeit, die man in Männnerkreisen der Sittlichkeit der Frauen und Mädchen zuwendet. – Zum Schutze der Männer! Man kann es leicht von frivolen Männern hören, daß es »um die Frauenzimmerchen nicht schade« sei, »die wollen es nicht besser«. Aber die Männer!
Bleibt zu beweisen, ob es alle nicht besser wollen oder ob nicht Tausende es teils nicht besser wissen, teils nicht besser können. Anschließend an diesen Gedankengang sehen wir nun in vielen Vereinen, Vorlesungen, ja sogar in Parlamenten Männer über die zunehmende Immoralität der Frauen und Mädchen sprechen und beraten. Ich glaube, daß die Zahl der gerechten und einsichtigen Männer, auch solcher, die mit ihrer Meinung an die Öffentlichkeit treten, im Wachsen begriffen ist. Aber es ist doch die Überzahl derer, die stolz darauf sind, »die Weiber« zu kennen, und die vielleicht nie einen Blick in das Geistes- und Gemütsleben eines normalen, ehrlichen Frauendaseins gethan haben, die das Urteil der denkfaulen Menge dirigieren. Und was sagen sie? Voll Indolenz, wie etwas Selbstverständliches, mit Mitleid oder Hohn, mit überlegenem Augenzwinkern, oder sattem Ekel wiederholen die Meister der Logik: die Mädchen sind schlecht, weil sie schlecht sind. Nun, das ist einfach nicht wahr. Daß es viele zügellose, schlechte Elemente in der Gesellschaft giebt, und wenn nicht energisch dagegen gearbeitet wird, späterhin noch viel mehr geben wird, ist wahr. Aber viele viele der Mädchen, die heute schlecht sind, sind schlecht, weil die Gesellschaft sie schlecht werden ließ und ihnen, so lange sie schwankten, so lange sie auf dem Scheidewege zwischen gut und schlecht standen, nicht half gut zu werden.
Unter Hilfe verstehe ich natürlich keine Hilfe im Sinne von Wohlthätigkeit, sondern ich verstehe darunter: Rat, Schutz und Förderung und das Zugeständnis aller rechtlichen und politischen Mittel, deren jeder Mensch, Mann und Frau, zur Aufrechterhaltung seiner physischen und sittlichen Existenz bedarf. Verfolge man doch einmal den Lebenslauf eines solchen Geschöpfes, über das die glatte, ungeprüfte Wohlanständigkeit den Stab bricht. Ein Mädchen, gleichviel, wo es auf die Welt kommt, ob in einem Hinterhause in Berlin, oder in einem Fabrikviertel in London, oder in einem Ghetto in Galizien – das Charakteristische des Milieus ist überall dasselbe. Körperlich ungepflegt, nimmt das Kind nur Wahrnehmungen auf, die seiner gesunden Entwicklung nach jeder Richtung hinderlich sind. Die Schlafräume sind überfüllt, und das Ringen zur Existenz und um die Existenz spielt sich als einziger Lebensinhalt vor dem Kinde ab. Auch wie es um Unterricht und Ausbildung, um Erziehung und Beaufsichtigung bestellt ist, wissen wir. Alles ungenügend im Verhältnis zu den Anforderungen, die das Leben später unweigerlich stellt. Was der Staat in Deutschland bietet, ist der Schulzwang bis zum 14. Jahre. Daß in diesem Alter ein Mädchen geistig reif zur Selbstbestimmung und erwerbsfähig sein kann, wird niemand ernstlich behaupten, und doch tritt in vielen tausend Fällen in diesem Augenblick die Notwendigkeit des Broterwerbes an das Mädchen heran. Aber man nehme auch die günstigeren Fälle, in denen den Mädchen eine Lehrzeit zugestanden wird, als Näherin, Schneiderin, Modistin, Ladnerin, etc., etc. Auf allen Erwerbsgebieten von der Fabrikarbeiterin bis zur Lehrerin und Beamtin ist die Arbeit der Frau bei gleicher Leistung noch schlechter bezahlt als die des Mannes. Es giebt Lohnsätze und Gehälter, die geradezu empörend sind. Wenn nun so ein nach jeder Richtung schwaches, mangelhaft erzogenes, ungenügend vorgebildetes Mädchen bemerkt und erfährt, daß es einen Erwerb giebt, der ihr mühelos ein sorgloses, bequemes Dasein unter verlockenden Äußerlichkeiten bietet, da ist es nur zu begreiflich, ja entschuldbar, wenn sie das Martyrium der Anständigkeit nicht länger auf sich lädt. Und so sehen wir denn die Kellnerinnen, die Ladnerinnen, die Modistinnen, die Probiermamsellen, Balletteusen und Choristinnen, wie sie sich verkaufen, leichteren oder schwereren Herzens verkaufen sie sich. »Man« ist sittlich entrüstet darüber – aber könnten sie sich denn verkaufen, wenn keine Käufer da wären?
Das ist eben die furchtbare Ungerechtigkeit, daß, wenn zwei Menschen gemeinsam ein Verbrechen begehen, dem einen von ihnen alle Schuld beigemessen wird, während der andre in den Augen der Welt als makellos gilt. Ich sage absichtlich: in den Augen der Welt makellos, denn straflos nach den unwandelbaren Naturgesetzen geschieht es ja nicht. Es ist unmöglich, hier eingehend über eine Frage zu sprechen, die alle Tiefen und Höhen menschlichen Seins berührt, die erschöpfend zu studieren ein Menschenleben ausfüllen kann und deren glückliche Lösung die Arbeit und das Streben von Jahrhunderten erfordern wird. Dennoch würde ich glauben, meine Aufgabe nur sehr ungenügend gelöst zu haben, wenn ich theoretisierend nicht auch einen Hinweis darauf bringen wollte, wo uns das erwachte soziale Gewissen ganz konkrete Arbeitsgebiete und Interessenkreise eröffnet und anweist, die scheinbar für sich bestehen, die aber, sowie man weiter in sie eindringt, ergeben, daß sie unlöslich untereinander verbunden und verschlungen sind.
Zwischen der Menge der Erscheinungen, die sich vielleicht erst bei genauerem Zusehen als schädlich erkennen lassen, liegt in die Augen springend die Wohnungsfrage.
Wer sich auch nur ganz oberflächlich mit Armenpflege beschäftigt hat und dadurch Gelegenheit fand, in die Wohnungen gänzlich Unbemittelter Einblick zu nehmen, wird bald zu der Überzeugung gelangen, daß alle theoretischen Erörterungen den bestehenden Mißständen gegenüber wertlos sind. Ob die schwindende Religiosität gekräftigt werden soll, ob Moralunterricht dafür eingesetzt wird – ob Predigt oder Bildung – so lange die Menschen durch ihre Wohnverhältnisse gezwungen sind, in Bezug auf Anstand und Feinfühligkeit hartschlägig zu werden, so lange trifft der Vorwurf der Verrohung nicht jene Klassen, die verrohen, sondern diejenigen Körperschaften, die nicht alles aufbieten, dieser Verrohung wirkungsvoll entgegenzutreten. Es giebt Wohnräume, um deren Tisch, wenn einer da wäre, sich nicht die Zahl ihrer Bewohner versammeln könnte, die sich nachts horizontal in die unmöglichsten Lagerstätten einpferchen müssen.
Vom subjektiven Standpunkte der Mieter, Aftermieter und Schläfer ist ihre heute vielleicht in vielen Fällen schon angeborene, der Mehrzahl nach durch Anpassung in das Unvermeidliche erworbene Hartschlägigkeit in Sachen des Anstandes ein Glück für sie zu nennen. Denn da eine Reihe von tierisch menschlichen Trieben und Äußerungen einfach nicht unterdrückt oder verleugnet werden können, so würde größere Feinfühligkeit in der Masse nur ein vermehrtes und vertieftes Unglücklichsein hervorrrufen.
Objektiv ist das zur Indolenz oder Roheit führende Abgestumpftsein in Dingen, die eine Stufenleiter bilden von Nichtachtung des Anstandsgefühls bis zur Verletzung der Sittlichkeit, aufs tiefste zu bedauern.
Denn die Gewohnheit hindert die Menschen, täglich und stündlich die obwaltenden Verhältnisse als unerträglich und unwürdig zu erkennen, und es schwindet ihnen damit der Anstoß und der Aufschwung, sie auf die eine oder andre Art verbessern zu wollen.
Diese engen, nach jeder Richtung ungenügenden Menschenwohnungen sind aber nicht nur im allgemeinsten Sinne gefährlich und ungesund, weil sie einem in der Selbstzucht sehr ungeübten Teile des Volkes in aufdringlichster Art die Gelegenheit geben, den Verkehr der Geschlechter verderblich zu gestalten. Sie sind auch deshalb ein Schaden für das Volk, weil sie den Begriff des Heims, des erstrebenswerten Aufenthaltes für die Familie, vernichten. Kein Raum, keine Luft, kein Licht, nach Feierabend kein Fürsichselbstbleiben der zusammengehörigen Familienglieder, geschweige denn Schmuck und Behagen im Wohnraum – woher soll da die Freude am Heim kommen? Was man nicht liebt, das pflegt man nicht, und was nicht gepflegt wird, geht zu Grunde – in diesem Falle Häuslichkeit und Familie.
Neben der Wohnungsfrage und sie an Wichtigkeit noch weit überragend steht die Lohnfrage. Da sie zu den heute meist besprochenen Angelegenheiten gehört und sie in ihrer ganzen Ausdehnung und Bedeutung hier doch nicht herangezogen werden kann, so sei mir gestattet, im Zusammenhange mit meinem Thema nur auf die ebenso bewunderns- wie beklagenswerten Lebenskünstler hinzuweisen, die mit den üblichen Löhnen auszukommen verstehen. Alleinstehende Mädchen und Burschen, die per Tag 1–1,20 Mark, Familienväter, die 3 Mark verdienen, gehören, soferne der Verdienst nur regelmäßig ist, schon zu den Gutsituierten. Und nun rechne man! Wöchentlich 18 Mark für den Lebensunterhalt einer Familie von durchschnittlich 6–8 Köpfen. Ich habe die Rechnung oft versucht, und das Resultat war auf dem Papier schon ein sehr beklemmendes. Nun bedenke man aber, wenn man die einzelnen Posten der Rechnung durchleben, oder richtiger gesagt, durchdarben muß am eigenen Leibe und am Leibe derer, die man liebt. Man sage nicht, daß die Gewohnheit des Entbehrens die Entbehrung leicht macht. Es giebt Dinge, die leicht zu entbehren man nicht gewöhnt sein darf, weil ihnen entsagen eine Herabsetzung und Herabwürdigung des Menschen bedeutet. Dazu kommt, daß Askese von der Natur nicht gewollt ist. Ein Aufgeben aller Genüsse, aller großen und kleinen, weisen und unweisen Freuden des Lebens im Berufe als Last- und Haustier wird nur von den wenigsten mit Bereitschaft geübt, und das furchtbare Wort von der »Prostitution als Aufbesserung des Lohnes« wird erklärlich. Das ganze Elend des KellnerinnenberufesKellnerinnenfrage und Dienstbotenfrage: Jeweils 30% der unehelichen Kinder stammen von Kellnerinnen bzw. weibl. Dienstboten. Beide Berufe sind die prädestiniertesten in der Vorstufe zur gewerblich registrierten Prostituierten. Für beide sucht Bertha Pappenheim ein ehrenhaftes Berufsbild durchzusetzen, das jungen Mädchen gestattet, sittlich ungefährdet ihren Lebensunterhalt zu verdienen Als Mitglied der Kellnerinnenkommission des ADF, die zum Ziel hat, das Kellnerinnengewerbe ihres anstößigen Charakters zu entkleiden, führte Bertha Pappenheim in Frankfurt a.M. eine Fragebogenaktion bei Frauen, die in Animierkneipen, Bars, Varietés, Wirtschaften, Kneipen, Restaurants, Café chantants u.a. tätig sind, durch, um auf der Basis dieses Materials eine Petition im Reichstag einzureichen mit ehrenamtlich tätigen Frauen aus der sozialen Hilfsarbeit. Welche Schwierigkeiten diese ehrenamtlich durchgeführte Enquête den Helferinnen machte, berichtet sie auf der X. Generalversammlung des ADF (2.-4. Okt. 1912) in Gotha. »Ich selbst muß sagen, daß ich es mir wohl überlegt habe: Wen können wir beauftragen, in dieses Lokal zu gehen, um eine wirkliche Beantwortung des Fragebogens zu bekommen? [ ...] Wir können es jungen Frauen nicht zumuten und auch den Männern dieser Frauen nicht, den Antrag entgegenzunehmen, daß die Frauen eine Enquete in den Animierkneipen, in den Varietés und dergleichen Räumen machen.« Aus diesem Grund stellt sie den Antrag für eine berufsmäßig durchgeführte Enquête. z.B., das moralische und physische Zugrundegehen von Hunderten von Mädchen, ist in Arbeitsbedingungen begründet, die ein Auskommen ohne sogenannten »unanständigen Nebenverdienst« so gut wie unmöglich machen.
Die schlechten Lohnverhältnisse sind aber nicht nur Grund dafür, daß die Mädchen sich selbst zur käuflichen Ware erniedrigen müssen, sie machen es auch den Männern vielfach unmöglich, eine legitime Eheschließung mit ihrer ganzen Gefolgschaft von Kosten und Verantwortung auf sich zu laden. Die Folge davon sind wilde Ehen, die Frauen und Kinder ganz der Willkür, dem Wohl- oder Übelwollen der Männer anheimstellen, und die, im Zusammenhang mit dem Sinken des sittlichen Gefühls von Mann und Frau, den Ausgangspunkt zu unsäglichem Jammer, Not und Herzeleid bilden.
Radikale Abwehr und Hilfe gegen Mißbräuche aller Art, wie sie die bestehenden Lohnverhältnisse mit sich bringen, kann nur die Organisation der Arbeit, das Zusammentreten der Arbeiter zur Gewerkschaft bieten.
Jedoch ist schon oft darauf hingewiesen worden, wie sehr in der Angelegenheit der Hungerlöhne die Frauen sowohl als Konsumenten wie als Arbeitgeber einen nachdrücklichen Einfluß zum Guten und Gerechten ausüben können. Freilich müssen sie, um diesen Einfluß thatsächlich auszuüben, beobachten, denken und urteilen lernen und den Blick weiten über die oft eng gesteckten Grenzpfähle der Häuslichkeit. Unbeschadet dieser Häuslichkeit würden viele Frauen dann zu der Einsicht kommen, daß es im Wettbewerb bei den Kaffeekränzchen ein höheres Interesse und einen höheren Ehrgeiz geben kann als den, der Putzfrau oder der Schneiderin 20 Pfennig Tagelohn weniger zu geben als die »unökonomische« Freundin oder Nachbarin.
Während die Behandlung der Lohnfrage und der Wohnungsfrage als Gegenstand der Bethätigung des einzelnen schon gewisse theoretische Voraussetzungen erfordert und Ergebnisse auf diesen Gebieten von Verhältnissen abhängen, die häufig von dem Wollen des einzelnen nicht direkt beeinflußt werden können, so finden wir dagegen in der Dienstbotenfrage3 einen großen Ausschnitt der Sittlichkeitsfrage, in der sehr oft die einzelnen Fälle von der Einsicht, dem Wohlwollen und dem Gerechtigkeitssinne einzelner Personen oder Familien abhängig sind.
Ich will in dem Augenblick von den Verbrechen der männlichen Familienglieder, die die Unerfahrenheit, Dummheit oder den Leichtsinn von Dienstmädchen nach ihrem Gefallen ausnützen, nicht sprechen, sondern nur von dem, was die Damen in liebelosem Aburteilen verpönen, von den »unsittlichen Verhältnissen« der Mädchen. In sehr vielen Fällen werden diese Verhältnisse nur dadurch zu unsittlichen, weil die Hausfrauen und Familienvorstände es nicht verstehen und es nicht der Mühe wert finden, sie durch Rat und That zu ganz sittlichen zu gestalten.
Und so frage ich denn, ist der Trieb, den die Natur zum Zwecke der Erhaltung der Art in alle Geschöpfe gepflanzt hat, in einem Mädchen zu verurteilen, weil es ein Dienstmädchen ist? Wenn ein Dienstmädchen nach dem terminus technicus der Frauen mit einem Gärtner, Diener oder Metzger anbändelt, weil sie im Innern vielleicht hofft, auf diesem Wege zu einer Verheiratung und Versorgung zu kommen, so thut sie genau dasselbe wie die Haustochter, die mit ihren Tennispartnern und Ballherren kokettiert. Nur mit dem Unterschied, daß dieselbe Frau auf die »Erfolge« der Tochter stolz ist, während sie die Erfolge des Dienstmädchens mit ganz anderm Maße mißt.
Und während in den Toasten bei Verlobungs- und Hochzeitsfesten das romantische Sich-Kennen-und-Lieben-Lernen des Paares gerne betont wird, kann dasselbe Kennen-und-Lieben-Lernen des Dienstmädchens zu seiner Entlassung und damit zu vollständigem Verderben führen.
So wie es in Dingen der Moral kein bevorzugtes Geschlecht geben darf, so soll es auch keinen bevorzugten Stand geben, und deshalb ist das »Anbändeln« der Dienstmädchen und das Kokettieren der Haustöchter aus dem gleichen Grunde zu erklären, aus dem gleichen zu beurteilen und aus dem gleichen erziehlichen zu bekämpfen.
Die Dienstbotenfrage ist vielleicht derjenige Teil der sozialen Frage, der dem erwachten sozialen Gewissen am leichtesten Gelegenheit giebt, sich zu bethätigen und Gerechtigkeit walten zu lassen.
Das Wollen kann mit dem Können in vielen Fällen gleichen Schritt halten, da es ja, wie schon erwähnt, dazu keiner Studien, keiner Vorbereitungen, keiner Reorganisation öffentlicher Einrichtungen bedarf, um einem Menschenkinde, das unter einem Dache mit uns wohnt, durch Güte, Geduld, Aufmerksamkeit und liebevolles Eingehen auf seine persönlichen Interessen den Weg zu rechtlicher, gesunder Lebensführung zu zeigen.
Die Dienstgeber müssen sich bemühen, das Vertrauen ihrer in gewissem Sinne Pflegebefohlenen zu erwerben. Vertrauen ohne verkehrte, schlechtangebrachte Vertraulichkeit kann der Autorität der Dienstgeber nur nützen.
Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, daß für diejenigen Klassen der Bevölkerung, die infolge kärglicher Lebensbedingungen auch moralisch von geschwächter Widerstandskraft sind, die Lohn- und Wohnverhältnisse den Boden bereiten, auf dem die Unsittlichkeit oft gegen das Besserwollen der Betroffenen wuchert.
Dieser aus Not käuflich gewordenen Ware steht ein Heer von Käufern gegenüber, für die alle jene Argumente, die für die Besitzlosen, in ihren Menschenrechten Geschmälerten zur Entschuldigung dienen, keine Giltigkeit haben.
Ich habe die Bemerkung gemacht, daß, wenn in ernsthafter Diskussion das Thema der Sittlichkeitsfrage zur Sprache kommt, oder wenn es in einschlägigen Schriften behandelt wird, von männlicher Seite immer die »geschichtliche Thatsache« ins Treffen geführt wird, daß, soweit wir menschliche Civilisation finden, auch die Erscheinung der Prostitution nebenher läuft. Aus dem, was war und ist, wird das, was immer sein wird, gefolgert, und man gelangt dann zu dem bequemen Schluß, die Gesellschaft habe sich unthätig, philosophisch ins Unvermeidliche zu fügen.
Nun wird es wohl zutreffen, daß es von jeher unter Männern und Frauen einen gewissen Prozentsatz gegeben hat und immer geben wird, die durch eine spezielle Veranlagung fast unüberwindlich gezwungen sind, sich fessellos ihren Leidenschaften und Begierden hinzugeben. Die Schwachen unter diesen gehen infolge ihrer Zügellosigkeit zu Grunde; Kraftnaturen können den Zumutungen, die sie sich selbst stellen, unter Umständen trotzen. Eine relative Minderzahl solcher Erscheinungen hat auch nie zu den sozialen Bedenken Veranlassung gegeben, wie das Überhandnehmen von Erscheinungen, wie sie z.B. in einem allbekannt gewordenen Strafprozeß symptomatisch geworden sind. – Vereinzelte Pest- oder Typhusfälle sind als solche auch nur vom Standpunkte des betroffenen Individuums sehr zu bedauern. Was aber in geordneten Staaten beim Vorkommen sporadischer Pest- oder Typhusfälle die Veranlassung zu umfassenden prophylaktischen und Sanierungsregeln giebt, ist die Gefahr einer weiten und späterhin unaufhaltsamen Verbreitung der Krankheit, die, indem sie Tausende von Einzel-Individuen erfaßt und vernichtet, dem Ganzen unermeßlichen Schaden zufügt.
Diese selbe Gefahr des unermeßlichen Schadens für das Ganze besteht auch auf dem Gebiete der Sittlichkeit, wie sie heute u. a. die Statistik der jugendlichen Verbrecher und andre Korruptionserscheinungen bei Individuen jugendlichen Alters signalisiert.
Nun ist ja natürlich weder anzunehmen noch zu verlangen, daß die leider sehr große Zahl derer, die infolge mangelnder Selbstzucht, Gelegenheit, Verführung oder andrer Antriebe dazu gelangen, gegen die Gebote der Sittlichkeit zu verstoßen, auf theoretischem Wege zu einer altruistischen Lebensauffassung gebracht werden.
Ich glaube, daß man volkserziehlich ein andres Mittel ergreifen muß. Bei den meisten Menschen sind Argumente, die geltend machen, was anderen schadet, wenig wirksam. Wirksamer sind Argumente, die zeigen, was uns selbst schadet, dem eigenen Ich, am eigenen Körper und in der nächsten Umgebung, der Familie.
Darum ist es vor allen Dingen die hygienische Seite der Sittlichkeitsfrage,4 auf die nicht dringend genug hingewiesen werden kann und über deren Tragweite jedem Menschen, Mann und Frau, Klarheit verschafft werden sollte. – Die jungen Leute dürfen nicht im Unklaren darüber bleiben, daß, wenn sie sich gewisse Ausschreitungen zu Schulden kommen lassen, sie thatsächlich krank werden, daß solche Krankheiten ansteckend und vererblich sind und für Generationen hinaus Gesundheit, Glück und Wohlstand vernichten können.
Damit will ich aber gar nicht sagen, daß Detailkenntnisse in dieser Beziehung für jeden nötig oder auch nur zuträglich wären. Diese mag man getrost Fachleuten überlassen, und ihre Diskussion ist der Sache nur schädlich, weil sie das große Publikum überflüssigerweise abstößt, statt es heranzuziehen.
Was an Kenntnissen nach dieser Richtung notwendig in Laienkreisen verbreitet werden sollte, übersteigt meiner Ansicht nach nicht das, was auch sonst an hygienischem Wissen allen Teilen des Volkes zugänglich gemacht werden sollte.
Was weiß z. B. eine Mutter über die Natur des Scharlachs als Krankheit mehr, als daß es eine ansteckende Krankheit ist, deren Verlauf ein bösartiger werden kann und in deren Folge oft recht unangenehme Nachkrankheiten auftreten können.
Jede Mutter würde berechtigterweise Zeter schreien, wenn in einem Ballsaal ein nach Scharlach nicht fertig »gehäuteter« und nicht gebadeter junger Mann erschiene, um mit der Tochter einen Walzer zu tanzen. Und auch das Mädchen wüßte, warum man sich vor der Berührung dieses Mannes zu hüten habe. Wenn aber ein junger Mann nach einiger Zeit, vielleicht mit einer nicht minder schlimmen Krankheit behaftet, um die Hand der Tochter wirbt, dann weiß in vielen Fällen niemand und in ebenso vielen will niemand wissen, ob nicht der Bund, dem man zujubelt, durch die mangelhafte Sittlichkeit des Mannes Krankheit und Elend zur Folge hat.
Und die Söhne, die auf die Universität und zum Militärdienst gehen, sollen die nicht wissen, wohin das Übermaß unverstandener Freiheit sie führen kann?
Den Zusammenhang von Sittlichkeit und Gesundheit der breiten Menge des Volkes klar zu machen, ist einer der wichtigsten Aufgaben innerhalb der sozialen Praxis, und es ist sehr erfreulich, daß es schon eine ganze Reihe von aufklärenden Schriften giebt, die in Ton und Inhalt den einschlägigen Ansprüchen entgegenkommen. Der Verein »Jugendschutz« in Berlin hat sich die Verbreitung solcher Schriften mit zu seinen dankenswerten Aufgaben gemacht. Wenn es auch einerseits erwiesen ist, daß Not und Mangel in unzähligen Fällen den Grund für das Sinken des Sittlichkeitsniveaus von Menschen ist, deren ganze Existenz auf die schwankende Basis kärglich bezahlter Lohnarbeit aufgebaut ist, so muß andrerseits auch sehr lebhaft betont werden, daß Reichtum und Üppigkeit an dem anderen Gesellschaftspole zu denselben Ausschreitungen und Übertretungen führen, wie Mangel und Armut. Dank der unverrückbaren und unabänderlichen Gerechtigkeit und Gesetzmäßigkeit in den Zusammenhängen der Natur sehen wir, daß Besitz und Vermögen nie und nimmer imstande sind, die Folgeübel der verletzten Sittlichkeit zurückzuhalten. Verhüllt, verhohlen, verleugnet mögen sie werden, aber sie werden sich doch unfehlbar einstellen in den verschiedensten Formen von Krankheit, Degeneration und Verfall der Familien und Geschlechter.
Wenn sich so beobachten läßt, daß die Forderungen der Sittlichkeit, die sich ja nicht nur auf das Geschlechtsleben der Menschen beziehen (wenn diese auch in der sogen. Sittlichkeitsfrage in den Vordergrund treten), daß diese Forderungen der Sittlichkeit in Normen bestehen, die sich zum Zwecke der aufsteigenden Fortentwicklung der Menschheit nicht umgehen lassen, dann wird man zu der Frage gedrängt: giebt es einen Faktor, der unter allen sozialen Verhältnissen wirkungsvoll herangezogen und angewendet werden kann, um der Sittlichkeit zu dienen und sie zum Gemeingut zu machen? Die Antwort kann lauten: ja, es giebt einen solchen Faktor, es ist die Erziehung.
Nun ist thatsächlich das Thema der Erziehung innerhalb der Sittlichkeitsfrage ein solches, das für sich allein Ausgang und Inhalt mannigfacher Studien und Erörterungen bilden kann.
Abgesonderte Gebiete innerhalb derselben bilden die Coeducation, – die gemeinsame Erziehung der Geschlechter – die Moralerziehung, die Volkserziehung durch öffentliche Einrichtungen wie Lesehallen.
Ich kann mich jedoch nur knapp an das halten, was ich, als im engsten Zusammenhang mit meinem Thema stehend, nicht unerwähnt lassen will.
Die große Menge des Volkes, die infolge der eingangs geschilderten sozialen Mißstände den Angriffen auf Moral und Sittlichkeit am exponiertesten gegenübersteht, genießt durchschnittlich die allergeringste Erziehung. Auch ist das, was man im allgemeinen unter Erziehung versteht, meist nur die Ausrüstung des einzelnen zum Kampfe gegen alle andren. Da aber die Gebote der Sittlichkeit sehr oft statt Selbstbehauptung Selbstverleugnung fordern, so bringt eine Erziehung, die nur den Zweck des Durchsetzens des eignen Ichs hat, im sittlichen Leben Konflikte hervor, denen das einseitig erzogene Individuum nicht gewachsen ist und in denen es unterliegen muß.
Das Ziel einer planmäßigen sittlichen Erziehung geht weit über die berufliche, bürgerliche Kampfausrüstung hinaus. Sie besteht darin, dem heranwachsenden Geschlechte den Weg zu zeigen zwischen Begehren, Gewähren und Verzichten. Eine solche Erziehung, die sich mit den zartesten sowie mit den heftigsten Regungen und Empfindungen des einzelnen Individuums zu befassen hat, kann, trotzdem sie als Ideal für alle das höchste Interesse des Staates bildet, nicht wie die Berufsbildungsanstalten direkt vom Staate veranlaßt werden. Eine solche Erziehung kann sich nur auf dem Boden der Familie entwickeln. Sache des Staates ist es aber, der Familie in ihren Vorständen und Mitgliedern als erste Bedingung die Zeit und damit die geistige und körperliche Frische und Energie zu geben, sich gegenseitig zu erziehen. Denn wenn heute durch die ganze Welt die Klage über sinkende Moral- und Sittlichkeitsbegriffe geht, so ist der wichtigste, innere, für alle Schichten der Gesellschaft gleichgeltende Grund darin zu suchen, daß die Eltern zu wenig Zeit und darum zu wenig Verständnis und Energie für die Erziehung ihrer Kinder haben.
So wie das alttestamentarische Gesetz der Sabbath-, in seiner modernen Form der Sonntagsruhe eine Vorschrift von der höchsten sittlichen Tragweite bis auf unsere Tage bildet, so ist die Forderung einer durchgangs für alle Arbeiter in allen Berufen herabgeminderten Arbeitszeit nur die Fortsetzung desselben Gedankens in Anwendung auf unsere raschlebige und intensiv arbeitende Generation: Ruhe und Muße zur Ausbildung und Förderung des Menschengeschlechtes!
Das für den einzelnen wie für die Gesamtheit so hochwichtige Geschäft der Jugenderziehung soll nicht als eine Nebenbeschäftigung betrieben werden müssen, deren Erfolg oder Mißerfolg einem Zusammenwirken von Zufälligkeiten überlassen bleibt. Denn die Erziehung ist es, die der Jugend den Wertmesser mit ins Leben geben soll für das, was erstrebenswert oder verderblich ist; sie muß den Grund legen zur Selbstzucht und Selbsterziehung, aus der allein dem Menschen die Kraft erwächst, jeweils die Sittlichkeitsfrage für sich selbst zu lösen.
Und so habe ich denn versucht, in allerdings nur sehr flüchtigen und sprunghaften Zügen, das mächtige Arbeitsfeld zu zeigen, das sich dem erwachten sozialen Gewissen darbietet. Es ist unermeßlich, denn es umfaßt das Leben; aber jeder Arbeitswillige kann einen Angriffspunkt finden, an dem er beginnen kann, es zu bestellen.
Und dieser sozialen Arbeit, es haftet ihr ein eigentümlicher, treibender und beglückender Zauber inne. Wie im Märchen verwandelt sie, was schmutzig und ekelerregend ist, in lauteres Gold.
Helene Lange über Bertha Pappenheims Vortrag:
»Frl. Pappenheim verstand es, die schon oft aufgezählten sozialen Ursachen des Übels, in der Wohnungsnot, den Lohnverhältnissen, der Dienstbotenfrage, der Erziehung so in den Vordergrund zu stellen, daß ihr Vortrag zu einem beredten Appell an das soziale Gewissen der Zuhörerinnen wurde. Sie zeigte ihnen die Seiten der Frage, an denen sie sich mit schuldig fühlen mußten, an denen sie mitarbeiten konnten, um eine Änderung herbeizuführen. Und sie zeigte ihnen unter Gesichtspunkten, die ihnen den Wunsch nahelegen mußten, innerhalb der Kommunen an der Hebung dieser Ursachen mitarbeiten zu können« (Helene Lange, Frauentage in Eisenach, aus: Die Frau, 9. Jg, Heft 2, S. 67-68).
Zur Lage der jüdischen Bevölkerung in Galizien. Reiseeindrücke und Vorschläge zur Besserung der Verhältnisse
Ich weiß, daß, was ich im Nachstehendem sage, vielen nicht gefallen wird; den Orthodoxen kann es zu modern, den Modernen zu altmodisch, den Philanthropen zu sozialistisch, den Sozialisten zu philanthropisch, den Gelehrten zu laienhaft, den Indolenten zu unbequem, den Vorsichtigen zu unvorsichtig, den Draufgehern zu zahm sein. Für alle diese habe ich nur eine Erwiderung: ich gebe die Dinge wieder, wie ich sie sah, wie ich sie auffaßte. Ich konnte mich nicht dazu verstehen, auf Kosten der subjektiven Wahrheit objektiv scheinen zu wollen.
Bertha Pappenheim.
Im Anschluß an diverse Verhandlungen der beiden Vereine, des Frankfurter Israelitischen Hilfsvereins und des Jüdischen Zweigkomitees zur Bekämpfung des Mädchenhandels in Hamburg, hatte ich mich erboten, eine Studienreise nach Galizien zu machen, um von bestimmten Gesichtspunkten aus über die Lage der jüdischen Bevölkerung dort mehr zu erfahren, als eine Beobachtung außer Landes es ermöglicht. Die genannten Vereine beauftragten Fräulein Dr. Sara Rabinowitsch und mich, diese Studienreise zu machen, und es erwächst uns beiden daraus die Pflicht, gesondert über die Eindrücke und Erfahrungen unserer Reise zu berichten, und diesen Bericht einem Kreise von Interessenten zu übergeben.
Um die äußere Reihenfolge der Reiseeindrücke festzuhalten, habe ich ein Tagebuch geführt, das mir ermöglicht, mir selbst jederzeit über Einzelheiten, die dem Gedächtnisse leicht entschwinden, wieder Rechenschaft zu geben. Das was ich heute zu bringen habe, ist aber weder ein chronologisches Aufzählen, noch ein geographisches Herzählen, vielmehr will ich mich bemühen, meine Eindrücke stofflich so zu gruppieren, daß sich die Reise und meine Absichten bei derselben als ein zusammenhängendes Ganzes darstellen.
Ich hoffe, daß das Niederschreiben mir selbst etwas Ruhe gebracht hat, und daß mir von der Erregung, die mich angesichts so vielen Elends, so vieler Verwahrlosung und Versumpfung oft heftig erfaßte, nur soviel Wärme übrig geblieben ist, um bei denen, die in geistigem Wohlstand und in angeborenen und anerzogenen Sittlichkeitsbegriffen leben, den Eifer zu notwendigen und, wie ich sicher glaube, aussichtsreichen Taten zu erwecken. Ich denke, daß ich meine Absicht, klar und übersichtlich zu bleiben, dann am sichersten erreiche, wenn ich meinen Stoff in der Weise gliedere, daß ich erst mitteile, was wir vorfanden und beobachteten und, daran anschließend, meine Vorschläge entwickle.
Vor allem muß ich mich aber dagegen verwahren, nach nur fünfwöchentlichem Aufenthalt in Galizien für eine Kennerin des Landes gelten zu wollen.
Meine österreichische Landsmannschaft, meine orthodox-jüdische Erziehung, und nicht zuletzt mein Beruf, der mich auf eine zehnjährige Tätigkeit in der Armenpflege blicken läßt, waren für mich selbst gewissermaßen die Entschuldigung, mich zu einer Reise, die, wie ich hoffe, nicht ohne praktische Ergebnisse bleiben wird, anzubieten.
Denn nicht alles, was dem Nichtösterreicher, und nicht orthodox erzogenen Juden in Galizien fremd oder befremdlich erscheint, kann einfach auf die Liste dessen gesetzt werden, was mit dem westeuropäischen Kulturhobel geglättet werden soll.
Man wird sich sehr davor hüten müssen, Dinge zu verlangen, die der Individualität des Landes, das in seiner Mischung von deutsch-österreichischen, polnischen und jüdischen Elementen einen sehr bestimmten Charakter hat, allzusehr widersprechen.
Neue Anforderungen können und sollen nur da gestellt werden, wo es sich um eine Verkümmerung oder Unkenntnis allgemeiner, für alle Völker gleich unerläßlicher Kulturfaktoren handelt.
Um nach jeder Richtung hin fein unterscheiden zu können, um Land und Leute gründlich kennen zu lernen, müßte man allerdings jahrelang dort gelebt haben. Dagegen ist aber zu erwägen, daß, wer jahrelang in einem Lande lebt, sich in die Sitten und Gebräuche eines Volkes einlebt, damit auch leicht die Fähigkeit unmittelbarer Beobachtung und Beurteilung verlieren kann, und was an Tiefe gewonnen wird, geht an Schärfe verloren.
Unserem besonderen Reisezweck gegenüber gibt es Dinge, die nur der Konstatierung und keiner besonderen subtilen Forschung bedürfen, Beobachtungen von Einzelheiten, die Schlüsse auf das Allgemeine rechtfertigen, ohne daß man deshalb »leichtfertig generalisiert«.
Wenn wir z.B. bei einem Wunderrabbi im Zimmer sitzen, – er bestreitet die Notwendigkeit von Knabenschulen – und während wir sprechen, fällt meiner Reisegefährtin von der Zimmerdecke herab ein schwerfälliges Ungeziefer in den Schoß, da brauche ich in dem Hause keinen Scheffel Salz zu essen, um mir über den Geist seiner Bewohner – Mann und Frau – ein annähernd richtiges Bild zu machen. Dasselbe gilt von den hervorstechendsten Eigentümlichkeiten des Landes und seiner jüdischen Bevölkerung, die wir nur eine relativ kurze Zeit beobachten konnten.
Ich darf hinzufügen, daß wir unsere Aufgabe ernst nahmen, daß wir eifrig beobachteten und unseren Zweck nicht aus den Augen ließen. Als Frauen war es uns nicht nur möglich, mit den intelligenten Kreisen zu verkehren, sondern wir suchten und fanden Gelegenheit, mit Männern und Frauen, Mädchen und Kindern des Volkes zu sprechen, und manches Wort, mancher Blick ließ uns in Verhältnisse und Zusammenhänge eindringen, die einem Manne unzugänglich und doch für das Verständnis der Zustände sehr wichtig sind.
Dennoch möchte ich für meinen Teil meinen Bericht weder als erschöpfend noch als wissenschaftliche Arbeit betrachtet sehen, da ich eine solche zu leisten nicht imstande bin.
Ich kann nur sagen, wie ich als Frau die Dinge gesehen habe, und kann aus meinen persönlichen Eindrücken nach meiner individuellen Auffassung Schlüsse ziehen und Vorschläge machen.
Was die äußeren Reiseumstände betrifft, die ja auch ein gewisses Interesse beanspruchen können, so muß ich sagen, daß sie eigentliche große Gefahren, wie von befreundeter Seite für uns befürchtet wurden, nicht boten.
Dennoch war die Reise tatsächlich mit Anstrengungen, Unbequemlichkeiten und hygienischen Unzuträglichkeiten aller Art verbunden.
Unter der Unsauberkeit mancher Hotels in den kleinen Orten hatten wir speziell weniger zu leiden, weil ich stets bestimmte Vorkehrungen zur Nachtruhe traf, und mit großer Energie immer wieder verlangte, was mir unerläßlich erschien. Männliche Reisende dürften nach dieser Richtung viel mehr zu leiden haben, da ihnen die Übung der Selbsthilfe fehlt. Selbstverständlich mußte ich mich doch in vieles Ungewohnte finden; so mußte ich lernen, meinen Konsum an Wasser sehr einzuschränken, und an Stelle eines Stubenmädchens (jüdische) Stubenknaben walten zu sehen!
Die Fahrten in den Lokalzügen schienen endlos, und wenn nicht bei Benützung der 3. Klasse auf manchen Strecken die Beobachtung der Mitreisenden die Zeit gekürzt hätte, wäre diese Bummelei mit Aufenthalten von 10 Minuten bis zu einer Stunde eine unleidliche Geduldprobe gewesen.
Die Wagenfahrten bei kaltem Wind und Regen sind nicht sehr behaglich, denn auch die guten Wagen und die guten Straßen sind nach mitteleuropäischen Begriffen schlecht. Aber manche Fahrt in der allverklärenden Maisonne war schön, wenn sie durch frischgrüne Buchen- und Birkenwälder, oder, wie einmal bei Mondschein, durch anmutiges Hügelland führte. Die kleinen Dörfer an den Reichsstraßen liegen in ziemlich großer Entfernung voneinander. Die ruthenischen5 Kirchen von eigentümlicher Bauart, mit drei grauen Kuppeln gekrönt, sind fast die einzigen festgemauerten Baulichkeiten, die man sieht. Die Glocken, meist vier an der Zahl, hängen in einem niederen, überdachten Gerüst in der nächsten Nähe der Kirche und entbehren dadurch des weithintönenden Klanges. Die Wohnungen sind meist niedere Hütten mit Strohdächern, die tief über die kleinen Fenster und Türen herabhängen, und für die jedes Fläckerchen Feuer auf dem offenen Herde eine große Gefahr werden kann.
Überall Ziehbrunnen, aus denen nur langsam, bei Bränden sicher entsetzlich langsam, Wasser geholt werden kann, und deren Anlage in der Nähe von Abfuhrstellen aller Art das ständige Vorhandensein von Typhus im Lande ausreichend erklärt.
An den Fenstern der Bauernhäuser werden meist Blumen gehalten, aber ich erinnere mich nicht, an den Fenstern der Behausungen, die uns vom Kutscher als solche bezeichnet wurden, oder die wir aus irgend einer Veranlassung kennen lernten, Blumen gesehen zu haben.
Auch sonst scheint der Sinn fürs Schöne unter dem geistigen Drucke und der furchtbaren Not des täglichen Lebens bei den galizischen Juden ganz erstorben. Die Frauen und Mädchen putzen sich auffallend und geschmacklos, aber sie schmücken sich nicht. An die Wohnräume in ihrer hygienischen Unzulänglichkeit ästhetische Ansprüche stellen zu wollen, klänge wie Hohn. Auch die Synagogen sind jeden Schmuckes – auch des durch die Gesetzesauslegung erlaubten – bar. Hie und da ein schöner Messingleuchter, und in Brody ein wahrer Schatz herrlicher alter silberner Thorakronen, sprechen von vergangenen, besseren Zeiten.





























