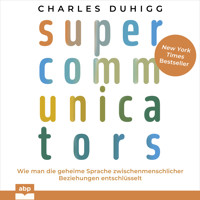21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Warum bekommen einige Menschen so viel erledigt – und andere nicht? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, verknüpft Duhigg in seinem neuen Bestseller die aktuellen Erkenntnisse der Neurowissenschaften, der Psychologie und der Behavioral Economics. Dazu kommen Erfahrungsberichte von CEOs, Pädagogen, Vier-Sterne-Generälen, FBI-Agenten, Piloten und Broadway-Liedkomponisten. Er belegt, dass sich die produktivsten Leute, Firmen und Unternehmen nicht nur anders verhalten, sondern auch einen grundlegend anderen Blick auf die Welt und ihre Entscheidungen haben. Smarter, schneller, besser erläutert die Schlüsselkonzepte der Produktivität, von Motivation über Zielsetzung bis hin zur Entscheidungsfindung. Duhigg zeigt in seiner Wissenschaft der Produktivität, wie jeder mehr erledigt bekommen kann, ohne großen Stress und mit geringen Anstrengungen – und so in allen Bereichen einfach smarter, schneller und besser werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Ähnliche
Für Harry, Oliver,Doris und Johnund – vor allem – Liz.
Charles Duhigg
Smarter, schneller, besser
Warum manche Menschen so viel erledigt bekommen – und andere nicht
Übersetzung aus dem Englischen von Silvia Kinkel
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:[email protected]
1. Auflage 2017
© 2017 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,Nymphenburger Straße 86D-80636 MünchenTel.: 089 651285-0Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2016 by Charles Duhigg. All rights reserved.Die englische Originalausgabe erschien 2016 bei Random House, einem Imprint und einer Divison von Penguin Random House LLC, New York, unter dem Titel Smarter Faster Better.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Silvia Kinkel, KönigsteinRedaktion: Matthias Michel, WiesbadenUmschlaggestaltung: Laura Osswald, MünchenUmschlagabbildung: Shutterstock/Michael D BrownSatz: Röser Media, KarlsruheDruck: GGP Media GmbH, PößneckPrinted in Germany
ISBN Print 978-3-86881-659-4ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-940-5ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86414-939-9
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unterwww.m-vg.de
Inhalt
Einleitung
1Motivation.
Neuinterpretation des Bootcamps, Rebellion im A Itersheim und Kontrollüberzeugung
2Teams.
Psychologische Sicherheit bei Google und Saturday Night Live
3Fokussieren.
Cognitive Tunneling, Air-France-Flug 477 und die Kraft mentaler Modelle
4Ziele setzen.
SMART-Ziele, Stretch Goals und der Jom-Kippur-Krieg
5Andere führen.
Mit Lean und Agile Management und einer Kultur des Vertrauens einen Entführungsfall lösen
6Entscheidungsfindung.
Mit Bayes’scher Psychologie die Zukunft vorhersagen (und beim Pokern gewinnen)
7Innovation.
Wie Ideenbroker und kreative Verzweiflung Disneys Eiskönigin retteten
8Daten richtig nutzen.
An den öffentlichen Schulen von Cincinnati Informationen in Wissen umwandeln
Anhang.
Anleitung für den Leser, diese Ideen umzusetzen
Danksagung
Über den Autor
Anmerkungen
Stichwortverzeichnis
Einleitung
Zu meinem ersten Kontakt mit der Wissenschaft der Produktivität kam es im Sommer 2011, als ich den Freund eines Freundes um einen Gefallen bat.
Damals beendete ich gerade ein Buch über die Neurologie und Psychologie der Gewohnheitsbildung. Ich befand mich in dem hektischen Endstadium des Schreibprozesses – und in einer Welle von Anrufen, panischen Umformulierungen, Überarbeitungen in letzter Minute – und hatte das Gefühl, immer mehr in Verzug zu geraten.
Meine Frau, die Vollzeit arbeitete, hatte gerade unser zweites Kind auf die Welt gebracht. Ich war investigativer Journalist bei der New York Times, verbrachte meine Tage damit, Storys hinterherzujagen, und die Nächte mit der Überarbeitung meines Buchmanuskripts.
Mein Leben fühlte sich an wie eine Tretmühle voller To-do-Listen, E-Mails, die eine sofortige Beantwortung verlangten, hektischer Meetings und ständiger Entschuldigungen, weil ich zu spät dran war.
Inmitten all dieses Herumgehetzes und Gewusels – und mit der vorgeschobenen Bitte um einen kleinen redaktionellen Rat – kontaktierte ich einen von mir bewunderten Autor, einen Freund eines meiner Kollegen bei der Times. Der Name des Autors ist Atul Gawande, und er scheint der Inbegriff des Erfolgs zu sein. Er war damals 46 Jahre alt, fester Mitarbeiter einer renommierten Zeitschrift und ein angesehener Chirurg in einem der Topkrankenhäuser des Landes. Er war außerordentlicher Professor in Harvard, Berater der Weltgesundheitsorganisation und Gründer einer gemeinnützigen Organisation, die chirurgisches Gerät in medizinisch unterversorgte Regionen dieser Welt schickt. Er hat drei Bücher geschrieben – alle Bestseller –, ist verheiratet und hat drei Kinder. 2006 wurde er mit dem »Geniepreis« der MacArthur-Stiftung ausgezeichnet – und spendete spontan einen großen Teil der 500 000 Dollar für wohltätige Zwecke.
Es gibt Menschen, die den Eindruck erwecken, unglaublich produktiv zu sein, und deren Lebensläufe so lange beeindruckend aussehen, bis einem klar wird, dass ihr größtes Talent darin besteht, sich selbst zu vermarkten. Und dann gibt es andere, so wie Gawande, die auf einer ganz anderen Ebene unterwegs zu sein scheinen, wenn es darum geht, etwas zu erreichen. Seine Beiträge waren intelligent und fesselnd, und nach übereinstimmenden Berichten war er außerdem ein begnadeter Chirurg, der sich engagiert um seine Patienten kümmerte, und ein hingebungsvoller Vater. Jedes Mal, wenn er im Fernsehen interviewt wurde, wirkte er entspannt und aufmerksam. Seine medizinischen, journalistischen und auch politischen Erfolge waren wichtig und real.
In einer E-Mail fragte ich ihn, ob er Zeit für ein Gespräch habe. Es interessierte mich, wie es ihm gelang, so produktiv zu sein. Was war sein Geheimnis? Und, falls ich es herausfand, könnte es mein eigenes Leben verändern?
»Produktivität« hat natürlich in verschiedenen Umgebungen unterschiedliche Bedeutungen. So treibt zum Beispiel jemand jeden Morgen eine Stunde Sport, bevor er die Kinder zur Schule bringt, und betrachtet diesen Tag als erfolgreich. Ein anderer verbringt diese Stunde vielleicht hinter verschlossenen Türen in seinem Büro, beantwortet E-Mails und telefoniert mit ein paar Klienten, und fühlt sich genauso erfolgreich. Ein Forscher oder Künstler vermag Produktivität in gescheiterten Experimenten oder verworfenen Leinwänden zu sehen, da jeder Fehler, so hofft er, ihn der Entdeckung näherbringt. Ein Ingenieur misst Produktivität möglicherweise daran, dass er die Geschwindigkeit einer Fertigungsstraße erhöhen konnte. Ein produktives Wochenende kann einen Spaziergang mit Ihren Kindern im Park enthalten; ein produktiver Arbeitstag wiederum beginnt damit, sie pünktlich im Kindergarten oder in der Schule abzuliefern und so früh wie möglich ins Büro zu kommen.
Einfach ausgedrückt bezeichnen wir mit Produktivität den besten Nutzen unserer Energie, unseres Verstandes und unserer Zeit, während wir versuchen, mit geringstmöglichem Aufwand möglichst viel zu erreichen. Es ist ein Prozess des Lernens, wie wir ohne großen Stress und mit geringen Anstrengungen mehr erledigt bekommen. Es geht darum, viel zu erledigen, ohne dabei alles zu opfern, was uns wichtig ist.
Entsprechend dieser Definition schien Atul Gawande alles richtig zu machen.
Ein paar Tage später erhielt ich seine Antwort, in der er mit Bedauern schrieb: »Ich wünschte, ich könnte helfen, aber meine zahlreichen Verpflichtungen nehmen mich voll in Anspruch.« Sogar er hatte offenbar seine Grenzen. »Ich hoffe auf Ihr Verständnis.«
Später in jener Woche erwähnte ich diesen E-Mail-Austausch einem gemeinsamen Freund gegenüber und betonte, dass ich nicht etwa gekränkt sei, sondern tatsächlich Gawandes Fokussierung bewundere. Ich stellte mir vor, dass seine Tage randvoll waren mit der Behandlung von Patienten, dem Unterrichten an der medizinischen Fakultät, dem Verfassen von Zeitschriftenartikeln und seiner Tätigkeit als Berater der weltgrößten Gesundheitsorganisation.
Nein, erwiderte mein Freund, da würde ich falschliegen. Ga-wande war in jener Woche deshalb so eingespannt, weil er Karten gekauft hatte, um mit seinen Kindern ein Rockkonzert zu besuchen. Und anschließend wollte er einen Kurzurlaub mit seiner Frau machen.
Tatsächlich schlug dieser gemeinsame Freund vor, ich solle Ga-wande Ende des Monats noch einmal eine E-Mail schicken, wenn er mehr Luft zum Plaudern in seinem Zeitplan habe.
In dem Moment wurden mir zwei Dinge klar:
Zum einen machte ich eindeutig etwas falsch, denn ich hatte mir seit neun Monaten keinen einzigen Tag mehr freigenommen; ich machte mir sogar immer mehr Sorgen, ob meine Kinder, wenn sie sich zwischen ihrem Vater und dem Babysitter entscheiden müssten, dem Babysitter den Vorzug geben würden.
Und zweitens, was noch wichtiger war, gab es da draußen Menschen, die wussten, wie man produktiver ist. Ich musste sie lediglich davon überzeugen, mich in ihre Geheimnisse einzuweihen.
Dieses Buch ist das Ergebnis meiner Untersuchungen, wie Produktivität funktioniert, und meiner Bemühungen zu verstehen, warum manche Menschen und Unternehmen so viel produktiver sind als andere.
Seit ich Gawande vor fünf Jahren kontaktierte, sprach ich mit Neurologen, Geschäftsleuten, Spitzenpolitikern, Psychologen und anderen Produktivitätsexperten. Ich habe mit den Filmemachern von Disneys Die Eiskönigin geredet und erfahren, wie sie unter immensem Zeitdruck – und einer nur knapp verhinderten Katastrophe – einen der erfolgreichsten Filme der Geschichte auf die Beine stellen konnten, indem sie in ihren Reihen eine bestimmte Art kreativer Spannung gefördert haben. Ich sprach mit Datenspezialisten bei Google und Autoren der ersten Staffeln von Saturday Night Live und erfuhr, dass der Erfolg in beiden Fällen zum Teil auf ein Set unausgesprochener Regeln bezüglich gegenseitiger Unterstützung und Risikobereitschaft zurückzuführen ist. Ich sprach mit FBI-Agenten, die mittels agilem Management und einer durch eine alte Autofabrik in Fremont, Kalifornien, beeinflussten Unternehmenskultur einen Entführungsfall lösten. Ich streifte durch die öffentlichen Schulen von Cincinnati und sah, wie eine Initiative zur Verbesserung des Unterrichts das Leben der Schüler veränderte, in dem es, paradoxerweise, erschwert wurde, Informationen aufzunehmen.
Bei meinen Gesprächen mit den unterschiedlichsten Menschen – Pokerspielern, Piloten, Generälen, Führungskräften, Kognitionswissenschaftlern – kristallisierte sich eine Handvoll Schlüsselfaktoren heraus. Mir fiel auf, dass Menschen immer wieder dieselben Konzepte erwähnten. Ich gelangte zu der Überzeugung, dass eine kleine Anzahl von Ideen den Kern dessen bildet, warum manche Menschen und Unternehmen so viel mehr leisten.
Dieses Buch erforscht die acht Ansätze, die bei der Steigerung von Produktivität am wichtigsten zu sein scheinen. So untersucht ein Kapitel, wie das Gefühl, die Kontrolle zu haben, Motivation hervorruft und wie das Militär orientierungslose Teenager zu Marines macht, indem es ihnen beibringt, »auf Handeln ausgerichtete« Entscheidungen zu fällen. Ein anderes Kapitel betrachtet, warum wir unsere Konzentration aufrechterhalten können, wenn wir mentale Modelle erschaffen – und wie ein Pilotenteam sich gegenseitig Geschichten erzählte und dadurch 440 Passagiere vor einem Flugzeugabsturz bewahrte.
Die Kapitel dieses Buches beschreiben die richtige Vorgehensweise beim Setzen von Zielen – durch das Akzeptieren sowohl ehrgeiziger Ziele wie auch banaler Hindernisse – und warum sich Israels politische Führer im Vorfeld des Jom-Kippur-Krieges so in ihre Fehleinschätzung verrannt haben. Diese Kapitel erforschen die Bedeutung des Fällens von Entscheidungen durch das Vergegenwärtigen der Zukunft als mannigfaltige Möglichkeiten statt als Fixierung auf das, von dem Sie hoffen, dass es eintritt. Sie werden erfahren, wie eine Frau diese Technik einsetzte, um die nationalen Pokermeisterschaften zu gewinnen. Diese Kapitel beschreiben, wie einige Unternehmen im Silicon Valley zu Giganten wurden durch das Schaffen einer »Kultur des Engagements«, die Mitarbeiter auch dann unterstützt, wenn ein solches Engagement schwierig wird.
Diese acht Ansätze miteinander zu verbinden, ist ein wirkungsvolles Prinzip: Produktivität dreht sich nicht darum, mehr zu arbeiten oder zu schwitzen. Sie ist nicht einfach das Ergebnis von mehr Arbeitsstunden am Schreibtisch oder davon, noch größere Opfer zu bringen.
Bei Produktivität geht es vielmehr darum, bestimmte Entscheidungen auf bestimmte Weise zu treffen. Die Art und Weise, wie wir uns selbst sehen und tagtäglich Entscheidungen treffen; die Geschichten, die wir uns selbst erzählen; die einfachen Ziele, die wir ignorieren; das Gemeinschaftsgefühl, das wir unter Kollegen wecken; die kreativen Kulturen, die wir als Führungskräfte schaffen: Das alles sind Dinge, die den reinen Fleiß von echter Produktivität unterscheiden.
Wir leben heute in einer Welt, in der wir zu jeder Stunde mit Kollegen kommunizieren können, über Smartphones Zugang zu notwendigen Dokumenten haben, innerhalb von Sekunden Kenntnis über Fakten erlangen und fast jedes Produkt innerhalb von 24 Stunden zu uns nach Hause liefern lassen können. Unternehmen können in Kalifornien Geräte entwickeln, Bestellungen von Kunden in Barcelona entgegennehmen, Entwürfe per E-Mail nach Shenzhen schicken und den Sendungsstatus von Lieferungen quer über den ganzen Erdball mitverfolgen. Eltern können die Termine aller Familienmitglieder automatisch abgleichen, Rechnungen online und während sie schon im Bett liegen bezahlen und die Handys ihrer Kinder lokalisieren, wenn sie zur ausgemachten Uhrzeit nicht zu Hause sind. Wir erleben eine ökonomische und soziale Revolution, die auf viele Weisen so tief greifend ist wie die neolithische oder die industrielle Revolution vergangener Jahrhunderte.
Diese Fortschritte bei der Kommunikation und Technologie sollten unser Leben einfacher machen. Stattdessen scheinen sie unsere Tage oft mit noch mehr Arbeit und Stress zu füllen.
Zum Teil liegt das daran, dass wir den falschen Innovationen unsere Aufmerksamkeit schenken. Wir starren auf die Werkzeuge der Produktivität – die Geräte und Apps und komplizierten Ablagesysteme, um den Überblick über die verschiedenen To-do-Listen zu behalten –, statt darauf zu achten, was uns diese Technologien beizubringen versuchen.
Es gibt jedoch Menschen, die herausgefunden haben, wie man diese sich verändernde Welt meistert. Es gibt Unternehmen, die entdeckt haben, welche Vorteile in diesen raschen Veränderungen stecken.
Wir wissen jetzt, wie Produktivität wirklich funktioniert. Wir wissen, welche Entscheidungen am wichtigsten sind und den Erfolg in greifbare Nähe rücken. Wir wissen, wie man Ziele so setzen muss, dass sie kühne Ziele erreichbar machen; wie wir Situationen neu ausrichten müssen, sodass wir verborgene Möglichkeiten entdecken, statt nur Probleme zu sehen; wie wir uns gegenüber neuen kreativen Verbindungen öffnen und wie wir schneller lernen, indem wir die Daten verlangsamen, die an uns vorbeirasen.
In diesem Buch geht es darum, die Alternativen zu erkennen, die wahre Produktivität verstärken. Es ist ein Leitfaden zur Wissenschaft, den Techniken und Möglichkeiten, die Leben verändern. Es gibt Menschen, die gelernt haben, wie man mit weniger Aufwand mehr Erfolg hat. Es gibt Unternehmen, die mit weniger Verschwendung erstaunliche Dinge erschaffen. Es gibt Führungskräfte, die die Menschen um sich herum verändern.
Dieses Buch hilft Ihnen dabei, bei allem, was Sie tun, smarter, schneller und besser zu werden.
1Motivation
Neuinterpretation des Bootcamps, Rebellion im Altersheim und Kontrollüberzeugung
I.
Die Reise war als Feier gedacht, eine 29-tägige Tour durch Südamerika, die Robert, der gerade 60 geworden war, und seine Frau Viola erst nach Brasilien, dann über die Anden nach Bolivien und Peru führen sollte. Ihr Reiseplan beinhaltete Ausflüge zu den Ruinen der Inkas, eine Bootstour auf dem Titicacasee, den Besuch von Kunsthandwerksmärkten und ein bisschen Vogelbeobachtung.
So viel Erholung erschien Robert, so scherzte er vor der Abreise mit Freunden, leichtsinnig. Er rechnete bereits aus, dass ihn die ständigen Anrufe bei seiner Sekretärin ein Vermögen kosten würden. Während der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hatte Robert Philippe aus einer kleinen Tankstelle in Louisiana ein Imperium für Fahrzeugersatzteile geschaffen und war durch harte Arbeit, Charisma und Hartnäckigkeit zu einem Bayou-Mogul aufgestiegen. Neben dem Ersatzteilgeschäft gehörten ihm eine Chemie- und eine Papierfabrik, diverse Ländereien und eine Immobilienfirma. Und hier war er nun, am Beginn seines siebten Lebensjahrzehnts, und seine Frau hatte ihn überredet, einen Monat in Ländern zu verbringen, von denen er annahm, dass es dort sogar schwierig sein würde, einen Fernseher zu finden, um sich ein College-Football-Spiel anzuschauen.
Robert betonte gern, dass es nicht eine Schotterpiste oder eine Seitenstraße längs der Golfküste gäbe, die er nicht mindestens einmal entlanggefahren sei, um sein Geschäft anzukurbeln. Nachdem Philippe Incorporated gewachsen war, wurde Robert berühmt dafür, Geschäftsleute aus den Großstädten von New Orleans bis Atlanta in dubiose Kaschemmen zu schleppen und sie nicht gehen zu lassen, bevor die Spareribs abgenagt und die Flaschen geleert waren. Während die anderen am nächsten Morgen mit ihrem Kater kämpften, brachte Robert sie dazu, Verträge in Millionenhöhe zu unterschreiben. Die Barkeeper waren instruiert, sein Glas mit nichts als Sodawasser zu füllen, während die anderen hochprozentige Cocktails bekamen. Robert hatte über Jahre keinen Alkohol angerührt.
Er war Mitglied der Knights of Columbus und der Handelskammer, ehemaliger Präsident der Louisiana Association of Wholesalers und der Greater Baton Rouge Port Commission, Vorstand der örtlichen Bank und spendete bereitwillig an jede politische Partei, die gerade geneigt war, seine Gewerbegenehmigungen zu bewilligen. »Sie werden niemanden finden, der das Arbeiten so liebte wie er«, sagte mir seine Tochter Roxann.
Robert und Viola hatten sich auf die Südamerikareise gefreut. Aber als sie nach den ersten zwei Wochen in La Paz das Flugzeug verließen, verhielt sich Robert plötzlich seltsam. Er stolperte durch den Flughafen und musste sich beim Gepäckband erst einmal hinsetzen, um zu Atem zu kommen. Als sich ihm ein paar Kinder näherten und um Geld bettelten, warf er ihnen ein paar Münzen vor die Füße und lachte. Während der Busfahrt zum Hotel hielt er mit lauter Stimme einen weitschweifenden Monolog über verschiedene Länder, die er besucht hatte, und die relative Attraktivität der dort lebenden Frauen. Vielleicht lag es an der Höhe. Mit 3600 Metern über dem Meeresspiegel ist La Paz eine der höchstgelegenen Städte der Welt.
Nachdem sie ausgepackt hatten, drängte Viola ihren Mann, einen Mittagsschlaf zu halten. Dazu habe er keine Lust, widersprach er. Er wollte ausgehen. In der folgenden Stunde spazierte er durch die Stadt, kaufte irgendwelchen Tand und regte sich jedes Mal auf, wenn die Einheimischen kein Englisch verstanden. Schließlich stimmte er zu, ins Hotel zurückzukehren, wo er sofort einschlief. Während der Nacht wachte er jedoch mehrfach auf und musste sich übergeben. Am nächsten Morgen sagte er, er würde sich schwach fühlen, wurde jedoch ärgerlich, als Viola vorschlug, dass er sich ausruhen solle. Den dritten Tag verbrachte er im Bett. Am vierten Tag entschied Viola, dass das Maß voll sei, und beendete die Urlaubsreise.
Zurück in Louisiana, schien sich Robert schnell zu erholen. Seine Verwirrtheit schwand und er hörte auf, seltsame Dinge zu sagen. Doch seine Frau und seine Kinder waren immer noch besorgt. Robert war lethargisch und verließ aus eigenem Antrieb nicht das Haus. Viola hatte erwartet, dass er nach der Rückkehr sofort ins Büro eilen würde, aber nach vier Tagen hatte er sich noch nicht einmal bei seiner Sekretärin gemeldet. Als Viola ihn daran erinnerte, dass die Rotwild-Jagdsaison bald begann und er sich eine Jagdlizenz besorgen müsse, meinte Robert, dass er dieses Jahr aussetzen würde. Sie telefonierte mit einem Arzt, und kurz darauf waren sie auf dem Weg zur Ochsner-Klinik in New Orleans.1
Der Leiter der neurologischen Abteilung, Dr. Richard Strub, führte mit Robert zahlreiche Tests durch. Die Vitalfunktionen waren alle völlig normal, auch das Blutbild zeigte nichts Ungewöhnliches. Keine Hinweise auf eine Infektion, auf Diabetes, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Robert zeigte, dass er den Inhalt der Tageszeitung verstand und sich detailliert an seine Kindheit erinnerte. Er war in der Lage, eine Kurzgeschichte zu interpretieren. Der Revised-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene ergab einen normalen IQ.
»Können Sie mir Ihr Unternehmen erklären?«, fragte Dr. Strub.
Robert beschrieb die Struktur seiner Firma und nannte ein paar Verträge, die sie in letzter Zeit abschließen konnte.
»Ihre Frau sagte, Sie würden sich anders verhalten«, fuhr Dr. Strub fort.
»Ja«, antwortete Robert. »Anscheinend habe ich nicht mehr so viel Elan wie früher.«
»Es schien ihm nichts auszumachen«, berichtete mir Dr. Strub später. »Er hat mir ganz sachlich von seinen Persönlichkeitsveränderungen erzählt, als würde er über das Wetter reden.«
Abgesehen von der plötzlichen Apathie konnte Dr. Strub keine Hinweise auf Erkrankungen oder Verletzungen finden. Er schlug Viola vor, eine Woche abzuwarten, ob sich Roberts Zustand von allein verbessern würde. Als die beiden einen Monat später wieder zu Dr. Strub kamen, hatte sich jedoch nichts verändert. Robert zeige keinerlei Interesse, seine alten Freunde zu sehen, erzählte seine Frau. Er las nicht mehr. Früher sei es nervenaufreibend gewesen, mit ihm zusammen fernzusehen, da er ständig zwischen den Kanälen wechselte, um etwas Spannenderes zu finden. Jetzt starrte er einfach nur auf den Bildschirm, gleichgültig gegenüber dem, was dort gerade lief. Sie hatte ihn schließlich überzeugen können, ins Büro zu gehen, aber seine Sekretärin sagte, er würde stundenlang am Schreibtisch sitzen und vor sich hin starren.
»Sind Sie unglücklich oder deprimiert?«, fragte Dr. Strub.
»Nein«, antwortete Robert. »Ich fühle mich gut.«
»Können Sie mir erzählen, wie Sie den gestrigen Tag verbracht haben?«
Robert beschrieb einen Tag vor dem Fernseher.
»Ihre Frau sagt, dass Ihre Mitarbeiter besorgt seien, weil man Sie kaum noch in Ihrem Büro antrifft«, meinte Dr. Strub.
»Ich interessiere mich jetzt wohl mehr für andere Dinge«, antwortete Robert.
»Als da wäre?«
»Keine Ahnung.« Dann schwieg er und starrte die Wand an.
Dr. Strub verschrieb verschiedene Arzneien – Medikamente, um hormonelles Ungleichgewicht und Konzentrationsschwäche zu bekämpfen –, aber keine schien eine Wirkung zu zeigen. Menschen, die unter Depressionen leiden, würden sagen, dass sie unglücklich sind, und ihre Hoffnungslosigkeit beschreiben. Robert jedoch gab an, dass er mit seinem Leben zufrieden sei. Er räumte ein, dass seine Persönlichkeitsveränderung seltsam sei, ihn aber nicht beunruhige.
Dr. Strub ordnete eine Kernspintomografie an, um Bilder von seinem Schädelinnern zu bekommen. In dem Teil von Roberts Gehirn, der als Striatum bezeichnet wird, war ein kleiner Schatten zu sehen, Anzeichen für eine durch geplatzte Äderchen hervorgerufene Blutansammlung. Derartige Verletzungen können in seltenen Fällen Gehirnschädigungen oder Gemütsschwankungen verursachen. Aber abgesehen von der Lustlosigkeit wies wenig an Roberts Verhalten darauf hin, dass er an einer neurologischen Störung litt.
Ein Jahr später sandte Dr. Strub dem Archives of Neurology einen Artikel.2 Roberts »Verhaltensveränderung ist charakterisiert durch Apathie und Motivationsmangel«, schrieb er. »Er hat seine Hobbys aufgegeben und schafft es in seinem Beruf nicht mehr, rechtzeitig Entscheidungen zu treffen. Er weiß, welche Maßnahmen in seinem Unternehmen nötig sind, schiebt die Dinge jedoch auf und vernachlässigt Details. Eine Depression besteht nicht.« Der Grund für seine Passivität, so vermutete Dr. Strub, sei die geringfügige Verletzung in seinem Gehirn, die vielleicht durch die Höhe Boliviens ausgelöst worden war. Aber auch das sei ungewiss. »Möglicherweise sind die Blutungen zufällig und die Höhe hat physiologisch keine Rolle gespielt.«
Es sei ein interessanter, aber letztlich nicht eindeutiger Fall, schrieb Dr. Strub.
Während der folgenden zwei Jahrzehnte erschien eine Handvoll ähnlicher Artikel in medizinischen Fachzeitschriften. Da gab es einen 60-jährigen Professor, der einen unvermittelten »Rückgang des Interesses« erlebte. Er war auf seinem Gebiet ein Experte mit erbitterter Arbeitsmoral gewesen. Und eines Tages hörte das plötzlich auf. »Mir fehlt einfach die Energie, die Tatkraft«, erzählte er seinem Arzt. »Ich habe keinen Antrieb. Morgens muss ich mich zwingen, aufzustehen.«3
Dann war da ein 19-jähriges Mädchen, das nach dem Einatmen von Kohlenmonoxid kurzzeitig ohnmächtig gewesen war und anschließend die Motivation für die banalsten Handlungen verloren zu haben schien. Wenn man sie nicht zwang, sich zu bewegen, saß sie den ganzen Tag lang in ein und derselben Position auf einem Stuhl. Ihr Vater musste die Erfahrung machen, dass er sie nicht allein lassen konnte, als er sie »mit schwerem Sonnenbrand am Strand fand, an derselben Stelle, an der sie sich Stunden zuvor unter einen Schirm gelegt hatte: ausgeprägte Trägheit hatte sie davon abgehalten, ihre Position zu verändern, als die Sonne weiterwanderte«, schrieb ein Neurologe.
Es gab einen pensionierten Polizeibeamten, der anfing, »erst irgendwann am Vormittag aufzuwachen und sich nicht wusch, solange er nicht dazu aufgefordert wurde, sich jedoch widerspruchslos fügte, sobald seine Frau ihn darauf hinwies. Anschließend saß er in seinem Sessel, aus dem er sich nicht wegbewegte.«
Ein Mann mittleren Alters war von einer Biene gestochen worden und hatte kurz darauf das Interesse verloren, mit seiner Frau, den Kindern oder Kollegen zu interagieren.
In den späten 1980ern hörte ein französischer Neurologe namens Michel Habib in Marseille von einigen dieser Fälle, wurde neugierig und begann, in den Archiven und Fachzeitschriften nach ähnlichen Fällen zu suchen. Er fand nicht viele Berichte, aber diese deckten sich in einem Punkt: Ein Verwandter brachte einen Betroffenen zum Arzt und nannte als Beschwerden plötzliche Verhaltensveränderung und Passivität. Medizinisch konnten die Ärzte nie etwas feststellen. Auch die Tests auf psychische Krankheiten fielen negativ aus. Die Betroffenen hatten einen normalen bis hohen IQ und wirkten physisch gesund. Keiner von ihnen gab an, depressiv zu sein, oder beklagte sich über seine Apathie.
Habib begann, Ärzte zu kontaktieren, die diese Patienten behandelten, und bat sie um die Kernspintomogramme. Dabei entdeckte er eine weitere Gemeinsamkeit: Alle Aufnahmen apathischer Patienten zeigten geplatzte Äderchen im Striatum, an der gleichen Stelle, an der Robert den kleinen Schatten in seinem Schädel hatte.
Das Striatum dient als eine Art Verteilerzentrum für das Gehirn, es übermittelt Befehle von Bereichen wie dem präfrontalen Kortex, wo Entscheidungen getroffen werden, zu einer älteren Hirnregion, den Basalganglien, die die Motorik regeln und emotionale Reize verarbeiten.4 Neurologen glauben, dass das Striatum dabei hilft, Entscheidungen in Handlungen umzusetzen, und zudem bei der Regulierung unserer Stimmungen eine wichtige Rolle spielt.5 Der von den geplatzten Äderchen angerichtete Schaden im primären visuellen Kortex der Patienten war gering – zu gering, wie einige von Habibs Kollegen meinten, um die Verhaltensänderungen zu erklären. Aber abgesehen von diesen geplatzten Äderchen konnte Habib nichts finden, das den Motivationsverlust bei diesen Menschen erklären könnte.6
Neurologen interessieren sich schon lange für Verletzungen dieses Bereiches, da das Striatum eine Rolle bei der Parkinson-Krankheit spielt.7 Aber wohingegen Parkinson oft Zittern, einen physischen Kontrollverlust und Depressionen hervorruft, schienen Habibs Patienten lediglich ihren Antrieb verloren zu haben.
»An Parkinson Erkrankte haben Schwierigkeiten, eine Bewegung in Gang zu setzen«, erzählte mir Habib. »Die apathischen Patienten haben jedoch keine Probleme mit der Bewegung. Sie verspüren einfach nur kein Verlangen, sich zu bewegen.« Das 19-jährige Mädchen zum Beispiel, das nicht allein am Strand gelassen werden konnte, war in der Lage, ihr Zimmer aufzuräumen, das Geschirr zu spülen, die Wäsche zu waschen und nach Rezept zu kochen, wenn ihre Mutter sie damit beauftragte. Wenn sie jedoch nicht gebeten wurde zu helfen, bewegte sie sich den ganzen Tag lang nicht. Wenn die Mutter das Mädchen fragte, was es gern zum Abendessen hätte, dann antwortete das Mädchen, keine besonderen Vorlieben zu haben.
Als er von den Ärzten untersucht wurde, so schrieb Habib, saß der 60-jährige Professor »ewig lange reglos und schweigend vor dem Arzt und wartete auf die erste Frage«. Als er gebeten wurde, seine Arbeit zu beschreiben, konnte er komplizierte Modelle erklären und aus der Erinnerung Studien zitieren. Dann verfiel er wieder in Schweigen, bis ihm die nächste Frage gestellt wurde.
Keiner der Patienten, mit denen sich Habib beschäftigte, sprach auf Medikamente an und bei keinem schien eine Therapie anzuschlagen. »Die Patienten legen gegenüber Lebensereignissen, die normalerweise eine emotionale Reaktion – positiv oder negativ – hervorrufen, völlige Gleichgültigkeit an den Tag«, schrieb Habib.
»Als hätte sich der Teil ihres Gehirns, in dem die Motivation, die Lebensschwungkraft (Élan vital) angesiedelt ist, in Luft aufgelöst«, erzählte er mir. »Es gab weder positive noch negative Gedanken. Es gab überhaupt keine Gedanken. Die Menschen hatten nichts von ihrer Intelligenz oder Wahrnehmungskraft eingebüßt. Ihre alte Persönlichkeit steckte immer noch in ihnen, aber es herrschte ein völliger Mangel an Antrieb oder Schwung. Ihre Motivation war vollständig verschwunden.«
II.
Der Raum in der University of Pittsburgh, in dem das Experiment durchgeführt wurde, war in einem fröhlichen Gelb gestrichen. Es gab einen Kernspintomografen, einen Computerbildschirm und einen lächelnden Wissenschaftler, der zu jung aussah, um schon einen Doktortitel zu haben. Jeder Teilnehmer an der Studie wurde in diesen Raum geführt, gebeten, Schmuck und sonstige Metallgegenstände abzulegen und sich dann auf einen fahrbaren Untersuchungstisch zu legen, der in die Röhre des Kernspintomografen geschoben wurde.
In der Röhre liegend, schauten die Probanden auf einen Computerbildschirm.8 Der Wissenschaftler erklärte, dass auf dem Bildschirm eine Zahl zwischen Eins und Neun erscheinen würde. Bevor die Zahl erschien, sollte der Proband raten, ob sie höher oder niedriger als Fünf sei, und auf einen entsprechenden Knopf drücken. Es würde mehrere Durchgänge geben, kündigte der Wissenschaftler an und betonte, dass es bei diesem Spiel nicht um Kompetenz gehe und keine Fähigkeiten abgefragt würden. Insgeheim hielt er das Spiel für eines der langweiligsten überhaupt. Tatsächlich war es mit genau dieser Intention konzipiert worden.
In Wahrheit interessierte es den Wissenschaftler, Mauricio Delgado auch gar nicht, ob die Probanden richtig oder falsch rieten. Für ihn war es viel spannender herauszufinden, welche Teile des Gehirns aktiv wurden, während die Testpersonen dieses unsäglich langweilige Spiel spielten. Der Tomograf zeigte dabei die Aktivität innerhalb des Kopfes auf. Delgado wollte herausfinden, wo Gefühle von Aufgeregtheit oder Erwartung – die Motivation – ihren Ursprung nehmen.9 Delgado sagte den Teilnehmern, dass sie jederzeit aufhören könnten. Aus Erfahrung wusste er jedoch, dass sie immer weiterraten würden, manchmal stundenlang.
Die jeweilige Testperson in der Röhre betrachtete aufmerksam den Bildschirm, traf Vorhersagen und drückte auf den entsprechenden Knopf. Manche jubelten, wenn sie recht hatten, oder stöhnten auf, wenn sie falschlagen. Delgado überwachte die Aktivität im Inneren ihres Kopfes und sah, dass das Striatum – das Verteilerzentrum – aufleuchtete, wenn die Patienten spielten, und zwar unabhängig vom Ergebnis. Delgado wusste, dass diese Art von Aktivität des Striatums mit emotionalen Reaktionen in Verbindung steht – vor allem mit Gefühlen von Erwartung und Aufgeregtheit.
Am Ende einer Sitzung fragte ihn ein Teilnehmer, ob er zu Hause weiterspielen könne.
»Das wird wohl nicht gehen«, antwortete Delgado und erklärte, dass dieses Spiel nur in seinem Computer existiere. Davon abgesehen, fuhr er fort und weihte den Teilnehmer in eines seiner Geheimnisse ein, sei das Experiment manipuliert. Um sicherzugehen, dass der Test bei allen Probanden gleich ablief, hatte Delgado den Computer so programmiert, dass jeder Teilnehmer die erste Runde gewann, die zweite verlor, die dritte gewann, die vierte verlor und so weiter – ein vorherbestimmtes Muster. Das Ergebnis stand bereits fest, und es war in etwa so, als würde man eine Münze werfen, die auf beiden Seiten einen Kopf zeigt.
»Das macht nichts«, antwortete der Mann. »Es stört mich nicht. Ich möchte einfach nur spielen.«
»Das war seltsam«, erzählte mir Delgado später. »Wo bitte liegt der Spaß bei einem manipulierten Spiel? Die getroffene Entscheidung ist bedeutungslos. Dennoch brauchte ich fünf Minuten, um dem Mann auszureden, das Spiel mit nach Hause nehmen zu wollen.«
Noch tagelang dachte Delgado über ihn nach. Warum hatte ihn das Spiel so fasziniert? Und wieso hatten auch die anderen Teilnehmer immer weitergespielt? Das Experiment hatte Delgado geholfen herauszufinden, welche Teile des Gehirns bei Ratespielen aktiv werden. Die Daten erklärten jedoch nicht, was die Probanden motivierte, es überhaupt zu spielen.
Ein paar Jahre später führte Delgado ein weiteres Experiment durch. Neue Teilnehmer wurden angeworben. Auch dieses Mal gab es ein Ratespiel, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Die Hälfte der Zeit durften die Teilnehmer selber raten; in der zweiten Hälfte entschied der Computer für sie.10
Als die Probanden zu spielen begannen, beobachtete Delgado die Aktivität ihres Striatums. Wenn sie selber raten durften, leuchtete ihr Gehirn wie beim ersten Experiment auf und zeigte die neurologischen Entsprechungen von Erwartung und Aufgeregtheit. Aber sobald der Computer für sie das Raten übernahm, tat sich im Striatum so gut wie nichts mehr – als hätte ihr Gehirn das Interesse an dieser Übung verloren. Nur wenn die Teilnehmer selber raten durften, gab es »starke Aktivität im Nucleus caudatus«, schrieben Delgado und seine Kollegen später. »Die Erwartung des Ratens selbst ging einher mit gesteigerter Aktivität in kortiko-striatalen Hirnregionen, vor allem im ventralen Striatum, die in gefühlsbedingte und motivationale Prozesse einbezogen sind.«
Als Delgado die Teilnehmer im Anschluss fragte, wie ihnen das Spiel gefallen habe, gaben sie an, wesentlich mehr Spaß gehabt zu haben, wenn sie selber raten konnten. Es war ihnen nicht egal, ob sie gewannen oder verloren. Wenn jedoch der Computer entschied, hätten sie sich gefühlt wie bei einer Pflichterfüllung. Dann hätten sie angefangen, sich zu langweilen, und gewollt, dass es bald vorbei ist.
Das ergab für Delgado keinen Sinn. Die Chancen zu gewinnen oder zu verlieren waren exakt dieselben, ob der Proband oder der Computer entschied. Selber zu raten, statt darauf zu warten, dass der Computer eine Entscheidung trifft, dürfte für die Gefühle beim Spielen keine Konsequenzen haben. In beiden Fällen müssten die neurologischen Reaktionen der Probanden gleich sein. Aber irgendwie veränderte es das Spiel, wenn die Teilnehmer selber raten durften. Statt als lästige Pflicht erlebt zu werden, wurde das Experiment zur Herausforderung. Die Teilnehmer waren allein deshalb stärker motiviert, weil sie glaubten, die Kontrolle zu haben.11
III.
In den vergangenen Jahrzehnten, als sich die Wirtschaft veränderte und das Versprechen lebenslanger Beschäftigungsverhältnisse in Großunternehmen Platz machte für freie Mitarbeit und Jobwechsel als Karriereweg, wurde es zunehmend wichtiger, Motivation zu verstehen. 1980 berichteten 90 Prozent der berufstätigen Amerikaner an einen Chef.12 Heute sind mehr als ein Drittel der berufstätigen Amerikaner Freiberufler, Auftragnehmer oder befinden sich in anderen befristeten Arbeitsverhältnissen.13 Die Berufstätigen, die in dieser neuen Wirtschaft Erfolg haben, sind diejenigen, die wissen, wie sie für sich selbst Entscheidungen treffen, ihre Zeit verbringen und ihre Energie aufteilen.14 Sie haben verstanden, wie man sich Ziele setzt, Aufgaben nach Prioritäten ordnet und Entscheidungen fällt, welche Projekte weiterverfolgt werden. Studien zufolge verdienen Menschen, die sich selbst motivieren können, mehr Geld als ihre »Kollegen«, berichten von höherer Lebenszufriedenheit und bezeichnen sich als glücklicher im Hinblick auf Familie, Job und Leben.
Selbsthilfebücher und Ratgeber für Führungskräfte beschreiben Selbstmotivation oft als statisches Merkmal unserer Persönlichkeit oder das Ergebnis eines Abwägungsprozesses, bei dem wir unbewusst Bemühung mit Belohnung in Relation setzen. Wissenschaftler sind jedoch der Auffassung, dass Motivation komplizierter ist. Motivation ist eher wie eine Fähigkeit, ähnlich dem Schreiben oder Lesen, die erlernt und verfeinert werden kann. Forscher fanden heraus, dass Menschen ihre Selbstmotivation verbessern können, wenn sie auf die richtige Weise daran arbeiten. Der Trick, so sagen sie, besteht darin, sich klarzumachen, dass eine Voraussetzung für Motivation das Gefühl ist, Macht über unsere Handlungen und unser Umfeld haben. Um uns selbst zu motivieren, müssen wir das Gefühl der Kontrolle haben.
»Das Bedürfnis nach Kontrolle ist ein biologischer Imperativ«, schrieb eine Gruppe Psychologen der Columbia University 2010 in der Fachzeitschrift Trends in Cognitive Sciences.15 Wenn Menschen glauben, die Kontrolle zu haben, arbeiten sie in der Regel härter und treiben sich selbst mehr an. Sie sind im Schnitt selbstbewusster und überwinden schneller Rückschläge.16 Menschen, die glauben, die Macht über sich selbst zu haben, leben oft länger als andere in dieser Vergleichsgruppe.17 Der die Kontrolle betreffende Instinkt ist so zentral für die Entwicklung unseres Gehirns, dass Kinder, die einmal gelernt haben, selbstständig zu essen, sich weigern, gefüttert zu werden, auch wenn dadurch vermutlich mehr von dem Essen in ihren Mund gelangen würde.18
Eine Möglichkeit, uns zu beweisen, dass wir die Kontrolle haben, besteht im Fällen von Entscheidungen. »Jede Entscheidung – und sei sie noch so banal – verstärkt die Wahrnehmung von Kontrolle und Selbsteffizienz«, erklärten die Forscher der Columbia University. Auch wenn das Treffen einer Entscheidung keinen Nutzen bringt, wollen Menschen Entscheidungsfreiheit.19»Tiere und Menschen bevorzugen das Sich-entscheiden-Können gegenüber dem Nicht-entscheiden-Können, auch wenn diese Entscheidung keinen zusätzlichen Nutzen bringt«, stellt Delgado in einem Aufsatz fest, der 2011 in der Fachzeitschrift Psychological Science erschien.20
Aus diesen Erkenntnissen entstand eine Theorie der Motivation: Der erste Schritt beim Schaffen von Antrieb besteht darin, den Menschen Entscheidungsmöglichkeiten zu geben, die ihnen das Gefühl von Autonomie und Selbstbestimmung vermitteln.21 In Experimenten zeigten sich Probanden stärker motiviert, schwierige Aufgaben zu erfüllen, wenn diese als Entscheidungen und nicht als Befehle erlebt wurden. Das ist einer der Gründe, warum Ihr Kabelanbieter all diese Fragen stellt, wenn Sie bei ihm einen Vertrag abschließen. Wenn er wissen möchte, ob Sie eine papierlose Rechnung gegenüber einem Einzelverbindungsnachweis bevorzugen oder HD-Qualität oder das Sportpaket gegenüber Spielfilmen, sind Sie wahrscheinlich motivierter, jeden Monat die Rechnung zu bezahlen. Solange wir ein Gefühl von Kontrolle haben, sind wir eher bereit mitzuspielen.
»Kennen Sie das? Wenn Sie auf der Autobahn im Stau stecken und sich langsam einer Ausfahrt nähern, wollen Sie diese nehmen, obwohl Sie dann vermutlich länger brauchen, um nach Hause zu kommen?«, fragt Delgado. »Unser Gehirn begeistert sich in dem Moment für die Möglichkeit, die Kontrolle zu übernehmen. Sie kommen nicht schneller nach Hause, aber es fühlt sich besser an, weil Sie das Gefühl haben, der Chef zu sein.«
Das ist eine nützliche Lektion für alle, die hoffen, sich selbst oder andere zu motivieren, denn sie legt eine einfache Methode nahe, den Willen zum Handeln auszulösen. Finden Sie eine Wahlmöglichkeit – es kann nahezu jede sein –, die es Ihnen ermöglicht, Kontrolle auszuüben. Wenn Sie damit hadern, einen Haufen nerviger E-Mails zu beantworten, entscheiden Sie sich für eine aus der Mitte Ihres Posteingangs. Wenn Sie einen Bericht schreiben müssen, formulieren Sie zuerst den Schluss oder beginnen Sie mit den Grafiken oder was auch immer Sie am meisten interessiert. Um die Motivation zu finden, einen unangenehmen Mitarbeiter zur Rede zu stellen, entscheiden Sie, wo das Gespräch stattfinden soll. Um den nächsten Verkaufsanruf zu tätigen, legen Sie fest, welche Frage Sie zuerst stellen.
Motivation wird dadurch ausgelöst, dass wir Entscheidungen treffen, die uns signalisieren, die Kontrolle zu haben. Die konkrete Entscheidung ist dabei weniger wichtig als die Geltendmachung von Kontrolle. Es ist das Gefühl von Selbstbestimmung, das uns antreibt. Deshalb waren Delgados Teilnehmer bereit, immer weiterzuspielen, wenn sie glaubten, das Sagen zu haben.
Was nicht heißen soll, dass es immer einfach ist, sich zu motivieren. Manchmal genügt es leider nicht, eine Entscheidung zu treffen. Um uns zu motivieren, ist hin und wieder ein bisschen mehr nötig.
IV.
Nachdem Eric Quintanilla das Formular unterschrieben hatte, das ihn offiziell zu einem U.S. Marine machte, schüttelte ihm der Rekrutierungsoffizier die Hand, schaute ihm in die Augen und sagte, dass er die richtige Entscheidung getroffen habe.
»Es ist die einzige Möglichkeit, die ich für mich sehe, Sir«, antwortete Quintanilla. Er wollte, dass seine Worte kühn und selbstbewusst klangen, doch seine Stimme zitterte und seine Hand war so feucht, dass sich beide anschließend die Hand an der Hose abwischten. Quintanilla war 23 Jahre alt. Fünf Jahre zuvor hatte er seinen Abschluss an der Highschool einer Kleinstadt unweit von Chicago gemacht. Er hatte überlegt, ein Studium anzufangen, wusste aber nicht, was er belegen, und auch nicht, was er anschließend beruflich machen sollte. In vielen Dingen war er sich unsicher. Also schrieb er sich am örtlichen Community College ein, erlangte nach zwei Jahren einen Associate Degree in General Studies und hoffte, damit einen Job in einem Handy-Shop im Einkaufszentrum zu bekommen. »Ich habe bestimmt zehn Bewerbungen verschickt«, sagte Quintanilla. »Und auf keine auch nur eine Antwort erhalten.«
In einem Geschäft für Bastelbedarf fand er schließlich eine Teilzeitstelle und fuhr gelegentlich einen Kühlwagen, wenn der eigentliche Fahrer krank oder in Urlaub war. Nach Feierabend spielte er World of Warcraft. So hatte sich Quintanilla sein Leben nicht vorgestellt. Er war bereit für etwas Besseres und entschied, dem Mädchen, mit dem er seit der Highschool zusammen war, einen Heiratsantrag zu machen. Die Hochzeit war wunderbar, doch danach ging sein bisheriges Leben unverändert weiter. Und dann wurde seine Frau schwanger. Noch einmal versuchte er es bei den Handy-Shops und wurde sogar zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Am Abend vorher übte er mit seiner Frau dafür.
»Schatz«, sagte sie zu ihm, »du musst denen einen Grund geben, warum sie dich einstellen sollen. Erzähl ihnen einfach, worauf du dich freust.«
Als ihn der Filialleiter am nächsten Tag fragte, warum er Mobiltelefone verkaufen wolle, erstarrte Quintanilla. »Keine Ahnung«, sagte er. Das war die Wahrheit. Er wusste es nicht.
Ein paar Wochen später traf Quintanilla auf einer Party einen ehemaligen Klassenkameraden, der gerade von der Grundausbildung zurückgekehrt war – 20 Pfund leichter, mit hervortretenden Muskeln und einem neu entdeckten Selbstbewusstsein. Er erzählte Witze und baggerte die Mädchen an. Vielleicht, so sagte Quintanilla am nächsten Morgen zu seiner Frau, sollte er zu den Marines gehen. Ihr gefiel die Idee nicht, genauso wenig wie seiner Mutter, aber Quintanilla wusste nicht, was er sonst tun könnte. Noch am selben Abend setzte er sich an den Küchentisch, zog mitten auf einem Blatt Papier einen Strich von oben bis unten, schrieb »Marinekorps« über die linke Spalte und versuchte, die rechte Spalte mit Alternativen zu füllen. Das Einzige, was ihm dazu einfiel, war: »In dem Geschäft für Bastelbedarf befördert werden.«
Fünf Monate später traf er mitten in der Nacht im San Diego Marine Corps Recruit Depot ein, schlurfte zusammen mit 80 anderen jungen Männern in einen Raum, wo ihm der Kopf geschoren, sein Blut getestet, seine Kleidung durch eine Uniform ersetzt wurde und er in sein neues Leben startete.22
Das 13-wöchige Bootcamp, das für Quintanilla 2010 begann, war ein relativ neues Experiment in dem 235-jährigen Bestreben des Korps, den perfekten Marine zu schaffen. Während der meisten Zeit seiner bisherigen Geschichte hatte sich das Ausbildungsprogramm für den Dienst darauf konzentriert, aus halbstarken Teenagern disziplinierte Truppen zu formen. Aber 15 Jahre vor Quintanillas Eintritt in die Armee wurde ein 53-jähriger General namens Charles C. Krulak zum Commandant befördert, dem obersten Befehlshaber der Marines. Krulak war davon überzeugt, dass die Grundausbildung verändert werden müsse. »Wir haben es mit wesentlich schwächeren Anwärtern zu tun«, erzählte er mir. »Viele dieser Kids brauchen nicht einfach nur Disziplin, sondern eine mentale Runderneuerung. Sie haben nie einer Sportmannschaft angehört, hatten noch nie einen richtigen Job, haben überhaupt noch nie etwas getan. Sie verfügen nicht einmal über das Vokabular bezüglich Ambitionen. Sie haben ihr Leben lang Anweisungen ausgeführt.«23
Das war ein Problem, denn das Korps brauchte immer mehr Soldaten, die in der Lage sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Marines – wie sie Ihnen gern bestätigen werden – unterscheiden sich von anderen Soldaten oder Matrosen. »Wir sind die Ersten, die eintreffen, und die Letzten, die gehen«, sagte Krulak. »Wir brauchen Leute mit viel Eigeninitiative.« In der heutigen Welt bedeutet das, dass das Korps Männer und Frauen braucht, die in der Lage sind, an Orten wie Somalia und Bagdad zu kämpfen, wo sich Regeln und Taktiken unvorhersehbar ändern und Marines oft Entscheidungen treffen müssen – allein und unmittelbar –, wie man am besten vorgeht.24
»Ich setzte mich mit Psychologen und Psychiatern zusammen und versuchte herauszufinden, was wir besser machen können, um diesen Rekruten beizubringen, selbstständig zu denken«, erläuterte Krulak. »Zu uns kamen tolle Rekruten, aber sie hatten nicht die geringste Zielrichtung oder auch nur eine Spur von Antrieb. Alles, was sie wussten, war, das unabdingbare Minimum zu tun. Das ist so, als würde man mit einem Packen nasser Socken arbeiten. Aber Marines können keine nassen Socken sein.«
Krulak begann, Abhandlungen zu studieren, wie man Selbstmotivation unterrichtet, und fand besonders die vom Korps Jahre zuvor durchgeführten Untersuchungen spannend, die gezeigt hatten, dass die erfolgreichsten Marines jene mit einer »ausgeprägten internalen Kontrollüberzeugung« waren – der Überzeugung, dass sie ihr Schicksal durch die von ihnen getroffenen Entscheidungen beeinflussen können.
Seit den 1950er-Jahren war die Kontrollüberzeugung ein wichtiges Untersuchungsgebiet innerhalb der Psychologie.25 Forscher stellten fest, dass Menschen mit einer internalen Kontrollüberzeugung dazu neigen, sich selbst zu tadeln oder zu loben für Scheitern beziehungsweise Erfolg, statt diese Verantwortung Dingen außerhalb ihres Einflusses zuzuschreiben. Zum Beispiel wird ein Schüler mit einer starken internalen Kontrollüberzeugung gute Noten seiner harten Arbeit zuschreiben statt seiner natürlichen Intelligenz. Ein Verkäufer mit einer internalen Kontrollüberzeugung wird ein verlorenes Geschäft seinem persönlichen Mangel an Hartnäckigkeit zuschreiben, statt es als Pech zu verbuchen.
»Die internale Kontrollüberzeugung wird im Zusammenhang mit wissenschaftlichem Erfolg, größerer Selbstmotivation und sozialer Reife, geringerem Vorkommen von Stress und Depressionen und einem längeren Leben gesehen«, schrieb 2012 ein Psychologenteam in der Fachzeitschrift Problems and Perspectives in Management.26 Menschen mit internaler Kontrollüberzeugung verdienen in der Regel mehr Geld, haben mehr Freunde, bleiben länger verheiratet und berichten von größerer beruflicher Zufriedenheit und mehr Erfolg. Im Gegensatz dazu wird eine externale Kontrollüberzeugung – die Überzeugung, dass das eigene Leben vorrangig von Ereignissen außerhalb Ihrer Kontrolle beeinflusst wird – in Zusammenhang gesehen mit höherem Stresslevel, [oftmals] weil ein Individuum die Situation als seine oder ihre Bewältigungsstrategien übersteigend erlebt«, stellten die Autoren fest.
Studien zeigen, dass die Kontrollüberzeugung eines Menschen durch Training und Feedback beeinflusst werden kann. So konfrontierte zum Beispiel ein 1998 durchgeführtes Experiment 128 Fünftklässler mit einer Reihe schwieriger Denksportaufgaben.27 Anschließend wurde jedem Schüler gesagt, dass er sehr gut abgeschnitten habe. Der Hälfte von ihnen wurde zudem gesagt: »Du musst hart an der Lösung des Problems gearbeitet haben.« Wie sich zeigte, aktivierte es die internale Kontrollüberzeugung der Schüler zu hören, sie hätten hart an der Problemlösung gearbeitet. Die Schüler zu ihrer harten Arbeit zu beglückwünschen, verstärkte deren Überzeugung, die Kontrolle über sich und ihre Umgebung zu haben.
Der anderen Hälfte der Schüler wurde ebenfalls gesagt, dass sie gut abgeschnitten hätten, und dann hinzugefügt: »Du musst in diesen Dingen echt clever sein.« Die Schüler zu ihrer Intelligenz zu beglückwünschen, aktivierte die externale Kontrollüberzeugung. Die meisten Fünftklässler sind davon überzeugt, keinen Einfluss auf ihre Intelligenz zu haben. Im Allgemeinen glauben jüngere Schüler, dass Intelligenz eine angeborene Fähigkeit sei, deshalb verstärkt es ihre Überzeugung, dass Erfolg oder Scheitern außerhalb ihrer Kontrolle liegen, wenn man ihnen sagt, dass sie intelligent sind.
Dann wurden alle Schüler gebeten, an drei weiteren Denkspielen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu arbeiten.
Die für ihre Intelligenz gelobten Schüler – denen vermittelt worden war, dass sie den Ausgang nicht willentlich beeinflussen konnten – konzentrierten sich in dieser zweiten Spielrunde sehr viel stärker auf die einfacheren Rätsel, obwohl sie für ihre Intelligenz gelobt worden waren. Sie waren weniger motiviert, sich selbst anzutreiben. Später sagten sie, das Experiment habe nicht sonderlich viel Spaß gemacht.
Im Gegensatz dazu wandten sich die Schüler, die für ihre harte Arbeit gelobt worden waren – und die man dadurch ermutigt hatte, die Erfahrung im Hinblick auf Selbstbestimmung zu gestalten –, den schwierigeren Rätseln zu. Sie arbeiteten länger und schnitten besser ab. Später gaben sie an, viel Spaß dabei gehabt zu haben.
»Internale Kontrollüberzeugung ist eine erlernte Fähigkeit«,28 erzählte mir Carol Dweck, die Stanford-Psychologin, die an der Durchführung dieser Studie mitwirkte. »Die meisten von uns erlernen sie früh in ihrem Leben. Aber bei einigen Menschen wird das Gefühl der Selbstbestimmung unterdrückt durch die Art ihrer Erziehung oder Erfahrungen, die sie gemacht haben, und sie vergessen, wie viel Einfluss sie auf ihr eigenes Leben haben können. Dann ist ein Training hilfreich, denn wenn man Menschen in Situationen bringt, in denen sie üben können, das Gefühl der Kontrolle zu haben, in denen die internale Kontrollüberzeugung neu geweckt wird, dann können diese Menschen anfangen, Gewohnheiten zu entwickeln, die ihnen das Gefühl geben, über ihr Leben selbst zu bestimmen – und je stärker sie sich so fühlen, desto stärker sind sie tatsächlich.«29
Für Krulak schienen Studien wie diese den Schlüssel zu enthalten, wie man Rekruten Selbstmotivation beibringt. Wenn er die Grundausbildung so umgestalten könnte, dass die Auszubildenden gezwungen waren, Kontrolle über ihre eigenen Entscheidungen zu übernehmen, würde sich dieser Impuls verstärken, so hoffte er. »Heute nennen wir es ›Vermitteln einer Tendenz zum Handeln‹«, erzählte mir Krulak. »Die Idee dahinter ist, dass Rekruten, sobald sie in ein paar Situationen die Kontrolle übernommen haben, anfangen zu lernen, wie gut sich das anfühlt. Wir sagen nie zu jemandem, er sei der geborene Anführer. ›Geboren‹ bedeutet ›außerhalb deiner Kontrolle liegend‹«, fuhr er fort. »Stattdessen bringen wir ihnen bei, dass Führungsfähigkeit erlernt ist, ein Produkt des Bemühens. Wir treiben die Rekruten an, diesen Nervenkitzel des Übernehmens von Kontrolle zu erfahren, diesen Rausch, das Sagen zu haben. Sobald wir es geschafft haben, dass sie süchtig danach sind, haben wir sie am Haken.«
Für Quintanilla begann diese Übung direkt nach seiner Ankunft. Anfangs gab es lange Tage mit anstrengenden Märschen, endlose Sit-ups und Push-ups und ermüdendes Exerzieren mit dem Gewehr. Ständig wurde er von Ausbildern angeschrien. (»Wir mussten ein Image aufrechterhalten«, erzählte mir Krulak.) Aber neben diesen Übungen wurde Quintanilla auch mit einem steten Strom von Situationen konfrontiert, die ihn zwangen, Entscheidungen zu fällen und die Kontrolle zu übernehmen.
In seiner vierten Trainingswoche wurde Quintanillas Ausbildungseinheit zum Beispiel aufgetragen, die Kantine zu putzen. Die Rekruten hatten keine Ahnung, wie sie das anstellen sollten. Sie wussten nicht, wo das Putzzeug untergebracht war oder wie die Industriespülmaschine funktionierte. Das Mittagessen war gerade vorbei, und sie wussten nicht, ob sie die Reste einpacken oder einfach wegwerfen sollten. Jedes Mal, wenn einer von ihnen bei einem Ausbilder nachfragte, bekam er einen Anschiss. Also begann die Einheit, Entscheidungen zu treffen. Der Tomatensalat wurde weggeworfen, die übrig gebliebenen Hamburger kamen in den Kühlschrank. Und die Spülmaschine wurde mit so viel Reinigungsmittel gefüllt, dass der austretende Schaum schon bald den Fußboden bedeckte. Es dauerte dreieinhalb Stunden, einschließlich des Aufwischens, bis die Einheit die Kantine sauber hatte. Aus Unwissenheit warfen sie noch essbare Lebensmittel weg, schalteten aus Versehen einen Kühlschrank aus und schafften es, zwei Dutzend Gabeln falsch einzuräumen. Nach getaner Arbeit ging ihr Ausbilder jedoch auf den Kleinsten, Schüchterndsten aus ihrer Einheit zu und sagte, er habe mitbekommen, wie der Rekrut sich durchgesetzt habe, als eine Entscheidung nötig war, wo man den Ketchup hinstellen sollte. In Wahrheit war es ziemlich offensichtlich, wo der Ketchup aufbewahrt wurde. Es gab mehrere Regale, in denen nichts als Ketchupflaschen standen.30 Aber der schüchterne Rekrut strahlte über das Lob.
»Ich verteilte eine Reihe von Komplimenten, und alle waren so konzipiert, dass sie unerwartet kamen«, sagte Sergeant Dennis Joy, ein durch und durch Furcht einflößender Ausbilder, der mich eines Tages durch das Rekrutenlager führte. »Du wirst nie für das belohnt, was dir leichtfällt. Wenn du Sportler bist, würde ich dir nicht zu deinem guten Lauf gratulieren. Nur der kleine Kerl wurde dafür gelobt, dass er so schnell gerannt ist. Nur der schüchterne Kerl wurde gelobt, weil er in die Rolle des Anführers geschlüpft war. Wir loben Menschen, wenn sie etwas tun, das ihnen schwerfällt. Auf diese Weise lernen sie zu glauben, dass sie es schaffen können.«
Das Kernstück von Krulaks überarbeitetem Grundlagentraining war die Feuerprobe, eine mörderische, dreitägige Herausforderung am Ende des Bootcamps. Quintanilla fürchtete sich vor der Feuerprobe. Er und seine Zimmergenossen unterhielten sich nachts flüsternd darüber. Es gab Gerüchte und wilde Spekulationen. Irgendjemand erzählte, dass im vergangenen Jahr ein Rekrut bei dieser Übung eines seiner Gliedmaßen verloren hätte. Quintanillas Feuerprobe begann an einem Dienstagmorgen, als seine Einheit um zwei Uhr früh geweckt wurde und man ihr sagte, sie solle sich fertig machen zum Marschieren, Kriechen und Klettern – über einen 80 Kilometer langen Hindernisparcours.31 Jeder trug 30 Pfund an Ausrüstung mit sich. Sie hatten nur zwei Mahlzeiten pro Person, die für 54 Stunden reichen mussten. Sie konnten bestenfalls auf ein paar Stunden Schlaf hoffen. Verletzungen waren einkalkuliert. Jeder, der stehen blieb oder zu weit zurückfiel, so sagte man ihnen, würde aus der Truppe fliegen.
Nach der Hälfte der Feuerprobe stießen die Rekruten auf eine Aufgabe namens /in »Sergeant Timmermans Tank«. »Der Feind hat dieses Gebiet chemisch kontaminiert«, brüllte ein Ausbilder und zeigte auf ein Matschgelände von der Größe eines Fußballfelds. »Das müsst ihr mit vollem Marschgepäck und Gasmaske überqueren. Wenn ein Rekrut hinfällt, seid ihr gescheitert und müsst von vorn anfangen. Wenn ihr länger als 60 Minuten auf dem Feld seid, gilt das ebenfalls als gescheitert und ihr müsst von vorn anfangen. Ihr müsst eurem Teamführer gehorchen. Ich wiederhole: Ohne direkte verbale Anordnung eures Teamführers geht ihr nicht weiter. Ihr müsst einen Befehl hören, bevor ihr handelt, andernfalls seid ihr gescheitert und müsst von vorn anfangen.«
Quintanillas Team bildete einen Kreis und setzte eine Technik ein, die sie in der Grundausbildung gelernt hatten.
»Was ist unser Hindernis?«, fragte einer der Rekruten.
»Ein Feld zu überqueren«, antwortete ein anderer.
»Wie setzen wir die Bretter ein?«, fragte ein weiterer Rekrut und zeigte auf die beiden Planken, an denen Seile befestigt waren.
»Wir könnten das jeweils hintere an das vordere legen und uns einen Weg bauen«, antwortete jemand. Der Teamführer erteilte einen verbalen Befehl und der Kreis löste sich auf, um die Idee längs des Felds zu testen. Sie stellten sich auf ein Brett und zogen das andere vor. Niemand konnte das Gleichgewicht halten. Sie bildeten wieder einen Kreis. »Wie nutzen wir die Seile?«, fragte ein Rekrut.
»Um die Bretter anzuheben«, antwortete jemand. Er schlug vor, sich hintereinander auf beide Bretter zu stellen und mithilfe der Seile jeweils ein Brett anzuheben, wie beim Skifahren.
Alle setzten ihre Gasmasken auf und stellten sich hinter dem Anführer auf die Bretter. »Links!«, brüllte er und die Rekruten zogen das entsprechende Brett langsam vorwärts. »Rechts!« Sie schoben sich langsam über das Feld. Nach zehn Minuten stand jedoch fest, dass es nicht funktionieren würde. Einige hoben das Brett zu schnell, andere schoben es zu weit nach vorn. Und weil sie alle Gasmasken trugen, war es unmöglich, die Anweisungen des Teamführers zu hören. Sie waren bereits zu weit, um umkehren zu können – aber in diesem Tempo würden sie für die Überquerung Stunden brauchen. Die Rekruten brachten einander durch Zurufen zum Anhalten.
Der Teamführer befahl eine Pause. Dann wandte er sich dem Mann hinter ihm zu. »Achte auf meine Schultern«, brüllte er durch seine Gasmaske. Der Teamführer zuckte erst mit der linken, dann mit der rechten Schulter. Indem er den Rhythmus des Teamführers beobachtete, konnte der Rekrut hinter ihm das Anheben der Bretter koordinieren. Das einzige Problem bestand darin, dass diese Vorgehensweise gegen eine der Grundregeln verstieß. Man hatte ihnen gesagt, sie dürften nur auf ein verbales Kommando von ihrem Teamführer reagieren. Durch die Gasmasken konnten sie jedoch nichts hören. Es gab aber keine andere Möglichkeit weiterzukommen. Also begann der Teamführer mit den Schultern zu zucken und die Arme zu schwingen, während er Befehle brüllte. Anfangs kapierte es niemand, also begann er, eines der Lieder zu brüllen, die sie auf langen Märschen gelernt hatten. Der Rekrut hinter ihm konnte genug davon aufschnappen, um mit einzustimmen. Sein Hintermann tat es ihm gleich. Schließlich sangen sie alle, zuckten im Gleichtakt mit den Schultern und schwangen mit den Armen. Sie überquerten das Feld in 28 Minuten.
»Rein technisch gesehen hätten wir sie zurück zum Start zurückschicken können, denn keiner konnte einen direkten verbalen Befehl vom Teamführer hören«, erzählte mir später ein Ausbilder. »Aber genau darum geht es bei der Übung. Wir wissen, dass man durch die Gasmaske nichts hören kann. Der einzige Weg, dieses Feld zu überqueren, besteht darin, das Problem zu umgehen. Wir versuchen, ihnen beizubringen, dass man nicht immer nur Befehlen gehorchen kann. Du musst die Kontrolle übernehmen und selber Lösungen finden.«
24 Stunden und ein Dutzend Hindernisse später versammelte sich Quintanillas Einheit am Fuß der letzten Herausforderung der Feuerprobe, einem lang gezogenen steilen Hügel, den sie Grim Reaper nannten. »Ihr müsst euch auf dem Reaper nicht gegenseitig helfen«, betonte Krulak. »Ich habe das schon erlebt. Rekruten stürzen, haben keine Kameraden und werden zurückgelassen.«
Zu diesem Zeitpunkt marschierte Quintanilla seit zwei Tagen und hatte weniger als vier Stunden geschlafen. Sein Gesicht war taub und seine Hände mit Blasen und Schnitten übersät vom Tragen der mit Wasser gefüllten Fässer über Hindernisse. »Es gab Kerle, die haben sich auf dem Reaper übergeben«, erzählte er mir. »Einer trug den Arm in einer Schlinge.« Als die Gruppe anfing, den Hügel hinaufzusteigen, stolperten die Männer nur so vor sich hin. Sie waren alle so erschöpft, dass sie sich wie in Zeitlupe bewegten und kaum vorankamen. Also bildeten sie eine Kette, Arm in Arm, um sich gegenseitig davor zu bewahren, den Hang hinabzustürzen.
»Warum tust du das?«, keuchte Quintanillas Kamerad und fiel in ein Frage-und-Antwort-Ritual, das sie bei Wanderungen trainiert hatten. Wenn die Situation am schlimmsten ist, so hatten ihre Ausbilder ihnen gesagt, sollten sie sich gegenseitig Fragen stellen, die mit »Warum« anfingen.
»Um ein Marine zu werden und meiner Familie ein besseres Leben bieten zu können«, sagte Quintanilla.
Seine Frau hatte eine Woche zuvor eine Tochter zur Welt gebracht, Zoey. Nach der Geburt war ihm erlaubt worden, ganze fünf Minuten mit ihr zu telefonieren. Es war der einzige Kontakt zur Außenwelt in fast zwei Monaten. Wenn er die Feuerprobe hinter sich hatte, würde er seine Frau und sein neugeborenes Kind sehen.
Wenn Sie etwas stark mit einer Entscheidung verbinden können, an der Ihnen etwas liegt, fällt Ihnen die anstehende Aufgabe leichter, hatten Quintanillas Ausbilder ihm gesagt. Deshalb stellten sie einander Fragen, die mit »Warum« anfingen. Machen Sie eine lästige Pflicht zu einer bedeutungsvollen Entscheidung, und Selbstmotivation wird einsetzen.
Als die Sonne ihren Zenit erreichte, erklomm die Einheit den Gipfel und stolperte zu einer Lichtung mit einem Flaggenmast. Alle wurden ganz still. Sie hatten es geschafft. Die Feuerprobe war überstanden. Ein Ausbilder ging durch ihre Reihen und blieb vor jedem Mann stehen, um ihm das Abzeichen mit Adler, Erdball und Anker zu überreichen. Sie waren jetzt offiziell Marines.
»Du denkst, das Bootcamp besteht nur aus Kämpfen und Herumgebrülle«, erzählte mir Quintanilla. »Aber so ist das nicht. Ganz und gar nicht. Es geht vielmehr darum zu lernen, wie du dich selbst dazu bringst, Dinge zu tun, die du dir nicht zugetraut hättest. Es geht um Gefühle.«
Die Grundausbildung, wie die Laufbahn beim Marinekorps auch, bietet nur wenige materielle Belohnungen. Das Anfangsgehalt eines Marines liegt bei 17 616 Dollar im Jahr. Allerdings weist das Korps eine der höchsten Jobzufriedenheiten überhaupt auf. Das Training, das jedes Jahr mit etwa 40 000 Rekruten durchführt wird, hat das Leben von Millionen Menschen verändert, die, so wie Quintanilla, keine Ahnung hatten, wie sie die nötige Motivation und Eigenregie aufbringen können, um die Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen. Seit Krulaks Reformen sind sowohl die Verbleibensrate neuer Rekruten wie auch die Leistungswerte der Marines um mehr als 20 Prozent gestiegen. Umfragen zeigen, dass die durchschnittliche internale Kontrollüberzeugung während der Grundausbildung deutlich zunimmt.32 Delgados Experimente waren ein Einstieg in das Verstehen von Motivation. Die Marines ergänzen diese Einsichten, indem sie uns verstehen helfen, wie man Menschen, die ungeübt sind in Selbstbestimmung, Tatendrang vermittelt. Wenn man den Menschen die Möglichkeit gibt, ein Gefühl von Kontrolle zu spüren, und sie üben lässt, Entscheidungen zu treffen, können sie lernen, ihre Willensstärke zu gebrauchen.
Um uns selbst beizubringen, uns besser zu motivieren, müssen wir darüber hinaus lernen, unsere Entscheidungen nicht nur als Ausdruck von Kontrolle zu betrachten, sondern auch als Bestätigung unserer Werte und Ziele. Aus diesem Grund fragen die Rekruten einander jeden Tag »warum« – weil es ihnen zeigt, wie sie kleine Aufgaben in einen Zusammenhang mit größeren Bestrebungen bringen können.
Die Bedeutung dieser Erkenntnis zeigt sich in einer Reihe von Studien, die in den 1990er-Jahren in Altersheimen durchgeführt wurden. Wissenschaftler untersuchten, warum manche Senioren in derartigen Einrichtungen förmlich aufblühen, während andere einem raschen physischen und psychischen Verfall anheimfallen. Sie stellten fest, dass ein entscheidender Unterschied darin besteht, dass die Senioren, die förmlich aufblühten, die Entscheidung getroffen hatten, gegen starre Zeitpläne, fixe Speisepläne und strenge Regeln zu rebellieren, die das Altersheim ihnen aufzwingen wollte.33
Einige Forscher bezeichnen diese Heimbewohner als »Umstürzler«, weil viele ihrer Entscheidungen kleine Rebellionen gegen den Status quo sind. Zum Beispiel begann eine Gruppe in einem Altersheim in Santa Fe jede Mahlzeit damit, Lebensmittel untereinander zu tauschen, um sich ihre eigenen Mahlzeiten zusammenzustellen, statt klaglos zu akzeptieren, was man ihnen servierte. Ein Bewohner erzählte einem der Wissenschaftler, dass er stets seinen Kuchen weggebe, da er, obwohl er Kuchen möge, »lieber ein zweitklassiges Essen zu sich nehmen würde, das er aber selbst zusammengestellt habe«.
Eine Gruppe von Bewohnern eines Altersheims in Little Rock verstieß gegen die Regeln der Einrichtung, indem sie die Möbel umstellten, um ihre Zimmer persönlicher zu gestalten. Weil die Kleiderschränke an der Wand festgeschraubt waren, benutzten sie ein Brecheisen – das sie sich in einem Werkzeugschrank besorgt hatten –, um die Schränke von den Wänden zu lösen. Als Reaktion darauf setzte der Heimleiter ein Meeting an, in dem er erklärte, dass es keine Notwendigkeit gäbe, selbstständig Umräumaktionen durchzuführen. Wenn die Bewohner Hilfe bräuchten, sollten sie sich an die Mitarbeiter wenden. Die Bewohner teilten ihm mit, dass sie keine Hilfe wollten, keine Erlaubnis bräuchten und weiterhin machen würden, was ihnen verdammt noch mal in den Kram passe.
Im Gesamtzusammenhang waren diese kleinen Verstöße relativ unbedeutend. Aber sie waren psychologisch wirkungsvoll, weil die Umstürzler die Rebellionen als Zeichen dafür ansahen, dass sie immer noch die Kontrolle über ihr Leben besaßen. So gingen sie zum Beispiel im Schnitt doppelt so lange spazieren wie die anderen Heimbewohner. Sie aßen ein Drittel mehr. Sie waren besser darin, die Anweisungen des Arztes zu befolgen, ihre Medizin einzunehmen, Sport zu betreiben und den Kontakt zu Familie und Freunden aufrechtzuerhalten. Diese Bewohner waren mit genauso vielen gesundheitlichen Problemen in dieses Heim gekommen wie die anderen, aber sobald sie einmal hier waren, lebten sie länger, berichteten von größerer Zufriedenheit, waren wesentlich aktiver und geistig agiler.
»Es ist der Unterschied zwischen dem Treffen von Entscheidungen, die Ihnen beweisen, dass Sie immer noch Herr über Ihr Leben sind, gegenüber dem Verfallen in eine Geisteshaltung, bei der man nur noch darauf wartet, zu sterben«, erklärte Rosalie Kane, eine Gerontologin an der University of Minnesota. »Es spielt nicht wirklich eine Rolle, ob Sie Kuchen essen oder nicht. Aber wenn Sie sich weigern, deren Kuchen zu essen, machen Sie sich selbst klar, dass die Entscheidung darüber immer noch bei Ihnen liegt.«