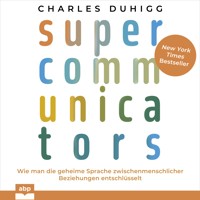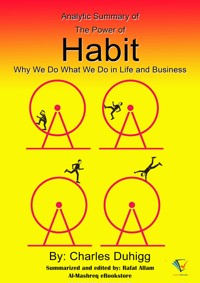25,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 25,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was wir von Superkommunikatoren lernen können Kommunikation ist eine Superkraft. Die besten Kommunikatoren wissen die verborgenen Schichten, die hinter jedem Gespräch lauern, zu erkennen und zu nutzen. Unsere Erfahrungen, unsere Werte und unser Gefühlsleben prägen jedes Gespräch – vom Flirt über die Frage, wer die Küche putzt, bis zur Gehaltsverhandlung. Eine praktische Anleitung zum erfolgreichen Kommunizieren Charles Duhigg verbindet fundierte Forschungsergebnisse mit seinem Markenzeichen: das Erzählen von Geschichten. Ein brillant geschriebener Ratgeber für alle, die lernen möchten, ihre Anliegen und Ziele erfolgreich durchzusetzen und ihre Mitmenschen besser zu verstehen. »Ein Buch, das wir alle lesen müssen. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Geschichten und Wissenschaft gibt Charles Duhigg uns mit Supercommunicators einen Leitfaden für bessere Gespräche und tiefere menschliche Beziehungen. Wenn Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten bei der Arbeit und im Leben verbessern wollen, ist dieses Buch der richtige Anfang.« Arthur C. Brooks, Professor an der Harvard Kennedy School und der Harvard Business School und Bestsellerautor der New York Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Aus dem amerikanischen Englisch von Nina Frey
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2024
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buch9loe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Supercommunicators
Einleitung
DIE DREI GESPRÄCHSTYPEN
1 – Das Übereinstimmungsprinzip
Wie man Spione besser nicht anwirbt
Gehirne im Gleichklang
Superkommunikatoren
Die drei Denkweisen
Spione anwerben heißt: eine Beziehung aufbauen
Diese Überlegungen in der Praxis
Die vier Grundregeln sinnvoller Gesprächsführung
DAS WORUM-GEHT’S-HIER-WIRKLICH?-GESPRÄCH
2 – Jedes Gespräch ist Verhandlung
Der Prozess Leroy Reed
Wie entscheiden wir, worüber wir reden möchten?
Ein Chirurg lernt kommunizieren
Der Superkommunikator im Geschworenenzimmer
Das Ziel jedes Verhandelnden: den Kuchen vergrößern
Die Kunst der Überredung
Der Verhandlungsvorgang kommt zum Ende
Diese Überlegungen in der Praxis
Fragen stellen, Hinweise erkennen
Wir bereiten uns auf eine Unterhaltung vor
Wir stellen Fragen
Wir achten im Gesprächsverlauf auf Hinweise
Wir experimentieren, indem wir das Angebot erweitern
DAS WIE-FÜHLEN-WIR-UNS?-GESPRÄCH
3 – Heilung durch das Ohr
Die gefühligen Hedgefonds-Manager
Die Macht der Fragen
Die richtigen Fragen
Von der Wichtigkeit, sich verletzlich zu machen
Gefühle sind ansteckend
Schneller tiefer
Die Freude an der Wechselseitigkeit
Nichts ist schwerer, als sich an emotionale Gespräche anzupassen
4 – Wie hört man Gefühle, die niemand ausspricht?
The Big Bang Theory
Astronautengefühle, gefriergetrocknet
Kommunikation ist, wenn man trotzdem lacht
Stimmung und Energie
Kommt ein Astronaut zum Psychiater …
The Big Bang: ein Urknall der Gefühle
Im Nachhall des Urknalls
5 – Kontakt trotz Konflikt
Mit dem Feind über Waffen sprechen
Kommunikation inmitten des Konflikts
Wie man außergewöhnliche Kommunikatoren heranbildet
In Washington wird über Waffen gesprochen
Die Liebesklempner
Die Waffendiskussion geht online
Diese Überlegungen in der Praxis
Emotionale Gespräche, im richtigen Leben und online
Auf Gefühle eingehen
Was ist im Konfliktfall anders?
Was ist online anders?
DAS WER-SIND-WIR?-GESPRÄCH
6 – Unsere soziale Identität bestimmt unsere Welt
Impfungen für die Impfgegner
Wie man die Vorurteile im Kopf zum Schweigen bringt
Feinde auf dem Fußballfeld
Wege aus der Covid-Falle
7 – Wie machen wir die schwierigsten Gespräche sicherer?
Netflix’ ewiges Problem
Warum Gespräche über Identität wichtig sind
Warum manche Gespräche so schwierig sind
Netflix’ »Keine-Regeln«-Regeln
Die Auswirkungen
Diese Überlegungen in der Praxis
Schwierige Gespräche leichter gemacht
Vor dem Gespräch
Zu Beginn des Gesprächs
Im Gesprächsverlauf
Nachwort
Dank
Hinweise zum Umgang mit Quellen
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für John Duhigg und Susan Kamil sowie Harry, Oli und Liz
Supercommunicators ist ein Sachbuch. Dennoch sind – aus Gründen der Anonymitätswahrung, zum Schutz von Persönlichkeitsrechten oder aus anderen Erwägungen – die Namen und charakterisierende Merkmale einiger Personen und Ereignisse verändert worden. Jegliche sich daraus ergebende Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und unbeabsichtigt.
Einleitung
Was Felix Sigala anging, waren sich alle einig: Mit ihm kam man leicht ins Gespräch. Außergewöhnlich leicht. Sich mit ihm zu unterhalten war eine reine Freude, weil man jedes Mal mit dem Gefühl von ihm schied, etwas Neues erfahren zu haben, ein wenig humorvoller geworden zu sein, interessanter sogar.[1] Selbst wenn man mit Felix nichts gemein hatte – was selten vorkam, denn jede Unterhaltung mit ihm förderte unweigerlich alle möglichen gemeinsamen Auffassungen, Erfahrungen oder Freunde zutage –, schien es einem, als ob er einen verstünde, ja, als ob ein tiefes Einverständnis herrschte zwischen ihm und seinem Gegenüber.
So wurde die Wissenschaft auf ihn aufmerksam.
Felix war zwei Jahrzehnte lang beim FBI gewesen. Nach dem Studium und einer Stellung beim Militär hatte er dort angeheuert und anschließend einige Jahre als Agent im Außeneinsatz verbracht. Damals war seinen Vorgesetzten erstmals aufgefallen, wie leicht er sich im Umgang mit anderen tat. Nach mehreren rasch aufeinanderfolgenden Beförderungen erhielt er schließlich ein gehobenes Amt mit der Dienstbeschreibung eines universell einsetzbaren Verhandlungsführers. Er war es, der zaudernden Zeugen die entscheidende Aussage zu entlocken vermochte, der entflohene Sträflinge dazu überredete, sich zu stellen, oder der trauernde Familien zu trösten verstand. Einmal gelang es ihm, einen Mann, der sich mit sechs Kobras, 19 Klapperschlangen und einem Leguan in einem Zimmer verbarrikadiert hatte, dazu zu bewegen, freiwillig herauszukommen und sämtliche Komplizen seines Tierschmugglerrings zu verraten. »Die Lösung bestand darin, ihn dazu zu bringen, die Lage aus der Sicht der Schlangen zu betrachten«, erzählte mir Felix. »Ein wenig seltsam war er schon, aber ein echter Tierfreund.«
Für Geiselnahmen unterhielt das FBI eine eigene Einheit für Krisenverhandlungen. Wurde die Angelegenheit ungewöhnlich brenzlig, musste jemand wie Felix ran.
Wenn jüngere Agenten Felix um Rat baten, gab er ihnen gerne ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg: Niemals so tun, als wäre man etwas anderes als ein Polizist. Niemals manipulieren, niemals drohen. Viele Fragen stellen und, falls das Gegenüber Gefühle zeigt, mit ihm weinen, lachen, klagen oder jubeln. Doch was letztlich das Geheimnis seines Erfolgs war, durchschauten selbst seine Kollegen nie so richtig.
Als schließlich im Jahr 2014 eine Arbeitsgruppe aus Psychologen, Soziologen und anderen Forschern vom Verteidigungsministerium beauftragt wurde, neue Methoden zu erkunden, um Offizieren die Kunst der Überredung und Verhandlung beizubringen – genau genommen: zu erforschen, wie man Menschen in besserer Kommunikation schult –, kamen die Wissenschaftler auf Felix zu. Sie hatten etliche Beamte gebeten, ihnen die besten Verhandlungsführer zu nennen, mit denen sie je zusammengearbeitet hatten, und wieder und wieder war sein Name gefallen.
Viele jener Wissenschaftler hatten sich Felix als hochgewachsenen, gut aussehenden Mann vorgestellt, mit warmem Blick und sonorem Bariton. Doch zum Interview erschien ein väterlicher Typ mittleren Alters mit Schnauzer, Bäuchlein und einer weichen, belegten Stimme. Er wirkte … unscheinbar.
Nachdem sich alle vorgestellt hatten und Höflichkeiten ausgetauscht worden waren, erklärte einer der Wissenschaftler Felix – wie er mir berichtete – die Grundzüge ihres Projekts und stellte schließlich eine weit gefasste Frage: »Können Sie uns sagen, wie Sie über Kommunikation denken?«
»Vielleicht ist es einfacher, wenn ich mit einem Beispiel beginne«, antwortete Felix. »Gibt es etwas, woran Sie besonders gerne zurückdenken?«
Der Wissenschaftler, mit dem Felix sich unterhielt, hatte sich als Leiter eines großen Forschungslabors vorgestellt. Er trug Verantwortung für Fördergelder in Millionenhöhe und Dutzende von Mitarbeitern. Er wirkte nicht wie jemand, der zur Mittagsstunde in müßigen Erinnerungen schwelgte.
Der Forscher hielt inne. »Wahrscheinlich die Hochzeit meiner Tochter«, antwortete er schließlich. »Die ganze Familie war zusammen, und nur wenige Monate darauf ist meine Mutter gestorben.«
Felix stellte ein paar Anschlussfragen und steuerte einige eigene Erinnerungen bei. »Meine Schwester hat 2010 geheiratet«, erklärte Felix dem Mann. »Sie ist inzwischen verstorben, an Krebs. Das war hart, aber an diesem Hochzeitstag war sie so wunderschön. Genau so will ich sie in Erinnerung behalten.«
So ging es die nächste Dreiviertelstunde weiter: Felix stellte den Wissenschaftlern Fragen und erzählte gelegentlich über sich. Wenn jemand etwas Persönliches preisgab, antwortete Felix mit einer Episode aus seinem eigenen Leben. Ein Wissenschaftler erwähnte Schwierigkeiten, die er mit seiner halbwüchsigen Tochter durchmachte, und Felix beschrieb daraufhin eine Tante, mit der er anscheinend selbst nicht zurechtkam, so redlich er sich auch mühte. Als ein anderer Forscher Felix nach seiner Kindheit fragte, erklärte dieser, er sei damals entsetzlich schüchtern gewesen – doch sein Vater sei Verkäufer gewesen (und sein Großvater ein Trickbetrüger), und indem er diese Vorbilder nachahmte, habe er allmählich gelernt, wie man zu anderen einen Draht aufbaut.
Als sich der Termin seinem Ende zuneigte, schaltete sich eine Psychologieprofessorin ein. »Verzeihen Sie«, sagte sie, »so nett dieses Treffen war, aber Ihre Arbeitsweise verstehe ich immer noch nicht. Warum, glauben Sie, haben so viele Leute uns an Sie verwiesen?«
»Berechtigte Frage«, erwiderte Felix. »Bevor ich antworte, möchte ich selbst etwas fragen: Sie haben erwähnt, dass Sie alleinerziehende Mutter sind, und ich stelle mir vor, es ist nicht einfach, Mutterschaft und Karriere unter einen Hut zu bringen. Das mag jetzt unerwartet klingen, aber ich frage mich: Was würden Sie jemandem raten, der eine Scheidung vor sich hat?«
Die Frau stutzte kurz. »Gut, meinetwegen«, sagte sie. »Tipps hätte ich da mehr als genug. Als ich mich von meinem Mann getrennt habe …«
Felix fiel ihr sanft ins Wort.
»Auf die Antwort kommt es gar nicht so an«, sagte er. »Ich weise nur darauf hin, dass Sie jetzt, nach einem Gespräch von nicht einmal einer Stunde, in einem Raum voller Fachkollegen, bereit wären, über einen der intimsten Bereiche Ihres Lebens zu sprechen.« Einer der Gründe für diese Unbefangenheit, erklärte er, war vermutlich die Umgebung, die sie gemeinsam hergestellt hatten – indem Felix genau zugehört und Fragen gestellt hatte, die seine Gesprächspartner in ihren empfindlichsten Bereichen aus der Reserve gelockt und dazu gebracht hatten, einander Hochpersönliches anzuvertrauen. Felix hatte die Wissenschaftler dazu ermuntert, ihre Sicht auf die Dinge zu erklären, und ihnen dann bewiesen, dass er sie verstanden hatte. Jedes Mal, wenn jemand etwas emotional Berührendes vorgebracht hatte – selbst dann, wenn den Sprechern gar nicht klar gewesen war, dass ihre Emotionen sichtbar geworden waren –, hatte Felix eigene Gefühle zum Ausdruck gebracht. Alle diese kleinen Entscheidungen, die sie getroffen hatten, hatten dazu beigetragen, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen.
»Es ist ein Bündel von Techniken«, erklärte er den Wissenschaftlern. »Kein bisschen Magie im Spiel.« Mit anderen Worten: Jeder kann lernen, ein Superkommunikator zu werden.
***
Wen würden Sie anrufen, wenn Ihr Tag aus dem Ruder gelaufen wäre? Wenn Sie in der Arbeit einen Geschäftsabschluss vermasselt oder sich mit dem Ehepartner gestritten hätten, oder sich frustriert fühlten und alles einfach satthätten: Mit wem würden Sie dann sprechen wollen? Vermutlich gibt es da jemanden, der Sie garantiert aufmuntern wird, die mit Ihnen gemeinsam eine heikle Frage erörtern kann, sich mit Ihnen freut oder ärgert.
Und nun fragen Sie sich: Handelt es sich dabei um den lustigsten Menschen in Ihrem Umfeld? (Vermutlich nicht, aber hätten Sie darauf geachtet, wäre Ihnen aufgefallen, dass er oder sie mehr lacht als andere.) Handelt es sich um den interessantesten, den gescheitesten Menschen, den Sie kennen? (Wahrscheinlicher ist: Sie ahnen, dass selbst dann, wenn diese Person nichts besonders Kluges von sich gibt, Sie sich nach dem Gespräch mit ihr klüger fühlen werden.) Handelt es sich um Ihren unterhaltsamsten Freund, Ihre selbstsicherste Freundin? Mit den besten Ratschlägen? (Die Antwort lautet sehr wahrscheinlich dreimal nein: Aber wenn Sie den Hörer auflegen, werden Sie dennoch das Gefühl haben, gelassener zu sein, gefestigter und der Lösung näher.)
Wie also stellt es diese Person an, dass Sie sich mit ihr so wohlfühlen?
Diese Frage versucht das vorliegende Buch zu beantworten. Über die letzten beiden Jahrzehnte ist ein ganzes Korpus an Forschungsliteratur zum Thema entstanden, warum manche unserer Gespräche glücken, während andere so kläglich scheitern. Die daraus gewonnenen Einsichten können uns helfen, bessere Zuhörer und einnehmendere Sprecher zu werden. So ist bekannt, dass unser Gehirn sich darauf hinentwickelt hat, sich nach zwischenmenschlichen Verbindungen und Beziehungen zu sehnen: Wenn es bei jemandem »klick!« macht, erweitern sich unsere Pupillen häufig im Gleichklang, und unsere Pulse klopfen im selben Takt; unsere Emotionen spiegeln sich, und wir fangen an, die Sätze unseres Gegenübers im Kopf zu ergänzen. Das nennt sich neuronale Kopplung und fühlt sich herrlich an. Manchmal passiert es einfach so, und wir finden keinen Grund dafür; wir freuen uns bloß, dass die Unterhaltung so gut verlaufen ist. Und manchmal scheitern wir wieder und wieder daran, so verzweifelt wir uns auch bemühen, eine Beziehung aufzubauen.
Für viele Menschen kann das Führen eines Gesprächs zur Prüfung werden, zu einer anstrengenden, sogar Angst einflößenden. »Das größte Problem an der Kommunikation«, soll der Dramatiker George Bernard Shaw gesagt haben, »ist die Illusion, dass sie stattgefunden hat.«[2] Doch mittlerweile hat die Wissenschaft etliche Geheimnisse geglückter Gesprächsführung gelüftet. Dadurch weiß man heute zum Beispiel, dass Menschen besser zu verstehen sind, wenn man nicht nur auf ihre Stimme, sondern auch auf ihren Körper achtet. Dass es manchmal wichtiger ist, wie wir fragen, als wonach. Anscheinend ist es vorteilhafter, soziale Unterschiede anzuerkennen, als so zu tun, als gäbe es sie nicht. Jede Diskussion ist emotionsgesteuert, so vernunftgetränkt das Thema auch sein mag. Wenn man ein Zwiegespräch beginnt, ist es hilfreich, sich die Diskussion als Verhandlungsgespräch vorzustellen, dessen Gewinn darin besteht, herauszufinden, was das Gegenüber wirklich will.
Und, vorneweg: Das wichtigste Ziel eines jeden Gesprächs ist es, eine Verbindung aufzubauen.
***
Dieses Buch verdankt sich, wenigstens teilweise, meinem eigenen Schiffbruch an der Kommunikation. Vor ein paar Jahren wurde ich eingeladen, beim Management eines relativ komplexen Arbeitsprojekts mitzuwirken. Ein Manager war ich nie gewesen – aber Chefs hatte ich schon viele gehabt. Außerdem hatte ich einen todschicken MBA von der Harvard Business School in der Tasche – und als Journalist war Kommunikation quasi mein Beruf! Das konnte also wohl nicht so schwer sein?
Konnte es doch, wie sich herausstellte. Termin- und Logistikpläne zu erstellen war kein Problem für mich, aber menschliche Verbindungen aufzubauen, daran scheiterte ich immer wieder. Eines Tages erzählte mir ein Kollege, die Teammitglieder fänden, ihre Vorschläge würden ignoriert, ihre Leistungen nicht gewürdigt. »Es ist unfassbar frustrierend«, hieß es.
Ich antwortete, ich hätte verstanden, und brachte mögliche Lösungen ins Spiel: Wollten vielleicht lieber sie die Sitzungen leiten? Oder wollten wir ein ordentliches Organigramm erstellen, in dem die Aufgaben aller Mitarbeiter klar aufgeschlüsselt waren? Oder wollten wir …
»Sie hören ja gar nicht zu«, wurde ich unterbrochen. »Wir brauchen keine klarere Rollenverteilung. Wir brauchen mehr gegenseitigen Respekt.« Das Team wollte darüber sprechen, wie wir als Menschen miteinander umgingen, während ich auf praktische Abhilfen fixiert war. Sie baten um Empathie, doch anstatt zuzuhören, kam ich mit Lösungen.
Um ehrlich zu sein: Eine ähnliche Dynamik kannte ich aus meinem Privatleben. Wenn wir als Familie in Urlaub fuhren, fand ich regelmäßig etwas, in das ich mich hineinsteigern konnte – wir bekamen nicht das versprochene Hotelzimmer, oder der Vordermann im Flugzeug hatte seinen Sitz zurückgelehnt –, und meine Frau pflegte mir zuzuhören und dann eine völlig vernünftige Lösung vorzuschlagen: Konzentriere dich doch einfach auf die positiven Aspekte der Reise! Woraufhin ich mich wiederum noch mehr ärgerte, weil ich spürte, dass sie mich nicht verstanden hatte: Ich hatte um Rückhalt gebeten (Sag mir, dass ich recht habe, mich aufzuregen!), nicht um vernünftigen Rat. Manchmal wollten meine Kinder reden, und ich, abgelenkt von der Arbeit oder etwas anderem, hörte nur mit halbem Ohr zu, bis sie sich schließlich davonschlichen. Im Rückblick war mir klar, dass ich damit die wichtigsten Menschen in meinem Leben im Stich ließ, aber wie ich mein Problem beheben sollte, das wusste ich nicht. Diese Fehlschläge verwirrten mich umso mehr, als ich doch Autor war und mein Brot mit Kommunikation verdienen sollte. Warum tat ich mich gerade bei jenen Menschen, die mir am wichtigsten waren, so furchtbar schwer, sie richtig zu verstehen, mit ihnen in Verbindung zu bleiben?
Ich glaube, dass ich mit dieser Verwirrung nicht allein bin. Wir alle haben beizeiten darin versagt, unseren Freunden und Kollegen richtig zuzuhören, voll zu würdigen, was sie uns mitzuteilen versuchen – den Sinn ihrer Worte zu vernehmen. Und wir haben alle schon darin versagt, so zu sprechen, dass wir auch verstanden werden.
Dieses Buch ist demnach ein Versuch, zu erklären, wie Kommunikation auf Abwege geraten kann und wie wir dazu beitragen können, sie wieder auf die rechte Spur zu lotsen. Es beruht auf einigen wenigen Kerngedanken.
Der erste lautet, dass viele Diskussionen tatsächlich aus drei verschiedenen Gesprächen bestehen. Es gibt die praktischen, entscheidungsorientierten Gespräche, die wissen wollen: Worum geht’s hier wirklich? Es gibt die emotionalen Gespräche, die fragen: Wie fühlen wir uns? Und es gibt die sozialen Gespräche, die danach forschen: Wer sind wir? Im dynamischen Verlauf eines Zwiegesprächs pendeln wir häufig zwischen allen drei Gesprächstypen hin und her. Wenn unser Gesprächstypus aber nicht der gleiche ist wie der unseres Gegenübers im selben Augenblick, werden wir es kaum schaffen, die Verbindung herzustellen.
Dazu kommt, dass jeder Gesprächstypus seiner eigenen Logik folgt und seine eigenen Techniken erfordert, weswegen wir, um gut zu kommunizieren, in der Lage sein müssen, den jeweils vorherrschenden Gesprächstypus zu erkennen und zu verstehen, wie er funktioniert.
Damit komme ich zum zweiten Kerngedanken dieses Buches: Um möglichst sinnvolle Diskussionen zu führen, sollten wir uns um »bewusste Gespräche« bemühen. Insbesondere heißt das, wir sollten zu erfahren versuchen, wie die Menschen um uns herum die Welt sehen, und ihnen umgekehrt helfen, unsere eigene Perspektive zu verstehen.
Der letzte Kerngedanke ist eigentlich kein Gedanke, sondern vielmehr eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe: Zum Superkommunikator kann jeder werden – und viele von uns sind es längst –, wenn wir nur lernen, unseren Instinkten zu vertrauen. Wir alle können lernen, genauer zuzuhören, auf einer tieferen Ebene Verbindungen aufzubauen. Auf den folgenden Seiten werden Sie erfahren, wie Netflix-Bosse, die Macher der TV-Serie The Big Bang Theory, Spione und Chirurgen, NASA-Psychologen und Corona-Forscher ihre Gewohnheiten des Sprechens und Zuhörens umgekrempelt haben – und es so geschafft haben, einen Draht zu anderen Menschen zu finden, von denen sie scheinbar Welten trennen. Und Sie werden erfahren, wie man diese Lektionen auf Alltagssituationen überträgt: auf unsere alltäglichen Gespräche mit Arbeitskolleginnen und Freunden, mit Partnern und Kindern, mit dem Barista im Café und mit dieser Frau, der wir im Bus immer zuwinken.
Und darauf kommt es tatsächlich an, denn in mancher Hinsicht ist es noch nie so wichtig gewesen, zu verstehen, wie man sinnvoll miteinander spricht. Es ist kein Geheimnis, dass sich unsere Gesellschaft zunehmend polarisiert hat, dass es immer schwerer fällt, zuzuhören und selbst Gehör zu finden. Aber wenn wir lernen, wie man sich zusammensetzt, einander ernst nimmt und, selbst wenn nicht jede letzte Unstimmigkeit auszuräumen sein wird, Wege findet, einander zu verstehen und das Notwendige zu sagen, dann können wir friedlicher und gedeihlicher miteinander leben.
Jedes sinnvolle Gespräch besteht aus zahllosen kleinen Entscheidungen. Es gibt flüchtige Momente, in denen die richtige Frage, ein entwaffnendes Eingeständnis oder ein mitfühlendes Wort den Kurs eines Dialogs radikal ändern können. Ein stilles Auflachen, ein kaum hörbarer Seufzer, ein freundliches Lächeln im Augenblick der Anspannung: Manche Menschen haben gelernt, diese Gelegenheiten zu erkennen, den aktuellen Gesprächstypus zu erfassen, zu verstehen, was die anderen wirklich wollen. Sie haben gelernt, das Ungesagte zu vernehmen und so zu sprechen, dass andere ihnen zuhören möchten.
In diesem Buch wollen wir herausfinden, wie wir kommunizieren, wie wir Verbindungen aufbauen. Denn das rechte Wort zur rechten Zeit kann alles verändern.
DIE DREI GESPRÄCHSTYPEN
Ein Überblick
Gespräch – das ist die gemeinsame Luft, die wir alle atmen. Den lieben langen Tag hindurch sprechen wir mit unserer Familie, unseren Freunden, mit Fremden, Kollegen, manchmal sogar mit Haustieren. Wir kommunizieren über Textnachrichten, E-Mail, Online-Postings und soziale Medien. Wir unterhalten uns mittels Tastaturen und Spracherkennungssystemen, manchmal über handgeschriebene Briefe und gelegentlich mit Grunzern und Grimassen, Lächeln und Seufzern.
Doch nicht alle Gespräche sind gleich. Eine wichtige Unterhaltung kann sich wunderbar anfühlen, als hätte sich etwas Bedeutendes enthüllt. »In letztem Betracht ist das Band jedes geselligen Umgangs, ob nun in der Ehe oder in der Freundschaft, die Unterhaltung«, schrieb Oscar Wilde.
Geht eine wichtige Unterhaltung jedoch schief, kann sich das entsetzlich anfühlen: frustrierend, enttäuschend, wie eine verpasste Gelegenheit. Hinterher sind wir nicht selten verwirrt und zornig, unsicher, ob jemand überhaupt ein Wort von dem verstanden hat, was da gesagt worden ist.
Wie kann es anders laufen?
Wie das folgende Kapitel zeigt, hat sich unser Gehirn so entwickelt, dass es nach Korrespondenzen, nach Bindungen sucht. Soll uns ebendieser Einklang mit unseren Mitmenschen zuverlässig glücken, müssen wir verstehen, wie Kommunikation funktioniert – und vor allem erkennen, dass unser Gesprächstypus im jeweils aktuellen Zeitpunkt mit dem unseres Gegenübers übereinstimmen muss, wenn wir eine Verbindung aufbauen wollen.
Superkommunikatoren sind nicht mit besonderen Gaben gesegnet – sie haben sich nur genauer damit beschäftigt, wie Unterhaltungen sich entwickeln, warum sie glücken, woran sie scheitern und wie die fast unbegrenzten Weichenstellungen eines jeden Zwiegesprächs uns einander näherbringen oder eben entfremden können. Sobald wir gelernt haben, diese Möglichkeiten zu erkennen, können wir beginnen, auf neue Weise zu sprechen und zuzuhören.
1 – Das Übereinstimmungsprinzip
Wie man Spione besser nicht anwirbt
Wenn Jim Lawler ganz ehrlich war, dann musste er sich eingestehen: Im Anwerben von Spionen war er eine Niete. Tatsächlich war er so schlecht, dass er sich fast jede Nacht schlaflos im Bett wälzte vor Sorge, entlassen zu werden – aus der einzigen Anstellung, an der ihm je etwas gelegen hatte, seinem zwei Jahre zuvor ergatterten Posten als Führungsoffizier bei der Central Intelligence Agency.[3]
Im Jahr 1982 war Lawler dreißig Jahre alt. Bevor er zur CIA gegangen war, hatte er an der Universität Texas ein glanzloses Jura-Examen gemacht und anschließend einen langweiligen Job nach dem anderen gehabt. Ohne wirkliche Lebensperspektive griff er eines Tages zum Hörer und rief einen CIA-Anwerber an, dem er einmal an der Uni begegnet war. Es folgte ein Vorstellungsgespräch, dann ein Lügendetektortest, dann mehr als ein Dutzend weiterer Interviews in verschiedenen Städten und anschließend eine ganze Batterie schriftlicher Prüfungen, die anscheinend alle nur darauf abzielten, herauszubekommen, was Lawler alles nicht wusste. (Wer, so fragte er sich, kann denn bitte sämtliche Spieler, die in den 1960er-Jahren Rugby-Weltmeister waren, aufzählen?)
Endlich saß er im letzten Bewerbungsgespräch. Rosig sah es nicht aus für ihn. Seine Leistungen waren schwach bis mittelmäßig gewesen. Er hatte keinerlei Auslandserfahrung, beherrschte keine Fremdsprachen, hatte nicht im Militär gedient und verfügte über keine besonderen Talente. Und doch, so bemerkte der Personalchef, war Lawler auf eigene Kosten zu diesem Gespräch nach Washington, D. C. geflogen, hatte sich durch eine Prüfung nach der anderen gebissen, obwohl jedermann klar war, dass er von den meisten Aufgaben nicht den leisesten Schimmer hatte, und hatte auf jeden Rückschlag mit bewundernswertem, wenn auch scheinbar wenig angebrachtem Optimismus reagiert.
Warum also, wurde er gefragt, wollte er so dringend zur CIA?
»Mein Leben lang habe ich etwas Wichtiges machen wollen«, antwortete Lawler. Er wolle seinem Vaterland dienen und »Demokratie in Länder tragen, die nach Freiheit schmachten«. Noch im Augenblick, da die Worte seinen Mund verließen, erkannte er ihre Lächerlichkeit. Wer sagt schon im Bewerbungsgespräch »schmachten«? Er hielt inne, atmete durch und sagte den aufrichtigsten Satz, der ihm in den Sinn kam. »Mein Leben kommt mir leer vor«, antwortete er. »Ich möchte an etwas teilhaben, das wirklich zählt.«
Eine Woche später kam ein Anruf: Man bot ihm eine Stellung an. Lawler sagte sofort zu und meldete sich im Camp Peary (der »Farm«, wie man das Ausbildungszentrum der CIA in Virginia auch nennt), wo er im Knacken von Türschlössern, im Umgang mit toten Briefkästen und in allerlei Beschattungstechniken unterwiesen wurde.
Der überraschendste Aspekt des »Farm«-Lehrplans war jedoch der Stellenwert, den der Geheimdienst der Kunst der Gesprächsführung beimaß. Im Zuge seiner Ausbildung lernte Lawler, dass die Arbeit bei der CIA im Wesentlichen aus Kommunikation bestand. Der Auftrag eines Agenten im Feld lautete nicht, sich im Schatten herumzudrücken oder flüsternd auf Parkplätzen Nachrichten auszutauschen – er lautete, auf Partys mit anderen zu plaudern, Freundschaften mit Botschaftsangestellten zu schließen und zu ausländischen Beamten Beziehungen zu knüpfen, alles in der Hoffnung, eines Tages bei einer ruhigen Unterhaltung den entscheidenden Informationsbrocken geliefert zu bekommen. So wichtig ist die Kommunikation, dass eine Zusammenfassung von CIA-Trainingsmethoden sie an die erste Stelle setzt: »Man muss Mittel und Wege finden, eine zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen. Das Ziel eines Führungsoffiziers sollte es sein, einen angehenden Agenten glauben zu machen – und zwar hoffentlich mit gutem Grund –, dass der Führungsoffizier einer der wenigen Menschen ist, der ihn wirklich versteht, vielleicht sogar der einzige.«[4]
Lawler absolvierte die Agentenschule mit gutem Erfolg und wurde nach Europa beordert. Seine Mission bestand darin, ein gutes Verhältnis zu ausländischen Bürokraten aufzubauen, Freundschaften mit Botschaftsattachés zu pflegen und neue Quellen zu erschließen, die womöglich zu freimütigen Unterredungen bereit waren – und mit alldem, so hofften seine Vorgesetzten, Kanäle für Gespräche zu eröffnen, die das Weltgeschehen ein wenig besser beherrschbar machen würden.
***
Lawlers erste Monate im Einsatz waren zäh. Er gab sein Bestes, dazuzugehören, ohne aufzufallen. Er lungerte im Smoking auf Abendveranstaltungen herum und bestellte Drinks an Bartresen in Botschaftsnähe. Nichts wollte glücken. Da gab es etwa den Büroangestellten bei der chinesischen Delegation, den er beim Après-Ski kennenlernte und wiederholt zum Mittagessen und zu Cocktails einlud. Schließlich nahm Lawler seinen Mut zusammen und erkundigte sich, ob sein neuer Freund eventuell daran interessiert sei, gegen etwas Bargeld hin und wieder Botschaftstratsch weiterzugeben. Der Mann antwortete, seine Familie sei recht wohlhabend, aber herzlichen Dank, und wegen so etwas pflegten seine Chefs Leute hinzurichten. Er wolle das Angebot lieber ausschlagen.
Dann war da die Empfangsdame im sowjetischen Konsulat, die vielversprechend wirkte, bis einer von Lawlers Vorgesetzten ihn diskret beiseitenahm und ihm erklärte, dass sie für den KGB arbeitete und gerade versuchte, ihn anzuwerben.
Endlich bot sich ihm eine Gelegenheit, seine Karriere doch noch aus dem Sumpf zu ziehen: Ein Kollege bei der CIA erwähnte eine junge Frau aus dem Mittleren Osten, die im Außenministerium ihres Heimatlandes arbeitete und gerade zu Besuch war. Yasmin sei auf Urlaub hier, erklärte der Kollege: Sie wohnte bei einem Bruder, der nach Europa ausgewandert war. Einige Tage später gelang es Lawler, ihr »zufällig« in einem Restaurant zu begegnen. Er stellte sich als Ölspekulant vor. Im sich entspinnenden Gespräch bemerkte Yasmin, dass ihr Bruder immer beschäftigt sei und nie Zeit habe, ihr irgendwas vom Land zu zeigen. Sie wirkte einsam.
Am nächsten Tag lud Lawler sie zum Mittagessen ein und erkundigte sich nach ihrem Leben. Gefiel ihr die Arbeit? War es schwer, in einem Land zu leben, das gerade eine konservative Revolution durchgemacht hatte? Yasmin vertraute ihm an, dass sie die an die Macht gelangten Radikal-Religiösen verabscheute. Am liebsten wäre sie fortgezogen, nach Paris oder New York, doch dazu hätte sie Geld gebraucht, und schon auf diese kurze Urlaubsreise hatte sie Monate sparen müssen.
Lawler witterte Morgenluft und erwähnte, seine Ölfirma könne eine Beraterin gebrauchen. Eine Teilzeitstelle, sagte er, Aufgaben, die sie neben ihrer Stelle im Außenministerium erledigen könne. Aber einen Bonus könne er ihr sofort anbieten, wenn sie sich verpflichten wollte. »Wir bestellten Champagner, und ich dachte, sie muss gleich weinen vor Glück«, erzählte er mir.
Nach dem Mittagessen eilte Lawler zurück ins Büro, um seinem Chef Bericht zu erstatten. Endlich hatte er seine erste Spionin angeworben! »Und dann sagt der zu mir: ›Glückwunsch. Die Zentrale wird begeistert sein. Jetzt musst du ihr nur noch erklären, dass du von der CIA bist und Informationen über ihre Regierung willst.‹« Lawler hielt das für eine ganz, ganz schlechte Idee. Wenn er Yasmin die Wahrheit sagte, würde sie nie wieder ein Wort mit ihm reden.
Aber sein Chef erklärte ihm, es sei unethisch, jemanden aufzufordern, für die CIA zu arbeiten, ohne ihm oder ihr reinen Wein einzuschenken. Sollte Yasmins Regierung davon Wind bekommen, käme sie ins Gefängnis, womöglich aufs Schafott. Sie musste sich im Klaren darüber sein, was für ein Risiko sie einging.
Also traf sich Lawler weiter mit Yasmin und hoffte auf den rechten Augenblick, seine wahren Auftraggeber offenzulegen. Je mehr Zeit sie miteinander verbrachten, desto freimütiger sprach sie. Sie schämte sich, dass ihre Regierung Zeitungsredaktionen schloss und die Meinungsfreiheit abschaffte, erklärte sie ihm, und sie verabscheute die Bürokraten, die Frauen gesetzlich verboten, bestimmte Fächer zu studieren, und sie zwangen, in der Öffentlichkeit Kopftücher zu tragen. Als sie sich um eine Stelle im Staatsdienst beworben hatte, sagte sie, hätte sie sich niemals vorstellen können, wie furchtbar es werden würde.
Lawler nahm das als Stichwort. Eines Abends eröffnete er ihr schließlich beim Essen, dass er gar kein Ölspekulant sei, sondern für einen amerikanischen Nachrichtendienst arbeite. Die USA, erklärte er ihr, wollten dasselbe wie sie: die Theokratie ihres Landes unterwandern, seine Führer schwächen, die Unterdrückung der Frauen beenden. Er entschuldigte sich, dass er sie über seine Identität angelogen hatte, aber die angebotene Arbeit sei echt. Ob sie sich vorstellen könne, für die CIA tätig zu werden?
»Noch während ich sprach, konnte ich zusehen, wie ihre Augen immer größer wurden und sie das Tischtuch mit beiden Händen fasste und dann den Kopf schüttelte – nein, nein, nein –, und als ich fertig war, begann sie zu weinen, und da war mir dann klar: Ich hab’s verbockt«, erzählte mir Lawler. »Das kann ihr Todesurteil sein, sagte sie, und sie könne das nicht tun, ausgeschlossen.« Nichts, was er hätte sagen können, hätte sie umgestimmt. »Sie wollte nur noch weg von mir.«
Lawler kehrte mit der schlechten Botschaft zu seinem Chef zurück. »Und der meint, ›Ich hab’ doch schon allen erzählt, dass du sie angeworben hast! Ich hab’s dem Abteilungsleiter erzählt und dem Stationsleiter, und die haben’s Washington erzählt. Und jetzt kommst du her und sagst, der Handel ist geplatzt?‹«
Lawler war völlig ratlos. »Ich hätte ihr zahlen und versprechen können, was ich wollte – nichts hätte sie dazu gebracht, ihr Leben aufs Spiel zu setzen«, erzählte er mir. Die einzige Option war, Yasmins Vertrauen zu gewinnen – sie zu überzeugen, dass er sie verstand und sie schützen würde. Aber wie macht man das? »Auf der Farm haben sie mir beigebracht: Um jemanden anzuwerben, muss man diese Person davon überzeugen, dass sie einem wichtig ist, und das heißt, sie muss einem tatsächlich wichtig sein, was wiederum heißt, dass man in irgendeiner Weise eine menschliche Beziehung aufbauen muss. Und ich hatte nicht die leiseste Ahnung, wie ich das bewerkstelligen sollte.«
***
Wie gelingt es uns, eine aufrichtige Beziehung zu einem anderen Menschen aufzubauen? Wie helfen wir ihnen gesprächsweise über die Schwelle, ein Risiko einzugehen, sich in ein Abenteuer aufzumachen, einen Posten oder auch ein Rendezvous anzunehmen?
Oder, etwas weniger dramatisch: Sagen wir einmal, Sie wollen einen Draht zu Ihrem Chef finden oder eine neue Freundin besser kennenlernen. Wie locken Sie Ihr Gegenüber aus der Reserve? Wie signalisieren Sie, dass Sie ganz Ohr sind?
Im Verlauf der letzten Jahrzehnte sind etliche neue Methoden entwickelt worden, das menschliche Verhalten und Gehirn zu erforschen, und die Wissenschaft hat genau diese Art von Fragen zum Anlass genommen, so ziemlich jeden Aspekt der Kommunikation unter die Lupe zu nehmen. Studien zur Informationsverarbeitung des Gehirns haben gezeigt, dass ein durch Sprache vermitteltes Eingehen zwischenmenschlicher Beziehungen nicht nur wesentlich wirkungsvoller, sondern auch wesentlich komplexer ist als bisher angenommen. Wie wir kommunizieren – die vielen unbewussten Entscheidungen, die wir beim Sprechen und Zuhören treffen, die Fragen, die wir stellen, die Schwächen, die wir dabei offenbaren, ja sogar die Tonlage unserer Stimme – all das kann einen Einfluss darauf haben, wem wir vertrauen, von wem wir uns überzeugen lassen und wen wir zum Freund gewinnen möchten.
Parallel zu dieser neuen Einsicht ist eine Fülle an neuer Forschungsliteratur[5] erschienen, aus der hervorgeht, dass das Herzstück eines jeden Gesprächs das Potenzial für neuronale Synchronisation bildet, eine wechselseitige Angleichung unserer Körper und Seelen – alles von unserer jeweiligen Atemfrequenz bis zur Gänsehaut –, die wir oft gar nicht bewusst wahrnehmen, die aber trotzdem mitbestimmt, wie wir sprechen, hören und denken. Manchen Menschen gelingt diese Synchronisation nie, nicht einmal im Gespräch mit engen Freunden. Andere – nennen wir sie Superkommunikatoren – schaffen es scheinbar mühelos, sich mit fast jedem beliebigen Gegenüber zu synchronisieren. Die meisten von uns befinden sich irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Doch wenn wir das allen Unterhaltungen zugrunde liegende Regelwerk durchschauen, können auch wir lernen, bessere und tiefere zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen.
Für Jim Lawler jedenfalls lag der Pfad zu einer solchen Beziehung zu Yasmin noch sehr im Dunkeln. »Mir war klar, ich habe noch maximal eine Chance, mit ihr zu reden«, erzählte er mir. »Ich musste einfach herausbekommen, wie ich zu ihr durchdringe.«
Gehirne im Gleichklang
Als Beau Sievers 2012 beim Dartmouth Social Systems Lab anfing, sah er noch ganz aus wie der Musiker, der er wenige Jahre zuvor gewesen war. An manchen Tagen hastete er gleich nach dem Aufstehen mit zerzaustem blonden Haarschopf und einem löchrigen Jazzfest-T-Shirt ins Labor. Die Sicherheitskräfte auf dem Campus, an denen er vorübersprintete, waren sich nicht sicher: Doktorand – oder eher der Grasdealer der Bachelorstudenten?
Sievers’ Weg an die Eliteuni war keineswegs gradlinig gewesen. Ursprünglich hatte er am Konservatorium mit Hingabe Schlagzeug und Musikproduktion studiert und sonst im Grunde gar nichts getan. Bald jedoch dämmerte ihm, dass er noch so viel üben konnte, nie würde er in den erlauchten Zirkel jener Schlagzeuger vordringen, die vom Schlagzeugen leben können. Also begann er andere Karrieremöglichkeiten ins Auge zu fassen. Zwischenmenschliche Kommunikation hatte ihn schon immer fasziniert. Insbesondere liebte er jene wortlose musikalische Zwiesprache, die sich manchmal auf der Bühne entspann. Da gab es Momente, wenn er mit anderen Musikern improvisierte und es plötzlich bei allen »klick!« machte, als ob sich alle ein einziges Gehirn teilten. Es fühlte sich an, als stünden die Musiker, aber auch das Publikum, der Typ am Mischpult, ja sogar der Barkeeper – plötzlich alle miteinander im Gleichklang. Dasselbe Gefühl stellte sich manchmal während tiefgründiger nächtlicher Gespräche ein, aber auch bei erfolgreichen ersten Dates. Also meldete er sich zu einigen Psychologiekursen an und bewarb sich schließlich für ein Doktoratsstudium bei Dr. Thalia Wheatley, einer der führenden Neurowissenschaftlerinnen, die erforschten, wie Menschen Verbindungen zueinander aufbauen.
»Warum es zwischen manchen Menschen ›klick!‹ macht und zwischen anderen nicht, ist eines der großen ungelösten Rätsel der Wissenschaft«, schrieb Wheatley in der Zeitschrift Social and Personality Psychology Compass.[6] Glückt eine derartige Verbindung über das Gespräch, fühlt es sich unter anderem deswegen so gut an, erklärte Wheatley, weil die Evolution unser Gehirn mit einem starken Bedürfnis nach dieser Art von Annäherung ausgestattet hat. Dieses Bedürfnis habe die Menschen dazu getrieben, Gemeinschaften zu bilden, ihren Nachwuchs zu beschützen, neue Freunde zu suchen, Allianzen zu schmieden. Es hat dazu beigetragen, dass unsere Art überlebt hat. »Der Mensch besitzt die seltene Fähigkeit«, schrieb sie, »noch in den scheinbar ungeeignetsten Situationen Bindungen zu anderen herzustellen.«[7]
Viele weitere Forschende sind von diesem Phänomen gleichermaßen fasziniert. Aus den Fachzeitschriften, die er nun systematisch durchforstete, erfuhr Sievers, dass Kollegen am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin im Jahr 2012 die Gehirnströme von Gitarristen beim Spiel von Christian Gottlieb Scheidlers Sonate D-Dur analysiert hatten.[8] Wenn die Musiker einzeln spielten, jeder auf die eigenen Noten fixiert, zeigte ihre neuronale Aktivität ein jeweils verschiedenes Bild. Gingen sie aber zu einem Duett über, begannen die elektrischen Pulse in den jeweiligen Hirnschalen sich einander anzugleichen. Den Forschern kam es vor, als wäre aus jeweils zwei Gitarristenköpfen ein einziger geworden. Und diese Verschmelzung ließ sich auch am restlichen Körper beobachten: Oftmals dauerte es nicht lange, bis die Musiker mit derselben Frequenz atmeten; ihre Augen weiteten sich synchron, und ihre Herzen begannen im Gleichtakt zu schlagen. Nicht selten stimmten sich sogar die elektrischen Impulse in den Nervenleitungen der Haut aufeinander ab.[9] Sobald sie aufhörten, miteinander zu musizieren – wenn die Noten wieder voneinander abwichen oder sie Solopartien spielten –, war es mit der Synchronisation der Gehirne wieder völlig vorbei, wie die Forscher schrieben.
Anderen Studien konnte Sievers entnehmen, dass dieselbe Erscheinung bei gemeinsamem Summen auftritt, aber auch, wenn Menschen im Tandem mit den Fingern klopfen, in Zusammenarbeit Rätsel lösen oder einander Geschichten erzählen.[10] An der Universität Princeton maßen Forscher die Gehirnaktivität von einem Dutzend Probanden, die einer jungen Frau zuhörten, während diese eine lange und verwickelte Anekdote von ihrem Schulball zum Besten gab.[11] Auf MRT-Bildschirmen konnten die Wissenschaftler zusehen, wie die jeweiligen Gehirntätigkeiten des Publikums sich zunehmend an jene ihrer Erzählerin anglichen, bis endlich alle gleichzeitig dieselben Stress- oder Unbehaglichkeitsgefühle, dieselbe Freude, denselben Spaß empfanden, als ob sie die Geschichte gemeinsam erzählten. Manche Zuhörer synchronisierten sich sogar noch enger mit der Sprecherin; ihr Gehirn schien sich fast genauso zu verhalten wie das ihrer Erzählerin. Bei der anschließenden Befragung stellte sich heraus, dass diese Studienteilnehmer die Figuren der Geschichte besser hatten auseinanderhalten können und sich kleine Details besser gemerkt hatten. Je genauer sich die Gehirne synchronisiert hatten, desto besser hatten die Probanden verstanden, was gesagt worden war. »Der Grad der neuronalen Kopplung zwischen Sprecher und Hörer gestattet eine Voraussage über den Kommunikationserfolg«, schrieben die Forscher 2010 in den Proceedings of the National Academy of Sciences.[12]
Superkommunikatoren
Diese wie auch viele andere Studien belegen immer wieder dieselbe Grundwahrheit: Ohne geistige Verbindung keine Kommunikation.[13] Wenn wir das, was jemand sagt, aufnehmen und der- oder diejenige wiederum versteht, was wir sagen, dann liegt das daran, dass sich unsere Gehirne in gewissem Maß aufeinander abgestimmt haben. Oft beginnen sich unsere Körper – unser Puls und Gesichtsausdruck, die erlebten Emotionen, das Prickeln in Armen und Nacken – in solchen Momenten ebenfalls zu synchronisieren.[14] Irgendetwas an der neuronalen Gleichzeitigkeit hilft uns, genauer zuzuhören und verständlicher zu sprechen.[15]
Manchmal stellt sich diese Verbindung mit nur einer weiteren Person ein. Manchmal entsteht sie innerhalb einer Gruppe oder sogar innerhalb eines großen Publikums. Doch wann auch immer sie gelingt, gleichen sich Kopf und Körper der Beteiligten aneinander an, weil wir, wie die Neurowissenschaft sagt, neuronal gekoppelt sind.
Im Zuge der Erforschung dieser Kopplung hat sich herausgestellt, dass manchen Menschen eine solche Synchronisierung besonders leichtfällt. Anders gesagt: Es gibt Personen, die systematisch besser darin sind, Verbindungen aufzubauen.
Wissenschaftler wie Sievers nennen solche Personen nicht Superkommunikatoren – sie ziehen Begriffe wie »Akteure hoher Zentralität« oder »Core Information Provider« vor –, aber woran man solche Leute erkennt, das wusste Sievers genau: Sie waren jene Freunde, die alle um Rat fragten, die Kolleginnen, die in Führungspositionen gewählt wurden, die Mitarbeitenden, die man bei Gesprächen gern dabeihatte, weil es mit ihnen einfach lustiger war. Sievers hatte mit Superkommunikatoren auf der Bühne gestanden, war auf Partys auf sie zugegangen, hatte bei Wahlen für sie gestimmt. Gelegentlich waren ihm sogar selbst Augenblicke der Superkommunikation geglückt – meistens, ohne voll zu durchschauen, wie.[16]
Doch keiner der von Sievers gelesenen Aufsätze schien eine Erklärung zu haben, warum manche Menschen sich besser mit ihrem Gegenüber synchronisieren können als andere. Also beschloss Sievers, ein Experiment zu veranstalten, das vielleicht die Antwort liefern würde.[17]
***
Zunächst versammelten Sievers und seine Kollegenschaft mehrere Dutzend Probandinnen und Probanden, denen sie eine ganze Reihe von mit Absicht schwer verständlichen Filmausschnitten vorspielten.[18] Manche Filme etwa stammten aus unterschiedlichen Kulturkreisen, bei anderen handelte es sich um kurze, völlig zusammenhanglose Fragmente aus der Mitte eines Films. Um die Ausschnitte noch verwirrender zu machen, hatten die Forschenden Tonspur und Untertitel entfernt; die Teilnehmer bekamen also nur rätselhafte stumme Darbietungen zu sehen. Ein zorniger Glatzkopf im erregten Gespräch mit einem blonden, stämmigen Typen: Freunde oder Feinde? Oder: Ein Cowboy sitzt in der Badewanne, ein anderer Mann beobachtet ihn von der Tür aus. Ist es sein Bruder? Sein Liebhaber?
Während die Probanden diese Ausschnitte betrachteten, überwachten die Forschenden ihre Gehirntätigkeit. Gleichzeitig beobachteten sie, dass jeder Einzelne ein wenig anders reagierte. Manche Zuschauer waren verdutzt. Andere lachten. Und keiner der Gehirnscans sah aus wie der andere.
Anschließend wurden die Teilnehmenden auf Kleingruppen verteilt, die gemeinsam einige Fragen erörtern sollten: »Ist der Kahle zornig auf den Blonden?« »Fühlt sich der Mann in der Tür von dem in der Wanne sexuell angezogen?«
Nachdem die Gruppen ihre Antworten eine Stunde lang miteinander besprochen hatten, wurden die Teilnehmenden abermals an die Gehirnscanner angeschlossen und bekamen dieselben Filmausschnitte vorgeführt.
Diesmal stellte die Forschungsgruppe fest, dass die neuronalen Impulse der Probanden sich mit jenen ihrer Gruppenmitglieder synchronisiert hatten. Indem sie sich miteinander unterhalten hatten – das Gesehene gemeinsam analysierten, Elemente der Handlung diskutierten –, hatten sich ihre jeweiligen Gehirne aufeinander abgestimmt.
Noch interessanter jedoch war ein anderes Untersuchungsergebnis: In manchen Gruppen war der Grad der Synchronisierung wesentlich ausgeprägter als in anderen. Die Gehirnaktivitäten dieser Teilnehmenden glichen einander beim zweiten Scan so frappierend, dass es wirkte, als hätten sich alle verabredet, völlig gleich zu denken.
Sievers vermutete, dass unter den Teilnehmenden dieser Gruppen eine besondere Person war, einer jener Menschen, die allen anderen die gedankliche Angleichung erleichterten. Aber wer nur? Seine erste Hypothese lautete, dass es ein starker Wortführer sein könnte, der die Synchronisierung beförderte. Tatsächlich gab es Gruppen, in denen eine Person von Beginn an die Regie übernommen hatte. »Ich glaube, die Geschichte geht gut aus«, hatte ein solcher Wortführer, bezeichnet als Akteur 4, Gruppe D, seinen Mitprobanden über einen Filmausschnitt mitgeteilt, in dem ein Kind anscheinend seine Eltern suchte. Akteur 4 war der direkte Typ und redete gern. Er wies seinen Kolleginnen und Kollegen Rollen zu und sorgte dafür, dass alle bei der Sache blieben. Vielleicht war Akteur 4 nicht nur ein guter Gruppenleiter, sondern auch ein Superkommunikator?
Doch als Sievers seine Daten auswertete, stellte sich heraus, dass dominante Wortführerinnen und Wortführer bei der gegenseitigen gedanklichen Angleichung der Gesprächsteilnehmer keineswegs hilfreich waren. Gruppen mit einem solchen Mitglied wiesen sogar den geringsten Grad an neuronaler Synchronisierung auf. Akteur 4 hatte es seinen Gruppenmitgliedern erschwert, sich aufeinander abzustimmen: Indem er die Kontrolle über das Gespräch an sich riss, drängte er alle anderen in ihre jeweils eigenen Gedankenwelten zurück.[19]
Vielmehr wiesen die Gruppen mit dem höchsten Grad an Synchronisierung ein oder zwei Akteure auf, die sich auffällig anders verhielten als Akteur 4. Diese Personen sprachen insgesamt weniger als die dominanten Wortführenden, und wenn sie doch einmal den Mund aufmachten, dann in der Regel, um Fragen zu stellen. Sie wiederholten die Einfälle ihrer Kolleginnen und Kollegen und hatten keine Scheu, ihre eigene Verwirrung zuzugeben oder sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Sie ermutigten die anderen Gruppenmitglieder (»Das ist clever! Erzähl mir mehr!«) und lachten über die Scherze anderer. Sie waren weder besonders redselig noch besonders geistreich, doch wenn sie sprachen, dann merkten alle auf. Und irgendwie machten sie es den anderen leichter, das Wort zu ergreifen. Sie bildeten das Schmiermittel, das das Gespräch in Gang hielt. Sievers nannte diese Personen »Akteure hoher Zentralität«.
Im folgenden Beispiel besprechen zwei Akteure oder Akteurinnen hoher Zentralität (in den Dialogen abgekürzt: AhZ; Akteurin oder Akteur: A) jene Badewannenszene, in der die Schauspieler Brad Pitt und Casey Affleck zu sehen sind:
AhZ 1:
Was spielt sich ab in dieser Szene?
[1]
AhZ 2:
Nicht die leiseste Ahnung. Ich hab’s nicht durchschaut.
[Lachen]
A 3:
Casey schaut Brad beim Baden zu. So lange, wie der ihn anstarrt, müssen wir annehmen, Casey steht auf Brad.
[Gruppe lacht.]
L’amour non partagé …
AhZ 2:
Ha, das klingt gut! Ich versteh zwar kein Wort, aber es klingt elegant!
A 3:
Unerwiderte Liebe, gewissermaßen.
AhZ 2:
Ah, okay, jetzt versteh ich.
AhZ 1:
Und was, meinst du, passiert in der nächsten Szene?
A 3:
Mir kommt’s vor, die rauben gleich ’ne Bank aus.
[Lachen]
AhZ 1:
Mensch, das wär’ was!
AhZ 2:
Tja. Ich hätt’ noch auf irgendeine andere Eingebung gehofft.
[Lachen]
Akteurinnen und Akteure hoher Zentralität stellten in der Regel zehn- bis zwanzigmal so viele Fragen wie die anderen Teilnehmenden.[20] War das Gespräch einer Gruppe in eine Sackgasse geraten, dann ermöglichten sie durch einen Themenwechsel allen Beteiligten ein kurzes Innehalten, oder sie lockerten eine peinliche Stille mit einem Scherz auf.
Doch der Hauptunterschied zwischen Akteurinnen und Akteuren hoher Zentralität und allen anderen Teilnehmenden bestand darin, dass Erstere ständig die Art und Weise ihrer Kommunikation an die ihrer Gesprächspartner anpassten.[21] Fast unmerklich spiegelten sie in ihrem eigenen Verhalten die Stimmungen und Einstellungen der anderen wider. Wurde jemand tiefsinnig, boten sie ihren eigenen Tiefsinn an. Wurde die Diskussion fröhlich, sprangen sie als Erste auf den Zug auf. Sie änderten häufig ihre Meinung und ließen sich bereitwillig von der Gruppe umstimmen.
Als in einem Gespräch ein Teilnehmer einen unerwartet ernsten Ton anschlug und ins Spiel brachte, die Figur im Filmausschnitt sei womöglich verlassen worden, wobei anklang, dass der Sprecher vielleicht persönliche Erfahrungen mit dem Thema hatte, passte der Akteur hoher Zentralität augenblicklich den Ton seiner eigenen Äußerungen dem an:
A 2:
Wie, meinst du, geht der Film aus?
[22]
A 6:
Kein Happy End, glaube ich.
AhZ
: Es gibt kein Happy End, meinst du?
A 6:
Nein.
AhZ
: Warum nicht?
A 6:
Ich weiß nicht. Dieser Film schien düsterer zu sein als …
[Stille]
…
AhZ
: Wie geht es denn aus?
…
A 6:
Vielleicht ist es der Neffe, und die Eltern sind gestorben oder so etwas, und sie …
A 3:
Er ist gerade verlassen worden.
AhZ
: Ja, diese Nacht haben sie ihn allein gelassen. Ja.
Der Wortwechsel dauerte nur Augenblicke, und schon war die gesamte Gruppe ernst geworden und sprach darüber, wie es sich anfühlt, verlassen zu sein. Alle räumten dem Akteur 6 Gelegenheit ein, mit seinen Gefühlen und Erfahrungen herauszurücken. Der Akteur hoher Zentralität passte sich dem ernsten Ton des Akteurs 6 an und lotste so die anderen in die gleiche Richtung.
Akteure hoher Zentralität, so schrieben Sievers und seine Mitverfassenden in ihrer Auswertung, passten »mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit ihre eigene Gehirntätigkeit an die Gruppe an« und spielten »eine überragende Rolle bei der Herausbildung einer in sich abgestimmten Gruppe, indem sie den Fortgang des Gesprächs begünstigen«.[23] Doch waren sie keine bloßen Spiegel ihrer Gegenüber – vielmehr gelang es ihnen, die anderen unmerklich zu führen, indem sie sie sanft dazu bewegten, einander zuzuhören oder sich klarer auszudrücken. Sie stimmten ihren Gesprächsstil auf den ihrer Mitakteure ab, schufen Raum für Ernst oder Frohsinn und bauten den anderen eine Brücke, es ihnen gleichzutun. Auf die Antworten, die die einzelnen Probandinnen und Probanden schließlich auf die Arbeitsfragen gaben, hatten sie außerordentlichen Einfluss: Tatsächlich wurde die von den Akteurinnen und Akteuren hoher Zentralität gebilligte Meinung regelmäßig von der Gruppe übernommen. Nur spielte sich dieser Einfluss fast völlig im Verborgenen ab. Spätere Befragungen der Teilnehmenden zeigten, dass sich kaum einer von ihnen bewusst war, in welchem Maß die Akteure hoher Zentralität für ihre eigenen Entscheidungen von Bedeutung gewesen waren. Nicht in jeder Gruppe fand sich eine solche Person – doch jene, die eine in ihren Reihen hatte, schienen nach dem Gespräch eine engere Gemeinschaft zu bilden, und ihre Gehirnscans belegten, dass sie besser aufeinander abgestimmt waren.
Bei der Betrachtung des Lebenshintergrunds der Akteurinnen und Akteure hoher Zentralität stellte Sievers noch weitere charakteristische Merkmale fest. Sie waren überdurchschnittlich gut vernetzt und bekleideten häufiger ein gewähltes Amt mit Entscheidungsbefugnissen oder Verantwortung. An diese Personen wandte man sich, wenn man etwas Wichtiges besprechen wollte oder Rat suchte.[24] »Was ja auch schlüssig ist«, erklärte mir Sievers. »Denn wenn man jemand ist, mit dem man leicht ins Gespräch kommt, dann wollen natürlich viele Leute mit einem sprechen.«
Mit anderen Worten: Die Akteurinnen und Akteure hoher Zentralität waren Superkommunikatoren.
Die drei Denkweisen
Also: Um zum Superkommunikator zu werden, müssen wir nichts weiter tun, als genau auf alles Gesagte und Ungesagte zu achten, die richtigen Fragen zu stellen, die Stimmungen des Gegenübers zu erspüren und uns auf sie einzustellen und unsere eigenen Gefühle für andere transparent zu machen.
Ist doch ganz einfach, nicht wahr?
Nein, das ist natürlich nicht einfach. Jede einzelne Aufgabe ist für sich genommen schwierig genug. Alle gleichzeitig zu erfüllen mag unmöglich erscheinen.
Um zu verstehen, wie Superkommunikatoren ihre Erfolge erzielen, sollten wir uns näher ansehen, was sich während eines Gesprächs in unserem Gehirn abspielt. Die Forschung hat sich damit beschäftigt, wie verschiedene Arten der Unterhaltung sich auf unser Denken auswirken: Je nachdem, welcher Gesprächstypus gerade herrscht, werden unterschiedliche neuronale Netzwerke und Gehirnareale aktiviert. Sehr stark vereinfacht, gibt es drei Gesprächstypen, die in den meisten Unterhaltungen vorherrschen.
Diese drei Gesprächstypen – die praktischen, entscheidungsorientierten Gesprächen, emotionalen Gesprächen bzw. Gesprächen über Identität entsprechen – lassen sich am besten durch drei Fragen beschreiben: Worum geht’s hier wirklich?, Wie fühlen wir uns? und Wer sind wir? Wie wir im Folgenden erfahren werden, greift jeder dieser drei Gesprächstypen auf eine andere Denkweise und eine andere Art der Informationsverarbeitung im Gehirn zurück. Ist beispielsweise die Rede von einer Entscheidung zwischen mehreren Alternativen – handelt es sich also um ein Worum-geht’s-hier-wirklich?-Gespräch –, dann aktivieren wir andere Bereiche unseres Gehirns, als wenn wir unsere Gefühle äußern (das wäre ein Wie-fühlen-wir-uns?-Gespräch), und wenn unser Denken nicht mit dem übereinstimmt, was sich im Gehirn unseres Gesprächspartners abspielt, wird bei uns beiden der Eindruck entstehen, aneinander vorbeigeredet zu haben.[25]
Die erste Denkweise – die entscheidungsorientierte – ist dem Worum-geht’s-hier-wirklich?-Gespräch zugeordnet, und sie wird immer dann aktiv, wenn wir uns über praktische Fragen austauschen, etwa bei der Lösungsfindung oder der Analyse von Plänen. Wenn jemand sagt: »Was unternehmen wir jetzt wegen Sams Noten?«, dann schaltet sich das frontale Kontrollnetzwerk unseres Gehirns ein, die Kommandozentrale unserer Gedanken und Handlungen. Wir müssen eine Reihe von Entscheidungen treffen, oft unterbewusst, um die vernommenen Worte zu bewerten und zugleich abzuwägen, welche verborgenen Motive oder Wünsche dahinter schlummern könnten: »Ist das eine ernsthafte oder spielerische Unterhaltung?« »Soll ich eine Lösung anbieten oder nur zuhören?« Das Worum-geht’s-hier-wirklich?-Gespräch ist wesentlich für Überlegungen, die die Zukunft betreffen, für das Aushandeln von Spielräumen, für die Vermittlung von Vorstellungen – und dafür, erst einmal festzustellen, worüber wir eigentlich sprechen wollen, was unsere Ziele für das aktuelle Gespräch sind und wie wir es führen wollen.
Die zweite Denkweise – die emotionale – tritt dann hervor, wenn wir darüber sprechen, wie wir uns fühlen. Sie greift auf neuronale Strukturen zurück, die an der Bildung unserer Überzeugungen, Emotionen und Erinnerungen beteiligt sind – unter anderem der Nucleus accumbens, die Amygdala und der Hippocampus. Wenn wir eine amüsante Anekdote zum Besten geben oder uns mit dem Ehegatten streiten oder im Verlauf eines Gesprächs plötzlich einen Anflug von Stolz oder Traurigkeit empfinden, dann ist die emotionale Denkweise am Werk. Wenn die Freundin sich bei uns über ihre Chefin beklagt und wir spüren, dass hier Empathie verlangt wird und nicht kluge Ratschläge, dann deshalb, weil wir auf die Frage Wie fühlen wir uns? eingestimmt sind.[26]
Die dritte Denkweise, die im Gespräch eine Rolle spielt – nämlich die soziale –, kommt dann ins Spiel, wenn wir über unsere Beziehungen zu anderen oder darüber sprechen, wie wir von anderen und von uns selbst gesehen werden, oder über unsere soziale Identität. Dies sind die Wer-sind-wir?-Gespräche. Wann immer wir beispielsweise die neuesten Bürointrigen durchhecheln oder mit jemandem versuchen, gemeinsame Bekannte auszumachen, oder erklären, welche Bedeutung unser familiärer oder religiöser Hintergrund oder sonst etwas Persönliches für uns hat, dann setzen wir das sogenannte Default Mode Network unseres Gehirns ein, gewissermaßen seine Standardeinstellung. Dieses neuronale Netzwerk bestimmt mit, wie wir (mit den Worten des Neurowissenschaftlers Matthew Lieberman) »über andere Menschen denken, über uns selbst, und über die Beziehung zwischen uns selbst und den anderen«.[27] Laut einer 1997 in der Fachzeitschrift Human Nature veröffentlichten Untersuchung sind rund 70 Prozent unserer Unterhaltungen ihrem Wesen nach soziale Gespräche.[28] Im Verlauf dieser Diskurse steuert die soziale Denkweise ständig, wie wir zuhören und was wir selbst sagen.