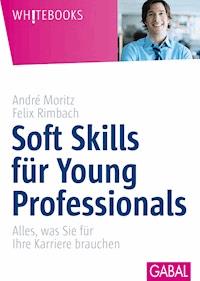
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GABAL
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Whitebooks
- Sprache: Deutsch
Dieser praxisorientierte Ratgeber zeigt, was Sie neben Fachkompetenz noch für Ihre gezielte Karriere brauchen. Orientiert am Begriff der immer wichtiger werdenden "Soft Skills" vermitteln André Moritz und Felix Rimbach die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die heute bei Young Professionals gefragt sind. Dieses Buch bietet Ihnen den entscheidenden Wissensvorsprung, beschreibt die wichtigsten Methoden und gibt handfeste Verhaltenstipps für Ihren beruflichen Alltag. Präsentation, Moderation, Rhetorik, Lerntechniken, Lesetechniken, Manipulationstechniken und vieles mehr – für Sie alles kompakt in einem Buch! Mit vielen Übungen, Checklisten und Literaturtipps.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 866
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
André Moritz · Felix Rimbach
Soft Skills für Young Professionals
Alles, was Sie für Ihre Karriere brauchen
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeInformationen sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN Buchausgabe: 978-3-89749-630-9ISBN epub: 978-3-95623-306-7
Lektorat: Christiane Martin, KölnUmschlaggestaltung: +malsy Kommunikation und Gestaltung, WillichUmschlagfoto: Getty images, München
©2016 GABAL Verlag GmbH, OffenbachDas E-Book basiert auf dem Buch „Soft Skills für Young Professionals“ von Àndre Moritz und Felix Rimbach, © 2006 GABAL Verlag GmbH, Offenbach.
www.gabal-verlag.de
Inhalt
Vorwort
1. Selbstbeobachtung
1.1. Werte & Glaubenssätze – Grundlage Ihrer Persönlichkeitsentwicklung
1.2. Ziele & Visionen – Ihre Zukunftsausrichtung
1.3. Persönlichkeit & Ausstrahlung
1.4. Wahrnehmung
2. Selbstentwicklung
2.1. Arbeitstechniken – Ihre Effizienz und Effektivität steigern
2.2. Selbstdarstellung & Ausstrahlung
2.3. Emotionale Intelligenz – Ihr Umgang mit Gefühlen und Menschen
2.4. Geistiges Wachstum und intellektueller Ausgleich
2.5. Regeneration & Freizeit
3. Gruppenbeobachtung
3.1. Motive & Bedürfnisse – Grundlagen der Gruppenentwicklung
3.2 Gruppentheorie – Dynamik von Teams
3.3. Interkultur – Ihr Verhalten in internationalen Gruppen
3.4. Evaluierung von Gruppen und Personen
4. Gruppenentwicklung
4.1. Networking – soziale Beziehungen aufbauen und nutzen
4.2. Partnerschaft, Familie und Freundschaft
4.3. Kommunikation in und vor Gruppen
4.4. Teams und Mitarbeiter führen
Über die Autoren
Empfohlene Literatur
Vorwort
Soft Skills für Young Professionals – dieses Buch geleitet Sie mit vielen Hilfen, Methoden und einem Bündel nützlichen Wissens durch die wichtigsten Situationen in Ihrem Beruf und in Ihrem Privatleben. Wir geben Ihnen eine Reihe nützlicher Werkzeuge, um das Arbeiten und Leben einfacher und effektiver zu machen, und wir möchten Ihnen einen Weg aufzeigen von Persönlichkeitsentwicklung hin zu nachhaltigem Erfolg im „Wir“, in der Gesellschaft.
Metodenkompetenz für Beruf und Privatleben
Mit dem Lesen dieses Buches steigern Sie eine Reihe essenzieller Methodenkompetenzen und sind in Standardsituationen des Berufs- und Privatlebens besser vorbereitet, richtig und angemessen zu handeln. Wenn Sie das hier in Ihren Händen liegende Fakten- und Methodenwissen erwerben und praktisch anwenden, werden Sie einen durchschlagenden Fortschritt und Erfolg erleben. Sie werden effektiver und effizienter handeln. Sie werden Dinge vereinfachen und Resultate in weniger Zeit erzielen. Die Qualität Ihrer Arbeit wird steigen, und Sie werden in zwischenmenschlicher Interaktion souveräner und erfolgreicher sein.
Die Zeiten von Einzelkämpfern in der Wirtschaft sind vorbei. Und immer wieder beklagen Unternehmen, dass es fachlich gut ausgebildeten Bewerbern an sozialer Kompetenz mangelt. Dazu kommen Defizite bei den kommunikativen Fähigkeiten sowie hinsichtlich genereller Methodenkompetenz. Dieses Buch soll einen entscheidenden Beitrag leisten, dies zu ändern.
Leben, Lernen und Arbeiten in unserer heutigen Gesellschaft führen zum Erfolg, wenn Sie die Synergie der Zusammenarbeit nutzen. Vor erfolgreicher Kooperation in Beruf und Gesellschaft steht jedoch die persönliche Auseinandersetzung mit sich selbst. Sich selbst zu kennen und an sich selbst zu arbeiten, schafft die Grundlage für Teamarbeit. Um aus dem formalen Zusammenschluss mehrerer Menschen zu einer Gruppe ein effektives und effizientes Team zu machen, bedarf es wiederum fundierter Kenntnisse über die spezifische Gruppe und Gruppen allgemein. Erst wenn sich die Gruppe kennt, kann sie wachsen.
Die vier Hauptteile des Buches
Das Buch besteht deshalb aus vier großen Teilen:
1. Selbstbeobachtung
2. Selbstentwicklung
3. Gruppenbeobachtung
4. Gruppenentwicklung
Diese vier Teile bilden die wesentlichen Stufen im Wachstumsprozess Ihres Selbst und Ihres Umfeldes. Diese vier Teile bilden den „roten Faden“ durch das Buch.
Im Abschnitt „Selbstbeobachtung“ geht es um das Erkennen und Definieren Ihrer Werte, Glaubenssätze, um Ihre ethischen und moralischen Prinzipien. Diese bilden das Fundament Ihrer Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Anschließend setzen Sie sich theoretisch wie praktisch mit Ihren Zielen auseinander. Dabei werden Sie aufgefordert, für verschiedene Zeithorizonte persönliche Ziele zu definieren. Sie setzen sich weiterhin mit Ihrer Persönlichkeit, Ihrer Ausstrahlung, Ihren Stärken und Schwächen sowie Ihrer eigenen Wahrnehmung und der Wahrnehmung durch andere Personen auseinander.
Ausgehend von den Grundlagen des ersten Teils gibt Ihnen der zweite Teil konkrete Impulse, wie und wo Sie an sich selbst arbeiten können. Das beginnt bei wesentlichen Arbeitstechniken, mit denen Sie Ihre Effektivität und die Effizienz Ihrer Arbeit steigern können. Vor allen Dingen gehören dazu das Zeitmanagement, Kreativitätstechniken, Lerntechniken, Schnell-Lesetechniken, Herangehensweisen systematischen Problemlösens sowie Aspekte des persönlichen Informations- und Wissensmanagements. Die Entwicklung Ihrer Ausstrahlung und der Fähigkeit zur Selbstdarstellung konfrontiert Sie im Folgenden mit Umgangsformen, Körpersprache, Rhetorik, Präsentation, Selbstvermarktung und dem Komplex der Bewerbung.
Selbstentwicklung bedeutet jedoch auch die Entwicklung Ihrer emotionalen Intelligenz – dem Umgang mit Ihren und den Gefühlen anderer. Neben geistigem Wachstum wird Selbstentwicklung auch begleitet von emotionalem Ausgleich, von Regeneration und von Freizeit. Hier erhalten Sie Impulse und Anregungen zur Balancierung Ihrer Entwicklung und Ihrer Aktivitäten.
Um erfolgreich in Gruppen agieren zu können, müssen Sie Gruppen verstehen. Das beginnt im Erkennen individueller Bedürfnisse und Handlungsmotive und setzt sich fort in der Kenntnis gruppendynamischer Prozesse und der spezifischen Eigenschaften von Gruppen als sozialem Gebilde. So erlangen oder vertiefen Sie im dritten Teil Kenntnisse interkultureller Besonderheiten und übertragen diese auf Gruppen mit Mitgliedern unterschiedlicher Herkunft. Damit schaffen Sie die Basis Ihrer interkulturellen Kompetenz. Im letzten Abschnitt des dritten Teils erwerben Sie die notwendigen Kenntnisse der Evaluierung von Gruppen und Personen im Arbeitsleben – eine Grundqualifikation, sobald Sie das erste Mal Personalverantwortung tragen.
Höchste Ebene im vierten Teil: Gruppenentwicklung
Der vierte Teil des Buches schließlich bringt Sie auf die höchste Ebene: das Etablieren und Fördern von Gruppen sowie die erfolgreiche Interaktion in diesen Gruppen. Sie erwerben die Kompetenz erfolgreichen Networkings – dem Aufbau, der Pflege und der Nutzung Ihres sozialen Beziehungsnetzwerks. Gruppenentwicklung beschränkt sich jedoch nicht auf die berufliche Ebene: Entwicklung und Wachstum beziehen sich in diesem Teil des Buches auch auf Ihre Partnerschaft, Ihre Familie und Ihre Freunde.
Zwei weitere Aspekte prägen den letzten Teil: auf der einen Seite die Kommunikation in und vor Gruppen. Dazu gehören vor allem Diskussionsleitung, Moderation, Verhandlung, Manipulation, Argumentation, Smalltalk, Schlagfertigkeit und Kommunikationsstörungen. Auf der anderen Seite erhalten Sie im Abschnitt „Teams und Mitarbeiter führen“ das nötige Handwerkszeug, um Teams und Mitarbeiter im Sinne der Philosophie dieses Buches erfolgreich zu entwickeln und zu leiten.
Theorie und Praxis
„Nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie“, hat Kurt Lewin einmal gesagt. Auf der anderen Seite ist alle Theorie nutzlos, wenn sie sich in der Praxis nicht bewährt.
Und so hört man von den Pragmatikern: „Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Theorie viel kleiner als in der Praxis.“ Darauf wiederum antworten Idealisten und Wissenschaftler gern: „Für zu viele Leute gilt: Alles, was sie verstehen ist praxisrelevant und was sie nicht mehr verstehen ist bloße Theorie.“
Ein wenig haben sie alle Recht. Aus diesem Grund haben wir als Autoren, André Moritz und Felix Rimbach, versucht, mit „Soft Skills für Young Professionals“ beides so gut wie möglich zu verbinden. Wir sind der Überzeugung, dass uns dies gelungen ist.
Das Buch spiegelt unseren individuellen Ansatz wider, theoretisch fundiertes Wissen mit einem motivierenden und aktivierenden Schreibstil zu verbinden. So soll es Sie einerseits mit dem theoretischen Know-how ausstatten, auf der anderen Seite jedoch auch aufrütteln und zu konkreten Entscheidungen und konkretem Handeln veranlassen. Wir haben dabei bewusst auf Fußnoten in wissenschaftlichem Stil verzichtet, da das Buch primär einem praxisorientierten Ratgeberstil folgt. Dennoch werden Sie auf verschiedenen Seiten auch Absätze finden, die zu konkreten Tipps zu erfolgreichen Verhaltensstrategien auch eine nützliche theoretische Basis vermitteln.
„Wer viel schießt, ist noch lange kein guter Schütze“ – wir sind der Meinung, dass soziale Kompetenz, kommunikative Kompetenz und Methodenkompetenz nicht zwingend nur auf Lebenserfahrung basieren. Im Gegenteil: Jeder kann sie erlernen! Nicht nur aus Büchern, aber gute Bücher können einen wesentlichen Impuls geben und essenzielle Grundlagen schaffen. Sie sind auf dem besten Weg dazu, diese Grundlagen zu erarbeiten und auszubauen.
1. Selbstbeobachtung
Grundlage aller gezielten Persönlichkeitsentwicklung ist die Kenntnis des eigenen Ich. Wer bin ich? Woher komme ich? Was will ich? Was ist mir wichtig? Wo will ich hin? Woran glaube ich? Was prägt mich? Wer ist mir wichtig? Wonach entscheide ich? Was beeinflusst mich? Wer beeinflusst mich? Was sind meine Werte? An welchen Moralvorstellungen richte ich mein Handeln aus? Was ist für mich tabu? An welchen Maßstäben messe ich mich? Woran messe ich andere Menschen? Was bin ich? Was habe ich? Was kann ich?
Diese Reihe von Fragen stellt nur einen kleinen Ausschnitt aus dem dar, womit Sie sich früher oder später im Verlauf Ihrer persönlichen Entwicklung, Ihres Wachstums und Ihres Lebens auseinander setzen.
Einige Antworten werden Sie automatisch mit zunehmendem Alter finden; sie ergeben sich aus der wachsenden Lebenserfahrung. Andere müssen Sie sich rechtzeitig und bewusst selbst beantworten, wenn Sie Ihr Leben gestalten wollen.
Als Leser dieses Buches möchten Sie Ihre Entwicklung höchstwahrscheinlich aktiv in die Hand nehmen und selbstbewusst planen und steuern. In diesem Sinne ist es notwendig, nicht passiv auf Antworten durch wachsende Lebenserfahrung zu warten, sondern proaktiv nach ihnen zu suchen, sich Antworten zu geben und Entscheidungen zu treffen. Dieses Kapitel begleitet Sie auf dem spannenden Weg der Selbstbeobachtung.
Schnellübersicht: Was erwartet mich in diesem Kapitel?
1) Im ersten Abschnitt „Werte & Glaubenssätze“ setzen Sie sich mit Fragen Ihrer persönlichen Moral und Ethik auseinander, identifizieren Glaubenssätze, die Ihr Handeln, Ihre (Vor-)Urteile und Ihr Werteverständnis prägen, und machen sich Ihre Ideale und persönlichen Werte bewusst.
2) Im zweiten Abschnitt „Ziele & Visionen“ richten Sie den Blick in die Zukunft:Wohin wollen Sie in Ihrem Leben gehen? Welchen Weg wollen Sie dazu beschreiten? Haben Sie bereits eine Vision, die Sie durch Ihr Leben – in guten wie in schlechten Zeiten – leitet? Sie erfahren von der motivierenden Funktion von Zielen und wie Sie diese für maximale Motivierung und Orientierung richtig formulieren. Was macht eine effektive Zieldefinition aus? Wie komme ich von einer Lebensvision und einem so genannten Mission Statement zu mittelfristigen Zielen und einer Orientierung für die Woche und den Tag? Welche Rolle spielen Zufall und Glück dabei?
3) Im dritten Abschnitt „Persönlichkeit & Ausstrahlung“ setzen Sie sich mit Merkmalen von Persönlichkeit und Ausstrahlung auseinander und reflektieren Ihre eigene Wirkung auf Mitmenschen. Sie werden sich die Auswirkungen von Fühlmustern, Denkmustern und Verhaltensmustern auf den Status quo Ihrer und anderer Persönlichkeiten bewusst machen. Darauf aufbauend lernen Sie, wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Authentizität, Souveränität und Charme zusammen mit dem Bewusstsein eigener Lebensrollen, Stärken und Schwächen und Persönlichkeitstypen das Gesamtbild Ihrer Ausstrahlung und letztlich Persönlichkeit bilden.
4) Im vierten Abschnitt „Warnehmung“ schließlich machen Sie sich - bewusst, wie sehr unterschiedliche Wahrnehmungen zu unterschiedlichen Einschätzungen, Eindrücken und Analyseergebnissen führen. Hier geht es insbesondere darum, ein Selbstbild und Fremdbild zu erstellen sowie die eigene und fremde Einschätzung Ihrer Person auf Abweichungen zu untersuchen.
1.1. Werte & Glaubenssätze – Grundlage Ihrer Persönlichkeitsentwicklung
Unsere Zivilisation basiert zu großen Teilen auf dem Konsens über bestimmte Werte und Moralvorstellungen. Trotz nicht enden wollender Konflikte, Kriege und Differenzen in Religion, Wirtschaft, Politik und Kultur gibt es grundlegende Wert- und Moralvorstellungen, die das dauerhafte Zusammenleben erst ermöglichen. Viele dieser Werte und Moralvorstellungen sind das Resultat von Erziehung, Sozialisierung und Religion. Sie finden eine Manifestierung in nationalen und internationalen Gesetzen sowie religiösen Schriften wie der Bibel, dem Koran und der Thora.
Individuelle Wertvorstellungen und sozialer Konsens über Werte
Dabei entsteht ein Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft. Idealerweise sollte jeder Mensch seine eigenen Wertvorstellungen suchen, finden und in seinem täglichen Leben und Handeln manifestieren. Die Entscheidung für eigene Werte schafft ein höheres Commitment und damit eine höhere persönliche Verbindlichkeit. Das Prinzip leuchtet ein: Hat jemand seine Werte gefunden, lebt er mit höherer Verbindlichkeit danach, als wenn ihm Eltern, Kirche oder die Gesellschaft als Ganzes bestimmte Werte vorschreiben. Auf der anderen Seite erfordert ein friedliches und geregeltes Zusammenleben jedoch gerade diesen Konsens über bestimmte Werte und eine entsprechende Verbindlichkeit für alle Gesellschaftsmitglieder.
Moral, Ethik und Ideale für sich selbst finden
Moral (von lateinisch „mores“: Sitten, Charakter, Gewohnheit) definiert sich als System von Werten und Normen und deren praktischer Umsetzung im Alltag. Damit unterscheidet sich Moral vom Begriff der Ethik. Der Ethikbegriff lässt sich auf die griechische Antike und Aristoteles zurückführen. Hier war mit „ethos“ vor allem „das Gute“ gemeint, das, was sich gehört und was gerecht ist. Moral hingegen bezieht sich auf die tatsächliche Anerkennung und Verwirklichung von sittlichen Werten und Normen im täglichen Leben der Menschen.
Instanzen der Moralprägung
Als wichtige moralische Instanz gilt die Religion. Mit dem Sinn, Zweck und Wesen der Moral setzen sich jedoch vor allem auch Philosophie, Theologie, Soziologie und Psychologie auseinander. Moral unterscheidet sich von persönlichen Grundwerten insofern, als sie eine universale Grundübereinstimmung über allgemein gültige Werte manifestieren soll. Ein Beispiel dafür ist die Achtung der Menschenwürde. In diesem Verständnis dient Moral als normativer Rahmen für alle oder zumindest die meisten Menschen einer Gesellschaft bezüglich ihres Verhaltens gegenüber anderen Mitgliedern der Gesellschaft.
Die Individualmoral und die gesellschaftliche Moral können, müssen aber nicht deckungsgleich sein. In den meisten Fällen beeinflusst die gesellschaftliche Moral als stillschweigende Übereinkunft von Verhaltensregeln und Wertmaßstäben auch die individuelle Prägung von Werten. Daher müssen Sie sich jedoch bereits im Vorfeld bewusst werden, inwieweit „Ihre Werte“ tatsächlich Ihre eigenen Werte sind, oder ob Ihnen diese nicht unbewusst durch Erziehung und Sozialisation durch die Gesellschaft oktroyiert wurden.
Den idealen Menschen gibt es nicht
Aus Moral und Ethik ergeben sich bestimmte Vorstellungen, wie der ideale Mensch sein und leben sollte. Philosophen aller Epochen streiten und formen an diesem Idealbild von Menschen. Allerdings gibt niemand praktische, lebende Beispiele für dieses Idealbild. Den idealen Menschen gibt es in der Praxis nicht, weil unterschiedliche Rahmenbedingungen und Persönlichkeitstypen unterschiedliche Menschen hervorbringen oder erfordern.
Die Vorstellung eines Ideals basiert meist auf der Aggregation aller Merkmale, Eigenschaften und Werte, die ein Individuum oder eine Gesellschaft allgemein als „gut“ und „richtig“ betrachten. Dabei vergessen wir jedoch häufig, dass es miteinander konkurrierende Ziele gibt, die beide „gut“, aber nicht gleichzeitig zu realisieren sind. So ist es vermessen zu glauben, Sie könnten alles um Sie herum in den Griff bekommen, zum Beispiel, was Sie und andere von Ihnen möchten.
Unvereinbarkeit von Zielen
Es ist einfach nicht möglich, gleichzeitig ein bedingungslos engagierter Angestellter, Manager oder Unternehmer zu sein, jederzeit für seine Kinder oder andere Familienmitglieder da zu sein, sich dann für Entwicklungshilfe und gemeinnützige Projekte zu engagieren, ein Musterkonsument zur Ankurbelung der Binnennachfrage und des gemeinschaftlichen Wohlstands zu sein und letztendlich allem Materiellen zu entsagen und ein freies, ehrliches Leben für Religion, Philosophie oder Erlangung von Weisheit und Erleuchtung zu führen.
Machen Sie sich frei von Idealvorstellungen und Perfektion
Eine grundsätzliche Empfehlung bei der Suche und Definition der eigenen Werte, Moral und Prinzipien lautet daher: Machen Sie sich frei von Idealvorstellungen! Das ist der wichtigste Schritt zu einem einfacheren, entlasteten und glücklicheren Leben. Der Konflikt, der sich aus dem Versuch ergibt, allen Idealvorstellungen gerecht zu werden, ist einer der Hauptgründe für unglückliche, gestresste und/oder orientierungslose Menschen in unserer Gesellschaft.
Haben Sie sich erst einmal bewusst gemacht, dass Sie das Ideal nicht erreichen können, kann die Suche nach eigenen Moralvorstellungen und Werten viel entspannter erfolgen. Möchten Sie ein verantwortungsvolles Leben nach diesen Moralvorstellungen führen, müssen Sie diese als eigene Verpflichtung, nicht jedoch als auferlegten Zwang verstehen. Der Schlüssel liegt wie so oft in der Einstellung, im „Ich möchte“ statt „Ich muss“!
Je ehrlicher das eigene Commitment, die Selbstverpflichtung zu einem Wert, einer Tätigkeit oder einer Person ist, umso verbindlicher, stärker und motivierender ist diese Selbstverpflichtung. Es macht keinen Sinn, sich „Toleranz“ auf die Fahnen zu schreiben bzw. schreiben zu lassen, wenn Sie zum Beispiel nicht wirklich daran glauben. Ihre Wertvorstellungen müssen ehrlich sein, andernfalls bleiben sie nur Lippenbekenntnisse und werden auf Ihrem Weg keine Unterstützung und Orientierung sein.
Die Auswirkung kleiner sprachlicher Details
Persönliche Wertvorstellungen beginnen deshalb zum Beispiel mit:
„Ich will …“
„Es ist meine Überzeugung, dass …“
„Es ist mir wichtig …“
Schlechte Formulierungen und meist keine wirklich persönlichen Werte sind zum Beispiel:
„Ich sollte (besser) …“
„Man muss …“
Diese sprachlichen Finessen erscheinen mitunter pedantisch, haben aber eine große Wirkung auf die Motivation, das Lebensgefühl und die persönliche Ausstrahlung. Insbesondere der Unterschied zwischen „ich möchte“ und „ich muss“ kann den bedeutenden Unterschied zwischen Erfolg, Ausstrahlung und Charisma zweier Personen machen.
Glaubenssätze erkennen und hinterfragen
Neben Ihren Wert- und Moralvorstellungen ist Ihr Leben durch so genannte Glaubenssätze geprägt. Darunter sind – in den meisten Fällen unbewusste – Einstellungen, Meinungen, Überzeugungen und Paradigmen zu verstehen, die Ihr Handeln, Ihre Einschätzung von Menschen und Situationen und indirekt auch Ihr Wertekonzept beeinflussen oder manifestieren.
Glaubenssätze als Motor und als Bremse von Denken und Verhalten
Glaubenssätze sind gut und hilfreich, wenn sie einem Menschen Charakter und Orientierung geben. Sie sind im besten Fall das Ergebnis der eigenen Meinung und eines festen Standpunkts sowie Merkmal einer charakterstarken Persönlichkeit. Auf der anderen Seite können Glaubenssätze auch hinderlich und kontraproduktiv sein, wenn sie die persönliche Entwicklung bremsen oder zu Fehleinschätzungen und Fehlreaktionen verleiten.
Bodo Schäfer hat in seinem Buch „Der Weg zur finanziellen Freiheit“ recht treffend beschrieben, wie Glaubenssätze im Sinne von „Geld macht arrogant, egoistisch und machthungrig“ oder „Geld ist böse“ völlig im Widerspruch zu dem Wunsch vieler Menschen nach materiellem Reichtum stehen. Eine Person, die nach der eigenen Million strebt, gleichzeitig unbewusst solche Einstellungen mit sich herumträgt, erreicht das angebliche Ziel vermutlich nie! Ebenso lässt sich für einen Studenten der Wunsch, Jahrgangsbester zu werden oder unter den ersten zehn der Absolventen zu landen, kaum realisieren, wenn dieser gleichzeitig leistungshemmende Vorstellungen wie das Bild des „Strebers“ in sich herumträgt oder der Auffassung ist, „die letzten Notenpunkte zur Spitze kosten unverhältnismäßig viel Extraaufwand, der nicht durch den Zusatznutzen gerechtfertig ist“.
Nützliche Glaubenssätze sind ein Hebel zu mehr Erfolg und Zufriedenheit
In diesem Sinne ist es unerlässlich, sich seine Glaubenssätze – im Zuge der Selbstbeobachtung umfassend bewusst zu machen. Dabei gilt es jedoch nicht nur, nach negativen, das heißt, hinderlichen Überzeugungen zu suchen, sondern sich auch gezielt bewusst zu machen, wie das eigene Handeln auch positiv von Glaubenssätzen motiviert wird. Wer von Kindesbeinen an erlebt hat, dass Leistung früher oder später angemessen entlohnt wird, hat eine tief verinnerlichte und langfristige Motivation für Spitzenleistungen.
Eine gute Übung zum Herausfinden eigener Glaubenssätze ist, die folgenden Aussagen für sich fortzusetzen. Dies können Sie sogar an einem gemütlichen Abend zu zweit mit Ihrem Partner machen. Dabei entstehen mitunter erstaunliche Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse:
▪ Das Leben ist …
▪ Sterben müssen heißt …
▪ Menschen können …
▪ Menschen sollten …
▪ Die Welt braucht …
▪ Das Wichtigste am Leben ist …
▪ Unwichtig ist …
▪ Vergangenheit ist …
▪ Zukunft bedeutet …
▪ Gegenwart heißt …
▪ Zeit ist …
▪ Liebe ist …
▪ Freunde haben ist …
▪ Glück ist …
▪ Zufriedenheit bedeutet …
▪ Gefühle sind …
▪ Konflikte bedeuten …
▪ Hoffnung ist …
▪ Glauben können ist …
▪ Träume sind …
▪ Visionen sind …
▪ Veränderung bedeutet …
▪ Stagnation bedeutet …
▪ Ich brauche …
▪ Angst habe ich vor …
▪ Mut bedeutet …
▪ Das Allerschwerste ist …
▪ Es ist so leicht …
▪ Verlieren bedeutet …
▪ Gewinnen heißt …
▪ Perfekt sein bedeutet …
▪ Versagen bedeutet …
▪ Verlust ist …
▪ Schmerz ist …
▪ Arbeiten bedeutet …
▪ Geld bedeutet …
▪ Leistung ist …
▪ Stärke ist …
▪ Fantasie kann …
▪ Kreativität ist …
▪ … kann ich nicht ertragen.
▪ … wünsche ich mir mehr als alles.
▪ … ist mir sehr wichtig.
▪ … will ich erreichen.
▪ … mag ich besonders.
▪ … hasse ich an mir.
Grundsätzliche Lebenseinstellungen wählen
Geistiges Wachstum ist ein Prozess
Selbstbeobachtung ist ebenso wie der im zweiten Buchteil betrachtete Bereich der Selbstentwicklung ein Prozess. Sie können dafür kein Zertifikat erwerben oder einen Haken dranmachen, wenn Sie meinen, es erledigt zu haben. Im Verständnis eines Prozesses, eines Wachsens und Reifens macht es dabei Sinn, eine Ausgangssituation und einen Grundwert zu identifizieren, um zu erkennen, von wo aus Sie sich bewegen. Ihre Grundeinstellungen sind insofern bedeutsam, als sie Sie auf dem ganzen Weg begleiten. Ein klassisches Paradigma und Weltbild ist hier das „positive thinking“, das heißt, grundsätzlich mit einer optimistischen Haltung an neue Herausforderungen, vorhandene Konflikte oder persönliche Planungen zu gehen.
Selbstvertrauen spielt hier eine bedeutende Rolle. Statt „Das kann ich doch eh nicht“ oder „Dafür fehlt mir das Talent“ gilt es, an sich zu glauben. Wer sich zum Beispiel mit Techniken des Neurolinguistischen Programmierens auseinander setzt (NLP), findet diesen Ansatz immer wieder in Aussagen wie dieser:
„Um herauszufinden, ob dies etwas für Sie ist oder ob Sie es schaffen können, müssen Sie so tun, als ob es so wäre.“
Selbsterfüllende Prophezeiungen
Das Prinzip der sich selbst erfüllenden Prophezeiung fördert hier Ihren Erfolg. Wenn Sie sicher sind, dass Sie etwas schaffen, ist die Wahrscheinlichkeit, es tatsächlich zu schaffen, deutlich höher als bei einer pessimistischen Grundeinstellung. Wer nicht daran glaubt, etwas zu schaffen, wird es in vielen Fällen auch nicht realisieren. Wer gar nicht erst anfängt, wird nie erfahren, ob es funktioniert hätte, und sich lediglich in dem zweifelhaft komfortablen Glauben bestätigen, es sowieso schon vorher zu wissen und gewusst zu haben.
Intellektueller Ausgleich ist wichtig
Beständiges geistiges Wachstum, wie es in Kapitel 2.4. diskutiert wird, ist zum Beispiel sicher eine Idealvorstellung, und Sie mögen einräumen, dass in der Realität des Alltags häufig wenig Raum für das Lesen hoch geistiger Literatur, den Besuch kultureller Veranstaltungen oder die Muße für Musik, Kunst und Philosophie herrscht. Wer hart am Leben zu arbeiten hat, in finanziellen Nöten steckt, neben Job, Familie und Wohnung oder Haus kaum Zeit für sich selbst hat, dem mag das Ideal des beständigen geistigen Wachstums praxisfremd vorkommen. Aber gerade für Menschen in einer solchen Situation bietet das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines konstanten persönlichen Wachstumsprozesses Perspektiven. Der bekannte deutsche Zeitmanagementexperte Lothar J. Seiwert hat diese Erkenntnis in einem Buchtitel plakativ subsumiert:„Wenn du es eilig hast, gehe langsam.“
Zeitmanagementtheorien, wie wir sie in Kapitel 2.1. vorstellen, mögen in der Praxis nicht immer so erfolgreich sein, wie sie es auf geduldigem Papier sind. Letztlich ist es aber der erste Schritt, sich damit auseinander zu setzen, denn das Verständnis der Theorie schafft zumindest eine höhere Sensibilität im praktischen Alltag. Letztlich sind häufig eine richtige und eine bewusste Grundeinstellung der erste Schritt jeder langen Reise.
Die richtige Einstellung ist wichtig
So schafft Ihre Lebenseinstellung den Unterschied, der es Ihnen erlaubt, auch unter schwierigen Bedingungen, wenn auf den ersten Blick kein Raum für bestimmte Dinge vorhanden ist, Schritt für Schritt genau diesen Raum freizumachen. Es ist dieser Unterschied, der dazu führt, gerade in harten Zeiten den Glauben und den Optimismus nicht zu verlieren. Denn es macht einen Unterschied, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ihre Einstellung ist entscheidend für Ihre Ausgeglichenheit und Ihren persönlichen Erfolg.
„Das Leben ist bezaubernd, man muss es nur durch die richtige Brille sehen.“
ALEXANDRE DUMAS DER ÄLTERE
Gehören Sie zu den Menschen, die Probleme, Unklarheiten, Ungewissheit und Überraschungen als Risiken sehen? Erkennen Sie in einer Überraschung oder einem Problem eine Chance? Denken Sie beständig darüber nach!
Fehler akzeptieren
Sie haben einen Fehler gemacht? Das ist psychologisch für Sie nur halb so schlimm, wenn Sie bereit sind, Fehler zu akzeptieren und Fehler einfach als Erfahrung und Lernimpuls verbuchen.
Machen Sie sich bewusst, dass Ihre moralischen und ethischen Werte, Ihre Ideale, Ihre Glaubenssätze und Ihre Lebenseinstellungen die entscheidende Basis für Ihre Entwicklung und Ihr Handeln sind. Entsprechend sind sie auch die Basis für alle folgenden Kapitel dieses Buches mit konkreten Handlungsempfehlungen und Tipps zu effektiven Verhaltensweisen.
„Erfolg ist das Ergebnis richtiger Entscheidungen. Richtige Entscheidungen sind das Ergebnis von Erfahrungen. Erfahrung ist das Ergebnis falscher Entscheidungen.“
ANTHONY ROBBINS
Übung 1.1.
(A) Schreiben Sie spontan fünf wichtige Werte in Ihrem Leben auf! Welche Eigenschaften, Handlungsmaximen und Verhaltensweisen finden Sie persönlich für Ihre eigene Person und für andere Menschen richtig und wichtig?
(B) Umkreisen Sie in der folgenden Liste die Werte, die Ihnen richtig und wichtig erscheinen!
(C) Vergleichen und überdenken Sie die Ergebnisse aus (A) und (B)! Welche sind Werte, welche sind Moralvorstellungen, welche sind Tugenden – oder macht das überhaupt einen Unterschied? Mit welchen können Sie sich wirklich identifizieren? Welche würden Sie sich selbst und ganz bewusst öffentlich auf die Fahnen schreiben? Denken Sie wenigstens 5 Minuten darüber nach.
(D) Im Ergebnis der drei Aufgaben und Überlegungen:Welches sind die drei für Sie heute ausschlaggebenden Werte, an denen Sie Ihr Leben und Handeln ausrichten wollen?
(E) Schreiben Sie drei Glaubenssätze auf, von denen Sie denken, „ich sollte das eigentlich nicht denken/machen/sagen/glauben“, oder wählen Sie Glaubenssätze, die Sie Ihrer Meinung nach potenziell in irgendeiner Form behindern!
1.2. Ziele & Visionen – Ihre Zukunftsausrichtung
„Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will.“
MICHEL DE MONTAIGNE
„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“
LAOTSE
Aller Fortschritt basiert auf Weiterentwicklung. Gezielte Weiterentwicklung setzt voraus, dass Sie wissen, wo Sie stehen und wo Sie hingehen wollen.
Ausgehend vom Bewusstsein, was Sie derzeit können (im Sinne von Qualifikation und Möglichkeiten unter den gegebenen Rahmenbedingungen), was Sie derzeit haben (Wissen, materiellen Dingen, Kontakten) und was Sie derzeit wollen (Wünsche, Bedürfnisse) sind konkrete Ziele und Wege für die Weiterentwicklung festzulegen.
Ziele richtig definieren
Merkmale „wohlgeformter Ziele“
Um Ziele motivierend zu gestalten, sodass sie Orientierung geben und Energie für das „Anpacken“ freisetzen, bedarf es einer richtigen Formulierung. Entscheidende Merkmale einer solchen Formulierung sind:
1.
Schriftlichkeit
5.
Positive Formulierung
2.
Realismus
6.
Aktive Formulierung
3.
Terminierung
7.
Verantwortungszuweisung
4.
Messbarkeit
8.
Visualisierung
1. Schriftlichkeit
Fühlen Sie sich an ein beliebiges Silvesterfest zurückversetzt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind Sie in das neue Jahr mit einigen Zielen oder guten Vorsätzen gegangen. Wie viele dieser Ziele haben Sie über die Jahre gesehen tatsächlich realisiert? Hatten Sie diese schriftlich fixiert? Ein entscheidender Faktor für die Zielerreichung, noch vor der richtigen Formulierung an sich, ist die schriftliche Fixierung. Wenn Sie etwas aktiv zu Papier gebracht haben, hat das Ganze psychologisch eine wesentliche höhere Selbstverpflichtung, als beispielsweise einfach nur gedanklich ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr ins Auge zu fassen. Zudem ermöglicht die Schriftlichkeit eine spätere Kontrolle: Was Sie einmal schwarz auf weiß auf dem Papier festgehalten haben, können Sie später nicht einfach umdeuten oder aufweichen (Kapitel 4.4.).
Stärkere Selbstverpflichtung
Ebenso wie ein Vertrag bindend ist, erzeugen niedergeschriebene Ziele ein höheres Commitment. Diese persönliche Selbstverpflichtung wirkt dabei noch stärker, wenn der Betroffene das Ziel selbst aktiv niederschreibt. Dies ist insbesondere im Rahmen von Zielvereinbarungsgesprächen bedeutsam: Vereinbarte Ziele für das nächste Jahr sollte jeder Mitarbeiter selbst schreiben und nicht von der Führungskraft das fertig ausgefüllte Blatt vorgesetzt bekommen.
2. Realismus
Nur realistische Ziele motivieren
Ihre Ziele müssen realistisch formuliert sein, um motivieren zu können. Nur ein Ziel, an das Sie auch glauben, wird genug Energie freisetzen, um loslegen und beständig auf die Zielerreichung hinarbeiten zu können. Halten Sie die Zielerreichung für unrealistisch, werden Sie nur mit halber Kraft arbeiten. Dies gilt ebenso für alle anderen an der Zielerreichung beteiligten Personen. Das Motto „Warum sollen wir uns anstrengen, den Termin schaffen wir doch eh nicht“ ist verständlich und psychologisch ein Schutz für den Menschen, sich sinnlos zu verausgaben. Auf der anderen Seite dürfen Sie das Ziel jedoch nicht zu tief hängen, denn dann besteht keine Notwendigkeit, sich anzustrengen. Dies ist gerade für Führungskräfte ein wichtiger Aspekt: Überzogene Ziele führen zu Überlastung, Stress, innerer Kündigung, eingeschränkter Einsatzbereitschaft und Unzufriedenheit. Zu niedrig angesetzte Ziele führen auf Dauer ebenso zu Unzufriedenheit und Demotivation, vor allem aber zu suboptimalen Ergebnissen.
Erfolg macht zuversichtlich
Jeder braucht eine gewisse Herausforderung. Ein realistisches Ziel soll also weder über- noch unterfordern, jedoch ein gewisses Herausforderungspotenzial enthalten. Ebenso wie die Wertschätzung von Dingen häufig davon abhängt, wie viel jemand dafür aufgeben musste, so resultiert die Zufriedenheit eigener Betätigung daraus, wie anstrengend und herausfordernd der Weg zum Ergebnis war. Konnten Sie Ihr Bestes geben und an der Aufgabe wachsen, können Sie mit Stolz auf das erreichte Ergebnis und den Weg dorthin zurückblicken. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstachtung wachsen, und die Motivation für anstehende Herausforderungen steigt. Nichts macht zuversichtlicher, als Erfolg zu haben. Eine realistische Zielsetzung ist letztlich nicht nur Voraussetzung für die Zielerreichung und unter gegebenen Rahmenbedingungen für optimale Ergebnisse, sondern nebenbei auch Motor für persönliches Wachstum in einer Aufwärtsspirale.
3. Terminierung
Eine Aufgabe nimmt immer so viel Zeit in Anspruch, wie zur Verfügung steht.
Terminieren stellt sicher, dass Projekte auch abgeschlossen werden.
Zu jeder Zieldefinition gehört ein konkreter Termin, bis zu dem die Aufgabe oder Zielstellung realisiert ist. Nur so wird die Sache angepackt, vorangetrieben und der innere Schweinehund mitsamt seiner „Aufschieberitis“ überwunden. Zwar sorgt die wachsende Projektkultur mit knappsten Terminvorgaben – so genannten „Deadlines“ – für permanenten Stress unter Mitarbeitern. Auf der anderen Seite zeigt sich jedoch, dass die meisten Aufgaben und Ziele doch irgendwie immer in der gegebenen Zeit realisiert werden können. Je näher die Deadline rückt, umso effizienter wird in der Regel gearbeitet. Je knapper die Zeit, umso eher verzichtet man auf Kleinigkeiten und Details, die mehr Zeit kosten als Nutzen bieten.
Natürlich muss die Terminierung auch hier realistisch sein. Voraussetzung ist aber, dass überhaupt ein Terminziel besteht, an dem die Aufgabe oder das Projekt fertig gestellt sein müssen. Ohne Termin bleibt das Ziel in der Regel ein Wunsch, dessen Realisierung sich permanent nach hinten verschiebt.
4. Messbarkeit
Die Terminierung Ihres Ziels ist ein erster Schritt in Richtung Messbarkeit. In der Regel wird die Zielerreichung jedoch nur sekundär am Termin und primär an anderen qualitativen und quantitativen Faktoren gemessen. Die Identifikation und Formulierung dieser Faktoren sowie die Vorgabe eines konkreten Zielwertes bzw. Zielzustands ist eine wesentliche Aufgabe bei der Zieldefinition. Ziele müssen konkret messbar formuliert sein, sonst haben Sie keine Chance zu überprüfen, ob und wann das Ziel erreicht wurde.
Ungünstige und günstige Zielformulierungen
Ungünstige Zielformulierungen sind „Ich will Karriere machen“, „Ich will weniger rauchen“ oder „Ich möchte mehr Zeit mit Martina verbringen“. Richtig sind konkrete Zielformulierungen wie „Ich will meine Zwischenprüfung mit 2,0 abschließen“, „Ich rauche nur noch fünf Zigaretten am Tag“ oder „Ich möchte jeden ersten Montag im Monat mit Martina verbringen“.
5. Positive Formulierung
„Es ist ein großer Unterschied, ob wir spielen, um nicht zu verlieren, oder ob wir spielen, um zu gewinnen.“
BODO SCHÄFER
Bewusstsein auf erfreulichen Zustand lenken
Die Einstellung macht den Unterschied. Die Zielformulierung muss deshalb positiv abgefasst sein, also ohne negative Wörter wie „nicht“, „kein“, „weniger“ und so weiter. Derartige Formulierungen lenken das Bewusstsein auf den negativen Umstand, statt es auf einen positiven Zielzustand zu fokussieren und positive Energie freizusetzen.
Statt „Ich will weniger rauchen“ formulieren Sie Ihr Ziel in der Art: „Als Nichtraucher führe ich ein gesundes Leben und fühle mich fit.“ Diese zweite Formulierung lenkt das Bewusstsein auf den erfreulichen Zustand eines Nichtrauchers, während der erste Versuch eher ein negatives Zwang- und Schuldgefühl im Format „Ich rauche – das ist schlecht. Ich muss damit aufhören“ erzeugt.
6. Aktive Formulierung
Neben einer positiven Formulierung ist bei der Zieldefinition insbesondere auf eine aktive Beschreibung des Ziels bzw. der Maßnahmen zu achten. Dies erhöht die Verbindlichkeit und fördert das Anpacken der Aufgabe. Statt einer Formulierung nach dem Schema „SAP-HR wird eingeführt“ oder „Einführung SAP-HR“ verwenden Sie aktive Formulierungen wie „Einführen von SAP-HR“. Eine gute aktive Formulierung macht klar, dass Sie Maßnahmen zur Realisierung in Angriff nehmen müssen und nicht passiv auf das Eintreten des Zielzustands warten können.
7. Verantwortungszuweisung
Klare Verantwortlichkeiten erhöhen die Verbindlichkeit
Der nächste Schritt nach einer aktiven und positiven Formulierung ist das Einbinden der Verantwortung in die Zieldefinition. Die Zieldefinition soll klar werden lassen, wer konkret für die Zielerreichung zuständig ist. Die Verantwortlichen sollen sich darüber hinaus konkret angesprochen und tatsächlich für die Realisierung und alle dazu notwendigen Maßnahmen verantwortlich fühlen. Die Zieldefinition „Einführen von SAP-HR“ können Sie somit erweitern zu „Einführen von SAP-HR durch die IT-Abteilung bis zum 31.12. dieses Jahres“. Ebenso erzeugt die Formulierung eines persönlichen Ziels „Website Segelverein“ in der Form „Ich erstelle die Website für unseren Segelverein bis zum Jahresende“ eine deutlichere Identifikation mit der Aufgabe und dem Ziel.
8. Visualisierung
Die Zielerreichung erfolgt in der Regel umso effizienter, je höher die motivatorische Kraft in der Zielformulierung ist. Eine schriftliche, realistische, aktive und positive Zielformulierung ist eine essenzielle Grundlage für die gewünschte Motivierung der Beteiligten. Ein bemerkenswerter Effekt lässt sich darüber hinaus erreichen, wenn Sie das Ziel bzw. den Zielzustand so konkret wie möglich visualisieren.
Je konkreter und klarer die Vorstellung vom Ziel, umso höher die motivatorische Kraft des Ziels.
Diese Visualisierung kann entweder tatsächlich in Bildform erfolgen, oder aber auch in geschickter Formulierung des Ziels als Zielzustand. Zum Beispiel so: Statt „Ich möchte der Jahrgangsbeste werden“ formulieren Sie das Ziel so, als ob Sie es bereits erreicht hätten: „Ich bin der Jahrgangsbeste“. Statt „Ich möchte mit 40 ein Haus am See haben“ heißt es dann „Ich bin 40 und habe ein Haus am See“.
Je konkreter die Vorstellung vom Zielzustand, umso klarer halten Sie sich das Ziel jederzeit vor Augen. Je klarer die Vorstellung, umso greifbarer das Ziel. Je greifbarer das Ziel, umso höher die Motivation, die letzten Schritte zu diesem Ziel in Angriff zu nehmen. Das Ziel scheint nicht mehr so weit entfernt, wird realistischer. Je realistischer und konkreter es sich abzeichnet, umso mehr Energie wird für die Zielerreichung freigesetzt und aufgewendet.
Wünsche konkret visualisieren
Aus diesem Grund empfiehlt es sich, gerade materielle Ziele so konkret, detailliert und ausgeschmückt wie möglich zu visualisieren. Wenn Sie für ein Auto sparen und zum Beispiel unbedingt ein bestimmtes Cabrio Ihr Eigen nennen wollen, stellen Sie sich ein Bild von diesem Wagen auf den Schreibtisch und stecken Sie ein Bild davon in Ihre Geldbörse. Wie soll das Haus am See konkret aussehen? Machen Sie sich einen Plan. Wo soll die Terrasse hin, wie sieht es aus, wenn die Sonne ins Wohnzimmer fällt? Stellen Sie sich vor, wie das Boot am Bootssteg befestigt ist und im Wind schaukelt. Planen Sie den Kamin – gehen Sie in einen Baumarkt und schauen Sie sich nach einem Wunschmodell um. Stellen Sie sich vor, wie Sie im Winter mit einem Glas Rotwein davor sitzen und guter Musik lauschen. Solche plakativen Vorstellungen verstärken den Wunsch, konkretisieren das Ziel und setzen unglaublich viel Energie und Motivation frei.
Wenn Sie wissen, wo Sie hinwollen und wie es dort aussieht, fühlen Sie tief in sich den Wunsch, sofort loszulaufen. Die konkrete Vorstellung und die Begeisterung sind Ihr Motor! Stellen Sie sich wie ein Marathonläufer das Ziel vor, das unbeschreibliche Gefühl, durch das Ziel zu laufen. Das gibt Kraft, auch zwischenzeitliche Schwächen und Probleme zu überwinden. Sie wissen, wo Sie hinwollen. Sie haben Ihr Ziel visualisiert und motivierend vor Augen!
Tabelle 1: Richtige und falsche Zielformulierungen
Falsche Zielformulierung
Richtige Zielformulierung
„Wir wollen die Prozesse im Unternehmen verbessern.“
„Zum Jahresende liegt die durchschnittliche Fehlerrate in der Produktion unter 5 %.“
„Wir müssen kundenfreundlicher werden.“
„Wir führen bis zum 1. Juli ein System fester Kundenbetreuer sowie kostenlose Service-Rufnummern ein. Der Erfolg wird durch eine jährliche Kundenzufriedenheits-Befragung evaluiert.“
„Ich will mehr lesen.“
„Im Sommerurlaub werde ich die Bücher ‚Soft Skills für Young Professionals’ und ‚Omnisophie’ lesen.“
„Mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen.“
„Ich treffen mich jeden Montag mit Gordon, Toni und Sebastian in der Lykia-Bar zum Kartenspielen.“
„Ich ernähre mich gesund.“
„Ich mache jeden Sonntagmorgen einen Obstsalat und frisch gepressten Orangensaft für das Familienfrühstück.“
Zielbildung und Strukturierung
Von der langfristigen Vision zum Ziel für den Tag
Bei der Auseinandersetzung mit Zielen gilt es, sich die Hierarchie von Zielen zu verdeutlichen. Eine – im Folgenden erarbeitete – Lebensvision stellt zwar eine grobe Orientierung dar, bietet jedoch eine zu geringe Konkretisierung und Verbindlichkeit, um tägliche Aktivitäten daran auszurichten. Langfristige Ziele und Visionen sind wichtig, um dem Leben Sinn und Richtung zu geben, aber weniger geeignet, um im Jetzt und Hier wirklich Aktionen anzustoßen. Aus diesem Grund ist es erforderlich, Ziele von einem langfristigen Zeithorizont auf mittelfristige Zielstellungen bis hin zur kurzfristigen Zielvorgabe herunterzubrechen.
Natürlich gibt es für Ihre Ziele und Zeitplanung unterschiedliche Zeithorizonte. Deshalb macht es Sinn, langfristige Ziele auf mittelund kurzfristige Ziele herunterzubrechen. Eine solche Zielhierarchie kann dann wie folgt aussehen:
1.
Lebensziele
5.
Quartalsziele
2.
Fünfjahresziele
6.
Monatsziele
3.
Zehnjahresziele
7.
Wochenziele
4.
Jahresziele
8.
Tagesziele
Was möchten Sie im Laufe Ihres Lebens erreichen? Was möchten Sie in den nächsten zehn Jahren erreichen? Was in den nächsten fünf Jahren? Was müssen Sie dafür im Laufe des nächsten Jahres machen?
Zeitpunktund zeitraumbezogene Ziele
Grundsätzlich lassen sich bei der Betrachtung des Zeitaspektes zeitpunkt- und zeitraumbezogene Ziele unterscheiden. Ein zeitpunktbezogenes Ziel sieht vor, dass die Zielerreichung zu einem bestimmten Zeitpunkt gewährleistet ist, zum Beispiel zum Jahresende ein Körpergewicht von 75 kg auf die Waage zu bringen. Ein zeitraumbezogenes Ziel verlangt hingegen die permanente Zielerreichung innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums, so zum Beispiel der Wunsch, im gesamten Jahresablauf das Körpergewicht im Bereich von 75 bis 80 kg zu halten.
Typisierung und Ausgewogenheit von Zielen
Die Gesamtheit Ihrer Ziele muss ausgewogen sein
Neben der Unterscheidung nach ihrem zeitlichen Horizont lassen sich Ziele auch nach anderen Perspektiven typisieren. Eine solche Typisierung ist sinnvoll, da Sie erst dadurch erkennen können, wenn alle Ihre Zielstellungen in nur eine bestimmte Richtung tendieren. Das können Sie zwar als „konsequent“ bezeichnen, eine zu einseitige Ausrichtung aller Ziele ist im Sinne einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung erfahrungsgemäß aber eher problematisch (Kapitel 3.1.).
Besteht das persönliche Zielsystem hauptsächlich aus materiellen Zielen, stellen sich früher oder später Konflikte und Zweifel über den Sinn alles Zielstrebens ein. Da nach Maslow Bedürfnisse grundsätzlich unbegrenzt sind, lässt sich hier nie eine vollständige Zufriedenheit erreichen. Zudem stellt sich früher oder später Frustration ein, weil der reine Materialismus natürlich nicht glücklich macht. Gefragt ist also ein ausbalanciertes persönliches Zielsystem, das Elemente möglichst verschiedener Zieltypen enthält. So lässt sich mit einem ausgewogenen Konzept von materiellen und immateriellen Zielen, zum Beispiel ein bestimmtes Wohnumfeld, Auto, Hobby, die Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen, geistiges Wachstum, Gesundheit und Sport, Kultur oder Kreativität, viel eher ein Zustand des Glücks realisieren. Ist alles Handeln nur auf das Erarbeiten der „ersten Million“ ausgerichtet und bleiben andere Zielbereiche auf dem Papier und im praktischen Leben leer, fehlt ein ausgewogener Zielmix im Sinne eines ganzheitlichen Lebenskonzepts (Kapitel 2.1.).
Je größer das individuelle Zielbündel wird, umso wichtiger ist, dass Sie eine Priorisierung vornehmen. Dieses Thema fällt schwerpunktmäßig in den Bereich des persönlichen Zeitmanagements, zu dem Sie im Weiteren detaillierte Informationen erhalten.
Erkennen und Umgehen mit Zielkonflikten
Komplementäre Ziele
Einen möglichst ausgewogenen Zielmix zu finden, kann schwieriger als erwartet sein. In der Praxis treten regelmäßig Zielkonflikte auf, die es im Vorfeld zu erkennen und möglichst zu umgehen gilt. Im Idealfall handelt es sich bei allen Zielen um komplementäre Ziele, das heißt, eine höhere Zielerreichung des Ziels A führt automatisch zu einer höheren Zielerreichung des Ziels B. Ein Beispiel dafür kann verallgemeinert „Gesünder ernähren und dadurch Abnehmen“ sein. Im täglichen Leben ist dieser Idealfall leider relativ selten anzutreffen – an der Tagesordnung sind häufig eher Zielkonflikte.
Konkurrierende Ziele
In diesen Bereich fallen konkurrierende Ziele. Eine Zielkonkurrenz liegt vor, wenn eine erhöhte Zielerreichung von A zu einem geringeren Zielerreichungsgrad des Ziels B führt. So lässt sich in der Regel der Vorsatz, mehr Biokost in Naturkostläden zu kaufen, kaum mit dem Ziel in Einklang bringen, weniger Geld für die monatlichen Lebensmittel auszugeben.
Zielantinomie und Zielindifferenz
Problematisch sind Zustände der Zielantinomie, bei denen die Zielerreichung von A die Zielerreichung von B ausschließt. Ein Beispiel: So widersprechen sich die Zielstellungen, sich vermehrt und regelmäßiger telefonisch bei Freunden und Verwandten zur Kontakterhaltung und -pflege zu melden, gleichzeitig aber die Telefonrechnung innerhalb der nächsten 6 Monate zu halbieren. Zielindifferenz dagegen liegt vor, wenn sich die Ziele A und B in ihrer Zielerreichung nicht beeinflussen. So besteht zwischen der Naturkost und der Telefonrechnung weder ein Konflikt noch ein Zusammenhang.
Lebensvision und Mission Statement
„Um wirklich glücklich zu sein, muss man eine Aufgabe und eine große Hoffnung haben.“
RICARDA HUCH
Eine große Aufgabe schafft Sinn für das persönliche Leben
Eine der wichtigsten Aufgaben im Rahmen einer gezielten und ausgewogenen Persönlichkeitsentwicklung ist das Formulieren einer Lebensvision. Die Amerikaner nennen eine solche Vision auch „Mission Statement“. Ihre Lebensvision, Ihr Mission Statement ist essenziell. Das Zitat „Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will“ zu Beginn des Kapitels 1.2. veranschaulicht die Bedeutung einer solchen Richtungsvorgabe und Orientierung so treffend, dass es an dieser Stelle noch einmal erinnert sei.
Ein möglichst konkreter, individuell, aus tiefem Herzen und mit gesundem Verstand erarbeiteter Lebensentwurf bildet nicht nur die Grundlage für das Herunterbrechen und Operationalisieren von Teilzielen. Eine konkrete, visualisierte, voll Begeisterung erfüllte Vorstellung vom eigenen Leben setzt eine unglaubliche Menge an Energie, Hartnäckigkeit, Ehrgeiz und Leistungsanreiz frei. Sie bietet Orientierung in schweren Phasen, bei Rückschlägen und persönlichen Tiefschlägen, in harten Zeiten.
„Der Weg ist das Ziel“
KONFUZIUS
Ganzheitliche Sicht relativiert Probleme
Die Vorstellung vom Ziel bzw. die ganzheitliche Sicht vom Lebensweg hilft Ihnen, Konflikte und Probleme des Alltags in der Gesamtsicht zu relativieren und ihnen so die negative Energie zu nehmen. Das Wissen um das langfristige Oberziel, die klare Vorstellung, wohin Sie in Ihrem eigenen Leben wollen, beugt Selbstzweifeln und Sinnkrisen vor. Eine ganzheitliche Sicht über den gesamten Lebensweg mildert oder verhindert gar die typische Midlife-Crisis, wie sie in den modernen westlichen Gesellschaften immer häufiger und früher anzutreffen ist.
Ihre konkrete Lebensvision verhilft Ihnen zu Zuversicht, Ausgeglichenheit und Souveränität. Wenn Sie genau wissen, was Sie wollen, können alltägliche Probleme Sie nicht aus der Ruhe bringen. Alles relativiert sich in der Gesamtsicht. Schwierigkeiten können Sie eher als Chancen verstehen, als wenn Sie sich in einer sehr kurzfristigen Sicht von Problem zu Problem und Termin zu Termin hangeln, ohne sich eines umfassenden Kontexts für das eigene Handeln bewusst zu sein.
„Ein Mann mit einer Idee ist unausstehlich, bis ihm die Idee zum Erfolg verholfen hat.“
MARK TWAIN
Die langfristige Vision als Maßstab für heutiges Handeln
Die konkrete Lebensvision ist der Maßstab, an dem Sie Ihr Tun im Hier und Jetzt ausrichten können. Das gibt Ihnen Kraft und Motivation, auch wenn es am einen oder anderen Tag mal nicht so gut läuft. Sie haben jederzeit im Hinterkopf, warum Sie das alles machen und worauf Sie langfristig hinarbeiten.
Auch Glück und Zufall spielen eine Rolle
Machen Sie sich bei aller gezielten Persönlichkeitsentwicklung, beim Entwurf einer Lebensvision und bei der Planung Ihrer Karriere bewusst, dass Ihr Leben auch durch eine Reihe von Zufällen und Glück beeinflusst wird. Zwar lässt sich über diesen Aspekt aus philosophischer und religiöser Sicht trefflich streiten, wenn es um die Auseinandersetzung mit Vorbestimmung und Schicksal versus Zufall und Glück geht. Fakt ist jedoch, dass Ihr Lebensweg von verschiedenen, für Sie unvorhergesehenen Umständen geprägt sein wird. Diese Tatsache sollten Sie zumindest so weit wie möglich einplanen, zum Beispiel dadurch, Zeitpuffer in der persönlichen Planung zu reservieren und Alternativ- und Notfallpläne zur Hand zu haben („was mache ich, wenn …“).
Ebenso wichtig wie zu wissen, was Sie wollen, ist zu wissen, dass nicht alles planbar und vorhersehbar ist. Sofern Sie sich das nicht bereits bewusst gemacht und verinnerlicht haben, machen Sie es an dieser Stelle!
So viel ist sicher: Nichts ist sicher.
Übung 1.2
(A) Nennen Sie sechs Merkmale richtiger Zielformulierungen.
(B) Formulieren Sie anhand der o. g. Merkmale ein persönliches Ziel für die nächsten 14 Tage. Mein Ziel:
(C) Gibt es einen Unterschied zwischen Lebensvision und Mission Statement? Wenn ja, worin liegt dieser für Sie? Wenn nein, was verbinden Sie mit beiden Begriffen persönlich?
(D) In welchem Zusammenhang können Ziele zueinander stehen? Welche Arten von Zielkonflikten kennen Sie?
(E) Versuchen Sie an dieser Stelle, auf einem leeren Blatt oder am Computer einen ersten Entwurf einer möglichen Lebensvision zu verfassen. Dabei geht es nicht um ein verbindliches Ergebnis, sondern vielmehr um den damit verbundenen Prozess des Nachdenkens über sich und das eigene Leben. „Der Weg ist das Ziel!“ – Nehmen Sie Konfuzius beim Wort, vielleicht ein Glas guten Rotwein und zwei oder drei Stunden Zeit (vorerst nicht mehr!) – und fangen Sie an!
(F) Vermerken Sie den heutigen Tag im Kalender (z. B. 16. Juni) und markieren Sie diesen Tag in den Folgemonaten (16. Juli, 16. August etc.). Nehmen Sie an diesen Tagen den Entwurf zur Hand, überdenken Sie ihn und entwickeln Sie ihn weiter. So bleiben Sie am Ball und sind Tag für Tag für die Langfristigkeit Ihrer Ziele und Aktivitäten sensibilisiert. Nach und nach entwickeln Sie so ein sorgfältig überdachtes Lebenskonzept und eine konkrete, visionäre Vorstellung von dem, was Ihnen wichtig ist.
1.3. Persönlichkeit & Ausstrahlung
Wenn eine Person eine Rolle spielt, tut Sie dies nur so lange, bis der Vorhang fällt.
Persönlichkeit und Ausstrahlung als Meta-Aspekte
Persönlichkeit und Ausstrahlung sind im Rahmen der in diesem Buch betrachteten Soft Skills so genannte Meta-Aspekte. Das bedeutet, dass sie sich auf eine höhere logische Ebene beziehen als zum Beispiel die konkreten, im Buch beschriebenen Arbeitstechniken. Als Meta-Aspekte fließen sie in fast alle bereits betrachteten und folgenden Bereiche mit ein. Wenn Sie beispielsweise etwas an Ihrer Ausstrahlung ändern, wirkt sich das auch auf die Wahrnehmung durch andere beim Einsatz einer bestimmten Moderationstechnik aus.
Flexible und fixe Persönlichkeitseigenschaften
In der psychologischen Theorie besteht Persönlichkeit aus flexiblen (zeitraumbezogenen) und fixen (zeitpunktbezogenen) Eigenschaften. Neben physiologischen Eigenschaften, welche ebenfalls die Persönlichkeit und Ausstrahlung determinieren, zählen dazu kognitive Fähigkeiten sowie Denkweisen in emotionalen und sozialen Aspekten.
Probieren Sie Persönlichkeit und Ausstrahlung in einen direkten Zusammenhang zu setzen, so stoßen Sie auf Schwierigkeiten. Die Vermutung, dass Ausstrahlung die in Erscheinung tretende Persönlichkeit darstellt, ist dabei zwar intuitiv nahe liegend, aber widerspricht wie folgend dargestellt der wissenschaftlichen Betrachtung. An zwei Beispielen können Sie die vorwiegend unbewussten Faktoren Persönlichkeit und Ausstrahlung besonders einleuchtend beobachten. Erstens wird bekanntlich innerhalb weniger Sekunden entschieden, ob auf einen Flirt eingegangen wird oder nicht. Zweitens, wie im Kapitel „Bewerbung“ beschrieben wird, entscheiden sich die meisten Bewerbungsgespräche innerhalb der ersten drei Minuten (Kapitel 2.2.).
Grundlage jeder Interaktion
In der kurzen Zeit der jeweiligen Entscheidungsfindung beider Beispiele, sei es beim Flirt oder im Bewerbungsgespräch, ist eine Evaluierung von Fachkompetenz oder besonderen Qualitäten nicht möglich. Erkennbar wird, beruflich sowie privat bilden Persönlichkeit und Ausstrahlung stets die Grundlage jeder Interaktion. Ein affektiertes oder negatives Auftreten, sei es im beruflichen Alltag oder zu Hause, führt stets zu einem schlechten Eindruck beim Gegenüber. Persönlichkeit und Ausstrahlung bestehen aus zahlreichen Faktoren, welche aufgeschlüsselt und einzeln schwer darstellbar sind; die Beeinflussung eines isolierten Faktors auf diese Ausstrahlungs- und Persönlichkeitseigenschaften ist so gut wie gar nicht abgrenzbar. Dies ist allerdings auch nicht nötig, da die Einflussfaktoren dieser Aspekte nur in der Summe, also dem ganzen Bild der Person, Wirkung zeigen und eine Persönlichkeit bilden. Erst die ausgeglichene Symbiose aller einzelnen Elemente beschreibt eine persönliche oder berufliche Wesensart, welche einen Charakter formt, und nur diese Einheit führt damit auch zu Ihrem persönlichen und beruflichen Erfolg.
Wie können Sie sich nun diesem Komplex der Persönlichkeit annehmen? Im Folgenden schlagen wir eine Strukturierung von Persönlichkeit und Ausstrahlung in drei Felder vor, wobei in eines dieser Felder auch der Themenkomplex der Ausstrahlung einzuordnen ist. Wir differenzieren Fühlmuster, Denkmuster und Verhaltensmuster.
Fühlmuster
Gefühle werden während der Erziehung geprägt und haben sich bis zum postpubertären Stadium stark fortentwickelt. Diesen Gefühlen gilt es, sich durch Kenntnisse und Umgehensweisen anzunehmen. Die Fühlmuster werden stark durch die Werte- und Moralvorstellungen beeinflusst, wie sie in Kapitel 1.1. diskutiert wurden. Fühlmuster beschreiben dabei das Gefühl für das eigene Selbst, wie beispielsweise das Selbstvertrauen. Ebenso fallen Stimmungen in die Kategorie der Fühlmuster. Stimmungen, welche im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung der Soft Skills von Relevanz sind, beschreiben unter anderem Angst und Furcht, Trauer und Freude sowie die Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Dabei beschreibt dieser Themenkomplex neben der Erläuterung der einzelnen Muster auch die positive Umgehensweise mit diesen.
Denkmuster
Denkmuster beschreiben allgemein kognitive Vorgänge, Reaktionen und Verknüpfungsmuster. Die Denkmuster basieren nach dieser Schematisierung nur auf den Fühlmustern und werden in der Jugend geprägt. Es gibt viele verschiedene Denkmuster, wie beispielsweise Selbstachtung, der Unterschied zwischen analytischem und emotionalem Denken sowie die Wahrnehmung von Stärken und Schwächen. Denkmuster können Sie auf der einen Seite durch praktische Methoden konkret umformen, aber auf der anderen Seite hilft auch erfahrungsgemäß schon der gekonnte Umgang mit ihnen im Privat- und Berufsleben weiter.
Abbildung 1: Sichtbarkeit von Fühlmustern, Denkmustern und Verhaltensmustern
Verhaltensmuster
Verhaltensmuster können sich verändern
Verhaltensmuster sind offen sichtbare Verhaltensweisen, welche auf den Fühl- und Denkmustern basieren. Sie beschreiben zum Beispiel Authentizität, Souveränität oder Charisma, ein intro- oder extrovertiertes, dominantes oder eher gewissenhaftes Auftreten. Verhaltensmuster werden wie die vorherigen Muster frühzeitig geprägt, sie unterliegen aber im Laufe der Jahre einer außergewöhnlich starken Veränderung.
Fühlmuster analysieren
„Glauben ist Vertrauen, nicht Wissenwollen.“
HERMANN HESSE
Fühlmuster beschreiben Gefühle, welche uns unbemerkt in jeder Situation in unserem Handeln und Denken beeinflussen. Fühlmuster können bereits aus jahrelanger Erziehung gebildet werden, sind aber ebenfalls Momentaufnahme von Gemütszustand und Stimmung. In diesem Kapitel wird auf zwei Komplexe dieser Fühlmuster eingegangen. Der erste Komplex ist das Gefühl von Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein. Dabei werden neben einem theoretischen Hintergrund auch Selbstwertquellen sowie Bedrohungen aufgeführt. Ebenso präsentieren wir Ihnen einige Übungen zur Entfaltung Ihres positiven Selbstwertgefühls. Als zweiter elementarer Bereich werden die Umgehensweisen mit Stimmungen dargestellt. Dabei wird in drei Teilgebieten der jeweilige positive und negative Aspekt einer Stimmung beschrieben und auf aktive Verhaltensweisen hingewiesen.
Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
„Die Gelassenheit ist die anmutigste Form des Selbstbewusstseins.“
F. DE LA ROUCHFOUCAULE
Selbstwertgefühl speist sich aus sozialer Anerkennung und Erfolgen
Selbstwertgefühl ist die Empfindung für den eigenen Wert im Privaten und/oder im Beruf. Selbstwert oder auch Selbstbewusstsein ist größtenteils Resultat aus Zufriedenheit oder der Anerkennung von individuellen Leistungen oder Erfolgen. Ein Sprichwort lautet beispielsweise: „Die Seele ernährt sich von Anerkennung.“ Dabei ist die Anerkennung nicht nur von externen Meinungsträgern bedeutend, sondern primär ist die eigene Wertschätzung relevant. Auf ein Selbstwertgefühl ist jeder Mensch angewiesen, denn bei einem Fehlen dieses Fühlmusters besteht nicht nur für die Person an sich eine Gefahr, sondern auch ein Risiko für alle anderen Personen in ihrem Umkreis.
Hohes Selbstwertgefühl macht weniger empfindlich
In der Stress- und Emotionstheorie wird die Verletzung des Selbstwertgefühles als ein typischer Faktor für negative Emotionen verantwortlich gemacht. Hauptquellen dieser Verletzung sind berufliche oder familiäre Ursachen. Wie weiter hinten im Kapitel „Selbstwertbedrohungen“ beschrieben, wird besonders externe Kritik von zahlreichen Personen als bedrückend angesehen. Dabei leiden Personen mit einem niedrigen Selbstwert erstens mehr unter den gleichen Reizen sowie zweitens auch eher, als eine Person mit einem höheren Selbstwertgefühl. Fast immer potenziert sich die emotionale Mangelerscheinung in einem Teufelskreis von Unzufriedenheit und Selbstwertmangel.
In den unerfreulichsten Fällen von mangelndem Selbstwert versuchen die betroffenen Personen sogar, anderen vergleichbare Empfindungen einzureden. Wenn diese angegriffenen Personen nun ähnliche Schwierigkeiten mit ihrem persönlichen Wertegefühl entwickeln wie der Angreifer, hat dieser damit einen Schwächeren geschaffen, von welchem er sich bequem abgrenzen kann. Diese Abgrenzung und Unterdrückung ist Wurzel für sein eigenes Selbstwertgefühl.
Wie Menschen niedriges Selbstwertgefühl häufig zu kompensieren versuchen
Ein eher harmloses Auftreten einer Selbstwertmangelerscheinung ist das Ersatzselbstvertrauen. So versuchen die Betroffenen, sich mit Äußerlichkeiten, welche vorwiegend nicht auf persönlichen Erfolgen oder Leistungen beruhen, zu individualisieren. Aufgrund der fehlenden Eigenleistung bietet jedoch diese Art des Selbstvertrauens weder eine dauerhafte Zufriedenheit noch persönliches Glück, was diese Personen früher oder später erkennen. Ein Symptom von Mangelerscheinungen ist das Adaptieren von Eigenschaften oder Verhaltensweisen von aktuellen Stars oder Vorbildern als Orientierung. Pubertierende Kinder fangen beispielsweise an zu rauchen und neigen zu frühen sexuellen Aktivitäten, um dieser Orientierung nachzuleben und damit den gleichen Status in der Gesellschaft wie dieses Vorbild einzunehmen. Subsumiert probieren diese Individuen mehr darzustellen, als sie selbst fühlen bzw. als sie wirklich sind. Werden Personen mit affektiertem Selbstvertrauen dabei ertappt und findet eine Gegenüberstellung mit der Realität statt, werden diese erfahrungsgemäß ablehnend und sogar aggressiv.
Prägende Eigenschaften von Personen mit mangelndem Selbstwertgefühl sind vorwiegend verkrampftes und unnatürliches Auftreten sowie spießige oder verklemmte Umgangsweise. Die Identifikation, ob ein Selbstvertrauen einer anderen Person authentisch oder affektiert ist, bedarf einer gründlichen und professionellen psychologischen Ausbildung. Haben Sie demzufolge Geduld mit anderen und mit sich selbst, wenn Sie die Authentizität eines Selbstvertrauens überprüfen.
Personen mit einem echten Selbstwertgefühl sind durch ein ganzheitliches Lebenskonzept geprägt. Sie benötigen keine Abgrenzung zu anderen, sei es durch Sprüche, die neueste und teuerste Mode oder einem spektakulären Auftritt in der aktuellsten Bar. Sie gelten oft sogar genau im Gegenteil als eher anspruchslos, offen und praktisch. Sie sind tolerant, kooperativ und leicht umgänglich. Zusätzlich sind sie erfahrungsgemäß nicht besitzergreifend, weder in Bezug auf Personen noch auf Taten.
Struktur
Strukturell gibt es mehrere theoretische Modelle, um Selbstwert zu kategorisieren. Üblich ist die Abgrenzung des Selbstwertes nach der Quantität, nach der Zielgruppe oder nach der Ausbreitung. Zusätzlich zu diesen Unterscheidungen birgt die Literatur noch weitere erwähnenswerte Modelle, welche aber meist nur theoretische Nützlichkeit besitzen.
Hoher und niedriger Selbstwert
Ihre Geltung für die Umwelt
Hoher Selbstwert heißt, Sie erkennen unkompliziert oder außerordentlich stark Ihre individuelle Geltung in Ihrer direkten Umgebung oder der Gesellschaft. Ein niedriger Selbstwert symbolisiert die Schwierigkeit bei der Identifikation von persönlichem Wert für sein soziales Umfeld.
Individueller und kollektiver Selbstwert
Diese Abgrenzung unterscheidet das Betrachtungsobjekt. Beim individuellen Selbstwert wird nur eine einzelne Person beobachtet, beim kollektiven Selbstwert eine Gruppe, welche sich der Selbstwertbetrachtung unterzieht. Dabei kann eine Person einen kollektiven Wert fühlen, ohne einen individuellen Selbstwert zu akzeptieren. Diese Differenzierung ist wichtig für die Betrachtung einiger Gruppenprozesse in den folgenden Kapiteln.
Globaler und spezifischer Selbstwert
Diese Differenzierung bezieht sich auf eine Quelle des Selbstwertes. Unterschieden wird, ob es sich um einen allgemeinen Selbstwert handelt oder ob er von einer konkreten Begebenheit herrührt.
Stabiler und variabler Selbstwert
Im Falle, dass der Selbstwert quantitativen oder qualitativen Veränderungen unterliegt, spricht man von stabilem oder variablem Selbstwert. Da im Laufe der Persönlichkeitsentfaltung eine Person kontinuierlich ein neues Selbstbild erfährt und entwirft, ist der Selbstwert zu einem gewissen Teil variabel.
Positiver und negativer Selbstwert
Der positive Selbstwert führt zu einem positiven Wohlbefinden, der negative zu einer negativen Aura. In dieser Kategorisierung ist eine Verlagerung in den positiven Bereich vorteilhaft, soweit eine gesunde Selbstkritikkultur besteht. Diese allgemeine Abgrenzung zwischen positivem und negativem Selbstwert wird für die kommenden Kapitel weiterverwendet.
Abbildung 2: Dimensionen des Selbstwertgefühls
Gemeinsam haben die in Abbildung 2 dargestellten Merkmale alle, dass eine Verschiebung in ein Extrem, mit Ausnahmen des positiven Selbstwerts, unvorteilhafte Facetten aufwirft. Stets ist ein hoher positiver Selbstwert nur im Rahmen substanzieller Selbstkritik produktiv und demnach ist unbeirrt ein Mittelmaß von Selbstbewusstsein und Kritik zu forcieren.
Abbildung 3: Balance zwischen Selbstbewusstsein und Selbstkritik
Aus Kritik kann sich Hilflosigkeit entwickeln
Beispielhafte Einflüsse für die Ausbildung von einem negativen Selbstwertgefühl sind die Abwertung der eigenen Persönlichkeit und der sozialen oder fachlichen Kompetenz durch eine andere Person oder sich selbst. Pauschalisiert handelt es sich dabei um Fremd- und Selbstkritik, mit welcher nicht umgegangen werden kann. Schwierig wird der Umgang mit Kritik, wenn sie vor einer größeren Gruppe geäußert wird. Als zweites Mangelgefühl forciert die Vermutung des Missverstehens zwischen der betroffenen Person und anderen Menschen in ihrem Umkreis eine Einschränkung des Selbstwertes. Diese Eindrücke entwickeln zügig ein Empfinden von Vernachlässigung oder Missachtung. Aus Kritik sowie Kommunikationsunfähigkeit entsteht sich häufig eine Hilflosigkeit, welche den Teufelskreis erfahrungsgemäß von vorne nährt.
Quellen und Bedrohung
Was Ihr Selbstwertgefühl behindert und fördert
Neben diesen verschiedenen Einordnungen von Selbstwert gibt es unerschiedliche Einflussfaktoren, welche die Ausprägung des Selbstwertes determinieren. Dabei können Sie zwischen Selbstwertquellen und Selbstwertbedrohungen unterscheiden. Aus den Selbstwertquellen entstehen ebenfalls fundamentale Selbstwertbedrohungen, wenn sich Konstellationen entwickeln, in welchen die fachliche oder soziale Kompetenz einer Person in Abrede gestellt wird oder es zu unmittelbaren Angriffen auf die Persönlichkeit kommt. Ebenso tauchen Bedrohungen auf, wenn sich Selbst- und Fremdbild in einem eklatanten Ungleichgewicht befinden.
Typische Quellen, aber auch Bedrohungen für das Selbstwertgefühl sind kulturelle Faktoren, soziale Faktoren, Familie, relevante Bezugsgruppen und individuelle Faktoren (Abbildung 4).
Abbildung 4: Selbstwertquellen und Selbstwertbedrohungen
1. Kulturelle Faktoren
Selbstwert gemessen an kulturellen Maßstäben und sozialen Erwartungshaltungen
Wie schon im Kapitel 1.1.„Werte & Glaubenssätze“ angesprochen, befinden wir uns fortwährend in der kulturellen Einwirkung unseres unmittelbaren gesellschaftlichen Umfeldes, welches durch die Jahre von Kindheit und Jugend vorgeprägt wurde. Durch Erziehung und Entwicklung während dieser Kinder- und Jugendzeit adaptieren wir die Normen und Werte unseres sozialen Umfeldes. Diese Anschauungen beeinflussen den Kern des Selbstwertgefühles und beantworten beispielsweise die Fragestellung, was wir und unsere Kultur überhaupt als Wert an sich ansehen. Mit der Zeit manifestieren sich verschiedene Wertevorstellungen, Ideale und Ansichten. Das Entsprechen nun gerade dieser Ideale ist Träger von Selbstwert und Selbstvertrauen. Die kulturellen Faktoren und Einflussgrößen auf das Selbstwertgefühl reifen darüber hinaus durch differenzierte Wahrnehmung im fortschreitenden Alter.
2. Soziale Faktoren
Selbstwert durch Feedback direkter Kontaktpersonen
Sie erfahren anhaltend Rückmeldungen durch die Interaktion mit Ihrem gesellschaftlichen Umfeld. Wenn auch nicht explizit artikuliert, erlangen Sie Bestätigung oder Ablehnung in jeder Konversation mit einem Freund oder einem Arbeitskollegen. Diese Bestätigungen oder Ablehnungen ordnen Sie ein, dadurch geben diese Ihnen eine ungefähre Vorstellung Ihrer Akzeptanz in der Gesellschaft. Wie auch die kulturellen Faktoren unterliegen ebenfalls die sozialen Faktoren der unaufhörlichen Umgestaltung. Im Allgemeinen wird eine Person im Laufe der Zeit und ihrer Persönlichkeitsentfaltung sowie durch die Loslösung von Eltern und primärem Freundeskreis sozial unabhängiger.
3. Familie
Selbstwert durch familiäre Maßstäbe und Erwartungen
Die Familie ist grundlegend für jede psychologische Entfaltung in der Kinder- und Jugendzeit, welche größtenteils durch die Nähe zu den Eltern, ihre Liebe, Zuneigung, Anerkennung und Aufmerksamkeit geprägt ist. Eine Person, welche nicht bereits in diesem jungen Alter Selbstvertrauen und einen Selbstwert aufgebaut hat, benötigt wesentlich stärkere Impulse im Erwachsenenalter, um ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln. In der theoretischen Psychologie heißt es, dass bis zum siebten Lebensjahr entschieden ist, ob eine Person ein positives Selbstvertrauen haben oder eher zurückhaltend auftreten wird. Ferner treten die Familienmitglieder auch als unmittelbare Vertreter der kulturellen und sozialen Umgebung gegenüber einer Person auf und sind damit Vermittler der gesellschaftlichen Wert- und Moralvorstellungen. In der postjugendlichen Phase ist die Familie unmittelbarer Gegenpol zur Karriere. Sie kann beraten, unterstützen und Feedback geben sowie Ausgleich zu Beruf, Ausbildung oder Studium bieten. Dem gegenüber steht der Zeitaufwand, welchen Sie in eine Familie investieren und einbringen müssen. Damit wird die Familie zur permanenten Selbstwertquelle, kann aber auch eine eklatante Selbstwertbedrohung darstellen, wenn grundsätzlicher Dissens über Entwicklungswege besteht oder die Familie dem Einzelnen kein Vertrauen entgegenbringt und eine ausreichende Anerkennung verweigert.
4. Relevante Bezugsgruppen
Selbstwert durch Feedback aus „Peer-Groups“
Schon ab der ersten Schulklasse orientiert sich ein Mensch an Gleichaltrigen bzw. Menschen, die sich in gleicher und ähnlicher Situation befinden, den so genannten „Peer-Groups“. In diesen Gruppen werden Ideale gebildet und festgelegt, wie eine Person durch das Zeigen oder die Adaption von Merkmalen den zeitgemäßen Trendvorstellungen genügen kann. Die Anerkennung und Akzeptanz in diesen „Peer-Groups“ hat augenblickliche Einwirkung auf das Selbstwertgefühl. Die Frage, wie Sie bei einer anderen Person oder einer Gruppe ankommen, spielt unmittelbar eine Rolle in der Erwägung des eigenen Selbstwertgefühls. Diese Bezugsgruppen werden nicht mit der Abschlussprüfung der Oberschule abgelegt, sondern begleiten uns fortwährend – seien sie beruflich oder privat. Erfolg und Glück werden vielfach in Vergleichen zu anderen Personen aus unserer „Peer-Group“ gemessen. Besonders im fortgeschrittenen Alter, wenn die 50 überschritten ist, findet häufig eine Art vergleichendes Resümee statt. In diesem evaluiert der Einzelne, was er erreicht hat. Dabei betrachtet er die relevanten Bezugsgruppen und bewertet in einer Unterschiedsanalyse den eigenen Lebensweg. Fällt dieses Resümee negativ aus, fällt die Person eventuell in eine Midlife-Crisis.
5. Individuelle Faktoren
Mit individuellen Faktoren sind die Einflüsse umschrieben, welche von Person zu Person oder auch zwischen den Geschlechtern unterschiedlich ausgeprägt sind. So ist zum Beispiel soziale Überlegenheit ein solcher individueller Faktor. Auch das Verhältnis zu oder die Abhängigkeit von beruflichen Erfolgen oder die Neigung zur Selbstkritik können solche Faktoren sein, welche individuell das Selbstwertgefühl beeinflussen. Diese persönlichen Faktoren beeinflussen das Selbstwertgefühl ebenso stark und gelegentlich sogar nachhaltiger als die anderen Umstände. So ist beispielsweise das Verlangen nach Anerkennung unterschiedlich ausgeprägt und kann bei einer Person mit starker Ausprägung dieses Faktors besonders zügig zur Selbstwertquelle oder Selbstwertbedrohung werden.
Quellen und Bedrohungen des Selbstwertgefühls
Alle diese erwähnten Faktoren beeinflussen unser Selbstvertrauen. Als Quelle spenden und als Bedrohung rauben sie uns Kraft und Mut für komplexe Herausforderungen im Privat- und Berufsleben. Studien haben wiederholt bewiesen, dass Personen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl nicht unter einer höheren Quantität von Faktoren litten, als selbstbewusste Personen. Vielmehr können sie mit einer vergleichbaren Anzahl von Faktoren nur schlechter umgehen. Demnach kommt es gar nicht darauf an, geradewegs alle der erwähnten Faktoren als direkte Quelle zu akquirieren, wenn Sie bereits zu einer Einzelnen ein außerordentlich zuträgliches Verhältnis aufgebaut haben.
Aufbau und Stärkung des Selbstwertgefühls
Trotz frühkindlicher Prägung ist mangelnde Selbstsicherheit kein unkorrigierbares Schicksal – es wurde erlernt und kann demnach größtenteils auch umgelernt werden. Dazu klären wir im Folgenden erst, welchen Grundlagen das Selbstwertgefühl entspringt und schließen dann einige konkrete Vorschläge an, wie Sie durch gezielte Übungen Ihr Selbstwertgefühl gegebenenfalls steigern können.





























