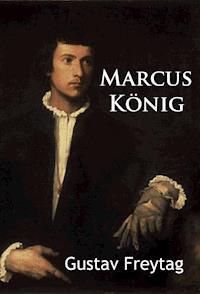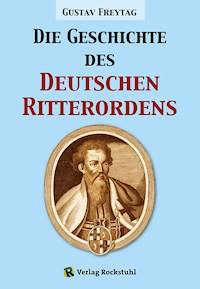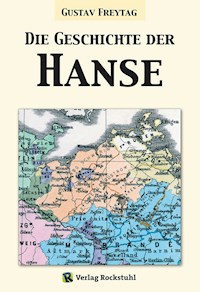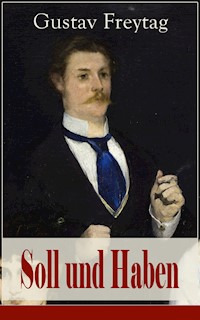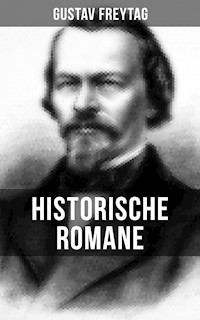Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gustav Freytags Roman 'Soll und Haben' ist ein Meisterwerk des 19. Jahrhunderts, das die Geschichte von zwei jungen Männern erzählt, die in den Handel involviert sind. Mit einem fesselnden und detaillierten Schreibstil verwebt Freytag die Geschichte von Anton Wohlfart, einem tüchtigen Kaufmann aus Norddeutschland, und des skrupellosen Unternehmers August Peters in einer Handlung voller Intrigen und Spannung. Der Roman reflektiert die aufstrebende bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und die wachsende Bedeutung des Handels in Deutschland. Freytags präzise Darstellung der Charaktere und ihr moralisches Ringen machen 'Soll und Haben' zu einem zeitlosen Klassiker der deutschsprachigen Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1427
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Soll und Haben
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
1
Ostrau ist eine kleine Kreisstadt unweit der Oder, bis nach Polen hinein berühmt durch ihr Gymnasium und süße Pfefferkuchen, welche dort noch mit einer Fülle von unverfälschtem Honig gebacken werden. In diesem altväterischen Orte lebte vor einer Reihe von Jahren der königliche Kalkulator Wohlfart, der für seinen König schwärmte, seine Mitmenschen – mit Ausnahme von zwei Ostrauer Spitzbuben und einem groben Strumpfwirker – herzlich liebte und in seiner sauren Amtstätigkeit viele Veranlassung zu heimlicher Freude und zu demütigem Stolze fand. Er hatte spät geheiratet, bewohnte mit seiner Frau ein kleines Haus und hielt den kleinen Garten eigenhändig in Ordnung. Leider blieb diese glückliche Ehe durch mehrere Jahre kinderlos. Endlich begab es sich, daß die Frau Kalkulatorin ihre weißbaumwollene Bettgardine mit einer breiten Krause und zwei großen Quasten verzierte und unter der höchsten Billigung aller Freundinnen auf einige Wochen dahinter verschwand, gerade nachdem sie die letzte Falte zurechtgestrichen und sich überzeugt hatte, daß die Gardine von untadelhafter Wäsche war. Hinter der weißen Gardine wurde der Held dieser Erzählung geboren.
Anton war ein gutes Kind, das nach der Ansicht seiner Mutter vom ersten Tage seines Lebens die staunenswertesten Eigenschaften zeigte. Abgesehen davon, daß er sich lange Zeit nicht entschließen konnte, die Speisen mit der Höhlung des Löffels zu fassen, sondern hartnäckig die Ansicht festhielt, daß der Griff dazu geeigneter sei, und abgesehen davon, daß er eine unerklärliche Vorliebe für die Troddel auf dem schwarzen Käppchen seines Vaters zeigte und das Käppchen mit Hilfe des Kindermädchens alle Tage heimlich vom Kopf des Vaters abhob und ihm lachend wieder aufsetzte, erwies er sich auch bei wichtigerer Gelegenheit als ein einziges Kind, das noch nie dagewesen. Er war am Abend sehr schwierig ins Bett zu bringen und bat, wenn die Abendglocke läutete, manchmal mit gefalteten Händen, ihn noch herumlaufen zu lassen; er konnte stundenlang vor seinem Bilderbuch kauern und mit dem roten Gockelhahn auf der letzten Seite eine Unterhaltung führen, worin er diesen wiederholt seiner Liebe versicherte und dringend aufforderte, sich nicht dadurch seiner kleinen Familie zu entziehen, daß er sich vom Dienstmädchen braten ließe. Er lief zuweilen mitten im Kinderspiel aus dem Kreise und setzte sich ernsthaft in eine Stubenecke, um nachzudenken. In der Regel war das Resultat seines Denkens, daß er für Eltern oder Gespielen etwas hervorsuchte, wovon er annahm, daß es ihnen lieb sein würde. Seine größte Freude aber war, dem Vater gegenüberzusitzen, die Beinchen übereinanderzulegen, wie der Vater tat, und aus einem Holunderrohr zu rauchen, wie sein Herr Vater aus einer wirklichen Pfeife zu tun pflegte. Dann ließ er sich allerlei vom Vater erzählen, oder er selbst erzählte seine Geschichten. Und das tat er, wie die Frauenwelt von Ostrau einstimmig versicherte, mit so viel Gravität und Anstand, daß er bis auf die blauen Augen und sein blühendes Kindergesicht vollkommen aussah wie ein kleiner Herr im Staatsdienst. Unartig war er so selten, daß der Teil des weiblichen Ostrau, welcher einer düsteren Auffassung des Erdenlebens geneigt war, lange zweifelte, ob ein solches Kind heranwachsen könne; bis Anton endlich einmal den Sohn des Landrats auf offener Straße durchprügelte und durch diese Untat seine Aussichten auf das Himmelreich in eine behagliche Ferne zurückhämmerte. Kurz, er war ein so ungewöhnlicher Knabe, wie nur je das einzige Kind warmherziger Eltern gewesen ist. Auch in der Bürgerschule und später im Gymnasium wurde er ein Muster für andere und ein Stolz seiner Familie. Und da der Zeichenlehrer behauptete, Anton müsse Maler werden, und der Ordinarius von Tertia dem Vater riet, ihn Philologie studieren zu lassen, so wäre der Knabe seiner zahlreichen Anlagen wegen wahrscheinlich in die gewöhnliche Gefahr ausgezeichneter Kinder gekommen, für keine einzige Tätigkeit den rechten Ernst zu finden, wenn nicht ein Zufall seinen Beruf bestimmt hätte.
An jedem Weihnachtsfest wurde durch die Post eine Kiste in das Haus des Kalkulators befördert, worin ein Hut des feinsten Zuckers und ein großes Paket Kaffee standen. Gewöhnlichen Zucker ließ der Hausherr durch seine Frau klein schlagen, diesen Zuckerhut zerbrach er selbst mit vielem Kraftaufwand in einer feierlichen Handlung und freute sich über die viereckigen Würfel, welche seine Kunst hervorzubringen vermochte. Der Kaffee dagegen wurde von der Frau Kalkulatorin eigenhändig gebrannt, und sehr angenehm war das Selbstgefühl, mit welchem der würdige Hausherr die erste Tasse dieses Kaffees trank. Das waren Stunden, wo ein poetischer Duft, der so oft durch die Seelen der Kinder zieht, das ganze Haus erfüllte. Der Vater erzählte dann gern seinem Sohne die Geschichte dieser Sendungen. Vor vielen Jahren hatte der Kalkulator in einem bestäubten Aktenbündel, das von den Gerichten und der Menschheit bereits aufgegeben war, ein Dokument gefunden, worin ein großer Gutsbesitzer aus Posen erklärte, einem bekannten Handelshause der Hauptstadt mehrere tausend Taler zu schulden. Offenbar war der Schuldschein in kriegerischer und ungesetzmäßiger Zeit in ein falsches Aktenheft verlegt worden. Er hatte den Fund am gehörigen Orte angezeigt, und das Handelshaus war dadurch in den Stand gesetzt worden, einen verzweifelten Rechtsstreit gegen die Erben des Schuldners zu gewinnen. Darauf hatte der junge Chef der Handlung sich angelegentlich nach dem Finder des Dokuments erkundigt und demselben einen artigen Brief geschrieben, der Kalkulator hatte, wie seine Art war, sehr bestimmt allen Dank abgelehnt, weil er nur seine Amtspflicht erfüllt habe. Von da ab erschien an jeder Weihnacht die erwähnte Sendung mit einem kurzen herzlichen Begleitschreiben und wurde jedesmal umgehend durch ein kalligraphisches Kunstwerk des Kalkulators erwidert, worin dieser unermüdlich seine Überraschung über die unerwartete Sendung ausdrückte und der Firma zum neuen Jahr aus voller Seele Gutes wünschte. Selbst seiner Frau gegenüber behandelte der Herr die Weihnachtssendung als einen Zufall, eine Kleinigkeit, ein Nichts, welches von der Laune eines Kommis der Firma T. O. Schröter abhänge, und jedes Jahr protestierte er eifrig, wenn die Frau Kalkulatorin die zu erwartende Kiste bei ihren Wirtschaftsplänen in Rechnung brachte. Aber im stillen hing seine Seele an diesen Sendungen. Es waren nicht die Pfunde Raffinade und Kuba, es war die Poesie dieser gemütlichen Beziehung zu einem ganz fremden Menschenleben, was ihn so glücklich machte. Er hob alle Briefe der Firma sorgfältig auf, wie die drei Liebesbriefe seiner Frau, ja er heftete sie mit dem Ehrwürdigsten, was er kannte, mit schwarz und weißem Seidenfaden, in ein kleines Aktenbündel; er wurde ein Kenner von Kolonialwaren, ein Kritiker, dessen Geschmack von den Kaufleuten in Ostrau höchlich respektiert wurde; er konnte sich nicht enthalten, den billigen Meliszucker und den Brasilkaffee als untergeordnete Erzeugnisse der Schöpfung mit einer entschiedenen Verachtung zu behandeln; er fing an, sich für die Geschäfte der großen Handlung zu interessieren, und studierte in den Zeitungen regelmäßig die Marktpreise von Zucker und Kaffee, welche mit merkwürdigen und für Nichteingeweihte ganz unverständlichen Bemerkungen hinter den politischen Nachrichten standen; ja er spekulierte in seiner Seele mit als Associé seines Freundes, des großen Kaufmanns, er ärgerte sich, wenn der Kaffee in den Zeitungen flaute, und war vergnügt, wenn der Zucker als angenehm notiert war.
Das war ein unscheinbares, leichtes Band, welches den Haushalt des Kalkulators mit dem geschäftlichen Treiben der großen Welt verknüpfte; und doch wurde es für Anton ein Leitseil, wodurch sein ganzes Leben Richtung erhielt. Denn wenn der alte Herr am Abend in seinem Garten saß, das Samtkäppchen in dem grauen Haar und seine Pfeife im Munde, dann verbreitete er sich gern mit leiser Sehnsucht über die Vorzüge eines Geschäftes und fragte dann scherzend seinen Sohn, ob er auch Kaufmann werden wolle. Und in der Seele des Kleinen schoß augenblicklich ein hübsches Bild zusammen, wie die Strahlen bunter Glasperlen im Kaleidoskop, zusammengesetzt aus großen Zuckerhüten, Rosinen und Mandeln und goldenen Apfelsinen, aus dem freundlichen Lächeln seiner Eltern und all dem geheimnisvollen Entzücken, welches ihm selbst die ankommende Kiste je bereitet; bis er begeistert ausrief: «Ja, Vater, ich will!» – Man sage nicht, daß unser Leben arm sei an poetischen Stimmungen; noch beherrscht die Zauberin Poesie überall das Treiben der Erdgeborenen. Aber ein jeder achte wohl darauf, welche Träume er im heimlichsten Winkel seiner Seele hegt, denn wenn sie erst groß gewachsen sind, werden sie leicht seine Herren, strenge Herren!
So lebte die Familie still fort durch manches Jahr. Anton wuchs heran und lief mit seiner Büchermappe durch alle Klassen des Gymnasiums bis in die stolze Prima. Wenn die Frau Kalkulatorin ihren Mann bat, über Antons Zukunft einen festen Entschluß zu fassen, erwiderte der Hausherr mit einem siegesfrohen Lächeln: «Der Entschluß ist gefaßt, er will ja Kaufmann werden. Erst muß er mit dem Gymnasium fertig sein, dann steht ihm die ganze Welt offen.» Und dann tat der Kalkulator, als ob das Abiturientenzeugnis ein Schlüssel zu allen Ehren der Welt sei. Im geheimen aber bangte ihm ein wenig davor, den Familientraum der Ausführung näherzubringen.
Unterdes kam ein schwarze Tag, wo die Fensterladen des Hauses lange geschlossen blieben, das Dienstmädchen mit roten Augen die Treppe auf und ab lief, der Arzt kam und den Kopf schüttelte und der alte Herr am Lager seiner Frau das Samtkäppchen in den gefalteten Händen hielt, während der Sohn schluchzend vor dem Bette kniete und seinen Lockenkopf darauf legte, welchen die Hand der sterbenden Mutter noch zu streicheln versuchte. Drei Tage nach diesem Morgen wurde die Frau Kalkulatorin begraben, und der alte Herr und Anton saßen am Abend nach dem Begräbnis bleich und einsam einander gegenüber. Anton schlich von Zeit zu Zeit hinter die Stachelbeeren, sich dort in der Stille auszuweinen, und der alte Herr stand häufig von seinem Stuhle auf und ging in die Schlafstube, wo die weiße Gardine mit den beiden Quasten hing, und weinte ebenfalls. Der Jüngling erhielt nach langem Weinen die roten Backen wieder, der alte Herr kam nicht wieder zu Kräften. Er klagte über nichts, er rauchte seine Pfeife wie immer, er ärgerte sich noch immer, wenn der Kaffee flaute; aber es war kein rechtes Rauchen und auch kein rechter Ärger mehr. Oft sah er seinen Sohn nachdenklich und traurig an, und der junge Gesell konnte nicht erraten, was den Vater so besorgt mache. Als der Vater aber an einem Sonnabend den Sohn wieder gefragt hatte, ob er noch Kaufmann werden wollte, und Anton zum hundertsten Male versichert hatte, daß er gerade dies gern wolle und nichts anderes, da stand der alte Herr entschlossen auf, rief das Dienstmädchen und bestellte zum nächsten Morgen eine Fuhre nach der Hauptstadt. Er gestand dem fragenden Sohn nicht, weshalb er die unerhörte Expedition vornahm. Und er hatte wohl Grund zum Schweigen, der arme alte Herr! Denn wenn er auch seit zwanzig Jahren stolz gewesen war auf seinen großen Handelsfreund, so hatte ihm doch immer der Mut gefehlt, selbst vor den Kaufmann zu treten und für seinen Sohn einen Platz im Kontor zu erbitten. Sein Wunsch kam ihm sehr verwegen vor und seine Ansprüche unermeßlich gering. Oft hatte er sich's vorgenommen, und stets hatte er's wieder aufgeschoben, bis die Sorge um seinen Sohn größer wurde als seine Scheu.
Als er den Tag darauf sehr spät aus der Hauptstadt zurückkehrte, war er in ganz anderer Stimmung, glücklicher als je nach dem Tode der Frau Kalkulatorin. Er begeisterte seinen Sohn, der ihn in ahnungsvoller Spannung erwartete, durch seinen Bericht von der unglaublichen Annehmlichkeit des großen Geschäftes und der Freundlichkeit des großen Kaufmanns gegen ihn. Er war zu Mittag geladen worden, er hatte Kiebitzeier gegessen, er hatte griechischen Wein aus den Kellern seines Freundes getrunken, einen Wein, gegen welchen der beste Wein im Gasthof zu Ostrau nichtswürdiger Essig war; er hatte das Versprechen erhalten, daß sein Sohn nach Jahresfrist in das Kontor eintreten könne, und einige Wünsche über die Vorbildung, die dafür wünschenswert sei. Schon am nächsten Tage saß Anton vor einem großen Rechenbuch und disponierte mit unbeschränkter Vollmacht über Hunderttausende von Pfunden Sterling, welche er bald in rheinische Gulden verwandelte, bald in Hamburger Mark Banko umsetzte, als brasilianische Milreis in die Welt flattern ließ und zuletzt ruhig in mexikanischen Staatspapieren anlegte, an denen er mit größter Sicherheit alle möglichen Interessen bis zu zehn vom Hundert abzog. Hatte er auf diese Weise ein kolossales Vermögen zusammengescharrt, so ging er in den Garten, ein kleines dünnleibiges Buch in der Hand, welches auf dem Titel versprach, ihn in vier Wochen zu einem fertigen Engländer zu machen. Dort bemühte er sich zum Entsetzen der deutschen Sperlinge und Finken, das A und andere ehrliche Buchstaben auf jede Weise auszusprechen, welche dem Menschen möglich ist, wenn er einen Buchstaben anders ausspricht, als sich mit der Natur und dessen Charakter verträgt.
So ging wieder ein Jahr hin, Anton war gerade achtzehn Jahre alt und hatte seine Abiturientenprüfung bestanden; da wurden wieder einmal an einem Morgen die Fensterladen des Kalkulators nicht zu gehöriger Zeit geöffnet, wieder rannte das Dienstmädchen mit verweinten Augen durch das Haus, und wieder schüttelte die Nachtlampe unzufrieden und kummervoll ihre feurige Mütze. Diesmal lag der alte Herr selbst im Bett, und Anton saß vor ihm, beide Hände des Vaters haltend. Der alte Herr aber ließ sich nicht festhalten, sondern starb so eilig als möglich, nachdem er seinen Sohn vielmal gesegnet hatte. Nach einigen Tagen lauten Schmerzes stand Anton allein in der stillen Wohnung, eine Waise, im Anfang eines neuen Lebens.
Der alte Herr war nicht umsonst Kalkulator gewesen: sein Haushalt war in musterhafter Ordnung, seine sehr geringe Hinterlassenschaft in der geheimen Schublade des Schreibtisches war auf dem gehörigen Blatt Papier zu Heller und Pfennig aufgezeichnet; alles, was im letzten Jahre durch das Dienstmädchen zerschlagen oder verwüstet worden war, fand sich an der betreffenden Stelle bemerkt und abgerechnet, über jedes war Disposition getroffen. Auch ein Brief an den Kaufherrn fand sich vor, den der Verstorbene noch in den letzten Tagen mit zitternder Hand geschrieben hatte: ein treuer Hausfreund war zum Vormund Antons bestellt und mit dem Verkauf des Hauses und Gartens und seines ganzen Inhalts beauftragt, und Anton trat, vier Wochen nach dem Tode des Vaters, an einem frühen Sommermorgen über die Schwelle des väterlichen Hauses, legte den Schlüssel desselben in die Hand des Vormundes, übergab sein Gepäck einem Fuhrmann und fuhr durch das Tor des Städtchens auf die Hauptstadt zu, den Brief seines Vaters an den Kaufmann in der Tasche.
2
Schon welkte das frischgemähte Wiesengras in der Mittagssonne, als Anton dem Nachbar aus Ostrau, der ihn bis zur letzten Station vor der Hauptstadt mitgenommen hatte, die Hand schüttelte und dann rüstig auf der Landstraße vorwärts schritt. Es war ein lachender Sommertag, auf den Wiesen klirrte die Sense des Schnitters am Wetzstein, und oben in der Luft sang die unermüdliche Lerche. Vor dem Wanderer strich die Landschaft in hügelloser Ebene fort, am Horizont hinter ihm erhob sich der blaue Zug des Gebirges. Kleine Bäche, von Erlen und Weidengruppen eingefaßt, durchrannen lustig die Landschaft, jeder Bach bildete ein Wiesental, das auf beiden Seiten von üppigen Getreidefeldern begrenzt wurde. Von allen Seiten stiegen die hellen Glockentürme der Kirchen aus dem Boden auf, jeder als Mittelpunkt einer Gruppe von braunen und roten Dächern, die mit einem Kranz von Gehölz umgeben waren. Bei vielen Dörfern konnte man an der stattlichen Baumallee und dem Dach eines großen Gebäudes den Rittersitz erkennen, welcher neben den Dorfhäusern lag, wie der Schäferhund neben der wolligen Herde.
Anton eilte vorwärts, wie auf Sprungfedern fortgeschnellt. Vor ihm lag die Zukunft, sonnig gleich der Flur, ein Leben voll strahlender Träume und grüner Hoffnungen. Nach langer Trauer in der engen Stube pochte heut sein Herz zum erstenmal wieder in kräftigen Schlägen; in der Fülle der Jugendkraft strahlte sein Auge und lachte sein Mund. Alles um ihn glänzte, duftete, wogte wie in elektrischem Feuer, in langen Zügen trank er den berauschenden Wohlgeruch, der aus der blühenden Erde aufstieg. Wo er einen Schnitter im Felde traf, rief er ihm zu, daß heut ein guter Tag sei, und einen guten Tag rief jeder Mund dem schmucken Jüngling zurück. Im Getreidefelde neigten sich die Ähren am schwanken Stiel auf ihn zu, sie nickten und grüßten, und in ihrem Schatten schwirrten unzählige Grillen ihren Gesang: «Lustig, lustig im Sonnenschein!» Auf der Weide saß ein Volk Sperlinge, die kleinen Barone des Feldes flüchteten nicht, als er vor dem Stamm stehenblieb, ja sie beugten die Hälse herunter und schrien ihn an: «Guten Tag, Wandersmann, wohin, wohin?» Und Anton sagte leise: «Nach der großen Stadt, in das Leben.» «Gutes Glück», schrien die Sperlinge, «frisch vorwärts!»
Anton durchschnitt auf dem Fußpfad einen Wiesengrund, ging über eine Brücke und sah sich in einem Wäldchen mit guterhaltenen Kieswegen. Immer mehr nahm das Gebüsch den Charakter eines gepflegten Gartens an, der Wanderer bog um einige alte Bäume und stand vor einem großen Rasenplatz. Hinter diesem erhob sich ein Herrenhaus mit zwei Türmchen in den Ecken und einem Balkon. Wer auf dem Balkon stand, konnte über den Grasplatz hinüber durch eine Öffnung in den Baumgruppen die schönsten Umrisse des fernen Gebirges sehen. An den Türmchen liefen Kletterrosen und wilder Wein in die Höhe, und unter dem Balkon öffnete sich gastlich eine Halle, welche mit blühenden Sträuchern ausgeschmückt war. Es war kein prunkender Landsitz, und es gab viele größere und schönere in der Umgegend; aber es war doch ein stattlicher Anblick, sehr imponierend für Anton, der, in einer kleinen Stadt aufgewachsen, nur selten den behaglichen Wohlstand eines Gutsbesitzers in der Nähe gesehen hatte. Alles erschien ihm sehr prächtig und großartig! Die zierlich geformten Blumenbeete in dem geschorenen Samt des Rasens, die bunten Gruppen der Glashauspflanzen, der fröhliche Schmuck, den die Hand des Gärtners um das Herrenhaus herum angebracht hatte, das alles sah ihm in dem reinen Lichte und der Ruhe des Sonnentages aus wie ein Bild aus fernem Lande. Der glückliche Jüngling geriet in ein so träumerisches Entzücken, daß er sich in den Schatten eines großen Fliederstrauches am Wege setzte und hinter dem Busch verborgen lange Zeit auf das anmutige Bild hinstarrte. Wie glücklich mußten die Menschen sein, welche hier wohnten, wie vornehm und wie edel! Auf dieser Seite schöne Blüten und große Bäume, auf der andern Seite wahrscheinlich ein weiter Hofraum mit Scheuern und Ställen, viele Pferde darin, große Rinder und unzählige feinwollige Schafe. Denn schon vor dem Eintritt in den Park hatte Anton auf eingehegtem Wiesenraum eine Anzahl Füllen gesehen und ihre lustigen Sprünge beobachtet. Der Respekt vor allem, was stattlich, sicher und mit Selbstgefühl in der Welt auftritt, war ihm, dem armen Sohn des Kalkulators, angeboren, und wenn er jetzt in der reinen Freude über die Pracht, welche ihn umgab, an sich selbst dachte, erschien er sich als höchst unbedeutend, als gar nicht der Rede wert, als eine Art gesellschaftlicher Däumling, winzig, kaum sichtbar im Grase. Unwillkürlich fuhr er in die Rocktasche, seine Handschuhe herauszuholen. Sie waren von gelbem Zwirn, und noch seine gute Mutter hatte gesagt, sie sähen ganz aus wie seidene, und seidene Handschuhe galten in Ostrau für den höchsten Luxus. Der arme Junge zog mit ihnen die Überzeugung an, daß er durch sie seiner jetzigen Umgebung doch um einige Gran würdiger werde.
Lange saß er in der Einsamkeit; endlich kam Bewegung in das stille Bild. Auf den Balkon des Hauses trat durch die geöffnete Tür eine zierliche Frauengestalt im hellen Sommerkleide mit weiten Spitzenärmeln und einer liebenswürdigen Frisur, wie sie Anton von alten Rokokobildern her kannte; er konnte deutlich die feinen Züge ihres Gesichts erkennen und den klaren Blick des Auges, welches auf dem Rasenplatz unter ihren Füßen ruhte. Die Dame stand auf das Geländer gestützt, bewegungslos wie eine Statue, und Anton sah ehrerbietig zu ihr auf. Endlich flog aus der offenen Tür hinter der Dame ein bunter Papagei, setzte sich auf ihre Hand und ließ sich von ihr liebkosen. Dies glänzende Tier steigerte Antons Bewunderung. Und als dem Papagei ein fast erwachsenes Mädchen folgte, welches schmeichelnd den Hals der schönen Frau umschlang, und als die Dame zärtlich die Wange des Mädchens an die ihre drückte und als der Papagei auf die Köpfe der beiden Damen flog und laut schreiend von einer Schulter zur andern sprang, da wurde das Gefühl der Verehrung in Anton so lebhaft, daß er vor innerer Aufregung errötete und sich tiefer in den Schatten des Gebüsches zurückzog.
Er dachte an die beiden schönen Frauengestalten auf dem Balkon und ging mit elastischem Schritt wie einer, dem etwas Fröhliches begegnet ist, den breiten Weg zurück, um einen Ausgang aus dem Garten zu finden. Da hörte er hinter sich das Schnauben eines Pferdes. Auf einem schwarzen Pony kam die jüngere der beiden Damen in seinem Wege geritten, die schlanke Gestalt saß sicher auf dem Pferde und gebrauchte einen Sonnenschirm als Reitgerte. Die Damenwelt von Ostrau hatte nicht die Gewohnheit, auf kleinen Pferden umherzureiten. Nur einmal hatte Anton eine Kunstreiterin gesehen mit sehr roten Wangen und einem langen roten Kleide, welche, begleitet von einem großen schwarzbärtigen Herrn, hinter dem lustigen Bajazzo durch die Straßen ritt und an jeder Straßenecke anhielt, wo ihr Pferd einen Sprung machte und Bajazzo unerhört lächerliche Worte zu der versammelten Jugend sprach. Schon damals hatte er mit unsäglicher Bewunderung die schöne Reiterin betrachtet, und jetzt war er ganz der Mann, dasselbe Gefühl womöglich in stärkerem Grade zu empfinden. Er blieb stehen und machte der Reiterin eine ehrfurchtsvolle Verbeugung. Diese erwiderte die Huldigung mit graziösem Kopfnicken, worauf sie plötzlich ihr Pferd anhielt und freundlich fragte: «Suchen Sie jemand hier? Vielleicht wünschen Sie meinen Vater zu sprechen?»
«Ich bitte um Verzeihung», sagte Anton mit tiefster Ehrerbietung. «Wahrscheinlich bin ich auf einem Wege, der Fremden nicht erlaubt ist. Ich kam den Fußsteig über die Wiesen und sah kein Tor und keinen Zaun.»
«Das Tor ist auf der Brücke, es steht am Tage offen», belehrte das Fräulein, gnädig auf Anton sehend; denn da Ehrfurcht nicht gerade das gewöhnliche Gefühl ist, welches vierzehnjährige Fräulein einflößen, so war ihr die massenhafte Anhäufung dieser Empfindung außerordentlich wohltuend.
«Da Sie im Garten sind, wollen Sie sich nicht darin umsehen? Es wird uns freuen, wenn er Ihnen gefällt», fügte sie mit Würde hinzu.
«Ich habe mir die Freiheit genommen», erwiderte Anton wieder mit einer Verbeugung, «ich war bis dort oben am Rasenplatz vor dem Schloß. Er ist prächtig!» rief der ehrliche Junge begeistert aus.
«Ja», sagte die Dame, immer noch den Pony anhaltend, «Mama hat selbst dem Gärtner alles angegeben.»
«Also die gnädige Frau, welche vorhin auf dem Balkon stand, ist Ihre Frau Mutter?» fragte Anton schüchtern.
«Ah! Sie haben uns belauscht», rief die Kleine und sah ihn vornehm an. «Wissen Sie, daß das nicht hübsch war?»
«Seien Sie mir deshalb nicht böse», bat Anton demütig. «Ich trat sogleich zurück, aber es sah wunderschön aus. Die beiden Damen nebeneinander, die Büschel blühender Rosen und das zackige Weinlaub um Sie herum. Ich werde das nicht vergessen», fügte er ernsthaft hinzu.
‹Er ist allerliebst!› dachte das Fräulein. «Da Sie so viel von unserm Garten gesehen haben», sagte sie herablassend, «so müssen Sie auch auf die Punkte gehen, wo Aussichten sind. Ich reite dahin – wenn Sie mir folgen wollen.»
Anton folgte in der glücklichsten Stimmung. Das Fräulein redete ihrem Pferde zu, im Schritt zu gehen, und machte den Erklärer. Sie zeigte ihm große Baumgruppen und freundliche Aussichten auf die Landschaft, legte dabei einen Teil ihrer Majestät ab und wurde gesprächig. Bald plauderten beide so ungezwungen wie alte Bekannte. Endlich stieg das Fräulein ab, als ihr einige Stufen eine schickliche Veranlassung gaben, und führte das Pferd am Zügel; darauf wagte Anton den Hals des Schwarzen zu streicheln, was der Pony wohlwollend aufnahm und seinerseits dem Fremdling die Rocktaschen beroch.
«Er hat Zutrauen zu Ihnen», sagte das Fräulein, «er ist ein kluges Tier.» Sie warf ihm die Zügel über den Kopf und gab ihm einen Schlag, worauf der Pony in kurzen Sprüngen davonrannte. «Wir kommen in den Blumengarten, da darf er nicht hinein; er läuft zum Stall zurück; er ist's gewöhnt.»
«Dieser Pony ist ein Wunder von einem Pferde», rief ihm Anton nach.
«Ich bin sein Liebling», sagte das Fräulein beistimmend, «er folgt mir aufs Wort.» Anton fand die Anhänglichkeit des Pony natürlich, setzte dieselbe Empfindung beim Papagei voraus und war geneigt zu behaupten, daß alle übrige Kreatur der Erde eine ähnliche Stimmung gegen seine Führerin haben müsse.
«Ich denke, Sie sind von Familie», fragte die junge Dame plötzlich, stemmte ihren Schirm gegen einen Baumast und sah Anton mit altklugem Blick an.
«Nein», sagte der Sohn des Kalkulators traurig, «mein Vater starb vor vier Wochen, es ist ein Jahr, daß meine gute Mutter tot ist, ich bin allein, ich gehe nach der Hauptstadt.» Seine Lippen zuckten bei der Erinnerung an den jüngsten Verlust.
Erschrocken sah das Fräulein den Schmerz im Gesicht des Fremden. «Sie armer, armer Herr!» rief sie gerührt und verlegen. «Kommen Sie schnell, ich will Ihnen noch etwas zeigen. Hier sind die Frühbeete; hier ist das Beet mit Erdbeeren, es sind noch einige darin. – Franz, bringen Sie den Teller mit Beeren», rief sie dem Gärtner zu. Franz eilte damit herbei. Eifrig ergriff das Fräulein den Teller und bot die Beeren unserm Helden mit gütigem Lächeln: «Hier, mein Herr! Haben Sie die Güte, dies von mir anzunehmen. Vom Hause meines Vaters darf kein Gast scheiden, ohne von dem Besten zu kosten, das uns die Jahreszeit gibt. Bitte, nehmen Sie», bat sie dringend.
Anton hielt den Teller in der Hand und sah aus feuchten Augen herzlich nach der jungen Dame.
«Ich esse mit Ihnen», sagte das Fräulein und faßte zwei Beeren. Darauf leerte Anton gehorsam den Teller.
«Jetzt führe ich Sie noch aus dem Garten», sprach die Dame. Der Gärtner öffnete respektvoll eine kleine Seitentür, und das Fräulein geleitete den Reisenden bis an einen Teich, auf dem alte und junge Schwäne schwammen.
«Sie kommen heran», rief Anton freudig.
«Sie wissen, daß ich etwas für sie in der Tasche habe», sagte seine Begleiterin und löste die Kette eines Kahns. «Steigen Sie ein, mein Herr, ich fahre Sie hinüber, dort drüben ist Ihr Weg.»
«Ich darf Sie nicht so bemühen», sagte Anton und zauderte einzutreten.
«Ohne Widerspruch», befahl das Fräulein, «es geschieht gern.» Sie setzte sich auf die Steuerbank und drückte das Wasser mit dem leichten Ruder geschickt hinter den Kahn. So fuhr sie langsam über den Teich, die Schwäne zogen ihr nach, sie hielt von Zeit zu Zeit an und warf ihnen Bissen zu.
Anton saß ihr selig gegenüber. Er war wie verzaubert. Im Hintergrund das dunkle Grün der Bäume, um ihn die klare Flut, welche leise an dem Schnabel des Kahns rauschte, ihm gegenüber die schlanke Gestalt der Schifferin, gerötet durch ein liebliches Lächeln, und hinter ihnen her das Volk der Schwäne, das weiße Gefolge der Herrin dieser Flut. Es war ein Traum, so lieblich, wie ihn nur die Jugend träumt.
Der Kahn stieß an das Ufer, Anton stieg heraus und rief: «Leben Sie wohl!», und unwillkürlich streckte er ihr die Hand entgegen. «Leben Sie wohl», sagte die Kleine und berührte seine Hand mit den Fingerspitzen. Sie wandte den Kahn und fuhr langsam zurück. Anton sprang über den Rasen bis auf den erhöhten Weg und sah von dort auf das Wasser. Der Kahn landete an einer Baumgruppe, das Fräulein wandte sich noch einmal nach ihm um, dann verschwand sie hinter den Bäumen. Durch eine Öffnung des Parkes sah Anton das Schloß vor sich liegen, hoch und vornehm ragte es über die Ebene. Lustig flatterte die Fahne auf dem Türmchen, und kräftig glänzte im Sonnenschein das Grün der Schlingpflanzen, welche den braunen Stein der Mauern überzogen.
«So fest, so edel!» sagte Anton vor sich hin.
«Wenn du diesem Baron aufzählst hunderttausend Talerstücke, wird er dir doch nicht geben sein Gut, was er geerbt von seinem Vater», sprach eine scharfe Stimme hinter Antons Rücken. Dieser wandte sich zornig um, das Zauberbild verschwand, er stand in dem Staube der großen Landstraße. Neben ihm lehnte an einem Weidenstamm ein junger Bursche in ärmlichem Aufzuge, welcher ein kleines Bündel unter dem Arme hielt und mit ruhiger Unverschämtheit unsern Helden anstarrte.
«Bist du's, Veitel Itzig!» rief Anton, ohne große Freude über die Zusammenkunft zu verraten. Junker Itzig war keine auffallend schöne Erscheinung; hager, bleich, mit rötlichem krausem Haar, in einer alten Jacke und defekten Beinkleidern sah er so aus, daß er einem Gendarmen ungleich interessanter sein mußte als andern Reisenden. Er war aus Ostrau, ein Kamerad Antons von der Bürgerschule her. Anton hatte in früherer Zeit Gelegenheit gehabt, durch tapfern Gebrauch seiner Zunge und seiner kleinen Fäuste den Judenknaben vor Mißhandlungen mutwilliger Schüler zu bewahren und sich das Selbstgefühl eines Beschützers der unterdrückten Unschuld zu verschaffen. Namentlich einmal in einer düstern Schulszene, in welcher ein Knackwürstchen benutzt wurde, um verzweifelte Empfindungen in Itzig hervorzurufen, hatte Anton so wacker für Itzig plädiert, daß er selbst ein Loch im Kopfe davontrug, während seine Gegner weinend und blutrünstig hinter die Kirche rannten und selbst die Knackwurst aufaßen. Seit diesem Tage hatte Itzig eine gewisse Anhänglichkeit an Anton gezeigt, welche er dadurch bewies, daß er sich bei schweren Aufgaben von seinem Beschützer helfen ließ und gelegentlich ein Stück von Antons Buttersemmel zu erobern wußte; Anton aber hatte den unliebenswürdigen Burschen gern geduldet, weil ihm wohltat, einen Schützling zu haben, wenn dieser auch im Verdacht stand, Schreibfedern zu mausen und später an Begüterte wieder zu verkaufen. In den letzten Jahren hatten die jungen Leute einander wenig gesehen, gerade so oft, daß Itzig Gelegenheit erhielt, die vertraulichen Formen des Schulverkehrs durch gelegentliche Anreden und kleine Spöttereien aufzufrischen.
«Die Leute sagen, daß du gehst nach der großen Stadt, um zu lernen das Geschäft», fuhr Veitel fort. «Du wirst lernen, wie man Tüten dreht und Sirup verkauft an die alten Weiber; ich gehe auch nach der Stadt, ich will machen mein Glück.»
Anton antwortete, unwillig über die freche Rede und über das vertrauliche Du, das der Kamerad aus der Elementarschule immer noch gegen ihn wagte: «So gehe deinem Glück nach und halte dich nicht bei mir auf.»
«Es hat keine Eil'», entgegnete Veitel nachlässig, «ich will warten, bis auch du gehst, wenn dir meine Kleider nicht sind zu schlecht.» Diese Berufung auf Antons Humanität hatte die Folge, daß Anton sich schweigend die Gegenwart des unwillkommenen Gefährten gefallen ließ. Er warf noch einen Blick nach dem Schlosse und schritt dann stumm auf der Landstraße fort, Itzig immer einen halben Schritt hinter ihm. Endlich wandte sich Anton um und fragte nach dem Eigentümer des Schlosses.
Wenn Veitel Itzig nicht ein Hausfreund des Gutsbesitzers war, so mußte er doch zum wenigsten ein vertrauter Freund seines Pferdejungen sein; denn er war bekannt mit vielen Verhältnissen des Freiherrn, der in dem Schlosse wohnte. Er berichtete, daß der Baron nur zwei Kinder habe, dagegen eine ausgezeichnete Schafherde auf einem großen schuldenfreien Gut. Der Sohn sei auswärts auf einer Schule. Als Anton mit lebhaftem Interesse zuhörte und dies durch seine Fragen verriet, sagte Itzig endlich: «Wenn du willst haben das Gut von diesem Baron, ich will dir's kaufen.»
«Ich danke», antwortete Anton kalt. «Er würde es nicht verkaufen, hast du mir eben gesagt.»
«Wenn einer nicht will verkaufen, muß man ihn dazu zwingen», rief Itzig.
«Du bist der Mann dazu», sprach Anton.
«Ob ich bin der Mann oder ob es ist ein anderer: es ist doch zu machen, daß man kauft von jedem Menschen, was er hat. Es gibt ein Rezept, durch das man kann zwingen einen jeden, von dem man etwas will, auch wenn er nicht will.»
«Muß man ihm einen Trank eingeben», fragte Anton mit Verachtung, «oder ein Zauberkraut?»
«Tausendgüldenkraut heißt das Kraut, womit man vieles kann machen in der Welt», erwiderte Veitel, «aber wie man es muß machen, daß man auch als kleiner Mann kriegen kann so ein Gut wie des Barons Gut, das ist ein Geheimnis, welches nur wenige haben. Wer das Geheimnis hat, wird ein großer Mann wie der Rothschild, wenn er lange genug am Leben bleibt.»
«Wenn er nicht vorher festgesetzt wird», warf Anton ein.
«Nichts eingesteckt!» antwortete Veitel. «Wenn ich nach der Stadt gehe zu lernen, so gehe ich zu suchen die Wissenschaft, sie steht auf Papieren geschrieben. Wer die Papiere finden kann, der wird ein mächtiger Mann: ich will suchen die Papiere, bis ich sie finde.»
Anton sah seinen Reisegefährten von der Seite an, wie man einen Menschen ansieht, dessen Verstand in der Irre lustwandelt, und sagte endlich mitleidig: «Du wirst sie nirgend finden, armer Veitel.»
Itzig aber fuhr fort, sich vertraulich an Anton drängend: «Was ich dir sage, das erzähle keinem weiter. Die Papiere sind gewesen in unsrer Stadt, einer hat sie gekriegt von einem alten sterbenden Bettler und ist geworden ein mächtiger Mann; der alte Schnorrer hat sie ihm gegeben in einer Nacht, wo der andere hat gebetet an seinem Lager, ihm zu vertreiben den Todesengel.»
«Und kennst du den Mann, der die Papiere hat?» fragte Anton neugierig.
«Wenn ich ihn weiß, so werde ich es doch nicht sagen», antwortete Veitel schlau, «aber ich werde finden das Rezept. Und wenn du haben willst das Gut des Barons und seine Pferde und Kühe und seinen bunten Vogel und den Backfisch, seine Tochter, so will ich dir's schaffen aus alter Freundschaft und weil du ausgehauen hast die Bocher in der Schule für mich.»
Anton war entrüstet über die Frechheit seines Gefährten. «Hüte dich nur, daß du kein Schuft wirst, du scheinst mir auf gutem Wege zu sein», sagte er zornig und ging auf die andere Seite der Straße.
Itzig ließ sich durch diesen guten Rat nicht anfechten, sondern pfiff ruhig vor sich hin. So schritten die beiden Reisenden in langem Schweigen, welches Itzig unbefangen beim nächsten Dorfe unterbrach, indem er seinem Begleiter wieder Namen und Vermögensverhältnisse des Rittergutes angab. Und diese belehrende Unterhaltung wiederholte sich bei jedem Dorf, bis Anton ganz betroffen wurde über die ausgebreiteten statistischen Kenntnisse seines Gefährten. Endlich verstummten beide und legten die letzte Meile, ohne ein Wort zu sprechen, nebeneinander zurück.
3
Der Freiherr von Rothsattel gehörte zu den wenigen Menschen, welche nicht nur von aller Welt glücklich gepriesen werden, sondern auch sich selbst für glücklich halten. Er stammte aus einem sehr alten Hause. Ein Rothsattel war schon in den Kreuzzügen nach dem Morgenlande geritten. Wenigstens wurde in der Familie ein Rokoko-Flakon von buntem Glas als orientalisches Fläschchen aufbewahrt, zum Beweis für die Existenz des Ahnherrn und zur Erinnerung an die fromme Zeit der Kreuzzüge. Ein anderer Rothsattel hatte einen Haufen Bergleute gegen die Hussiten geführt und war mit dem ganzen Haufen zu seiner und des Herrn Ehre erschlagen worden. Wieder einer war Fähnrich in dem Heere des Moritz von Sachsen gewesen, er galt für den Stifter der Linie Rothsattel-Steigbügel, und sein kriegerisches Bildnis hing noch im Turmzimmer des Schlosses. Ein anderer hatte sich im Dreißigjährigen Kriege bei verschiedenen Armeen und auf eigene Faust gerührt; die Familiensage meldete von ihm, er sei ein sehr dicker Herr und ein großer Trinker gewesen, von kräftiger Suade und etwas freien Sitten. Er war als erster des Geschlechtes in die Gegend gekommen, in welcher diese Erzählung verlaufen soll, und hatte eine Anzahl Landgüter auf irgendeine Weise in Besitz genommen. Unter den Kinderfrauen der Familie bestand seit alter Zeit die düstere Überzeugung, daß dieser dicke Herr zuweilen im Keller auf einer großen Krauttonne zu sehen sei, wo er als ruheloser Geist sitze und ächze, zur Strafe für schauderhafte Vergehungen gegen die Tugend seiner weiblichen Zeitgenossen. Wieder ein anderer Vorfahre war kaiserlicher Rat zu Wien gewesen; der Urgroßvater des gegenwärtigen Besitzers war von dem großen König der Preußen starr angesehen und darauf mit Wohlwollen angeredet worden. Auch der Großvater war zu seiner Zeit ein unternehmender und vielbesprochener Kavalier gewesen, der in der Armee keine Lorbeeren gefunden und sich resigniert hatte, diese im Boudoir galanter Damen und am grünen Tisch zu suchen. Leider waren ihm dabei seine Güter lästig geworden und aus den Händen geglitten. Sein Sohn endlich, der Vater des gegenwärtigen Besitzers, war ein einfacher Landedelmann von mäßigem Geiste, der nach langen Prozessen das eine stattliche Gut aus den Trümmern des Familienvermögens rettete und sein Leben damit zubrachte, dasselbe für seine Nachkommen schuldenfrei zu machen. Die Rothsattel haben von je in dem Rufe gestanden, starke Nachkommenschaft zu hinterlassen, und alle älteren Damen aus der Familie erklärten diese Eigenheit – so höchst achtungswert sie auch sonst sei – doch für den einzigen Grund, daß das berühmte Haus nicht dazu gekommen war, die neunzinkige Grafenkrone oder gar den geschlossenen Reif eines Titularfürstentums auf dem Wappenhelm seines Seniors zu sehen. Gegenüber dem alten Brauch seines Hauses erwies der Vater auch dadurch seinen bescheidenen Sinn, daß er nur einen Sohn hinterließ.
Der gegenwärtige Besitzer des Gutes hatte in einem Garderegiment gedient, wie dem Sproß eines so kriegerischen Hauses ziemte. Er hatte dort den Ruf eines vollendeten Edelmanns erworben. Er war brauchbar im Dienst und ein vortrefflicher Kamerad gewesen, wohlbewandert in allen ritterlichen Übungen, zuverlässig in Ehrensachen. Er hatte bei Hofbällen stets schicklich dagestanden und, sooft er von einer Prinzeß befohlen wurde, mit guter Haltung getanzt. Auch als Mann von Charakter hatte er sich gezeigt, da er aus wirklicher Neigung ein armes Hoffräulein heiratete, eine liebenswürdige junge Dame, deren Abgang aus den Quadrillen des Hofes lebhafte Betrübnis in allen Männerherzen hervorrief. Mit seiner Gemahlin hatte sich der Freiherr als verständiger Mann in die Provinz zurückgezogen, hatte durch eine Reihe von Jahren fast ausschließlich für seine Familie gelebt und dadurch den Vorteil errungen, daß seine Regimentsschulden sämtlich bezahlt und seine Ausgaben nicht größer waren als seine Einnahmen. Sein Haus war vortrefflich eingerichtet; die geringe Aussteuer seiner Frau war dazu benützt worden, ihr durch Einrichtung des Parks eine große Freude zu machen. Der Freiherr hielt einen guten Weinkeller von guten Tischweinen, hatte zwei prächtige Wagenpferde und zwei elegante Reitpferde, ging jeden Morgen durch die Wirtschaft und ritt jeden Nachmittag aufs Feld, hielt viel auf seine Schafherde und setzte einen Stolz darein, seine feine Wolle gut waschen zu lassen. Er war ein durchaus ehrlicher Mann, noch jetzt eine imponierend schöne Gestalt, verstand würdig zu repräsentieren und einen gastfreien Wirt zu machen und liebte seine Frau womöglich noch mehr als in den ersten Monaten nach der Vermählung. Kurz, er war das Musterbild eines adligen Rittergutsbesitzers. Er war kein übermäßig reicher Herr, ungefähr das, was man einen Fünftausendtalermann nennt, und hätte sein schönes Gut in günstigen Zeiten wohl um vieles höher verkaufen können, als der scharfsinnige Itzig annahm. Er hätte das aber mit Recht für eine große Torheit gehalten. Zwei gesunde und fähige Kinder vollendeten das Glück seines Haushaltes, der Sohn war im Begriff, als Militär die Familienkarriere zu beginnen, die Tochter sollte noch einige Jahre unter den Flügeln der Mutter leben, bevor sie in die große Welt trat.
Wie alle Menschen, welchen das Schicksal Familienerinnerungen aus alter Zeit auf einen Schild gemalt und an die Wiege gebunden hat, war auch unser Freiherr geneigt, viel an die Vergangenheit und Zukunft seiner Familie zu denken. An seinem Großvater war die trübe Erfahrung gemacht worden, daß ein einziger ungeordneter Geist hinreicht, das auseinanderzustreuen, was emsige Vorfahren an Goldkörnern und Ehren für ihre Nachkommen gesammelt haben. Er hätte deshalb gern sein Haus für alle Zukunft vor dem Herunterkommen gesichert, hätte gern sein schönes Gut in ein Majorat verwandelt und dadurch leichtsinnigen Enkeln erschwert, zwar nicht Schulden zu machen, aber dieselben zu bezahlen. Doch die Rücksicht auf seine Tochter hielt ihn von diesem Schritte ab, es kam seinem ehrlichen Gefühl ungerecht vor, dies geliebte Kind wegen künftiger ungewisser Rothsattel zu enterben. Und er empfand mit Schmerz, daß sein altes Geschlecht in der nächsten Generation in dieselbe Lage kommen werde, in der die Kinder eines Beamten oder eines Krämers sind, in die unbequeme Lage, sich durch eigene Anstrengung eine mäßige Existenz schaffen zu müssen. Er hatte oft versucht, von seinen Erträgen zurückzulegen, indes die Gegenwart war dazu wirklich nicht geeignet; überall fing man an, mit einer gewissen Reichlichkeit zu leben, mehr auf elegante Einrichtung und den zahllosen kleinen Schmuck des Daseins zu halten. Und was er in günstigen Jahren etwa gespart hatte, das war auf kleinen Badereisen, welche die zarte Gesundheit seiner Frau nach der Behauptung des Arztes notwendig machte, immer wieder ausgegeben worden. Der Gedanke an die Zukunft seiner Familie beschäftigte den Freiherrn auch heut, als er auf seinem Halbblut durch die große Kastanienallee dem Schlosse zusprengte. Es war eine sehr kleine Wolke, welche unter dem Sonnenschein seiner Seele dahinfuhr, sie verschwand im Nu, als er Gewänder vor sich flattern sah und seine Gemahlin erkannte, welche mit der Tochter ihm entgegeneilte. Er sprang vom Pferde, küßte sein Lieblingskind auf die Stirn und sagte vergnügt zu seiner Frau: «Wir haben vortreffliches Wetter zur Heuernte, es wird nach Kräften eingefahren, der Amtmann behauptet, wir hätten noch nie so viel Futter gemacht.»
«Du hast Glück, Oskar», sagte die Baronin, zärtlich zu ihm aufblickend.
«Wie immer seit siebzehn Jahren, seit ich dich heimgeführt habe», antwortete der Gemahl mit einer Artigkeit, die vom Herzen kam.
«Heut sind es siebzehn Jahre», rief die Baronin, «sie sind vergangen wie ein Sommertag. Wir sind sehr glücklich gewesen, Oskar.» Sie schmiegte sich an seinen Arm und sah dankend zu ihm auf.
«Gewesen?» fragte der Freiherr. «Ich denke, wir sind's noch. Und ich sehe nicht ein, weshalb es nicht weiter so fortgehen soll.»
«Berufe es nicht», bat die Baronin. «Mir ist manchmal, als könnte so viel Sonnenschein nicht ewig währen; ich möchte demütig entbehren und fasten, um den Neid des Schicksals zu versöhnen.»
«Nun», sagte der Freiherr gutmütig, «das Schicksal läßt uns auch nicht ungezaust. Die Donnerwetter fehlen uns nicht, aber diese kleine Hand erhebt sich zur Beschwörung, und sie ziehn vorüber. Hast du nicht Ärger genug mit dem Haushalt, den Tollheiten der Kinder und zuweilen mit deinem Tyrannen, daß du dir mehr ersehnst?»
«Du lieber Tyrann!» rief die Baronin. «Dir danke ich dies Glück. Und wie fühle ich es! Nach siebzehn Jahren bin ich immer noch stolz darauf, einen so stattlichen Hausherrn zu haben, ein so schönes Schloß und ein so großes Gut, wo jeder Fußtritt des Bodens auch mir gehört. Als du mich, das arme Fräulein mit meinem Fähnchen und dem Schmuckkästchen, das ich der Gnade der Herrschaften verdanke, in dein Haus führtest, da erst lernte ich erkennen, welche Seligkeit es ist, im eigenen Hause als Herrin zu regieren und dem Willen keines andern zu gehorchen als dem des geliebten Mannes.»
«Du hast doch vieles aufgegeben um meinetwillen», sagte der Freiherr. «Oft habe ich gefürchtet, daß unser Landleben dir, dem Günstling der verstorbenen Prinzeß, zu einsam und klein erscheinen würde.»
«Dort war ich Dienerin, hier bin ich Herrin», sagte die Baronin lachend. «Außer meiner Toilette hatte ich nichts, was mir selbst gehörte. Immer in den langweiligen Stuben der Hoffräulein herumziehen, an allen Abenden zu der letzten Rolle verurteilt sein und dabei die Angst haben, daß das immer so fortgehen soll, bis man alt wird in ewigen Zerstreuungen, ohne eigenes Leben! Du weißt, daß mich das oft traurig gemacht hat. Hier sind die Überzüge unserer Möbel nicht von schwerem Seidenstoff, und in unserm Saal steht keine Tafel aus Malachit, aber was im Hause ist, gehört mir.» Sie schlang ihren Arm um den Freiherrn: «Du gehörst mir, die Kinder, das Schloß, unsere silbernen Armleuchter.»
«Die neuen sind nur Komposition», warf der Freiherr ein.
«Das sieht niemand», erwiderte seine Gemahlin fröhlich. «Und wenn ich das Porzellan ansehe und am Rande dein und mein Wappen erblicke, so schmecken mir unsere zwei Schüsseln zehnmal so gut als die vielen Gänge der Hofküche. Und vollends die großen Hoftage und unsere Marschallstafel, wo jeder den andern zum Verzweifeln genau kannte und jeder dem andern zum Verzweifeln gleichgültig war.»
«Du bist ein glänzendes Beispiel von Genügsamkeit», sagte der Freiherr. «Um deinetwillen und wegen der Kinder wollte ich, dies Gut wäre zehnmal so groß und unsere Einnahme so, daß ich dir einen Pagen halten könnte, Frau Marquise, und außer der Wirtschafterin ein paar Hoffräulein.»
«Nur kein Fräulein», bat die Baronin, «und was den Pagen betrifft, so braucht man keinen, wenn man einen Kavalier hat, der so aufmerksam ist wie du.»
So schritt der Freiherr behaglich zwischen den beiden Frauen dem Schlosse zu. Lenore hatte sich unterdes der Zügel seines Reitpferdes bemächtigt und redete dem Pferde freundlich zu, so wenig Staub als möglich zu machen.
«Dort hält ein fremder Wagen, ist Besuch gekommen?» fragte der Freiherr, als sie sich dem Hofe näherten.
«Es ist nur Ehrenthal», antwortete die Baronin, «er wartet auf dich und hat bereits seinen ganzen Vorrat von schönen Redensarten an uns verschwendet; Lenore ließ ihrem Übermut die Zügel schießen, und es war hohe Zeit, daß ich sie wegführte; dem drolligen Manne wurde angst bei der Koketterie des unartigen Kindes.»
Der Freiherr lächelte. «Mir ist er immer noch der liebste aus dieser Klasse von Geschäftsleuten», sagte er, «sein Benehmen ist wenigtens nicht abstoßend, und ich habe ihn in dem langen Verkehr stets zuverlässig gefunden. – Guten Tag, Herr Ehrenthal, was führt Sie zu mir?»
Herr Ehrenthal war ein wohlgenährter Herr in seinen besten Jahren, mit einem Gesicht, welches zu rund war, zu gelblich und zu schlau, um schön zu sein; er trug Gamaschen an den Füßen, eine diamantene Busennadel auf dem Hemd und schritt mit großen Bücklingen und tiefen Bewegungen des Hutes durch die Allee dem Baron entgegen.
«Ihr Diener, gnädiger Herr», antwortete er mit ehrerbietigem Lächeln. «Wenn mich auch nichts herführt von Geschäften, so werde ich Sie doch bitten, Herr Baron, daß Sie mir manchmal erlauben, herumzugehen in Ihrer Wirtschaft, damit ich in meinem Herzen eine Freude habe. Es ist mir eine Erholung von der Arbeit, wenn ich komme in Ihren Hof. Alles so glatt und wohlgenährt und alles so reichlich und gut eingerichtet in den Ställen und in den Scheunen. Die Sperlinge auf dem Dach sehen bei Ihnen lustiger aus als die Sperlinge von andern Leuten. Wenn man als Geschäftsmann so vieles erblicken muß, was einen nicht erfreut, wo die Menschen durch ihr Verschulden in Unordnung kommen und Verfall, da tut's einem wohl, wenn man ein Leben sieht wie das Ihre; keine Sorgen, keine großen Sorgen zum wenigsten, und so vieles, was das Herz erfreut.»
«Sie sind so artig, Herr Ehrenthal, daß ich glauben muß, etwas recht Wichtiges führt Sie her. Wollen Sie ein Geschäft mit mir machen?» fragte der Freiherr gutmütig.
Mit einem Kopfschütteln, wie es dem biedern Mann ansteht, wenn er einen ungerechten Verdacht von sich abweisen will, antwortete Herr Ehrenthal: «Nichts vom Geschäft, Herr Baron! Die Geschäfte, die ich mit Ihnen mache, sind solche, wo man sagt keine Artigkeiten. Gute Ware und gutes Geld, so haben wir es immer gehalten, und so wollen wir's mit Gottes Hilfe auch ferner halten. Ich kam nur herein im Vorbeifahren» – dabei bewegte er nachlässig die Hand, um pantomimisch zu bekräftigen, daß er nur im Vorbeifahren sei -, «ich wollte fragen wegen des Pferdes, das der Herr Baron zu verkaufen haben. Es ist einer im Dorfe daneben, dem ich habe versprochen, zu fragen nach dem Preis. Ich kann's ebensogut mit dem Amtmann abmachen, wenn der Herr Baron keine Zeit haben für mich.»
«Kommen Sie mit, Ehrenthal», sagte der Freiherr, «ich führe mein Pferd selbst in den Stall.»
Herr Ehrenthal machte den Frauen viele Bücklinge, welche von Lenore durch ebenso viele Knickse erwidert wurden, und folgte dem Freiherrn zur Stalltür. Dort blieb er respektvoll stehen und bestand darauf, daß das Pferd des Barons und der Baron selbst vor ihm eintraten. Nach kurzer Besichtigung und dem üblichen Reden und Gegenreden führte der Freiherr Herrn Ehrenthal auch in den Kuhstall, worauf Herr Ehrenthal den leidenschaftlichen Wunsch aussprach, auch die Kälber zu sehen, und endlich die Bitte zufügte, auch bei den Zuchtböcken zur Audienz zugelassen zu werden. Er war ein erfahrener Geschäftsmann, und wenn das Entzücken, welches er aussprach, auch etwas handwerksmäßig und überschwenglich klang, so war das, was er lobte, doch wirklich lobenswert, und der Freiherr hörte das Lob mit Wohlgefallen an.
Nach Besichtigung der Schafe mußte eine Pause gemacht werden, denn Ehrenthal war zu sehr ergriffen von der Feinheit und Dichtigkeit ihres Pelzes. «Nein, dieser Stapel!» seufzte er in träumerischer Begeisterung. «Schon jetzt kann man sehen, was er sein wird im nächsten Frühjahr.» Er wiegte den Kopf hin und her und zwinkerte mit den kleinen Augen nach der Sonne. «Wissen Sie, Herr Baron, daß Sie sind ein glücklicher Mann! Haben Sie gute Nachrichten von Ihrem Herrn Sohn?»
«Danke, lieber Ehrenthal, er hat gestern geschrieben und seine Zeugnisse geschickt», antwortete der Freiherr.
«Er wird werden wie sein Herr Vater», rief Herr Ehrenthal aus, «ein Kavalier von erster Qualität und ein reicher Mann, der Herr Baron weiß zu sorgen für seine Kinder.»
«Ich erspare nichts, lieber Ehrenthal», erwiderte der Baron nachlässig.
«Was ersparen!» rief der Händler mit Verachtung gegen eine so plebejische Tätigkeit. «Was wollen Sie sparen? Wenn ich mir erlauben darf, das zu bemerken als ein Geschäftsmann, der schon lange die Ehre hat, Sie zu kennen. Was brauchen Sie zu sparen? Sie werden doch dereinst, wenn der alte Ehrenthal nicht mehr sein wird, auch ohne Sparen hinterlassen dem jungen Herrn das Gut, welches unter Brüdern wert ist ein und ein halbes Hunderttausend, und dem gnädigen Fräulein Tochter außerdem eine Aussteuer von – was soll ich sagen -, von fünfzigtausend Taler bar.»
«Sie irren», sagte der Freiherr ernst, «ich bin nicht so reich.»
«Nicht so reich?» rief Herr Ehrenthal mit sittlicher Entrüstung gegen jeden Menschensohn (den Baron ausgenommen), der so etwas behaupten könnte. «Es hängt doch nur von Ihnen ab, jeden Augenblick so reich zu sein. Wer ein Vermögen hat wie der Herr Baron, der kann in zehn Jahren verdoppeln sein Kapital ohne Gefahr. – Warum wollen Sie nicht Pfandbriefe der Landschaft auf Ihr Gut nehmen?»
Die ‹Landschaft› der Provinz war damals ein großes Kreditinstitut der Rittergutsbesitzer, welches Kapitalien zur ersten Hypothek auf Rittergüter auslieh. Die Zahlung erfolgte in Pfandbriefen, welche auf den Inhaber lauteten und überall im Lande für das sicherste Wertpapier galten. Das Institut selbst zahlte die Interessen an die Besitzer der Obligationen und erhob von seinen Schuldnern außer den Zinsen noch einen geringen Zuschlag für Verwaltungskosten und zu allmählicher Tilgung der aufgenommenen Schuld.
«Ich mache keine Geldgeschäfte», antwortete der Freiherr stolz, aber in seiner Brust klang die Saite fort, welche der Händler angeschlagen hatte.
«Die Geschäfte, welche ich meine, sind so, wie sie heutzutage macht jeder Fürst», fuhr Herr Ehrenthal mit Feuer fort. «Wenn der gnädige Herr Pfandbriefe der Landschaft aufnimmt auf sein Gut, so kann er jede Stunde erhalten fünfzigtausend Taler in gutem Pergament. Sie zahlen dafür der Landschaft vier vom Hundert, und wenn Sie die Pfandbriefe liegen lassen in Ihrer Kasse, so erhalten Sie davon Zinsen dreieinhalb vom Hundert. Dann zahlen Sie ein halbes Prozent zu an die Landschaft, und durch das halbe Prozent wird noch amortisiert das Kapital.»
«Das heißt Schulden machen, um reich zu werden», warf der Gutsherr achselzuckend ein.
«Verzeihen Sie, Herr Baron, wenn ein Herr wie Sie fünfzigtausend Taler liegen hat, welche ihn jährlich kosten ein halbes Prozent, so kann er damit kaufen die halbe Welt. Immer gibt es Gelegenheit, Güter zu erwerben zu einem Spottpreise, wenn man bar Geld oder Pfandbriefe hat zu rechter Zeit. Da sind Rittergüter, da sind Waldungen, die man kaufen kann, oder Anteile von Bergwerken oder Aktien von einer soliden Sozietät. Oder der Herr Baron können selbst anlegen ein Etablissement auf Ihrem Gut, wenn Sie wollen schaffen Zucker aus Rüben wie der Herr von Bergen am Gebirge oder amerikanisches Mehl wie der Herzog von Löbau oder bayrisches Bier wie Ihr Nachbar, der Graf Horn. Was ist dabei für eine Gefahr? Sie werden einnehmen zehn, zwanzig, ja fünfzig Taler vom Hundert des Kapitals, das Sie geliehen haben von der Landschaft zu vier vom Hundert.»
Der Freiherr sah nachdenklich vor sich hin. Was ihm der Händler sagte, war durchaus nichts Neues und Unerhörtes, er selbst hatte oft ähnliches gedacht. Es war gerade die Zeit, wo eine Menge von neuen industriellen Unternehmungen aus dem Ackerboden aufschoß, wo durch die hohen Schornsteine der Dampfmaschinen, durch neuentdeckte Kohlen- und Erzlager, durch neue landwirtschaftliche Kulturen große Summen erworben und noch größere Reichtümer erhofft wurden. Die vornehmsten Grundbesitzer der Landschaft standen an der Spitze ausgedehnter Aktienunternehmungen, welche auf einer Verbindung moderner Industrie und des alten Ackerbaues beruhten. Es war nichts Neues und Auffallendes in den Worten des Händlers, und doch schlugen sie als zündender Blitz in die Seele des Freiherrn. Sie kamen im rechten Augenblick. Herr Ehrenthal bemerkte die Wirkung, welche er hervorgebracht hatte, und schloß mit der Gemütlichkeit, welche seine Lieblingsstimmung war: «Wo habe ich das Recht, einem Herrn, wie Sie sind, einen Rat zu geben? Aber jeder Gutsbesitzer muß sagen dasselbe, daß ein solches Geschäft mit Pfandbriefen in unserer Zeit die solideste Art ist, wie ein vornehmer Herr kann sorgen für seine Kinder. Wenn einst das Gras wachsen wird über dem Grabe des alten Ehrenthal, dann werden Sie an mich denken und bei sich sagen: Der alte Ehrenthal war nur ein einfacher Mann, aber er hat mir geraten, was gut war und ein Segen für die Familie.»
Der Freiherr sah immer noch vor sich hin. Was er lange in sich herumgetragen hatte, das war auf einmal zum festen Entschluß geworden. Dem Händler sagte er mit einer Leichtigkeit, die ihm nicht vom Herzen kam: «Ich will mir's überlegen.» Ehrenthal war damit zufrieden und bat um die Erlaubnis, sich den Damen empfehlen zu dürfen, was er als Mann von Welt und Gemüt selten unterließ.
Es war schade, daß der Freiherr nicht das Gesicht des Geschäftsmannes sah, als dieser in seinen Wagen stieg und mechanisch die Bourbonrose ins Knopfloch steckte, welche ihm Lenore beim Abschiede mit schalkhafter Artigkeit überreicht hatte. Auch Herr Ehrenthal machte ein lustiges Gesicht, aber nicht aus Freude über die volle Rose. Er ließ den Kutscher langsam durch die Feldmark fahren und sah wohlgefällig auf die Ackerstücke, welche mit reifender Frucht zu beiden Seiten des Weges lagen. In langem Zuge kamen die Heuwagen des Gutes ihm entgegen. Sooft er stillhielt, um einen Riesenwagen vorbeizulassen, berupften seine Pferde das Heu, und sein Kutscher drehte sich um und rief schnalzend: «Schönes Futter!»
«Ein schönes Gut», sagte dann Ehrenthal in tiefem Nachdenken.
Unterdes saß die Baronin in einer Gartenlaube und blätterte in den neuen Journalen, welche der Buchhändler aus der nächsten Kreisstadt zugeschickt hatte. Sie betrachtete prüfend die Modekupfer und genoß die kleinen Nippes der Tagesliteratur: Geschichten von Menschen, welche auf außerordentliche Weise reich geworden, und von andern, welche auf schauderhafte Weise ermordet sind, Tigerjagden aus Ostindien, ausgegrabene Mosaikböden, rührende Schilderungen von der Treue eines Hundes, hoffnungsreiche Betrachtungen über die Unsterblichkeit der Seele, und was sonst das flüchtige Auge eleganter Damen zu fesseln vermag. Die schöne Gemahlin des Freiherrn schaukelte während des Lesens die gestickte Fußbank, ihre Seele war nur halb in den Blättern, sie sah oft über den Rasenplatz nach ihrer Tochter, welche, wieder mit dem Pony beschäftigt, diesem aus Blumen und Zeitungspapier eine groteske Halskrause und eine gehörnte Mütze zurechtmachte, was der Pony vergebens dadurch zu vereiteln suchte, daß er so viel Blüten und Zeitungspapier wegfraß, als er mit dem Maul erreichen konnte. Als die junge Dame, stolz auf ihr Werk, den Kopf nach der Laube wandte und das Auge der Mutter auf sich gerichtet sah, überließ sie das Pferd dem herzueilenden Bedienten und flog wie eine Libelle zu den Füßen der Mutter. Sie setzte sich auf die Fußbank, zog die Journale auf das Knie der Baronin und fing an, sich possenhaft mit den Herren und Damen der Modekupfer zu unterhalten. Da die Gesichter dieser Ideale, wie bekannt, den Vorzug haben, allen Menschen ähnlich zu sehen, von denen sie sich durch einzelne charakteristische Eigenheiten, durch merkwürdig kleine Lippen und zuweilen durch ein auf der Stirn oder den Wangen sitzendes Auge unterscheiden, so wurde der jungen Dame nicht schwer, zahlreiche Ähnlichkeiten mit Bekannten des Hauses aufzufinden und die Bilder danach zu behandeln. Die Mutter lächelte über die kindischen Scherze der Tochter und sagte endlich, ihre Gedanken laut fortsetzend: «Lenore, du wirst jetzt ein großes Mädchen und bist noch so sehr Kind. Wir haben dich aufwachsen lassen bei dem Unterricht der Bonne und des Kandidaten; es wird Zeit, daran zu denken, daß du etwas Ordentliches lernst, mein armes Kind.»
«Ich dachte, das Lernen sollte jetzt aufhören», antwortete Lenore schmollend.
«Deine französische Aussprache ist noch schlecht, und dein Vater will, daß du dich im Zeichnen übst, du hast Anlage dazu.»
«Ich zeichne nur Karikaturen», rief Lenore, «die sind am leichtesten, man macht eine lange Nase oder kurze Beine, und das Kerlchen sieht lächerlich aus.»
«Du sollst nicht Karikaturen zeichnen», sprach die Mutter, «das verdirbt deinen Geschmack und macht dich spöttisch.» Lenore ließ das Köpfchen hängen. «Und wer war der junge Mann, mit dem du vorhin durch den Garten gingst?» fuhr die Mutter strafend fort. «Du hast ihm die Erdbeeren des Vaters gegeben.»
«Schilt nur nicht immer, liebe Mutter», rief die Tochter errötend. «Der Fremde war ein hübscher, artiger Junge, er geht nach der Hauptstadt; er hat weder Vater noch Mutter, das tat mir leid. Und so bescheiden war er! Sei mir nicht böse», schmeichelte sie und flog an den Hals der Mutter, in deren Augen mehr Liebe als Zorn zu lesen war.
Die Mutter küßte das Kind auf den Mund und sagte gütig: «Du bist mein gutes, wildes Mädchen, suche mir jetzt den Vater, sein Kaffee wird kalt.»
Als der Freiherr in die Laube trat, noch voll von seiner Unterredung mit Ehrenthal, legte die Baronin ihre Hände in die seinen: «Oskar, ich habe Sorgen um Lenore!»
«Ist sie krank?» fragte der Vater betroffen.
«Sie ist gesund und von Herzen gut, aber sie ist kecker und ungebundener, als sich für ihre Jahre paßt.»
«Sie ist auf dem Lande aufgewachsen und eine tüchtige Dirn geworden», erwiderte der Freiherr beruhigend.
«Es fehlt ihr aber an Form und an Zartgefühl im Umgange mit Fremden», fuhr die Mutter fort. «Ich fürchte, sie ist in Gefahr, ein Original zu werden.»
«Nun, das Unglück wäre nicht so groß», sagte der Freiherr lachend.
«Es gibt kein größeres für ein Mädchen aus unserm Kreise. Was in der Gesellschaft auffällt, wird auch lächerlich; ein kleiner Zug von bizarrem Wesen kann ihre ganze Zukunft verderben. Sie muß genötigt werden, mehr auf sich zu achten, und ich fürchte, hier auf dem Lande wird sie das nicht lernen.»
«Wir sollen das Kind von uns tun, vielleicht auf Jahre, und unter fremden Menschen auf blühen lassen?» fragte der Freiherr unwillig.
«Und doch muß es sein», sagte die Baronin ernst, «und es kostet mich viel, dir das zu sagen. Sie ist unartig gegen Mädchen ihres Alters, rücksichtslos gegen Frauen und Männern gegenüber viel zu dreist. – Kannst du dir ein Mädchen von Lenorens Wesen am Hofe denken?» fragte die Baronin nach einer Pause.
Der Gemahl konnte sich das nicht denken, vielleicht deshalb nicht, weil ein Fürstenhof überhaupt nicht der Ort ist, wo schnell aufgeschossene Fräulein die Schulbücher umhertragen und Katze und Maus spielen.
«Sie wird sich ändern», warf er endlich ein.
«Sie wird sich nicht ändern», entgegnete die Baronin sanft, die Hand auf seine Schulter legend, «solange der Liebling mit seinem Vater zu Pferde über Gräben setzt und ihn sogar auf dem Pirschgang begleitet.»
«Ich kann mich nicht darein finden, beide Kinder zu entbehren», sprach der Vater gutmütig. «Das wäre sehr hart für uns, am schwersten für dich, du strenge Hausfrau.»
«Vielleicht!» sagte die Baronin leise, und ihre Augen wurden feucht. «Aber wir dürfen nicht an uns denken, nur an die Zukunft der Kinder.»
Der Freiherr sah die Bewegung der geliebten Frau, er zog sie an sich und sprach entschlossen: «Höre, Elsbeth, wenn wir in früheren Jahren von dieser Zeit sprachen, da dachten wir uns Lenorens Erziehung anders. Wir wollten die Winter über selbst in der Stadt leben, unter deinen Augen sollte das Kind den letzten Unterricht erhalten und in die Gesellschaft treten. Du sollst dich nicht von ihr trennen. Wir ziehen schon in diesem Winter nach der Hauptstadt.»
Überrascht erhob sich die Baronin. «Guter Oskar!» rief sie gerührt aus. «Aber – verzeih die Frage, würde ein solcher Aufenthalt nicht in anderer Hinsicht für dich ein großes Opfer sein?»
«Nein», sagte der Freiherr fröhlich, «ich habe Pläne, die auch für mich es wünschenswert machen, den Winter in der Stadt zuzubringen.»
Er erzählte; der Umzug nach der Hauptstadt wurde beschlossen.