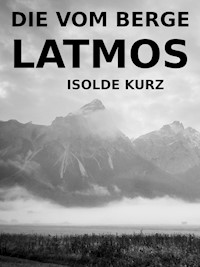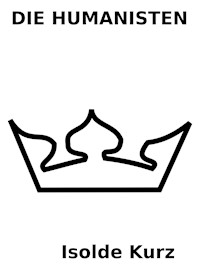Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist eine Geschichte von Liebe und Tod, die die deutsche Reisegruppe in den italienischen Bergen erfährt. In der Hitze der Hundstage haben sie sich für die Bergtour entschieden. Dem Tode nahe sehen sie die Bilder der Vergangenheit vor sich, in der eine verzweifelte Liebe zu Eifersucht und Tod geführt hatte. AUTORENPORTRÄT Isolde Kurz (1853 – 1944) war eine deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin. Ihre Kindheit nahe Stuttgart schilderte sie später als idyllisch, jedoch nicht frei von Konflikten zwischen dem freigeistigen Lebens- und Erziehungsstil ihrer Eltern und den bodenständigen Anschauungen der Dorfbevölkerung. Seit 1873 lebte sie für über 40 Jahre in Florenz. Ihre Novellen und Erzählungen spielen meist in Mittelitalien. Sie starb - 90jährig – in Tübingen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Solleone
Eine Geschichte von Liebe und Tod
Saga
Solleone
Die Geschichte, die ich erzählen will, habe ich von einem befreundeten Kunstgelehrten, der im Weltkrieg verscholl. Er war eine feinsinnige, ganz nach innen gerichtete Natur mit starker seelischer Erlebniskraft, aber schwach entwickelten Organen zur Aufnahme der Aussenwelt und besser in den Schätzen der Galerieen als im Naturleben bewandert. Wenn man mit ihm im Freien ging, musste man scharf auf die Wege achten, denn er hatte die Neigung, im Eifer des Gesprächs ganz unbewusst von der Richte abzudrängen; ging er allein, so geschah ihm leicht dasselbe, weil er sich dann in einsame Gedanken verspann. Die Vermutung liegt nahe, dass ihm diese Eigenheit im Krieg, den er schon in vorgerücktem Alter mitmachte, verhängnisvoll geworden sei. Sein Name war Martin Francke. In jungen Jahren hatte er einmal in Italien einen leichten Sonnenstich erlitten, und seitdem trat die angeborene Zerstreutheit deutlicher hervor. Die Umstände, unter denen jener Unfall sich ereignete, liessen eine tiefe Spur in seinem Leben und waren zugleich in wunderlicher Weise mit einem ihm völlig fremden Schicksal aus längst vergangenen Tagen verknüpft, auf das er mit seinem Denken immer wieder zurückkam.
Martin Francke hatte nach der Universitätszeit vorübergehend eine Hauslehrerstelle bei einer wohlhabenden Familie in Frankfurt eingenommen, wo er einen sonst gut begabten, aber in den humanistischen Fächern zurückgebliebenen jungen Menschen für die Abgangsprüfung vorbereiten musste. Seinen Zögling, dem der Name Manfred gut zu Gesichte stand, liebte er wie einen jüngeren Bruder und hat ihm zeitlebens das zärtlichste Andenken bewahrt. Denn dieser Jüngling war nach Martin Franckes Zeugnis so etwas wie eine Handarbeit Gottes inmitten der menschlichen Fabrikware, ein alleredelstes Stück deutscher Jugend. Zwischen Lehrer und Schüler war der Abstand der Jahre nicht gar zu gross, wenn auch Francke durch den Vollbart, der ihm schon in frühester Jugend gewachsen war, bei weitem älter aussah, und da ein jeder gerade das besass, was dem andern fehlte, waren sie als Freunde wie für einander geschaffen.
In dem jungen Manfred kündigte sich auf Schritt und Tritt der Naturforscher an, der er werden wollte. Er beobachtete das Tierleben, sammelte Pflanzen und Steine, und eine Landschaft war ihm ihrer Gestaltung nach beim ersten Schritte durchsichtig. Dagegen fehlte ihm der Sinn für alles Sprachgesetz, und erst als sein Hofmeister den glücklichen Einfall hatte, ihm die Sprache gleichfalls als einen lebendigen, nach ähnlichen Normen wie die Naturgebilde wachsenden Organismus zu zeigen, glückte es ihm, den Geist des Schülers zu fesseln und ihn dann auch heil an den Klippen der Matura vorüberzubringen. Zum Dank schickte die Familie Lehrer und Zögling auf eine gemeinsame Ferienreise nach Italien. Im toskanischen Apennin am Südhang des Monte Giovi lebte dem Jüngling ein italienischer Verwandter, auf dessen ländlichem Anwesen er schon als Knabe die Ferien zu verbringen pflegte. Bei diesem sollte er sich samt dem miteingeladenen Lehrer von den Mühen der Studierstube erholen. Als die Mutter dem älteren Freunde beim Abschied empfahl, auf seinen Zögling gut achtzuhaben, dass ihm nichts zustosse, fügte der Vater lachend hinzu:
Und du, Manfred, gib gut acht auf deinen Mentor, dass auch ihm nichts zustösst.
Das war eine berechtigte Mahnung, denn der Schüler war der lebensgewandtere von beiden, dabei schlank und schön wie ein Olympiasieger, mit Muskeln, die hart und straff waren wie Holz, während der Lehrer schwächer gebaut und nur für geistige Anstrengungen gestählt war, ausserdem, wie schon gesagt, in äusseren Dingen ein wenig ungeschickt.
Den beiden schloss sich als dritter Reisekamerad noch ein Studienfreund Martin Franckes an, der Archäologe Dr. Karl Johannsen, der einige Jahre später bei den Ausgrabungen auf Kreta starb. Ihm zuliebe machten die Freunde einen starken Umweg und durchwanderten zu Fuss das Umbrische und einen Teil des Toskanischen auf den Spuren der Etrusker. Manfred ruhte nicht, bis die beiden Älteren ihr kleines Gepäck mit in seinen Rucksack steckten, der schon den eigenen Reisebedarf nebst einem Kodak enthielt, und unter diesem Ballast, den er noch durch mineralogische Funde vermehrte, marschierte er auch bei der Hitze Leichtfüssig weg, ohne ihn zu spüren. Seine Gesellschaft kam den zwei anderen wohl zustatten, denn er sprach fliessend das Italienische, und seiner munteren Liebenswürdigkeit und glücklichen Erscheinung öffneten sich alle Türen, auch fiel, wohin sie kamen, die Nachtherberge annehmbar und die Zeche billig aus.
Als sie den Consumapass überschritten hatten und Johannsen sich von den andern trennen wollte, um über Florenz die Heimreise anzutreten, liess Manfred es durchaus nicht zu. Sein Verwandter sei der gastfreundlichste Mann von der Welt, er liege ordentlich auf der Lauer, um Fussreisende abzufangen und auf sein Gut zu schleppen, wo er oft monatelang gebildeten Umgang entbehre. Herr Parga würde sich für persönlich geschädigt halten, wenn ein Fremder von Belang in seiner Nähe vorbeigereist wäre, ohne bei ihm einzutreten. Und übrigens habe er, Manfred, bereits den dritten Gast angekündigt. Der also Genötigte liess es sich gern gefallen, und des anderen Morgens brachen die drei wohlgemut nach dem Monte Giovi auf. Nur dass unglücklicherweise die Stunde des Abmarsches durch einen ländlichen Schuster von Pontassieve verzögert worden war, der einem der Wanderer die zerrissene Sohle auszubessern hatte.
Man trat soeben in die Hundstage, die der Italiener Solleone, Löwensonne, nennt, nicht weil, wie das Landvolk meint, die Sonne alsdann Löwenstärke hat, sondern um ihren Stand im Tierkreis zu bezeichnen; doch ein leichtbedeckter Himmel stellte angenehmes Marschwetter in Aussicht. Niemand konnte erwarten, dass dies der heisseste Tag des Jahrhunderts werden würde, wie man später festgestellt hat.
Wie eine Sphinx mit vorgeschobenem Oberleib kauerte der Berg vor ihnen, den eine bestrittene Überlieferung mit dem alten Jupiterkult in Verbindung bringt. Seine tiefzerklüfteten Flanken glichen ungeheuren versteinten Wellen und waren bis zu halber Höhe mit niedrigem Baumwuchs bedeckt. Und wie nun einmal alles, was mit dem klassischen Altertum zusammenhängt, die Seele des Gebildeten in stärkere Schwingung versetzt, glaubten die beiden angehenden Gelehrten sich dem Sitze des Göttervaters zu nähern, obgleich ihr nüchterner junger Kamerad versicherte, dass der Monte Giovi sich weder durch antike Baureste noch durch alte Ortssagen vor den anderen Apenninenhäuptern auszeichne. Bald war der lange schmale Grat mit Kreuz und Kirchlein nicht mehr zu sehen, denn das Felsgebäu des Unterstocks hing schwer über die Wanderer herein und liess von der Glut des nahenden Mittags einen beschwerlichen Aufstieg fürchten. Dr. Johannsen seufzte und stöhnte, er war ein Koloss auf tönernen Füssen, denn ein zu schwach geratenes Beingerüst hatte bei ihm die Last eines allzuschweren Oberkörpers zu tragen. Aber unvermutet kam auf holprigem Fahrweg, der sich neben dem Fusssteig, doch nicht so jäh wie dieser, zu Tale stürzte, ein mächtiges Gespann weisser toskanischer Ochsen im Schmuck ihrer roten Troddeln in Sicht, behäbigen Schrittes ein abenteuerliches Fuhrwerk hinter sich herschleppend. Manfred schrie vor Vergnügen laut auf und pfiff durch die Hände, worauf ihm ein gleicher Pfiff und ein Knallen mit der Peitsche antwortete.
Bist du’s, Dario? rief er dem jungen Bauern zu, der das Leitseil hielt, worauf ein fröhliches Gnorsì (Ja, Herr) antwortete.
Das dacht ich mir gleich, sagte er dann zu den zwei andern, der alte Herr schickt uns seine Staatskarosse entgegen, diese Aufmerksamkeit liess er sich natürlich nicht nehmen.
Die beiden anderen umgingen und bestaunten das seltsame Gefährt. Auf einem hölzernen Schlitten oder Bergschleife war ein länglich viereckiger Weidenkorb befestigt, in dem drei Stühle bereit standen, und Manfred erklärte den Reisegenossen, dass alle ansässigen Herrschaften sich solcher Equipagen bedienten, weil der Zustand der höheren Feldstrassen und ihre grosse Steile das Fahren mit Rädern erschwere. Dieses Fuhrwerk war übrigens nicht allein zur Bequemlichkeit der Reisenden gekommen, sondern hatte vor allem aus einer am Berge klebenden Ortschaft den Mundbedarf der Gäste heraufzuschaffen, wie eine mächtige in Tücher und Blätter gehüllte Ochsenrippe und eine ebensolche Hammelkeule verrieten. Die Stühle waren nur mitgeschickt, damit der eine oder der andere der Herren „Alpinisten“, wie der Bauer sich schmeichelhaft ausdrückte, im Notfall davon Gebrauch machen konnte.
Betrachten wir dieses Gespann mit Ehrfurcht, sagte der bärtige Mentor: mit solchen grossen weissen, troddelumbaumelten Ochsen sind gewiss schon die Urahnen dieses jungen Landmanns ausgefahren, um auf der Spitze des heiligen Berges dem Göttervater zu opfern.
Und von der klassischen Erinnerung angefeuert, kletterte er eilig über die Deichsel in den Wagenkorb. Die beiden andern folgten, der schwarzäugige Bursche, in dem Manfred einen ehemaligen Spielkameraden wiedergefunden hatte, nahm das Leitseil zur Hand, und nun ging es unter Via! und Va-n-là! bergan.
Nach tausend Schritten fühlten sich die zwei Neulinge an allen Knochen zerschlagen, und Manfred, der schon nach einer Minute wieder herausgesprungen war, sah ihnen lachend zu, wie sie sich samt dem Sitz mühsam an Bord hielten, denn solange es steil hinaufging, mussten sie darauf achten, nicht nach rückwärts mit dem Stuhl hinauszurutschen, und bei einer plötzlichen Senkung des Weges waren sie in Gefahr vornüberzukippen. Er selber ging mit seinem Rucksack, den er nur um die Gepäckstücke der Freunde erleichtert hatte, aber durchaus nicht ablegen wollte, lustig daneben. Er freute sich diebisch, so oft die Cibea – so nannte sich jenes urtümlichste aller Fuhrwerke – das eine Mal mitten durch ein Loch rutschte, wobei der eingedickte Schlamm aufspritzte, das andere Mal über einen Steinbrocken weg musste, der breit im Wege lag. Die Ochsen nahmen jedes Hindernis mit unerschütterlicher Gelassenheit und trugen ihre Last sicher an den Abstürzen hin. Aber die Reisenden wurden unzählige Male mit ihren Stühlen gegen den Rand der Cibea geschleudert und rieben sich bei jedem Stoss schmerzhaft die Kniee. Martin Francke ertrug es nicht länger, er kletterte gleichfalls aus dem Marterstühlchen und nahm den Weg unter die Füsse, nur Johannsen erklärte, es sei eine heilige Lebensregel, niemals zu Fusse zu gehen, wo man auch nur zum schlechtesten Fahren Gelegenheit habe, und um seinem Widerspruch Nachdruck zu geben, spannte er den ländlichen grünen Riesenschirm auf, unter dem er sich wie unter einem Baldachin zurechtsetzte.