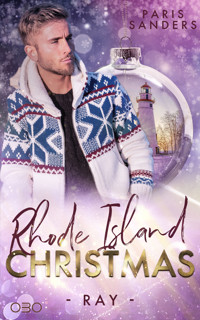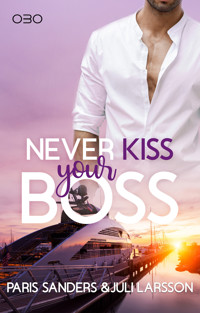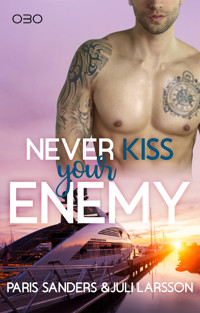9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Obo e-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hol dir 3 Liebesromane in einem Bundle der Erfolgsautorinnen Paris Sanders und Juli Larsson. Klappentext - Never kiss your Boss Tyler Norman ist so heiß, dass ich mir garantiert die Finger an ihm verbrennen würde … wenn ich etwas mit ihm anfangen wollte, was nicht der Fall ist. Mein Mantra lautet: Never Kiss your Boss. Leider muss ich es momentan täglich aufsagen, oder eher stündlich, denn ich arbeite bei ihm als Taucherin. Das bedeutet, dass ich auf seiner Yacht lebe und da kann man sich einfach nicht aus dem Weg gehen. Dann schlägt auch noch Tylers Mutter vor, ich solle seine Fake-Verlobte spielen. Ich bin so dämlich und stimme zu. Tja, jetzt kreist dieses Mantra ständig durch meinen Kopf, aber die Anziehungskraft wird immer stärker … Bücher 1 bis 3 der "Never Kiss" Reihe von Paris Sanders und Juli Larsson. WICHTIGER HINWEIS: Komplett überarbeitete Neuauflage der "Treasure Hunters" Reihe, die die Autorinnen unter dem gemeinsamen Pseudonym Jana Reeds geschrieben haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 964
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
SOMMERKÜSSE IN CADIZ
3 IN 1 BUNDLE DER “NEVER KISS” REIHE
PARIS SANDERS
JULI LARSSON
IMPRESSUM
Nachdruck, Vervielfältigung und Veröffentlichung - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages!
Im Buch vorkommende Personen und Handlung dieser Geschichte sind frei erfunden und jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen ist zufällig und nicht beabsichtigt.
Copyright © 2024 dieser Ausgabe Obo e-Books Verlag,
alle Rechte vorbehalten.
ist ein Label der
OBO Management Ltd.
36, St Dminka Street
Victoria, Gozo
VCT 9030 Malta
INHALT
Never kiss your Boss
1. Tyler
2. Lou
3. Tyler
4. Lou
5. Tyler
6. Lou
7. Tyler
8. Lou
9. Tyler
10. Lou
11. Tyler
12. Lou
13. Tyler
14. Lou
15. Tyler
16. Lou
17. Tyler
18. Lou
19. Tyler
20. Lou
21. Tyler
22. Lou
23. Tyler
24. Lou
25. Tyler
26. Lou
27. Tyler
28. Lou
29. Lou
30. Tyler
31. Lou
32. Tyler
33. Lou
34. Tyler
35. Lou
36. Tyler
37. Lou
38. Tyler
39. Lou
40. Tyler
41. Tyler
Epilog
Never kiss your best Friend
1. Dylan
2. Marli
3. Dylan
4. Marli
5. Dylan
6. Marli
7. Dylan
8. Marli
9. Dylan
10. Marli
11. Dylan
12. Marli
13. Dylan
14. Marli
15. Dylan
16. Marli
17. Dylan
18. Marli
19. Dylan
20. Marli
21. Dylan
22. Marli
23. Dylan
24. Marli
25. Dylan
26. Marli
27. Dylan
28. Marli
29. Dylan
30. Marli
31. Dylan
32. Marli
33. Dylan
34. Marli
35. Dylan
36. Marli
37. Dylan
38. Marli
39. Dylan
40. Marli
Never kiss your Enemy
1. Carmen
2. Juan
3. Carmen
4. Juan
5. Carmen
6. Juan
7. Carmen
8. Juan
9. Carmen
10. Juan
11. Carmen
12. Juan
13. Carmen
14. Juan
15. Carmen
16. Juan
17. Carmen
18. Juan
19. Carmen
20. Juan
21. Carmen
22. Juan
23. Carmen
24. Juan
25. Carmen
26. Juan
27. Carmen
28. Juan
29. Carmen
30. Juan
31. Carmen
32. Juan
33. Carmen
34. Juan
35. Carmen
36. Juan
37. Carmen
38. Juan
39. Carmen
40. Juan
41. Carmen
42. Juan
Epilog
OBO e-Books
NEVER KISS YOUR BOSS
TYLER
Die Kleine in dem knappen, roten Bikini sah verdammt gut aus. Ich hob meine Sonnenbrille an, um genauer hinzusehen. Tolle Kurven, leicht gebräunte Haut und Brüste, die mit den kleinen dreieckigen Stofffetzen nur notdürftig bedeckt wurden. Sie warf einen Blick über ihre Schulter, schaute mich an und lächelte. Es war nicht der erste Blickkontakt, den wir hatten. Ich wollte mich gerade aus meinem Liegestuhl erheben, zu ihr gehen und sie fragen, ob sie Lust hatte, mit mir einen Drink zu kippen, als eine tiefe Stimme Fantasien unterbrach, die nichts mehr mit einem Getränk, dafür sehr viel mit nackter Haut und zerwühlten Laken zu tun hatten.
„Mr. Norman.“ Ein Schatten schob sich vor die Sonne. Genauer gesagt der Schatten von Morris, dem Butler meiner Eltern. Ich kannte Morris schon, seit ich ein fünf Jahre alter Bengel war und Sandburgen baute. Ich hatte Respekt vor ihm, was wahrscheinlich daran lag, dass er mich mehr als einmal aus dem Meer fischen musste. Als Kind hatte ich mich bei jedem Seegang ins Wasser gestürzt, egal, wie gefährlich es war. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er immer geradeheraus das sagte, was er meinte, ohne Rücksicht darauf, mit wem er es zu tun hatte.
„Ja, was ist, Morris?“ Ich konnte mir denken, warum er hier war. Ich fragte nur, um Zeit zu schinden, was blöd war, aber … egal. Der Grund seines Hierseins hatte garantiert nichts mit den Badeschönheiten zu tun, die sich am Meer tummelten, sondern mit der Tatsache, dass ich mich schon seit Wochen nicht mehr bei meiner Mutter hatte blicken lassen. Ich vermied Besuche in meinem Elternhaus, seit mein Vater vor drei Monaten überraschend an einem Herzinfarkt gestorben war.
„Mrs. Norman hätte gern mit Ihnen gesprochen. Es ist wichtig. Ganz davon abgesehen sollten Sie Ihre Mutter eindeutig mal wieder mit einem Besuch beehren.“ Ein stahlharter Blick aus grauen Augen traf mich. Obwohl Morris in einem dunkelblauen Anzug vor mir im Sand stand, inmitten nur wenig bekleideter Sonnenanbeter, verlor er nichts von seiner imposanten Erscheinung. Keine Ahnung, wie der Mann das anstellte, aber er schaffte es immer, eine Aura der Autorität und stoischen Ruhe um sich zu verbreiten.
„Ich weiß.“ Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Alles in der Bemühung, so zu tun, als würde mich Morris nicht wie einen kleinen Jungen fühlen lassen, der seine Suppe nicht aufgegessen hatte. „Ich habe im Moment viel zu tun“, fügte ich hinzu.
Die Aussage traf auf Schweigen. Der Blick aus den stahlgrauen Augen wurde noch durchdringender.
„Oh, okay. Sie wissen genau, warum ich mein Elternhaus meide. Warum schauen Sie mich so an?“
„Vor seinen Gefühlen davonzulaufen, hat noch nie etwas Gutes gebracht.“
„Mag sein, aber wenigstens werden keine schmerzhaften Erinnerungen wachgerufen, wenn ich hier am Strand liege.“
Statt einer Antwort verschränkte Morris die Arme vor der Brust. Noch immer sah er mir in die Augen. Ich wusste schon jetzt, wer als Erster wegschauen würde. „Na gut, ich komme.“
„Wann?“
Verdammt. Der Mann kannte mich zu gut.
„Am Wochenende.“
Morris zog die Augenbrauen hoch.
„Okay, okay. Morgen Mittag zum Lunch.“
Keine Bewegung. Nicht einmal ein Nicken.
„Also gut. Heute Abend.“
Morris drehte sich um. „Achtzehn Uhr. Seien Sie pünktlich.“
* * *
Obwohl Fisher Island nur drei Meilen vom Miami South Pointe Park entfernt ist – im Grunde hätte ich meiner Mutter zuwinken können, als ich dort am Strand saß –, dauerte es mit dem Auto etwa eine Dreiviertelstunde, bis ich dort war. Von dieser Zeit verbrachte ich den größten Teil auf der privaten Fähre, auf der nur Besucher und Bewohner von Fisher Island zugelassen sind. Aber das war nicht weiter schlimm, ich genoss die langsame Fahrt über den schmalen Wasserstreifen, der zu der kleinen Insel führte. Auf Fisher Island zu wohnen, bedeutete, dass man Geld hatte. Verdammt viel Geld.
Ich wuchs dort auf und verbrachte die meiste Zeit meines Lebens im oder auf dem Wasser. Jetski, Surfen, Tauchen, Segeln, Schwimmen. Egal, was es war, solange es was mit dem Meer zu tun hatte, war ich dabei.
Die Fähre legte langsam an und ich fuhr hinunter. Eine Meile noch, dann passierte ich das große eiserne Tor, das vor mir aufschwang. Morris hatte recht. Ich war schon zu lange nicht mehr hier gewesen. Seit dem Tod meines Vaters hatte ich mich mit meiner Mutter fast nur noch in Restaurants getroffen. Oder im Country Club. Hauptsache, ich musste nicht nach Hause und die Räume betreten, die so viele Erinnerungen an meinen Vater bargen … und an unsere letzte Begegnung.
Ich stellte den Motor ab und blieb für einen Augenblick sitzen, atmete tief durch. Dann erst öffnete ich die Fahrertür und stieg aus. Vor mir erhob sich der dreistöckige Bau. Eine weiß gestrichene Fassade, jede Menge Rundbögen. Alles sah aus wie immer. Die Auffahrt gesäumt von einem gepflegten Rasen, Palmen und Zitrusbäumen. Der Duft von Orangen lag in der Luft. Für mich bedeutete dieser Geruch, dass ich zu Hause war. Meine Mutter stammte aus Orlando, sie war in der Nähe der riesigen Orangenplantagen, die man in diesem Teil von Florida findet, aufgewachsen und hatte ein Stück ihrer Heimat mit nach Fisher Island gebracht.
Ich öffnete die Haustür mit meinem Schlüssel und trat ein, der helle Marmor der Eingangshalle glänzte, als sei er gerade eben poliert worden. Und so wie ich Giselle, die Haushälterin meiner Eltern, kannte, war genau das der Fall.
Ich schluckte. Dass der alte Mann tot war, konnte ich noch immer nicht glauben. Noch weniger wollte ich daran erinnert werden. Zum Glück hörte ich eilige Schritte auf mich zukommen, dann betrat meine Mutter die Eingangshalle.
„Tyler, da bist du ja!“ Sie umarmte mich, dann trat sie einen Schritt zurück. „Wie geht es dir?“, fragte sie mich mit leiser Stimme.
„Gut. Es geht mir gut.“ Ich räusperte mich. „Es tut gut, wieder hier zu sein“, sagte ich dann. Es war nicht einmal eine Lüge – oder zumindest keine allzu große Lüge. Es war gut, wieder in meinem Elternhaus zu sein.
„Schön!“ Mutter lächelte mich an. In ihren Augen lag noch die Traurigkeit, deren Anblick mir in den letzten Wochen so vertraut geworden war. Der plötzliche Tod meines Vaters war nicht nur für mich ein schwerer Schlag gewesen.
„Du bist ganz zerzaust.“ Sanft strich sie mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht, dann richtete sie meinen Hemdkragen. „So“, sagte sie zufrieden, „jetzt siehst du schon wieder etwas präsentabler aus.“
Ich grinste sie an. „Die Frauen mögen diesen zerzausten Look.“
„Das kann sein, aber ich bin deine Mutter.“ Wieder stahl sich dieses Lächeln, das nicht ganz ihre Augen erreichte, auf ihr Gesicht. „Ich dachte, wir essen erst und dann … Es gibt da etwas, was dein Vater dir zeigen wollte, kurz bevor er …“ Sie brach ab. In ihren Augen schimmerten Tränen. „Lass uns ins Esszimmer gehen. Giselle hat Penne arrabbiata gemacht. Sehr scharf, so wie du sie am liebsten magst. Komm.“ Sie drehte sich um und ging voraus, ihre Absätze klapperten auf dem Marmor. Der Klang gehörte ebenso zu meiner Kindheit wie der Duft von Orangenbäumen.
Meine Mutter führte mich ins Esszimmer. Jetzt, im Hochsommer, war es zu heiß, um auf der Terrasse zu sitzen. Sonnenlicht strömte durch die großen Flügeltüren, die Klimaanlage surrte leise und sorgte dafür, dass in dem Raum eine angenehm kühle Temperatur herrschte.
Der Tisch im Esszimmer war wie immer makellos gedeckt mit einer blütenweißen Tischdecke, teurem Porzellan und Kristallgläsern. Giselle kam und trug das Essen auf, kaum dass wir uns gesetzt hatten. Meine Mutter hob ihr Weinglas und prostete mir zu.
„Auf uns und …“ Sie schluckte. „Ich bin froh, dass du gekommen bist. Walter hätte nicht gewollt, dass dir eure letzte Begegnung so viel Trauer bereitet. Er wollte …“ Wieder schluckte sie. Ich konnte ihr förmlich ansehen, dass sie ihre Tränen zurückhalten musste. „Er war so aufgeregt in den Tagen kurz vor seinem Ableben. Er erzählte mir immer wieder, er hätte etwas entdeckt. Etwas, was genau das sei, was du … Er hat ein Projekt geplant, das er mit dir gemeinsam umsetzen wollte und … Entschuldige.“ Sie hob ihre Serviette und tupfte ihre Augen ab. „Ich habe dir die Unterlagen, an denen er gearbeitet hat, ins Arbeitszimmer gelegt. Du solltest dir das mal anschauen.“
„Worum geht es denn?“
„Das findest du am besten selbst heraus. Aber ich glaube, er hatte recht. Ich glaube, du wirst verstehen, was er meinte und warum er so begeistert war.“
„Du machst es ja ziemlich spannend.“
„Ja, nicht wahr? Aber jetzt lass uns essen, bevor alles kalt wird, sonst schimpft Giselle mit uns.“
* * *
Eine Stunde später stand ich im Büro meines Vaters im ersten Stock. Der Raum war genau so eingerichtet, wie man es von einem Mann vermuten würde. Schwere Mahagoni-Möbel, dick gepolsterte lederne Sessel. Nicht mal der Kamin fehlte, und das, obwohl er in Florida höchstens im Januar oder Februar benutzt wurde. Die Wand gegenüber der Tür wurde vollkommen von einem Bücherregal in Anspruch genommen. Hier bewahrte mein Vater die kostbaren Erstausgaben auf, die er im Laufe seines Lebens erworben hatte. Werke von Hemingway, Faulkner, Edgar Allan Poe fanden sich hier ebenso wie die von James Fenimore Cooper oder Margaret Mitchell. Mein Vater hatte nicht nur einen vielfältigen Literaturgeschmack, sondern war schon immer jemand gewesen, der sich mit den unterschiedlichsten Themen beschäftigte.
Vorsichtig näherte ich mich seinem Schreibtisch. Ich konnte mich nur zu gut an unsere letzte Begegnung erinnern, und diese war nicht gerade harmonisch verlaufen. Ich hatte in dem Sessel vor dem Schreibtisch gesessen, mein Vater mir gegenüber. In der Hand ein Glas Whiskey, denn es war bereits spät am Abend. Ich hatte auf Alkohol verzichtet, ich musste noch nach Hause fahren.
Wir redeten zuerst ganz entspannt, doch irgendwann kam das Thema auf meine fehlende Berufswahl. Mein Vater nahm einen Schluck von seinem Whiskey und knallte dann das Glas auf den Tisch.
„Es wird Zeit, dass du etwas mit deinem Leben anfängst. Verantwortung übernimmst und, verdammt noch mal, arbeitest!“
Natürlich reagierte ich genervt. Es war nicht das erste Mal, dass wir diese Unterredung führten.
Ich weiß noch, dass ich „Ja, ja“ murmelte.
„Nur weil du es finanziell nicht nötig hast, Geld zu verdienen, heißt das noch lange nicht, dass du dein Playboy-Dasein nicht aufgeben solltest“, ereiferte sich mein Vater.
„Ich denke drüber nach“, entgegnete ich damals ohne wirkliche Überzeugung. Ich wollte ihn nur besänftigen, damit ich mir nicht eine weitere seiner Tiraden anhören musste. Kurz darauf war das Thema beendet und mein Vater frustriert. Er war enttäuscht von mir. Zu diesem Zeitpunkt machte es mir nicht allzu viel aus. Ich hatte geglaubt, noch genügend Zeit zu haben, um ihm zu beweisen, aus welchem Holz ich geschnitzt war. Ich dachte, ich könnte noch ein, zwei Jahre das gute Leben genießen und dann voll ins Berufsleben einsteigen. Ich hatte sogar Pläne dafür gemacht …
Jetzt war Dad tot. Gestorben in dem Wissen, einen nichtsnutzigen Sohn in die Welt gesetzt zu haben, der außer etlichen Frauengeschichten nichts vorzuweisen hatte.
Ich umrundete den Schreibtisch und nahm im Schreibtischsessel meines Vaters Platz. Es fühlte sich seltsam an, auf dieser Seite des Tisches zu sitzen. Falsch irgendwie.
Die Tischplatte glänzte, als sei sie gerade erst poliert worden. Das Holz schimmerte in einem satten Dunkelbraun, durchzogen mit dunklen Rottönen. Der Computerbildschirm befand sich links von mir. Vor mir nur das teure Schreibtischset mit dem goldenen Füllfederhalter und einigen messerscharf gespitzten Bleistiften. Auf der ledernen Schreibtischmatte lag ein schmaler Ordner. Ich öffnete ihn. Hierin fand ich die Unterlagen, die mein Vater mir hatte zeigen wollen. Das Projekt, das ihm laut meiner Mutter so sehr am Herzen gelegen hatte, dass er nächtelang in seinem Arbeitszimmer gesessen und Dokumente studiert hatte.
Aufmerksam las ich die Schriftstücke, die mein Vater gesammelt hatte. Einige davon in Spanisch verfasst, was mir zum Glück keine Schwierigkeiten bereitete. Ich sprach es fließend – dank einiger Freunde, die meinen Eltern stets ein Dorn im Auge gewesen waren.
Als ich mit der Durchsicht fertig war, blieb ich auf der letzten Seite hängen. Dad hatte ein Diagramm gemalt. Ein Organisationsschema. Ganz oben erkannte ich meinen Namen, darunter hatte er Leute aufgelistet, die wir brauchen würden, um sein Vorhaben durchzuführen. Meist stand dort die Jobbeschreibung wie Kapitän oder Taucher. Neben einigen dieser Bezeichnungen hatte er handschriftlich bereits Namen eingefügt.
Ich schloss den Ordner und lehnte mich zurück. Nichts in dem Gespräch mit meiner Mutter hatte mich auf das vorbereitet, was ich gefunden hatte. Aber mein Vater hatte recht, zum ersten Mal in meinem Leben war ich bereit, an einem seiner Projekte teilzunehmen. Und „bereit“ war nicht einmal das richtige Wort dafür, ich konnte es nicht erwarten, mit der Arbeit zu beginnen.
LOU
In Momenten wie diesem war mein Leben einfach nur perfekt.
Ich spürte, wie das Glücksgefühl durch meinen Körper floss, und es fühlte sich an, als wären kleine Blubberblasen in meinem Bauch – ähnlich denen, die vom Mundstück des Sauerstoffgeräts aufstiegen.
Im schummerigen Halbdunkel schaute ich mich um, prüfte, ob einer der Gruppenteilnehmer meine Hilfe brauchte. Heute war es nur eine kleine Truppe, bloß vier Leute waren mit mir auf Tauchgang, und sie alle konnten bereits jahrelange Erfahrung vorweisen und wussten, was sie hier taten. Ich entdeckte das Pärchen, Sue und Michael aus Atlanta. Die beiden kamen jedes Jahr um diese Zeit auf die Keys, um die Riffs und Wracks zu erforschen. Sie zählten zu den wenigen Stammkunden, die die Tauchschule vorweisen konnte. Wild gestikulierend deutete Sue auf einen Schwarm Doktorfische, der sich an der Heckseite des alten Schiffes tummelte. Sofort zückte ihr Mann die Unterwasserkamera, um Fotos zu schießen.
Ich schwamm an der Backbordseite der Benwood entlang, ließ meinen Blick über das zerschossene Heck gleiten, das nach den vielen Jahrzehnten, die das Wrack hier unten lag, von Algen und Korallen überwuchert war.
1942 sank das Schiff vor der Küste Key Largos und diente seitdem als beliebter Ausflugs- und Erkundungspunkt für Taucher. Während ich langsam weiter in Richtung Bug schwamm, entdeckte ich aus dem Augenwinkel eine große Schildkröte. Ich schaute mich um zu diesem wunderschönen Tier. So unbeholfen Schildkröten an Land auch wirkten, im Wasser bewegten sie sich leicht, ja, fast schon majestätisch. Die Schildkröte kam so nah, dass ich nur die Hand auszustrecken brauchte, um sie zu berühren. Die Tiere kannten hier keine Angst vor den Menschen, sie waren an deren Gesellschaft gewöhnt und es herrschte eine Art gegenseitiger Respekt. Wer hier tauchte, dem lag das Wohl der bunten Fische, der Schildkröten und ja, auch der seltener auftauchenden Haie am Herzen. Taucher wussten, sie waren nur zu Gast in dieser einzigartigen Welt. Sie gehörten für eine Weile dazu, doch dann mussten sie diese Welt verlassen und in ihre eigene zurückkehren.
Meine innere Uhr sagte mir, dass es allmählich Zeit wurde, meine Gruppe wieder an die Oberfläche zu führen. Bereits seit einer Stunde schwammen wir im warmen Wasser und erkundeten das Schiffswrack.
Während die Schildkröte weiterzog, kehrte ich zurück zu dem Punkt, an dem ich Sue und Michael beim Fotografieren des Fischschwarms zurückgelassen hatte. Kurz nach mir kamen auch Steve und Daniel an unserem Treffpunkt an, und ich erkannte an den strahlenden Augen, dass der Tauchgang für meine Gäste ein voller Erfolg war.
Ich gab das Zeichen zum Auftauchen und langsam machten wir uns auf den Weg an die Wasseroberfläche.
Wie jedes Mal, wenn ich einen Tauchgang beendete, schwang ein wenig Wehmut mit. Wehmut darüber, diese Welt, in der ich mich von klein auf zu Hause fühlte, verlassen zu müssen.
Ich warf einen Blick zurück auf das Wrack der Benwood, auf die unzähligen Fische, die sich dort tummelten. Ich wusste, in wenigen Tagen würde ich wiederkehren und die nächste Gruppe Taucher zu diesem wunderschönen Ort führen. Ich würde ihre Begeisterung durch die Tauchermasken erkennen können und die Faszination, die auch mich jedes Mal erfasste – vollkommen egal, wie oft ich hier herunterkam. Ich kannte die Riffs und Wracks vor Key Largo wie meine Westentasche, sie waren seit meiner Kindheit mein zweites Zuhause. Meine Mom hatte immer gescherzt, dass ich irgendwann mit Kiemen und Schwimmhäuten aufwachen würde. Manchmal tat sie so, als wolle sie kontrollieren, ob ich nicht langsam selbst zum Fisch wurde. Dann kitzelte sie mich am Hals und an den Füßen, bis ich vor Vergnügen kreischte, während sie mir vormachte, nach Kiemen und Schwimmhäuten zu suchen.
Die Erinnerung an meine Mom ließ meinen Brustkorb eng werden, und ich schloss für eine Sekunde die Augen, um mich wieder zu besinnen. Ich hatte einen Job zu erledigen, ich durfte mich nicht von den Erinnerungen und Gefühlen mitreißen lassen. Nicht jetzt … Nicht, solange ich für meine Tauchgruppe verantwortlich war.
„Ihr wart ganz schön lange unten“, murmelte Dylan, als er mir die Hand entgegenstreckte, um mir über die Leiter an Bord zu helfen.
„Ich war genau im Zeitplan“, gab ich zurück, zuckte mit den Schultern und fing an, mich aus dem dünnen Neoprenanzug zu pellen. Ich hörte das aufgeregte Geplapper der Tauchgäste, die sich bereits gegenseitig erzählten, was sie alles im und um das Wrack herum entdeckt hatten.
Mein Bruder hingegen warf mir nur missmutige Blicke zu. Ich wusste genau, sein Problem war nicht, dass ich zu lange unten gewesen wäre – denn das war ich nicht. Seine Sorge galt einzig und allein mir.
„Du weißt, ich mag es nicht, wenn du die Zeit so ausreizt.“ Noch immer wirkte sein Blick düster.
„Ich hab dich auch lieb, Dylan“, antwortete ich, ging auf die Zehenspitzen und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
„Bah! Du bist nass. Kannst du dich vielleicht erst mal trocken legen? Ich hab keine Wechselklamotten dabei.“
Ich rollte gut sichtbar mit den Augen und grinste meinen Bruder an. „Wenn ich mich erst abtrockne, macht es aber nicht halb so viel Spaß, dich zu ärgern.“
Nun löste sich Dylans finstere Miene auf und er schüttelte lächelnd den Kopf. „Wann wirst du endlich erwachsen?“, fragte er.
Ich zuckte mit den Schultern. „Erwachsenwerden ist langweilig. Außerdem bist du bereits erwachsen für zwei.“ Damit wandte ich mich der Tauchgruppe zu, die sich inzwischen von ihren Neoprenanzügen befreit hatten und nur in Badekleidung am Heck unseres Bootes die Sonne genossen. „Na, habt ihr ein paar ordentliche Fotos machen können?“, fragte ich und ließ mich neben Sue auf eine Bank sinken. Ich zog die große Kühlbox hervor und verteilte gekühlte Wasserflaschen, während Dylan im Führerhaus den Motor anließ, um uns zurück zum Ufer zu bringen.
„Hast du die grüne Muräne gesehen?“, fragte Steve und Michael ergänzte: „Die war riesig! Ich hatte ja kurz ein wenig Schiss, dass wir sie gestört haben könnten. Mit Muränen ist nicht zu spaßen, wenn die sauer werden.“
„Ach, so schlimm ist es nicht. Die sind es ja gewohnt, dass wir um sie herumschwimmen, und solange du nicht versuchst, in ihre Höhle einzudringen …“
Daniels Augen wurden groß. „Um Himmels willen! Wer würde denn auf so eine Idee kommen?“
Ich warf ihm nur einen bedeutsamen Blick zu – wenn er wüsste, auf was für unmögliche Ideen manche Leute so kamen. Dann wandte ich mich an Michael, der sich neben mich setzte und mir auf dem Display der Kamera die Fotos zeigte, die er geschossen hatte.
„Schau mal, Lou. Heute war echt viel los dort unten. Lippfische, Tüpfel-Ritterfisch, Büschelbarsche … Und da – ich hab sogar einen Rochen drauf bekommen. Wahnsinn, wie elegant der aussieht. Ein bisschen, als würde er fliegen … So schwerelos.“
„Na ja, das ist man ja auch unter Wasser“, warf seine Frau lachend ein.
Allmählich kam das Ufer Key Largos in Sicht, in wenigen Minuten legten wir an. Die Sonne senkte sich langsam dem Horizont entgegen und würde in anderthalb Stunden auf der anderen Seite des Keys untergehen. Mein Feierabend nahte und damit endete die Zeit, in der ich mich ablenken konnte. In der ich meine Erinnerungen verdrängen und mich dem widmen konnte, wofür ich lebte – meinem Job, der Tauchschule und der magischen Unterwasserwelt.
* * *
Ich zog die Flipflops aus und ließ sie an den Riemen von meinen Fingern baumeln, als ich eine gute Stunde später auf den Strand trat. Der Sand war noch warm von der Sonne des Tages, und ich genoss es, meine Füße darin zu vergraben. Nur ein paar Meter vom Flutsaum entfernt ließ ich mich fallen, zog die Beine an und legte die überkreuzten Arme darauf ab. Ich schaute hinaus aufs Meer, auf den Himmel, der am Horizont in den unterschiedlichsten Rottönen schimmerte, auf die Sonne, die glühend unterging. Mit jeder Minute, die verstrich, wurde es ein wenig dunkler um mich herum. Noch schaffte ich es nicht, die Erinnerungen zuzulassen, und lenkte meine Gedanken zurück auf den heutigen Ausflug. Auf meine Arbeit, auf die Termine, die vor mir lagen, und darauf, was ich noch alles im Büro zu erledigen hatte.
„Was mache ich hier eigentlich?“, fragte ich mich selbst leise, nahm eine Handvoll Sand auf und ließ ihn langsam durch meine Finger rieseln. Während ich zuschaute, wie die winzigen Körnchen zurück auf den Strand fielen, spürte ich, wie sich etwas in mir bewegte. Mein Kopf wurde still … Alle Ablenkung verschwand, und ich kam dort an, wo ich hinwollte – und wovor ich mich gleichermaßen fürchtete.
„Zehn Jahre … Heute vor zehn Jahren“, murmelte ich und fühlte, wie sich meine Brust zuschnürte. Ich erinnerte mich an den Tag, als wäre es erst gestern gewesen, und der Schmerz in meinem Inneren, den ich an den meisten Tagen verdrängte, brach sich Bahn. Tränen sammelten sich in meinen Augen und liefen über meine Wangen, während ich immer wieder neuen Sand aufnahm und durch meine Finger rieseln ließ.
„Das hast du damals schon gemacht. Stundenlang …“ Für eine Sekunde war ich versucht, meine Tränen abzuwischen und ein Lächeln für Dylan aufzusetzen, doch etwas in seiner Stimme zeigte mir, dass es ihm ähnlich ging wie mir.
„Darf ich mich setzen?“, fragte er und ich zuckte mit den Schultern. Dann spürte ich mehr, als dass ich es sah, wie mein Bruder sich neben mir fallen ließ. Ohne ein weiteres Wort legte er seinen Arm um meine Schultern und zog mich an sich, so wie er es damals gemacht hatte. Endlich schaffte ich es, den Sand loszulassen, und legte meinen Kopf an seine Brust. Ich hörte seinen beruhigenden Herzschlag. Wie viele Nächte hatte ich diesen Herzschlag gehört, um überhaupt einschlafen zu können? Ich wusste es nicht mehr, es waren zu viele.
„Bist du okay?“, fragte Dylan und strich mir die langen Haare hinters Ohr.
„Nein“, antwortete ich wahrheitsgemäß.
„Es ist zehn Jahre her und noch immer fehlen sie mir so wahnsinnig. Hört das jemals auf?“, fragte Dylan leise und ich zuckte mit den Schultern. Meine Hand wanderte wie von selbst zu der langen Narbe an meinem Oberschenkel – dem einzig sichtbaren Zeichen dafür, was heute vor zehn Jahren geschehen war.
„Sie fehlen mir auch so sehr. Manchmal habe ich das Gefühl, zu ersticken, weil es noch immer so wehtut. Und manchmal denke ich, ich höre Mom oder Dad, wie sie nach Hause kommen und nach uns rufen.“
„So geht es mir auch“, erwiderte Dylan.
Noch ein paar Minuten genoss ich den Trost, den mein Bruder mir spendete, dann löste ich mich von ihm.
„Ich dachte, du hättest es vergessen“, gab ich ehrlich zu, den Blick auf den Horizont gerichtet.
„Wie könnte ich diesen Tag vergessen?“
Ich zuckte nur mit den Schultern, hatte keine Antwort auf seine Frage.
„Wollen wir?“, fragte Dylan und zeigte mir damit, dass er auch keine Antwort erwartet hatte. Ich drehte mich zu ihm um, da ich nicht wusste, was er meinte. In der Hand hielt er zwei dunkelrote Rosen. Er musste sie mitgebracht und hinter sich versteckt gehalten haben.
Ich nickte, und mein Bruder stand auf, streckte mir die Hand entgegen, um mich hochzuziehen. Ohne meine Hand loszulassen, gingen wir gemeinsam ins Wasser – soweit es möglich war, ohne unsere Shorts nass zu machen. Dylan gab mir eine der Rosen, dann blieben wir stehen und sahen uns an. Wie auf ein stilles Zeichen holten wir aus und warfen die Blumen ins Meer hinaus. Einen Augenblick schauten wir ihnen schweigend hinterher, wie sie von den Wellen davongetragen wurden. Erst als die Rosen nicht mehr zu sehen waren, kehrten wir an den Strand zurück und gingen hoch zu unserem kleinen Häuschen. Zu dem Häuschen, in dem wir bis vor zehn Jahren noch zu viert gewohnt hatten.
TYLER
Der Steg bewegte sich leicht unter meinen Füßen, eine salzige Brise stieg mir in die Nase. Über mir kreischten die Möwen. Hier auf Key Largo wehte ein sanfter Wind, der die schwüle Hitze etwas erträglicher machte. Vielleicht hätte ich mir doch ein Apartment auf den Florida Keys zulegen sollen, anstatt in Miami zu leben. Dort speicherte der Asphalt die Hitze und strahlte sie wieder ab, sodass es in der Stadt meist noch heißer war als außerhalb. Bei Temperaturen, die im Sommer gerne mal über dreißig Grad kletterten und von einer drückenden Schwüle begleitet wurden, fast nicht auszuhalten.
Hier draußen dagegen kam es mir vor, als könne ich zum ersten Mal Luft holen.
Key Largo Diving School war auf einem verwitterten Holzschild zu lesen. Mehrere Boote dümpelten am Kai träge auf den kleinen Wellen. Ein paar Meter noch, dann befand ich mich vor der grauen Holzhütte, die als „Office“ ausgezeichnet war. Hier hoffte ich, diesen Lou zu finden, dessen Name mein Vater auf seiner Liste vermerkt hatte.
Nachdem ich über eine Woche lang seine Unterlagen studiert und mich in seine Quellen eingelesen hatte, war ich überzeugt davon, dass Dad da tatsächlich auf etwas gestoßen war, dem sich lohnte, nachzugehen.
Ich stieß die Tür auf und betrat den kleinen Raum. Sofort strömte mir ein Schwall kühler Luft entgegen. Ein paar Schritte vom Eingang entfernt befand sich ein Holztresen. Überhaupt bestand hier alles aus Holz. Der Fußboden, die Wände, die Decke. Das Mobiliar. Bilder der Unterwasserwelt hingen an den Wänden, neben Regalen, die mit allem Möglichen gefüllt waren, was man als Taucher so brauchte.
Der Typ hinter dem Tresen schaute auf, als ich auf ihn zuging.
„Hi, ich bin Dylan. Was kann ich für Sie tun?“, begrüßte er mich. Seine sonnengebräunte Haut und die ausgebleichten Haare verrieten, dass er eine Menge Zeit an der frischen Luft verbrachte.
„Hallo, ich suche Lou.“ Ich kam vor dem Tresen zum Stehen. Kaum hatte ich die Worte gesagt, als sich auch schon seine Miene verfinsterte. Statt etwas zu sagen, musterte er mich von oben bis unten. Seinem verächtlichen Blick nach zu urteilen, war er nicht angetan von dem, was er sah. Keine Ahnung, welche Laus dem Typen über die Leber gelaufen war.
„Und was wollen Sie von … Lou?“
„Das ist vertraulich.“
Sein Blick wurde noch unfreundlicher, er runzelte die Stirn und wir lieferten uns so etwas wie ein stilles Ich-schaue-nicht-zuerst-weg-Duell. Er bohrte seinen Blick in meinen und ich tat das Gleiche. Es ging ihn nichts an, was ich von Lou wollte. Ich war nicht hier, um jedem, der mir begegnete, von meinen Plänen zu erzählen. Im Gegenteil, ich würde sämtliche Informationen so lange wie möglich für mich behalten.
„Tut mir leid, Lou ist gerade nicht hier.“ Alles in seinem Tonfall verriet, dass ihm überhaupt nichts leidtat.
„Und kommt wann wieder?“ Auffordernd sah ich ihn an. Wenn der so weitermachte, würde ich mal ein Wort mit dem Manager reden. Darüber, wie potenzielle Kunden hier behandelt wurden. Kein Wunder, dass in dem Laden nichts los war.
„Kann ein paar Stunden dauern. Ist gerade auf der großen Tour. Sie können es ja morgen noch mal versuchen. Oder schauen Sie doch mal auf dem Sunshine Key vorbei, da gibt’s auch eine Tauchschule. Sind nicht so gut wie wir, aber vielleicht finden Sie ja dort, was Sie suchen.“
Der hatte echt Nerven. „Kein Problem, ich warte auf Lou. Wo ich schon mal da bin, buche ich gleich einen Einzel-Tauchgang. Die Wreck-Treck-Tour“, sagte ich einem spontanen Einfall folgend. Eigentlich hatte ich nicht vorgehabt, zu den Wracks zu tauchen, die vor der Küste Floridas verstreut liegen. Bisher hatte ich mich nie dafür interessiert. Wenn ich unter Wasser war, dann, weil ich ein Korallenriff sehen wollte oder einen Adrenalinkick suchte, wie man ihn beim Tauchen mit Haien bekam. Aber zu irgendwelchen alten Schiffen zu tauchen? Dazu war mir meine Zeit immer zu schade gewesen.
„Lou ist die ganze Woche ausgebucht und nächste Woche ebenfalls.“
Ausgebucht? Klar. Hier drängelten sich ja auch die Kunden.
Ich zuckte mit den Schultern. „Ich muss nicht unbedingt mit Lou tauchen. Ich kann auch allein runtergehen.“ Ich musterte diesen Dylan. Zeit, ihm mal eine Dosis seiner eigenen Unfreundlichkeit zu verpassen. „Geben Sie mir einfach einen Anzug und jemanden, der mich rausbringt. Oder dürfen Sie das nicht?“ Ich deutete auf den Tresen. „Ich verstehe schon, dass man als Rezeptionist wahrscheinlich nur Telefongespräche entgegennimmt und die Termine einträgt.“ Mit einem freundlichen Grinsen sah ich ihn an. Dylan dagegen wirkte, als würde ihm gleich Rauch aus den Ohren kommen.
„Die Wreck-Treck-Tour? Wäre normalerweise kein Problem mit einem erfahrenen Taucher. Allerdings machen wir mit Anfängern nicht sofort die große Tour.“ Jetzt feixte er, offensichtlich sehr zufrieden mit seiner Antwort.
„Ich tauche schon, seit ich laufen kann.“
„Ach ja? Das sagen sie alle. Das Einzige, was ich anbieten kann, ist ein Tauchgang zur Benwood. Die liegt nicht besonders tief, ist aber trotzdem beeindruckend und bestens geeignet, um erste Erfahrungen beim Wracktauchen zu sammeln.“ Mit diesen Worten schob er mir ein paar Formulare rüber. Während ich die Vertragsbedingungen überflog, wandte Dylan sich Richtung Hinterzimmer, rief nach einem gewissen Kyle und erklärte ihm, dass er mit mir rausfahren würde. Ich wusste, dass dieser Dylan recht hatte. Allein mit mir auf die große Tour zu gehen, wäre unverantwortlich, auch wenn ich gehofft hatte, er würde die Sache nicht so eng sehen.
„Hier.“ Ich kritzelte meine Unterschrift auf die markierten Linien und schob den Papierkram zu ihm rüber.
„Alles klar. Willkommen bei Key Largo Diving. Wir duzen uns hier, ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus, Mr. Norman.“ Er betonte meinen Nachnamen mit einem sarkastischen Tonfall, dann hielt er mir seine Hand hin. Anscheinend hatte die Tatsache, dass ich jetzt zahlender Kunde war, seine Laune nicht gebessert.
Ich nahm seine Hand. Sein Händedruck war fest, alles andere hätte mich auch gewundert nach dem Pissing-Contest, den wir uns gerade geliefert hatten.
„Du kannst mich Tyler nennen“, sagte ich.
„Okay, Tyler.“ Er drehte sich zu einem Kleiderständer, an dem jede Menge Neoprenanzüge hingen. „Größe M nehme ich an.“ Noch bevor ich antworten konnte, hatte er einen Tauchanzug von der Stange genommen und mir zugeworfen. Das Teil knallte gegen meine Brust, weil ich es nicht schnell genug auffangen konnte.
„L“, knurrte ich und feuerte den Anzug zurück.
„Sorry, mein Fehler.“ Dieses Mal reichte er mir die richtige Größe. „Umkleidekabinen sind draußen auf der Rückseite vom Office.“ Er schaute auf seine Uhr. „Wenn du fertig bist, komm zur Moonshadow, ich warte dort auf dich.“
„Alles klar.“
Die Moonshadow war ein kleines Motorboot. Neben unseren Sauerstoffflaschen, einigen Seilrollen und einer Kühlbox gab es gerade genug Platz, dass ich mich setzen und die Fahrt hinaus aufs Meer genießen konnte. Wobei „genießen“ nicht unbedingt das richtige Wort war, denn Dylan heizte über die Wellen, als wolle er den Kahn zu Bruch fahren. Wir hatten kaum Seegang, doch er schaffte es dank der überhöhten Geschwindigkeit, dass wir nach jeder Mini-Welle aufs Wasser knallten. Hätte ich Plomben in den Zähnen gehabt, wären sie nach dieser Fahrt garantiert rausgefallen. So aber spannte ich meine Kiefer an, hielt mich fest und sagte nichts. Ich war mir sicher, er wartete nur darauf, dass ich ihn bat, die Geschwindigkeit zu drosseln.
Irgendwann stoppte er endlich den Motor und drehte sich zu mir.
„Wir sind da“, sagte er unnötigerweise.
„Super“, murmelte ich und zog das Oberteil des Neoprenanzugs nach oben, das ich vorher auf die Hüfte gestreift hatte, dann half ich Dylan dabei, das Boot für unseren Tauchgang vorzubereiten. Was bedeutete, den Anker zu legen, eine Boje aufs Wasser zu setzen und die Tauchleine daran zu befestigen. Als alles vorbereitet war, gab es das Briefing und den Sicherheitscheck. Dylan erläuterte die Besonderheiten der Wracks und was es zu beachten gab. Er war gründlich, das musste ich ihm lassen. Man merkte ihm an, dass er wusste, wovon er redete, und nicht zum ersten Mal einen Taucher auf eine Tour vorbereitete.
„Nur damit das klar ist, da unten habe ich das Sagen. Wenn ich das Zeichen zum Auftauchen gebe, tauchen wir auf. Du wirst nicht allein in das Wrack tauchen, sondern nur mit mir gemeinsam. Keine Unternehmungen auf eigene Faust, du folgst mir und machst das, was ich bestimme. Alles klar?“ Mit dieser Frage beendete er das Briefing. Sie war unnötig, ich hätte schon ein totaler Anfänger sein müssen, um nicht zu wissen, wie ich mich unten zu verhalten hatte, aber wahrscheinlich wollte Dylan nur noch mal klarmachen, wer hier der Boss war.
„Aye, aye, Captain“, murmelte ich sarkastisch.
Meine Antwort brachte mir einen kalten Blick ein. Dann setzte sich Dylan auf den Bootsrand und ich tat es ihm nach. Gemeinsam ließen wir uns nach hinten ins Wasser fallen.
LOU
Der Donnerstag gehörte in der Tauchschule zu den ruhigsten Tagen der Woche. An diesem Tag boten wir keine Tauchgänge an, und es gab nur am Nachmittag einen Anfängerkurs, den Dylan leitete.
Daher hatte ich mir den heutigen Vormittag freigenommen und war in die Stadt zum Einkaufen auf den Markt gefahren. Danach schaute ich noch auf einen Kaffee bei meiner besten Freundin im Büchercafé vorbei.
„Hey, Süße, was gibts Neues?“, fragte ich und drückte Marli kurz an mich.
„Nicht viel, alles wie immer. Keine große Aufregung, ganz wie ich es mag.“ Marli grinste mich an, als ich verständnislos den Kopf schüttelte. Eigentlich gab es auf den ersten Blick nichts, was uns verband, trotzdem waren wir seit dem Kindergarten die besten Freundinnen. Bereits damals war sie ein ganzes Stück größer als ich und das hatte sich bis heute nicht geändert. Okay, das war auch nicht schwer, die meisten Menschen waren größer als ich. Dennoch war ich es, die auf sie aufpasste, und das schon von klein auf.
Ich rutschte auf einen Barhocker am Tresen, während Marli mir unaufgefordert einen Kaffee aus der großen Glaskanne einschenkte, den Becher vor mich stellte und mir die Kaffeesahne hinschob. Dann griff sie nach ihrem eigenen Becher und schenkte auch sich selbst etwas ein.
„Dass dir das nicht zu langweilig ist. Du musst doch mal rauskommen.“ Ich schüttelte erneut leicht den Kopf und rührte die Sahne in mein Heißgetränk.
„Ach, Lou … Ich hab hier alles, was ich brauche.“
„Aber du hast doch nicht studiert, um dann hier zu versauern!“
Marli zuckte mit den Schultern. „Was soll ich denn machen? Ich kann mir keinen Job herzaubern. Und von hier weggehen? Nein, das geht gar nicht. Womöglich in New York in einem verstaubten Museum im Keller hocken und Fundstücke katalogisieren? Oder jeden Tag dieselbe Führung mit einer Horde Touristen abhalten, die nach zwei Minuten eh vergessen haben, was ich ihnen erzählt habe? Da würde ich eingehen!“ Sie legte mir die Hand auf den Arm, als wolle sie mir zeigen, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauchte. „Das Büchercafé ist vollkommen in Ordnung, ich bin rundum glücklich damit. Ich habe meine beiden größten Leidenschaften vereint – mal abgesehen von der Archäologie. Hier kann ich nach Herzenslust backen und ich habe immer mehr als genug Lesestoff. Was will ich mehr?“
„Natürlich liebst du den Job und den Laden, und ich freue mich auch, dass du zufrieden bist. Aber dennoch … Das kann doch nicht alles sein. Du bist Anfang zwanzig – willst du dein Leben lang hier drin versauern? Wir wohnen in Florida, hier scheint so ziemlich jeden Tag die Sonne und es ist warm – und du vergräbst dich hinter deinem Backofen oder einem Buch. Das könntest du auch in New York beim Katalogisieren von Fundstücken haben.“
„Hier im Laden zu arbeiten, ist nicht langweilig – im Gegenteil! Der Stapel neben meinem Bett wächst quasi täglich, und ich weiß gar nicht, wann ich die Bücher alle lesen soll. Ich versauere hier nicht, ich hab es mir so ausgesucht.“ Sie zuckte milde lächelnd mit den Schultern.
„Ich sehe es kommen, irgendwann bist du alt und grau und lebst allein mit fünfzehn Katzen in einer Einzimmerwohnung. Aber gut, wenn das alles ist, was du willst …“ Ich gab auf. Diese Diskussion hatten wir schon so oft geführt. Es war für mich nicht nachvollziehbar, wie Marli sich so zurückziehen konnte. Dass sie ihren Traum, bei Ausgrabungen dabei zu sein, auf alte Schätze zu stoßen und Relikte aus vergangener Zeit zu entdecken, einfach so aufgab. Wir waren jung, gerade erst mit dem College fertig. Wir sollten unsere Träume verwirklichen, ausgehen, Spaß haben, Männer kennenlernen und unser Leben genießen. Doch meine Freundin war schon immer ein kleiner Nerd gewesen. Ein stilles Mäuschen, das lieber allein in der Ecke saß, als mit anderen Kindern draußen herumzutoben. Im Kindergarten wurde sie deshalb aufgezogen und in der Schulzeit ging es genauso weiter. Der Anfang unserer Freundschaft basierte darauf, dass ich es nicht mit ansehen konnte, wie die anderen immer auf ihr rumhackten. Irgendwann platzte mir der Kragen, und ich ging wie eine Furie jeden an, der Marli ärgerte. Ich wurde zu ihrer Beschützerin und lernte schnell ihre stille und nachdenkliche Art zu schätzen. Nach dem Tod meiner Eltern war es Marli, die wie ein unerschütterlicher Felsen an meiner Seite stand. Die mich mit einer schier unendlichen Geduld festhielt, wenn ich weinte, wenn ich mit dem Schicksal haderte und wenn ich vor Wut meine Fäuste an der Wand meines Zimmers blutig schlug. Sie war nach dem Unfall jeden Tag bei mir – erst im Krankenhaus und dann zu Hause.In dieser Zeit lernte ich, was Freundschaft bedeutete und worauf es im Leben wirklich ankam. Ich habe nie vergessen, was Marli für mich getan hat – und umgekehrt war es genauso, das wusste ich. So unterschiedlich wir auch waren, wir hielten zusammen wie Pech und Schwefel.
„Was hast du heute noch vor?“, fragte Marli und nahm einen Schluck ihres Kaffees.
„Ich werde den Nachmittag mit der Buchhaltung verbringen, die Quartalsabrechnungen machen.“
Meine Freundin verzog das Gesicht, als würde sie unter spontanen Zahnschmerzen leiden.
„Guck nicht so!“, sagte ich lachend. „So schlimm ist das nicht. Ein paar Zahlen in den Computer hacken, Ablage und der ganze Bürokram – das ist doch entspannend. Ich habe Zeit für mich, kann nebenbei Musik hören und mich mit einer Tasse Kaffee und ein paar Keksen im Büro vergraben.“
„Ehrlich, Lou, wie kann man so was entspannend finden? Ich finde es nur total nervig. Mich macht es schon aggressiv, wenn ich ins Hinterzimmer gehe und diese Papierstapel sehe, die dort auf mich warten.“ Marli schaute an mir vorbei und begrüßte lächelnd zwei Frauen, die gerade das Büchercafé betraten.
„Herzlich willkommen im Fairytale, kann ich Ihnen helfen?“
„Vielen Dank! Ach, ist das niedlich! Ihr Laden ist ja ein Traum“, sagte die eine der Frauen und die andere nickte eifrig. „Sag ich doch. Hier könnte ich stundenlang stöbern oder an einem dieser kleinen Tische sitzen und Kaffee trinken. Du musst unbedingt den Kuchen probieren, Grace.“ Die Kundin wandte sich nun an Marli. „Backen Sie immer noch selbst, Miss Jones? Ich war zuletzt vor zwei Jahren hier, viel zu lange her.“
„Natürlich backen wir hier noch immer selbst. Das könnten wir doch niemals abgeben“, antwortete Marli freundlich lächelnd.
„Das ist gut! Richtig so, denn das ist ja das, was diesen Buchladen so besonders macht. Und natürlich Ihr Händchen für die Dekoration. Ich liebe es hier. Sagen Sie, können Sie mir vielleicht einen guten Fantasyroman empfehlen? Ich habe absichtlich meine Urlaubslektüre zu Hause vergessen, damit ich gleich einen Grund habe, hierherzukommen – ohne dass mein Mann deswegen herumnörgelt.“ Die Kundin zwinkerte Marli verschwörerisch zu.
„Natürlich kann ich Ihnen etwas empfehlen.“ Marli kam hinter dem Tresen hervor.
„Okay, ich verschwinde dann mal und mache mich an die Buchhaltung. Wenn du magst, helfe ich dir am Wochenende bei deiner.“
Marli warf mir einen dankbaren Blick zu. „Du bist die Beste, Lou. Pack dir noch ein Stück Kuchen ein und bring auch Dylan was mit. Ich weiß ja, er liebt Key Lime Pie.“
Ich gab meiner Freundin zum Dank noch einen Luftkuss, dann packte ich mir zwei Stücke des duftenden Kuchens ein und machte mich auf den Rückweg zur Tauchschule.
„Ah, gut, du bist da. Ich dachte schon, du schaffst es nicht rechtzeitig, bevor ich losmuss.“
„Ich war noch kurz bei Marli. Sie lässt dich grüßen und sie hat mir Key Lime Pie mitgegeben.“ Ich sah, wie die Augen meines Bruders für einen Moment aufleuchteten.
„Oh … Hm … Danke. Wie … Ähm, wie geht’s Marli denn? Ich hab sie lange nicht gesehen.“ Angestrengt schaute mein Bruder auf den Haufen Flossen vor sich, den er vorgab, zu sortieren. Ich hatte keine Ahnung, was mein Bruder gegen Marli hatte, aber seit einigen Monaten verhielt er sich merkwürdig. Wenn sie bei uns zu Hause auftauchte, verschwand er. Er ging ihr sichtlich aus dem Weg, doch als ich ihn darauf ansprach, meinte er nur, ich würde es mir einbilden.
„Es geht ihr gut. Am Wochenende helfe ich ihr mit der Buchhaltung. Davor graust es ihr ja immer.“
„Es ist halt nicht jeder so ein Zahlengenie wie du. Dafür kann Marli andere Dinge, die du nicht kannst – wie zum Beispiel backen.“
Huch? Was war das denn? Auf einmal verteidigte mein Bruder meine beste Freundin. „Schon gut, das sollte doch nicht gegen sie sein“, beschwichtigte ich ihn verwundert.
Dylan zuckte nur mit den Schultern und griff nach dem Haufen Flossen.
„Ich muss jetzt. Der Anfängerkurs geht gleich los. Wir sehen uns heute Abend.“
„Heißt das, ich darf dein Stück Pie auch essen?“, versuchte ich, ihn zu ärgern. Ich wollte nicht, dass wir in dieser schlechten Stimmung auseinandergingen.
Meine Frage zeigte die erhoffte Wirkung. Dylan lachte und schüttelte den Kopf. „Wehe dir! Finger weg von meinem Kuchen, ansonsten bist du die nächsten drei Wochen für die Anfänger zuständig.“
„Jesses, bitte nicht! Ich bin auch ganz artig!“ Abwehrend hob ich die Hände. Noch immer lachend verschwand mein Bruder zur Tür hinaus, und kurz darauf hörte ich,wie er seinen Jeep startete unddavonfuhr.
Sosehr ich es auch liebte, unter Wasser zu sein, diese Anfänger-Tauchkurse forderten meine Nerven zu sehr. Mir fehlte schlicht und ergreifend die Geduld. Es war mir unbegreiflich, wie schwer es manchen Teilnehmern fiel, durch das Mundstück der Sauerstoffflasche zu atmen. Oder wie einem erwachsenen Menschen der komplette Orientierungssinn unter Wasser flöten gehen konnte. Allein wenn ich die Teilnehmer schon sah, musste ich mir ein deutliches Augenrollen verkneifen. Diese Großstadt-Bürohengste in mittleren Jahren, die der Meinung waren, noch einmal richtig was erleben zu müssen. Die das Abenteuer suchten, um sich nicht in der Midlife-Crisis zu verlieren. Da standen sie nun am Ufer in ihren teuren Badeshorts von irgendeinem angesagten Label und blendeten mich regelrecht mit ihrer fahlen weißen Haut, die in der strahlenden Sonne das Licht reflektierte. Diese Körper hatten seit Monaten kein Sonnenlicht gesehen, da sie fast rund um die Uhr unter teuren Anzügen verborgen in klimatisierten Büros ausharrten. Kaum hatten sie Freigang, verbrachten sie den Sommerurlaub auf den Keys, um danach monatelang im Büro davon zu zehren. Nein, keine Chance, damit durfte mein Bruder sich herumschlagen.
Ich drehte das Radio an, dann verzog ich mich mit einem großen Becher Kaffee und meinem Stück Key Lime Pie ins Hinterzimmer, um mich in aller Ruhe der Buchhaltung zu widmen.
Zwei Stunden später schaute ich erstaunt auf, als ich die Türglocke über der Tür zum Office-Bereich läuten hörte. Ein Blick auf die Uhr ließ mich vermuten, dass es Dylan war, der den Tauchkurs beendet hatte und nun zurückkehrte. Ich streckte die Arme weit über den Kopf und bog den Rücken durch, um ihn nach dem langen Sitzen ein bisschen zu entspannen.
„Hallo? Jemand da?“, hörte ich eine mir unbekannte Stimme aus dem Empfangsbereich. Anscheinend hatte ich mich getäuscht, es war nicht Dylan. Schnell stand ich auf und ging nach vorn, um den potenziellen Kunden zu begrüßen.
„Hi, und herzlich willkommen. Was kann ich für Sie tun?“, fragte ich den Mann freundlich. Während ich ihn unauffällig musterte, öffnete sich eine Schublade in meinem Kopf, in die ich den Kerl sofort hineinschob. Schwarze Haare, blaue Augen, markantes Gesicht mit einem Hauch indianischem Einschlag, leicht arroganter Blick, die vollen Lippen ein wenig spöttisch verzogen, als würde er nichts auf der Welt ernst nehmen. Die Kleidung zwar leger, dennoch schrie sie förmlich „arschteuer“. Ein reiches Bürschchen auf der Suche nach Abenteuer. Jünger als die meisten, die hier aufkreuzten, nur ein paar Jahre älter als ich.
„Oh, gut, der Rottweiler scheint Ausgang zu haben. Hi, ich bin Tyler!“ Noch bevor ich fragen konnte, was er mit dem Spruch über den Rottweiler meinte, setzte dieser Tyler ein breites Lächeln auf und ließ seinen Blick über meinen Körper gleiten.
„Hi, Tyler. Was kann ich für dich tun?“, fragte ich erneut. Endlich kehrte sein Blick zu meinem Gesicht zurück.
„Ich bin auf der Suche nach Lou. Ist er da?“
„Er? Sehe ich etwa aus wie ein Kerl?“, fragte ich belustigt und genoss die Verwirrung, die in Tylers Augen auftauchte. „Ich bin Lou“, klärte ich ihn nach ein paar Sekunden Stille auf.
„Nein, das kann nicht sein. Lou ist ein Mann, da bin ich mir ganz sicher.“
„Nun, dann bist du hier falsch. Hier gibt es nur eine Lou und das bin ich.“
Tyler schüttelte den Kopf. „Du bist ein Püppchen. Der Lou, den ich meine, soll einer der besten Taucher auf den Keys sein. Also noch mal, wo finde ich ihn?“
Wollte dieses reiche Söhnchen mich verarschen? Und hatte er mich gerade Püppchen genannt? Bevor ich Luft holen konnte, um ihm eine passende Erwiderung zu geben, sah ich aus dem Augenwinkel, wie Dylan sich neben mir aufbaute.
„Es ist mir scheißegal, was du gehört hast. Lou ist definitiv die beste Taucherin der Keys und absolut nicht deine Kragenweite. Also das Beste ist, du verschwindest wieder – und diesmal endgültig.“ Drohend verhakte sich sein Blick in dem von Tyler. Die beiden starrten sich an und ignorierten mich.
Ich war mir nicht sicher, ob ich meinen Bruder richtig verstand – kannte er Tyler bereits? Es hörte sich so an. Doch dass er sich hier als mein Bodyguard aufspielte, kotzte mich richtig an. Ich war alt genug, um ohne ihn mit Tyler fertig zu werden.
„Ihr kennt euch? Alles klar, ich verstehe. Du bist der Rottweiler … Wenn ihr also mit eurem Schwanzvergleich fertig seid, könntet ihr mich bitte mal aufklären. Warum hast du mir nicht gesagt, dass jemand nach mir gefragt hat?“, fragte ich meinen Bruder. Dann wandte ich mich an Tyler. „Und du? Was willst du eigentlich von mir?“
Die beiden Männer reagierten nicht. Stumm starrten sie sich in die Augen und lieferten sich ein Blickduell wie zwei Boxer im Ring. Ich wartete förmlich darauf, dass sie sich aufeinander stürzten, und holte gedanklich schon einen Eimer Wasser, um die beiden mit einer kalten Dusche wieder voneinander zu trennen.
TYLER
„Was der von dir will, ist doch wohl klar“, sagte dieser Dylan, noch bevor ich ihre Frage beantworten konnte.
„Ach, und was soll das sein?“, fragte ich ihn nun meinerseits, denn allmählich nervte mich seine Art gehörig. Ich hatte es nicht nötig, jeder attraktiven Frau nachzulaufen, die meinen Weg kreuzte. Und, okay, diese Lou war sexy, aber gleich dermaßen eifersüchtig, auf mich loszugehen, als wäre sie sein Eigentum, ging mir entschieden zu weit. Die meisten Frauen machten mich an, vor allem, wenn sie sahen, dass ich Geld hatte.
„Na, was wohl?“ Dylan warf mir einen abschätzigen Blick zu.
„Dylan, könntest du dich da raushalten? Vor allem, wenn du ohnehin nicht vorhast, mir zu antworten?“ Lou stemmte die Hände in die Hüften und funkelte Dylan wütend an, dann wandte sie sich mir zu. Ihr Blick wurde nicht freundlicher, dabei hatte ich bis jetzt noch überhaupt nichts verbrochen. Außer vielleicht mit diesem Idioten einen Tauchgang zu absolvieren. Okay, es hatte Spaß gemacht, mit Dylan zu diesem Wrack runterzugehen, was wohl in erster Linie daran lag, dass er unter Wasser die Klappe halten musste. „Also, worum geht’s?“, fauchte Lou jetzt mich an.
„Was ich von dir will, geht ihn nichts an.“ Mit dem Daumen zeigte ich auf Dylan. „Und es hat nichts mit dem zu tun, was er denkt“, fügte ich hinzu, um dieses Thema ein für alle Mal zu beenden. Lou war total heiß, aber ich war kein kompletter Vollidiot. Falls ich sie wirklich anheuerte – und ich war mir im Moment nicht sicher, ob das eine gute Idee wäre –, musste ich mich sowieso von ihr fernhalten. Ich liebte schöne Frauen und heißen Sex, doch ich fing nie was mit Angestellten an. So etwas brachte nicht nur Ärger, sondern garantiert auch eine Anzeige wegen sexueller Nötigung. Warum dieses Risiko eingehen, wenn es in Miami mehr als genug Frauen gab, die nicht für mich arbeiteten?
„Ich habe keine Geheimnisse vor meinem Bruder.“ Aha. Jetzt zumindest war mir klar, warum sich der Typ wie ein totales Arschloch mir gegenüber verhielt.
„Freut mich, trotzdem geht es ihn nichts an.“ Egal, aus welchem Grund mein Vater glaubte, es sei eine gute Idee, mich mit dieser Sexbombe auf eine gemeinsame Mission zu schicken, ich war nicht so blöd, gleich herauszuposaunen, worum es eigentlich ging. Ich musterte sie, dann seufzte ich. Verdammt, sie war unglaublich attraktiv, sexy und erst diese Augen. Vor allem, wenn sie einen wütend anfunkelte, so wie gerade jetzt, kam der dunkle Blauton noch besser zur Geltung. Dazu die langen blonden Haare und der Killer-Body. Egal, wie viele Frauen es in Miami gab, ich merkte, dass mir ausgerechnet diese unter die Haut ging. Dabei kannte ich sie nicht einmal richtig.
„Was es auch ist, ich werde es ohnehin mit ihm besprechen.“
Sah ganz so aus, als würde ich so nicht weiterkommen. Also musste ich ihr wohl einen Teil der Wahrheit auftischen.
„Ich stelle gerade ein Team zusammen. Dazu brauche ich einen Taucher. Jemanden mit Tiefseeerfahrung. Aus irgendeinem Grund war mein Vater der Meinung, dass du die richtige Person für den Job bist.“
„Tiefseeexploration? Du bist aber nicht einer von diesen bescheuerten Schatzsuchern, die denken, sie könnten reich werden, wenn sie nur lange genug im Sand wühlen?“, knurrte Dylan. Der Typ hatte aber auch zu allem eine Meinung.
„Schatzsucher? Nein, ich bin Meeresbiologe.“ Verdammt, verdammt, verdammt. Von Meeresbiologie hatte ich so gut wie keine Ahnung. Klar, ich wusste, dass da unten jede Menge Fische herumschwammen. Von vielen kannte ich sogar die Namen, aber das war’s auch schon.
Dylan musterte mich. Langsam. Von oben nach unten. „Genau so siehst du aus. Ein Meeresbiologe mit Ferrari, Luxusklamotten und Rolex am Arm – wer’s glaubt!“
„Es soll auch Meeresbiologen geben, die Geld haben und wissen, wie man sich kleidet.“
„So einen sehe ich zum ersten Mal.“ Dylan verschränkte die Arme vor der Brust.
„Dylan! Könntest du dich endlich raushalten?“, warf Lou mit einem warnenden Unterton in der Stimme ein.
„Du wolltest doch, dass er erfährt, warum ich hier bin.“ Okay, eigentlich sollte ich diesen Blödmann nicht auch noch verteidigen, aber die Gute musste sich endlich mal entscheiden, was sie wollte.
„Du weißt jetzt, was er will, also kannst du gehen“, sagte sie an ihren Bruder gewandt. „Ein dickköpfiger Idiot hier drin reicht mir vollkommen.“
„Hey, einen zukünftigen Arbeitgeber als Idioten zu bezeichnen, ist nicht gerade klug.“
„Wer sagt denn, dass ich Arbeit suche? Die Tauchschule gehört mir und meinem Bruder. Ich bin nicht darauf angewiesen …“
Ich unterbrach sie. „Ja, und hier ist ja auch so viel los. Jede Wette, die Rechnungen stapeln sich, und ihr beide seid froh über jeden Auftrag, der reinkommt.“
Für einen Augenblick herrschte Stille.
„Raus hier“, knurrte Dylan.
„Ich regele das“, fauchte Lou ihn an. Und ich stand da und fragte mich, warum ich überhaupt meine Zeit mit den beiden verschwendete. Es gab jede Menge Taucher hier in der Gegend. Darunter etliche, die weder weiblich waren noch eine Figur besaßen, die ich nur dann im Wetsuit sehen wollte, wenn ich Chancen hatte, sie auch nackt in meinem Bett zu haben.
Dylan hielt in einer abwehrenden Geste die Hände hoch. „Ich gehe ja schon“, sagte er, dann drehte er sich um und stapfte davon. Nicht ohne die Tür hinter sich zuzuknallen, ganz wie ein Fünfjähriger, der auf seine Schwester wütend ist.
„Meeresbiologe also?“ Lou musterte mich. Ihrem Blick konnte ich ansehen, dass sie mir nicht glaubte.
„Ja.“ Ich wippte auf meinen Fußballen vor und zurück, dann steckte ich die Hände in die Hosentaschen. Alles in dem Bemühen, entspannt und gelassen zu wirken. Warum ich mir die Mühe machte, war mir selbst nicht klar. Schließlich konnte sie froh sein, wenn ich sie anheuerte. Und ich war mir immer noch nicht sicher, ob ich das überhaupt tun sollte. Eine Frau, vor allem eine so attraktive wie Lou, konnte nur Ärger bringen.
„Es geht um ein Forschungsprojekt in den Gewässern vor der spanischen Küste. Mein Vater war begeisterter Meeresbiologe und hat noch vor seinem Tod mit der Recherche begonnen. Ich möchte es für ihn zu Ende führen. Ich bin zwar kein so guter Biologe, wie er es war, denn er verbrachte sein ganzes Leben mit der Forschung auf diesem Gebiet, doch ich weiß genug, um sein Andenken zu ehren und die Sache durchzuziehen“, log ich munter vor mich hin. Die Geschichte hatte ich aus dem Stegreif gesponnen. Ich hätte mir vorher etwas überlegen sollen, aber ich hatte nicht damit gerechnet, mich als Auftraggeber großartig erklären zu müssen. Nein, in meiner Naivität hatte ich gedacht, ich müsse nur sagen, dass ich einen Taucher engagieren wollte, und dieser Lou würde begeistert zusagen.
„Ich finde das so wundervoll.“ Lou hatte plötzlich Tränen in den Augen. Zum ersten Mal, seit ich ihr begegnet war, lächelte sie mich an. Was ein ziemlich seltsames Gefühl in meinem Magen hervorrief. Mein Herz schien auf einmal einen Salto zu schlagen und für einen Augenblick blieb mir die Luft weg. Eine Lou, die mich wütend anblitzte, war sexy wie die Hölle. Aber eine, die mich anlächelte, mit Tränen, die in ihren Augen schimmerten, und leicht geöffneten Lippen? Meine Hose wurde plötzlich ziemlich unbequem und ich …
„Meine Eltern sind gestorben, als ich vierzehn Jahre alt war. Ich weiß, wie es ist, wenn man versucht, das Andenken an einen geliebten Menschen am Leben zu erhalten. Einfach, weil das das Einzige ist, was bleibt, wenn jemand gestorben ist“, sprach sie weiter.
Okay, in meiner Hose war nach dieser Erklärung alles wieder in Ordnung. Dafür regten sich andere Gefühle in mir. Seltsame Emotionen, die ich sonst nie spürte. Lous einfache Worte klangen echt. So sprach nur jemand, der wusste, was Verlust bedeutete. Der nachempfinden konnte, was in einem vorging, der einen geliebten Menschen verloren hatte. Plötzlich sah ich in ihr nicht mehr nur die attraktive Frau, die ich gern in meinem Bett hätte, sondern die Person, die sie wirklich war.
„Das tut mir sehr leid“, murmelte ich.
„Mir auch“, flüsterte sie, dann schluckte sie. „Ich wäre gerne dabei, wenn du eine Taucherin mit Tiefseeerfahrung anheuern willst.“
„Ja, äh, genau. So jemanden brauche ich und … mein Vater hatte deinen Namen schon bei der Crew, die er zusammenstellen wollte, aufgelistet, von daher denke ich, es wäre auch in seinem Sinne.“
„Also habe ich den Job?“
„Willst du denn nicht erst erfahren, was du dabei verdienst?“
„Wir werden uns schon einigen.“
„Okay.“ Ich streckte ihr die Hand hin. „In dem Fall bist du eingestellt, willkommen im Team.“ Lou schlug ein. Ein mulmiges Gefühl machte sich in mir breit. Eigentlich sollte ich mich freuen, denn ich hatte soeben das erste Mitglied meiner Crew angeworben. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass diese Lou mir schon jetzt mehr unter die Haut ging, als gut für mich war.
LOU
Einen Moment lang stand ich da und starrte Tyler hinterher. Hatte ich das gerade geträumt oder wurde ich soeben wirklich für die Tauchexpedition eines Meeresbiologen angeheuert? Mir kam diese ganze Szene im Nachhinein total unwirklich vor. Ich, eine kleine unbekannte Tauchlehrerin auf den Keys, sollte an so einem Projekt mitarbeiten? Nein, das konnte nicht real sein!
Was dagegen sehr real war, war der Streit mit meinem Bruder. Ich hasste es, wenn er den Bodyguard raushängen ließ, und er wusste das ganz genau.Schon als ich ein Teenie war, führte er sich so auf und beobachtete jedes männliche Wesen, das mir auch nur einen Hauch zu nahekam, mit Argusaugen – am liebsten vertrieb er sie sofort wieder. Doch obwohl ich dieses Theater affig fand, noch schlimmer war es für mich, mit Dylan zu streiten.
Seufzend wandte ich den Blick von der Tür ab und kehrte ins Hinterzimmer zurück. Der Kühlschrank in der hinteren Ecke brachte mich auf eine Idee. Schnell holte ich zwei Flaschen Bier heraus, dann machte ich mich auf den Weg, Dylan zu suchen. Ich hatte so eine Ahnung, wo er sich rumtreiben würde, und ich sollte recht behalten.
An Deck der Odyssey, dem größten unserer Schiffe, entdeckte ich meinen Bruder. Als ich an Bord ging, sah ich ihn fluchend über den auseinandergebauten Außenbordmotor gebeugt. Die Hände ölverschmiert untersuchte er gerade eine Schraube. Vielleicht war sie abgenutzt oder hatte sich gelockert. Auf jeden Fall war er dabei, den Motor zu reparieren.
„Hey …“, sprach ich ihn an.
Mit zusammengezogenen Augenbrauen schaute er zu mir auf. Dann wischte er sich die Finger an einem alten Lappen ab und hockte sich auf die Fersen.
„Ist der Spacken endlich weg?“, fragte er aggressiv und ich seufzte. „Dylan, bitte …“
„Nein!“, unterbrach er mich sofort. „Kein ‚Dylan, bitte …‘! Dieser reiche Schnösel, wenn ich den nur sehe, geht mir schon der Puls hoch. Der will doch nur eins von dir – und das ist ganz sicher nicht, dass du ihn auf eine Expedition begleitest. Ich hoffe, du hast ihm gehörig den Marsch geblasen und ihn achtkantig rausgeworfen.“
Bevor ich antwortete, drückte ich meinem Bruder eine der Bierflaschen in die Hand.
„Können wir bitte vernünftig miteinander reden? Ich mag nicht mit dir streiten“, sagte ich, ohne auf seine Ansage zu reagieren.
Es dauerte einen Moment, dann erkannte ich, wie die Anspannung aus Dylans Körper wich. Er stand auf, gab mir einen Kuss auf die Wange und stieß mit seiner Bierflasche leicht gegen meine. Ein leises Klirren erklang, als Glas auf Glas traf. „Du hast recht. Ich will auch nicht mit dir streiten – erst recht nicht wegen eines solchen Idioten.“