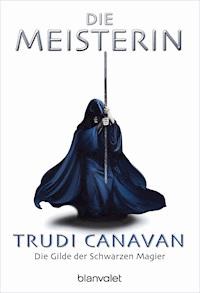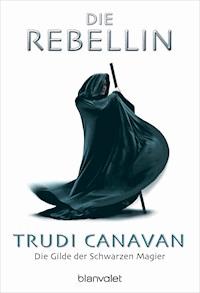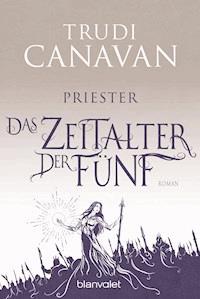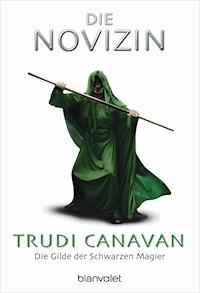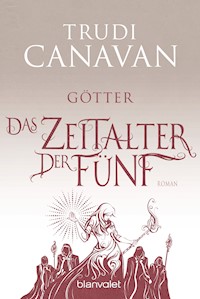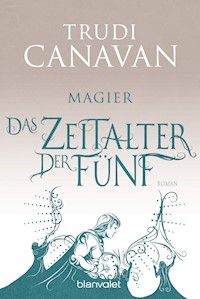9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: SONEA
- Sprache: Deutsch
Der Schwur der schwarzen Magierin
Lorkin, der Sohn der schwarzen Magierin Sonea, wurde in Sachaka entführt. Seine Häscher hoffen, von ihm die Kunst der Heilung durch Magie zu erlernen, die in Sachaka unbekannt ist. Lorkin weiß jedoch, dass diese Fähigkeit im Falle eines Krieges einen enormen Vorteil birgt. Er ist fest entschlossen, das Geheimnis zu wahren. Aber dann lernt er Tyvara kennen – und verliebt sich in sie ...
Währenddessen verfolgt seine Mutter Sonea in ihrer Heimat Kyralia einen abtrünnigen Magier, der seine Dienste an die Diebesgilde verkauft hat. Doch ein Mord, begangen mit schwarzer Magie, lenkt sie von ihrer Aufgabe ab. Denn es gibt nur zwei Magier, die dazu fähig sind: der Schwarze Magier Kallen, der ein wasserdichtes Alibi hat – und Sonea selbst! Sonea muss alles daran setzen, das Vertrauen der Magiergilde zurückzuerlangen. Denn ohne sie ist Kyralia einem Angriff der Schwarzen Magier von Sachaka hilflos ausgeliefert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 779
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Autorin
Trudi Canavan wurde 1969 im australischen Melbourne geboren. Sie arbeitete als Grafikerin und Designerin für verschiedene Verlage und begann nebenbei zu schreiben. 1999 gewann sie den Aurealis Award für die beste Fantasy-Kurzgeschichte. Ihr Erstlingswerk, der Auftakt zur Trilogie Die Gilde der Schwarzen Magier, erschien 2001 in Australien und wurde weltweit ein riesiger Erfolg. Seither stürmt sie mit jedem neuen Roman die internationalen Bestsellerlisten.
Außerdem von Trudi Canavan erschienen:
Die Vorgeschichte zur Gilde der Schwarzen Magier:Magie
Die Gilde der Schwarzen Magier:
1. Die Rebellin
2. Die Novizin
3. Die Meisterin
Sonea:
1. Die Hüterin
2. Die Heilerin
3. Die Königin
Das Zeitalter der Fünf:
1. Priester
2. Magier
3. Götter
Die Magie der tausend Welten:
1. Die Begabte
2. Der Wanderer
3. Die Mächtige
4. Die Schöpferin
Trudi Canavan
Die
Heilerin
Die Saga von Sonea 2
Roman
Deutsch von Michaela Link
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel»The Traitor Spy 2: The Rogue«bei Orbit, an imprint of Little, Brown Book Group, an Hachette Livre UK company, London.
© der Originalausgabe 2011 by Trudi Canavan
© der deutschsprachigen Ausgabe 2011 by Penhaligon Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft, München
Coverillustration: © Isabelle Hirtz unter Verwendung einer Fotografie von Olga Kessler
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-05964-4V005
www.blanvalet.de
ERSTER TEIL
1 Die Höhlen der Steinemacher
Nach einer alten sachakanischen Tradition, an deren Ursprung sich niemand mehr erinnern konnte, galt der Aspekt des Sommers als männlich, der des Winters als weiblich. Nun predigten die Anführerinnen und Vordenkerinnen der Verräterinnen schon seit Jahrhunderten, alle diese abergläubischen Vorstellungen über Männer und Frauen – insbesondere über Frauen – seien lächerlich, aber viele ihrer Mitglieder fanden noch immer, dass die Jahreszeit, die in ihrem Bergrefugium die größte Kontrolle über ihr Leben hatte, viel mit der weiblichen Kraft gemeinsam habe. Der Winter der Berge war machtvoll, gnadenlos und brachte Menschen zusammen, damit sie so gut wie möglich überleben konnten.
Im Gegensatz dazu war der Winter in den Tiefländern und Wüsten Sachakas ein Segen – er brachte den Regen, dessen es für eine gute Ernte und das Vieh bedurfte. Der Sommer dort war dagegen hart, trocken und unproduktiv.
Als Lorkin vom Kräuterhaus zurückeilte, war es in dem Tal deutlich kälter, als er erwartet hatte. Es lag bereits eine Ahnung von Schnee und Eis in der Luft. Seinem Gefühl nach lebte er noch nicht lange genug im Sanktuarium, als dass der Winter so kurz bevorstehen konnte. Es waren nur wenige Monate verstrichen, seit er die geheime Heimat der sachakanischen Rebellinnen erreicht hatte. Zuvor war er unten in den warmen, trockenen Tiefländern auf der Flucht gewesen, in Begleitung einer Frau, die ihm das Leben gerettet hatte.
Tyvara. Etwas in seiner Brust verkrampfte sich auf eine unbehagliche und doch seltsam angenehme Weise. Lorkin holte tief Luft und beschleunigte seine Schritte. Er war entschlossen, dieses Gefühl ebenso energisch zu ignorieren, wie Tyvara ihn ignorierte.
Ich bin nicht nur deshalb hierhergekommen, weil ich mich in sie verliebt habe, sagte er sich. Es war für ihn eine Frage der Ehre gewesen, vor ihren Leuten zu Tyvaras Verteidigung zu sprechen, da sie ihm das Leben gerettet hatte. Sie hatte die Attentäterin getötet, die versucht hatte, ihn zu verführen und zu ermorden, aber die Attentäterin war ebenfalls eine Verräterin gewesen. Riva hatte im Auftrag einer Gruppe gehandelt, die fand, er solle bestraft werden für das Versäumnis seines Vaters, des ehemaligen Hohen Lords Akkarin, einen vor vielen Jahren mit den Verräterinnen geschlossenen Handel nicht eingehalten zu haben.
Niemand aus der Gruppe, die seine Bestrafung wollte, hatte zugegeben, Riva den Befehl zu seiner Ermordung erteilt zu haben. Ein solcher Befehl hätte bedeutet, dass der Betreffende sich den Wünschen der Königin widersetzt hätte. Also tat die ihm feindlich gesinnte Gruppe, als sei der Mordanschlag ganz und gar Rivas Idee gewesen.
Es gibt Rebellen innerhalb der Rebellen, ging es Lorkin durch den Kopf.
Seine Aussage zugunsten Tyvaras mochte sie vor der Hinrichtung bewahrt haben, aber einer Bestrafung war sie dennoch nicht entkommen. Vielleicht war es die Arbeit, die Rivas Familie ihr zugewiesen hatte, die sie von ihm fernhielt. Wie auch immer, er hatte jedenfalls die Einsamkeit eines Fremden an einem fremden Ort zur Genüge kennengelernt.
Er hatte den Fuß der Felswand, die sich rings um das ganze Tal zog, fast erreicht. Beim Blick auf die zahlreichen Fenster und Türen, die auf dieser Talseite in den Fels gehauen worden waren, wusste Lorkin, dass Zeiten kommen mussten, da er sich in diesem Ort gefangen fühlen würde. Nicht wegen der strengen Winter, die es notwendig machten, in den Höhlen im Fels zu bleiben, sondern weil ihm als Fremdem, der die ungefähre Lage dieser Heimstatt der Verräterinnen kannte, niemals erlaubt werden würde, diesen Ort wieder zu verlassen.
Hinter den Fenstern und Türen gab es genug Raum im Fels, um die Bevölkerung einer kleinen Stadt zu beherbergen. Die kleinsten Höhlen waren vielleicht schrankgroß, die größten hatten das Format der Gildehalle. Die meisten waren nicht allzu tief in den Fels gehauen worden, da es in der Vergangenheit Beben und Einstürze gegeben hatte und die Menschen sich wohler fühlten, wenn der Weg ins Freie kurz genug war, um schnell hinauslaufen zu können.
Einige Gänge aber reichten tief in den Fels hinein. Diese waren die Domäne der Magierinnen unter den Verräterinnen – der Frauen, die diesen Ort trotz ihrer Behauptung, es handele sich um eine gleichberechtigte Gemeinschaft, allein regierten. Vielleicht machte es ihnen nichts aus, in größerer Tiefe zu leben, weil sie mit ihrer Magie verhindern konnten, dass ein Einsturz sie zerquetschte. Möglicherweise wollen sie aber einfach nur in der Nähe der Höhlen bleiben, in denen die magischen Kristalle und Steine gemacht werden.
Bei diesem Gedanken verspürte Lorkin ein Prickeln der Erregung. Er schob sich den Kasten, den er trug, auf die andere Schulter und trat durch den überwölbten Eingang in die Stadt. Vielleicht werde ich es heute Abend herausfinden.
Die Gänge der unterirdischen Stadt waren belebt; es war die Zeit, da viele Arbeiter zu ihren Familien zurückkehrten. An einer Stelle versperrten Lorkin zwei Kinder den Weg, die ganz in ihr Gespräch versunken waren.
»Verzeihung«, sagte er automatisch, während er sich an ihnen vorbeidrückte.
Die Kinder und einige umstehende Erwachsene blickten ihn erheitert an. Kyralische Manieren verwirrten alle Sachakaner. Bei den Ashaki und deren Familien, den mächtigen freien Bewohnern des Tieflands, war das Gefühl, dass sie ein selbstverständliches Recht auf die Dienste anderer hatten, zu stark ausgeprägt, um es für notwendig zu erachten, Dankbarkeit dafür zu zeigen – und es wäre ihnen auch lächerlich erschienen, Sklaven für etwas zu danken, das sie taten, weil sie keine andere Wahl hatten. Obwohl die Verräterinnen keine Sklaven hielten und ihre Gesellschaft angeblich auf dem Prinzip der Gleichheit beruhte, hatten sie keinen Sinn für gute Manieren entwickelt. Zuerst hatte Lorkin versucht, es ihnen gleichzutun, aber er wollte seine guten Manieren nicht in einem solchen Maß aufgeben, dass seine eigenen Leute ihn später unhöflich fanden, sollte er jemals nach Kyralia zurückkehren.
Sollen die Verräterinnen mich doch seltsam finden, das ist besser als undankbar oder hochmütig.
Nicht dass die Verräterinnen unfreundlich oder ohne Wärme gewesen wären. Sowohl Männer als auch Frauen hatten sich überraschend herzlich gezeigt. Einige der Frauen hatten sogar versucht, ihn in ihre Betten zu locken, aber er hatte höflich abgelehnt. Vielleicht bin ich ein Narr, aber ich habe Tyvara noch nicht aufgegeben.
Als Lorkin sich der Krankenstation näherte, wo er an den meisten Tagen arbeitete, mäßigte er sein Tempo, um wieder zu Atem zu kommen. Die Station wurde von Sprecherin Kalia geleitet, der inoffiziellen Führerin der Partei, die seine Ermordung befohlen hatte. Er wollte sie nicht wissen lassen, dass er den Weg rasch zurückgelegt hatte, und ihr auch nicht das Gefühl geben, er habe es besonders eilig, mit seinen Arbeiten des Tages fertig zu werden. Wenn sie daraus folgerte, dass es ihm wichtig sei, pünktlich Feierabend zu machen, würde sie eine weitere Aufgabe für ihn finden, um ihn länger festzuhalten. Wenn es andererseits nichts Rechtes mehr für ihn zu tun gab, hütete er sich, einfach auszuruhen und die Hände in den Schoß zu legen, denn dann fand sie ebenso rasch etwas Neues für ihn zu tun, und oft etwas ebenso Unangenehmes wie Unnötiges.
Wenn er allerdings hereingeschlendert kam, als habe er alle Zeit der Welt, würde sie ihn auch dafür bestrafen. Also nahm er seine gewohnt ruhige, stoische Haltung ein. Kalia entdeckte ihn, verdrehte die Augen und nahm ihm mittels ihrer Magie die Kiste ab.
»Warum benutzt du nie deine Kräfte?«, fragte sie und wandte sich seufzend ab, um die Kiste in den Lagerraum zu bringen.
Er ignorierte ihre Frage. Sie würde sicher nicht gern hören, dass Lord Rothen, sein alter Lehrer in der Gilde, der Überzeugung war, dass ein Magier nicht jede körperlich anstrengende Tätigkeit durch Rückgriff auf seine Magie vermeiden sollte, um nicht auf Dauer schwach und kränklich zu werden.
»Willst du, dass ich dir dabei helfe?«, fragte er. Die Kiste war voller Heilkräuter, die nun zu Heilmitteln verarbeitet werden mussten – Heilmittel, deren Rezeptur er gern kennenlernen wollte.
Sie blickte ihn über die Schulter hinweg an und runzelte die Stirn. »Nein. Halte ein Auge auf die Patienten.«
Er zuckte die Achseln, um sich seine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen, drehte sich um und ließ den Blick über den großen Saal der Krankenstation schweifen. Seit dem frühen Morgen, als er mit der Arbeit des Tages begonnen hatte, hatte sich nicht viel geändert. Die meisten der in Reihen aufgestellten Betten waren leer. Es waren lediglich einige Kinder da, die sich von typischen Kinderkrankheiten oder Verletzungen erholten, und eine alte Frau mit einem gebrochenen Arm. Alle schliefen.
Es war Kalias Idee gewesen, ihn auf der Krankenstation einzusetzen – zweifellos zur Prüfung seiner Entschlossenheit, die Verräterinnen keine heilende Magie zu lehren. Bisher waren keine Patienten eingeliefert worden, die drohten, an solchen Krankheiten oder Verletzungen zu sterben, die er nur mit Magie hätte heilen können, aber irgendwann würde es so weit sein. Er rechnete damit, dass Kalia in diesem Fall versuchen würde, die Menschen gegen ihn aufzuwiegeln. Aber er hatte einen Plan, wie er Kalia entgegentreten konnte. Allerdings verbarg sich hinter Kalias mütterlichem Erscheinungsbild und Gehabe ein scharfer Verstand, und sie hatte seine Absichten vielleicht bereits erraten. Er konnte nur abwarten.
Aber gerade jetzt konnte er das nicht. Er wurde anderenorts erwartet. Er war schon reichlich spät dran, und mit jedem verflossenen Augenblick wurde es später. Also folgte er Kalia in den Lagerraum.
»Sieht aus, als hättest du sehr viel Arbeit«, stellte er fest.
Sie blickte nicht zu ihm auf. »Ja. Ich werde die ganze Nacht aufbleiben.«
»Du hast schon letzte Nacht nicht geschlafen«, rief er ihr in Erinnerung. »Das tut dir nicht gut.«
»Sei nicht dumm«, fuhr sie ihn an. »Ich bin durchaus in der Lage, ohne Schlaf auszukommen. Diese Arbeit muss jetzt getan werden. Von jemandem, der weiß, was er tut.« Sie wandte sich ab. »Geh. Nimm du dir die Nacht frei.«
Lorkin ließ ihr keine Möglichkeit, ihre Meinung zu ändern. Mit einem stillen Lächeln kehrte er der Krankenstation den Rücken. Die Heiler der Gilde wussten, wie verheerend Schlafmangel sich auf den Körper auswirken konnte, weil sie es spürten. Die Magier der Verräterinnen wussten jedoch nicht, wie man mit Magie heilte, und da sie die Folgen ihrer Irrtümer niemals am eigenen Leib spürten, hielten sie an einigen seltsamen Auffassungen fest.
Er hatte nicht versucht, sie zu belehren, da es nicht taktvoll gewesen wäre, sie an das zu erinnern, was sie nicht wussten. Vor vielen Jahren hatte sein Vater versprochen, die Verräterinnen im Gegenzug für Kenntnisse der schwarzen Magie das Heilen durch Magie zu lehren – obwohl er nicht die Erlaubnis der Gilde hatte, dieses Wissen weiterzugeben, und, schlimmer noch, schwarze Magie in der Gilde verboten war.
Zu der Zeit hatten viele Kinder der Verräterinnen an einer tödlichen Krankheit gelitten, und Kenntnisse heilender Magie hätten sie vielleicht gerettet. Akkarin war nach Kyralia zurückgekehrt und hatte seine Seite des Handels niemals erfüllt. Seit er von dem gebrochenen Versprechen seines Vaters erfahren hatte, hatte Lorkin viele mögliche Gründe in Erwägung gezogen. Sein Vater hatte gewusst, dass der Bruder des Ichani, der ihn versklavt hatte, eine Invasion Kyralias plante. Er könnte sich verpflichtet gefühlt haben, sich zuerst um diese Bedrohung zu kümmern. Vielleicht konnte er die Bedrohung nicht erklären, ohne zu offenbaren, dass er verbotene schwarze Magie erlernt hatte. Möglicherweise war es ihm zu gefährlich erschienen, allein nach Sachaka zurückzukehren und eine neuerliche Gefangennahme durch die Ichani oder die Rache des Bruders seines ehemaligen Herrn zu riskieren.
Vielleicht hatte er auch niemals beabsichtigt, sein Versprechen zu erfüllen. Schließlich hatten die Verräterinnen einige Zeit, bevor sie ihre Hilfe anboten, von seiner schrecklichen Situation gewusst, während sie anderen – im Wesentlichen sachakanischen Frauen – ständig halfen, ohne einen Preis dafür zu verlangen. Dass sie Akkarin erst dann geholfen hatten, seine Freiheit wiederzuerlangen, als es für sie von Vorteil war, zeigte gewiss, wie skrupellos sie sein konnten.
Inzwischen war Lorkin in einem Teil der Stadt angelangt, dessen Gänge weniger belebt waren, so dass er rascher vorankam und sogar in Laufschritt verfallen konnte, ohne dabei beobachtet zu werden. Falls jemand aus Kalias Partei ihn in Eile sah, würde er es ihr vielleicht zutragen.
Tyvara hatte behauptet, er werde eine friedliche Gesellschaft antreffen, eine gerechte, doch das Leben hier entsprach nicht ganz ihren Beteuerungen, trotz des Prinzips der Gleichheit, das die Verräterinnen so hoch schätzten. Wie dem auch sei, sie machen ihre Sache besser als viele andere Länder, insbesondere der Rest von Sachaka. Sie kennen keine Sklaverei, und die Arbeit wird größtenteils aufgrund von Fähigkeiten verteilt und nicht aufgrund eines ererbten Klassensystems. Männer und Frauen mögen nicht wirklich gleichgestellt sein, aber das ist in allen Kulturen so – nur immer mit anderem Vorzeichen. Und die meisten Kulturen behandeln die Frauen sehr viel schlechter, als die Verräterinnen ihre Männer behandeln.
Er dachte an seinen inzwischen engsten Freund im Sanktuarium, einen Mann namens Evar, den er gleich treffen würde. Der junge Magier hatte sich aus Neugier zu Lorkin hingezogen gefühlt, weil Lorkin im Sanktuarium der einzige andere männliche Magier war, der sich noch mit keiner Frau zusammengeschlossen hatte. Lorkin hatte herausgefunden, dass sein erster Eindruck zum Status männlicher Magier falsch gewesen war: Er hatte vermutet, dass die Verräterinnen männlichen, magisch begabten Personen die gleichen Möglichkeiten bieten würden, Magie zu erlernen, wie sie die Frauen hatten. Tatsächlich waren aber alle männlichen Magier hier »natürliche«, deren Magie sich auf ursprüngliche Weise entwickelt hatte und nicht erst freigesetzt werden musste. Es war den Verräterinnen also nichts anderes übrig geblieben, als sie entweder zu unterrichten oder sie zum Sterben außerhalb des Sanktuariums auszusetzen, bevor sie die Kontrolle über ihre Kräfte verloren. Anderen männlichen Verrätern dagegen wurde keine Magie gelehrt.
Die wenigen glücklichen männlichen Naturmagier waren den Frauen jedoch trotzdem nicht ebenbürtig: Männer durften keine schwarze Magie erlernen. Dies stellte sicher, dass selbst schwache weibliche Magier mächtiger waren als die männlichen, weil sie ihre Kräfte mit schwarzer Magie stärken konnten.
Ich frage mich … hätte man mir Einlass ins Sanktuarium gewährt, wenn ich mich auf schwarze Magie verstünde?
Er dachte nicht weiter darüber nach, denn er hatte jetzt sein Ziel erreicht: den »Männerraum«. Es war eine große Höhle, in der diejenigen Männer lebten, die zu alt waren, um noch bei ihren Eltern zu wohnen, und noch von keiner Frau als Gefährte ausgewählt worden waren.
Evar unterhielt sich mit zwei anderen Männern, als Lorkin eintrat, kehrte ihnen jedoch den Rücken, sobald er seinen Freund bemerkte. Wie die meisten männlichen Verräter war er schmal und feinknochig, ganz anders als die typischen freien Sachakaner aus dem Tiefland mit ihrem hohen Wuchs und den breiten Schultern. Nicht zum ersten Mal fragte sich Lorkin, ob die Männer der Verräterinnen über viele Generationen hinweg kleiner geworden waren – gewissermaßen, um sich ihrem sozialen Status anzupassen.
»Evar«, sagte Lorkin. »Tut mir leid, dass ich spät dran bin.«
Evar zuckte die Achseln. »Lass uns essen.«
Lorkin zögerte, folgte seinem Freund dann aber in den Küchenbereich, wo ein großer Topf mit dampfender Suppe, die einer der ihren zubereitet hatte, auf die Männer wartete. Das gehörte nicht zu ihrem Plan. War er so spät, dass Evar seine Pläne inzwischen geändert hatte?
»Werden wir den Ausflug, den du vorgeschlagen hast, noch machen?«, erkundigte sich Lorkin so beiläufig wie möglich.
Evar nickte. »Wenn du es dir nicht anders überlegt hast.« Er beugte sich etwas dichter zu Lorkin hinüber. »Einige der Steinemacherinnen arbeiten länger«, murmelte der junge Magier. »Wir müssen ihnen Zeit lassen, ihre Arbeit fertigzustellen und heimzugehen.«
Lorkin spürte leichten Aufruhr in seinen Eingeweiden. »Bist du dir sicher, dass du das tun willst?«, fragte er, während sie mit ihren Tellern zu einem der langen Esstische hinübergingen und sich dort – etwas abseits von den anderen, die bereits aßen – einen Platz suchten.
Evar schlürfte etwas Suppe, schluckte und bedachte Lorkin dann mit einem beruhigenden Lächeln. »Nichts, was ich dir zeige, ist geheim. Jeder, der es sich ansehen will, kann das ohne Weiteres tun, solange er sich still verhält und niemandem in die Quere kommt. Was dir ebenfalls gelingen sollte.«
»Aber ich bin nicht irgendjemand.«
»Du bist angeblich einer von uns. Der einzige Unterschied ist, dass man dir gesagt hat, dass du nicht fortgehen darfst. Ich bezweifle, dass ich, wenn ich fortzugehen versuchte, ohne Erlaubnis weit käme und dass man mir eine solche Erlaubnis geben würde. Sie sehen es nicht gern, wenn sich viele von uns außerhalb der Stadt aufhalten. Jeder Spion stellt ein Risiko dar, selbst mit den Steinen, die vor dem Gedankenlesen schützen. Denn was nützt dir ein Stein in der Hand, wenn dir die Hand abgeschlagen wird?«
Lorkin verzog das Gesicht. »Trotzdem bezweifle ich, dass irgendjemand darüber glücklich sein wird, dass ich dort bin«, bemerkte er und wandte sich wieder dem eigentlichen Thema zu. »Oder darüber, dass du mich hinbringst.«
Evar schluckte den letzten Bissen seiner Mahlzeit herunter. »Wahrscheinlich nicht. Aber meine Tante Kalia liebt mich.« Lorkin hatte Kalia zwar nie mit Evar plaudern sehen, aber sie schien ihren Neffen tatsächlich zu schätzen. »Willst du das noch essen?«
Lorkin schüttelte den Kopf und schob die Reste seines Mahls beiseite. Er war zu nervös, um viel zu essen. Evar betrachtete stirnrunzelnd den halbvollen Teller, sagte jedoch nichts und aß den Rest einfach selbst. Da die landwirtschaftlichen Flächen im Tal knapp waren, sahen die Verräterinnen Verschwendung nicht gern. Und Evar war ständig hungrig. Die beiden erhoben sich, säuberten das Geschirr, das sie benutzt hatten, räumten es weg und verließen dann den Männerraum. Lorkin spürte, wie ihm seine Nervosität den Magen zusammenschnürte, aber gleichzeitig war er ungeduldig und voller Erwartung.
»Wir werden durch einen der hinteren Gänge gehen«, murmelte Evar. »Dort ist die Gefahr geringer, dass man dich bemerken wird, wenn du hineingehst.«
Während sie unterwegs waren, überlegte Lorkin sich noch einmal, was er eigentlich durch seinen Besuch der Höhlen herauszufinden hoffte. Die Gilde hielt schon jahrhundertelang daran fest, dass es keine wahren magischen Gegenstände gab, nur gewöhnliche Dinge, denen durch Magie strukturelle Integrität oder verbesserte Eigenschaften verliehen wurden – wie zum Beispiel durch Magie verstärkte Gebäude oder die Mauern, die in der Universität leuchteten –, weil sie aus Materialien bestanden, in denen Magie langsamer wirkte als gewöhnlich, so dass ihr Effekt noch erhalten blieb, lange nachdem ein Magier seine Arbeit daran beendet hatte. Selbst den gläsernen Blutsteinen, die die Gedankenrede zwischen dem Träger und dem Schöpfer des Rings kanalisierten, und zwar auf eine Art und Weise, die verhinderte, dass andere Magier sie hören konnten, gestand man keine eigene Magie zu.
Er vermutete nun, dass einige der Edelsteine im Sanktuarium tatsächlich Magie enthielten. Die meisten davon waren allerdings eher wie Blutsteine – es wurde Magie hineingegeben, die dann von dem Stein zu einem bestimmten Zweck umgeformt wurde. Alle Verräterinnen, die sich aus ihrem geheimen Zuhause herauswagten, trugen einen winzigen Stein unter der Haut, der es ihnen nicht nur gestattete, ihren Geist zu schützen, falls ein sachakanischer Magier ihre Gedanken las, sondern es ihnen auch ermöglichte, einen Gedankenleser stattdessen unschuldige, sichere Gedanken sehen zu lassen. Die Flure und Räume innerhalb der Stadt wurden mit Edelsteinen beleuchtet, die Licht spendeten. Die Krankenstation, auf der Lorkin sich um die Patienten kümmerte, barg mehrere Steine mit nützlichen Eigenschaften, angefangen von der Schaffung eines warmen Leuchtens oder einer sanften Vibration, um verkrampfte Muskeln zu lockern, bis hin zu Steinen, die Wunden ausbrennen konnten.
Falls die historischen Unterlagen, auf die Lorkin und Dannyl gestoßen waren, korrekt waren, dann war es auch möglich, in einem Edelstein unermessliche Mengen von Magie zu lagern. Vor vielen hundert Jahren hatte es einen Lagerstein in der sachakanischen Hauptstadt Arvice gegeben. Chari, die Frau, die ihm und Tyvara geholfen hatte, sicher bis zum Sanktuarium zu gelangen, behauptete, die Verräterinnen wüssten von Lagersteinen, hätten jedoch keine Ahnung, wie man sie herstellte. Vielleicht hatte sie die Wahrheit gesagt, vielleicht aber auch gelogen – möglicherweise, um ihre eigenen Leute zu schützen.
Falls es Kenntnisse über die Fertigung solcher Lagersteine gab, könnte es die Gilde der Notwendigkeit entheben, einigen Magiern zu gestatten, schwarze Magie zu erlernen für den Fall, dass es erneut zu einer Invasion sachakanischer Magier kam. Stattdessen könnte Magie in den Steinen gelagert werden, um sie für die Verteidigung des Landes zu benutzen.
Das war der Grund, warum er es riskierte, die Höhlen der Steinemacher zu besuchen. Er war nicht darauf aus zu lernen, wie die Steine hergestellt wurden, er wollte sich nur versichern, dass sie das Potenzial besaßen, das er sich von ihnen erhoffte. Denn dann könnte er vielleicht ein Tauschgeschäft zwischen der Gilde und den Verräterinnen aushandeln: die Kunst des Steinemachens gegen die Kunst der Heilung mittels Magie. Es wäre ein Tausch, von dem beide Seiten profitierten.
Er wusste, dass es harter Arbeit bedürfen würde, die Verräterinnen dazu zu bewegen, einen solchen Tausch überhaupt in Erwägung zu ziehen. Nachdem sie sich schon jahrhundertelang vor den Ashaki versteckten, waren sie sehr rigoros, was den Schutz ihres geheimen Zuhauses und ihrer Lebensweise anging. Sie gestatteten ihren Leuten keinerlei Gebrauch der Gedankenrede, um jede Möglichkeit auszuschließen, auf ihre Stadt und deren Lage aufmerksam zu machen. Mit wenigen Ausnahmen waren die einzigen Verräterinnen, die das Tal verlassen und wieder zurückkehren durften, die Spioninnen.
Aber während er Evar tiefer in das unterirdische Netzwerk von Gängen folgte, fragte sich Lorkin, ob es nicht zu früh für ihn war, die Höhlen aufzusuchen. Er wollte den Verräterinnen keinen Grund geben, ihm zu misstrauen.
Aber als einem Fremdländer würden sie ihm vielleicht ohnehin nie voll und ganz trauen. Und es reichte ihm auch so viel Vertrauen, dass er sie dazu bringen konnte, mit der Gilde und den Verbündeten Ländern Handel zu treiben. Und über kurz oder lang wird ihnen auffallen, dass sie versäumt haben, mir offiziell einen Besuch in den Höhlen zu verbieten, und sie werden das schleunigst nachholen. Ich muss also jetzt die Gelegenheit nutzen.
Evar hatte ihn noch auf einen weiteren Aspekt ihres Plans hingewiesen. »Die Verräterinnen treffen ihre Entscheidungen selbst – oder besser: Sie schätzen es nicht, wenn andere eine Entscheidung für sie treffen. Wenn du willst, dass sie etwas tun, musst du sie glauben machen, dass es sich um ihre eigene Idee handelt. Wenn uns jemand bei der Besichtigung der Höhlen entdeckt, dann hast du sie immerhin mit dem Kopf darauf gestoßen, dass sie etwas haben, das der Gilde wohl die Weitergabe der magischen Heilkunst wert sein könnte.«
»Da wären wir«, sagte Evar und drehte sich zu Lorkin um.
Der Flur war hier so schmal, dass sie nicht mehr nebeneinander gehen konnten. Evar war vor einem Durchgang stehen geblieben. Über Evars Schulter sah Lorkin, dass er in einen hell erleuchteten Raum führte.
Es gibt nicht einmal eine Tür, bemerkte er. Warum halten sie den Raum nicht verschlossen, wenn er ein Geheimnis birgt? Vielleicht weil es kein gar so großes Geheimnis ist?
Evar gab ihm ein Zeichen und trat durch die Öffnung. Lorkin folgte ihm und blickte sich in der riesigen Höhle um. Außer ihnen schien niemand da zu sein. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf die Höhlenwände, und sein Herz setzte einen Schlag aus.
Sie waren über und über mit einer Unzahl glitzernder, bunter Edelsteine bedeckt. Zuerst dachte er, die Anordnung der Steine sei willkürlich, aber langsam zeichneten sich vor seinen Augen Bänder, Wirbel und Flächen ähnlicher Farbtöne ab. Als er sich umdrehte, um die Wand hinter ihnen genauer zu betrachten, stellte er fest, dass die Steine unterschiedlich groß waren – manche nur winzige Punkte, andere daumennagelgroß.
»Da machen wir die Lichtsteine«, erklärte Evar, bedeutete ihm zu folgen und trat auf einen blendend hellen Bereich der Wand zu. »Ihre Herstellung ist am einfachsten, und man sieht auch sofort, ob sie gut geworden sind. Man braucht dazu nicht einmal einen Duplikatorstein.«
»Duplikatorstein?«, wiederholte Lorkin. Evar hatte solche Steine schon früher erwähnt, aber Lorkin hatte ihren Verwendungszweck niemals ganz verstanden.
»Einen von diesen hier.« Evar wechselte abrupt die Richtung und führte Lorkin zu einem der vielen Tische in der Höhle. Er öffnete eine hölzerne Schatulle, in der in einem Bett aus feinen, daunigen Fasern ein einzelner Edelstein lag. »Bei den Lichtsteinen braucht man den wachsenden Steinen lediglich den gleichen Gedanken einzugeben, den man benutzt, um ein magisches Licht zu erschaffen. Aber bei Steinen mit komplizierteren Verwendungszwecken ist es einfacher, man nimmt einen, der bereits fertig ist und einwandfrei funktioniert, und projiziert dessen Struktur in den neu zu schaffenden Stein. Das verringert die Fehlerquote und die Zahl mangelhafter Steine, außerdem kann man mehrere Steine gleichzeitig wachsen lassen.«
Lorkin nickte. Dann deutete er auf einen anderen Bereich. »Was tun diese Steine?«
»Eine Barriere schaffen und aufrecht halten. Sie werden benutzt, um vorübergehend Wasser einzudämmen oder Steinmuren aufzuhalten. Sieh dir mal das hier an …« Sie gingen zu einer Wand mit winzigen schwarzen Kristallen. »Das werden Gedankenblocker. Ihre Herstellung dauert lange, weil sie so kompliziert sind. Es wäre einfacher, wenn sie lediglich die Gedanken des Trägers beschirmen müssten, aber sie müssen dem Träger auch die Möglichkeit geben, die Gedanken auszusenden, die ein Gedankenleser vorzufinden erwartet, um ihn in die Irre zu führen.« Evar betrachtete die winzigen Steine voller Bewunderung. »Wir haben sie nicht erfunden – wir haben sie früher von den Duna-Stämmen gekauft.«
Lorkin erinnerte sich plötzlich an Dannyls Warnung, dass die Verräterinnen die Kenntnisse für die Herstellung von Edelsteinen vom Volk der Duna gestohlen hätten. Vielleicht war das nur die Art, wie die Duna es sahen. Vielleicht war es ein weiterer Handel gewesen, der schiefgegangen war, wie der zwischen seinem Vater und den Verräterinnen.
»Treibt ihr immer noch Handel mit ihnen?«, fragte er.
Evar schüttelte den Kopf. »Wir haben sie schon vor Jahrhunderten an Kenntnissen und Fähigkeiten übertroffen.« Er schaute nach rechts. »Hier sind einige, die wir selbst entwickelt haben.« Sie näherten sich einem Bereich mit großen Edelsteinen, deren Oberfläche Licht mit einem Schillern reflektierte, das Lorkin an das Perlmutt exotischer, polierter Muscheln erinnerte. »Dies sind Rufsteine. Sie sind wie Blutsteine. Sie ermöglichen es uns, über eine gewisse Entfernung hinweg miteinander zu kommunizieren, aber man braucht dazu immer zwei Steine, die dicht nebeneinander gewachsen sind. Es kann schwierig sein, den Überblick darüber zu behalten, welche Steine miteinander verbunden sind, daher können wir noch nicht mit der Herstellung von Blutsteinen aufhören.«
»Warum solltet ihr damit aufhören?«
Evar sah ihn überrascht an. »Du kennst doch sicher ihre Schwächen?«
»Nun … lass mich raten: Der Schöpfer dieser Steine sieht nicht ständig die Gedanken des Trägers?«
»Ja, und nur die Nachricht, die der Benutzer aussendet, wird von dem Edelstein aufgefangen, nicht all seine Gedanken und Gefühle.«
»Jetzt verstehe ich, inwiefern das eine Verbesserung wäre.« Lorkin drehte sich um, um sich im Raum umzusehen. Es gab so viele verschiedene Steine, und überall an den Wänden standen teils überladene Tische. »Was bewirken diese Edelsteine?«, fragte er und deutete auf einen großen Bereich.
Evar zuckte die Achseln. »Ich weiß es nicht genau. Ich vermute, es ist ein Experiment. Irgendeine Art von Waffe.«
»Waffe?«
»Für die Verteidigung der Stadt, sollte es jemals zu einer Invasion kommen.«
Lorkin nickte und sagte nichts mehr. Fragen in Bezug auf Waffen würden selbst seinem neuen Freund verdächtig erscheinen.
»Waffensteine müssten etwas können, zu dem ein Magier selbst nicht in der Lage ist«, erklärte Evar weiter. »Das wäre für Magier von geringen Fähigkeiten oder geringer Ausbildung sehr nützlich, oder für einen, dessen Kraft erschöpft ist. Ich hoffe, sie machen unsere Angriffe zielsicherer. Ich war nicht besonders gut in den Kampfdisziplinen, also werde ich, sollten wir jemals angegriffen werden, alle Hilfe brauchen, die ich bekommen kann.«
»Würdest du überhaupt kämpfen?«, fragte Lorkin. »Soweit ich es verstehe, sind in Schlachten mit Schwarzmagiern niedere Personen wie du und ich nur als Quelle für zusätzliche Magie von Nutzen. Wir würden unsere Macht wahrscheinlich einem Schwarzmagier überlassen und dann irgendwo hingeschickt, wo wir nicht im Weg wären.«
Evar nickte und bedachte Lorkin mit einem Seitenblick. »Ich finde es immer noch seltsam, dass du höhere Magie ›schwarz‹ nennst.«
»Schwarz ist in Kyralia eine Farbe der Gefahr und der Macht«, erklärte Lorkin.
»Das hast du bereits gesagt.« Evar wandte den Blick ab und schaute sich im Raum um, als suche er nach etwas anderem, das er Lorkin zeigen konnte. Dann weiteten sich seine Augen, und er gab einen leisen Laut von sich. »Oh-oh.«
Als Lorkin sich in die Richtung wandte, in die sein Freund starrte, bemerkte er, dass eine junge Frau durch den größeren Haupteingang eingetreten war. Er widerstand der Versuchung, nach dem kleinen Hintereingang Ausschau zu halten; er musste einige Schritte entfernt sein, und die Frau würde sie gewiss jeden Augenblick bemerken.
Sieht so aus, als würden wir jetzt genau die Schwierigkeiten bekommen, vor denen Kalia uns gewarnt hat.
Einen Moment später blickte die Frau auf und entdeckte sie. Sie lächelte Evar zu, dann wanderte ihr Blick zu Lorkin, und ihr Lächeln verblasste. Sie blieb stehen, schaute ihn nachdenklich an, dann drehte sie sich um und verließ den Raum.
»Hast du genug gesehen? Denn ich denke, jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um zu gehen«, sagte Evar leise.
»Ja«, erwiderte Lorkin.
Evar machte einen Schritt auf den Hintereingang zu und hielt dann inne. »Nein, lass uns durch den Hauptflur gehen. Wir wollen jetzt, da man uns gesehen hat, keinen schuldbewussten Eindruck machen.«
Sie tauschten ein grimmiges Lächeln, holten tief Luft und gingen auf den Bogengang zu, durch den die Frau verschwunden war. Sie hatten ihn fast erreicht, als eine andere Frau ihnen mit verärgerter Miene entgegenkam.
»Was hast du hier verloren?«, verlangte sie von Lorkin zu wissen.
»Hallo, Chava«, sagte Evar. »Lorkin ist mit mir hier.«
Sie blickte zu Evar. »Das sehe ich. Was hat er hier verloren?«
»Ich führe ihn herum«, erwiderte Evar. Er zuckte die Achseln. »Das ist nicht verboten.«
Der Blick der Frau verfinsterte sich noch weiter. Sie sah erst Evar, dann Lorkin und dann wieder Evar an. Sie öffnete den Mund, schloss ihn wieder, und ein Ausdruck von Verdruss huschte über ihre Züge. »Es mag nicht verboten sein«, belehrte sie Evar, »aber es gibt … noch andere Dinge zu berücksichtigen. Du weißt, wie gefährlich es ist, die Steinemacher zu unterbrechen oder abzulenken.«
»Natürlich weiß ich das.« Evars Ausdruck und Ton waren jetzt ebenfalls ernst. »Deswegen habe ich gewartet, bis die Steinemacher dieser Höhle Feierabend gemacht hatten, und habe Lorkin auch nicht durch die inneren Höhlen geführt.«
Sie zog die Augenbrauen hoch. »Du hast nicht zu entscheiden, wann ein Besuch angebracht ist. Hast du um Erlaubnis für diesen Besuch gebeten?«
Evar schüttelte den Kopf. »Das musste ich noch nie.«
Bei dem flüchtigen Aufscheinen von Triumph in Chavas Blick verkrampfte sich Lorkin. »Das hättet ihr tun müssen«, erklärte sie ihnen. »Diese Sache muss gemeldet werden, und ich will nicht, dass einer von euch beiden mir von der Seite weicht, bis die richtigen Leute davon erfahren und entschieden haben, was mit euch geschehen soll.«
Als sie auf dem Absatz kehrtmachte und wieder auf den Eingang zuging, sah Lorkin Evar an. Der junge Mann lächelte und zwinkerte ihm zu. Ich hoffe, er hat recht damit, dass man keine Erlaubnis braucht, dachte Lorkin, während sie beide hinter Chava her eilten. Ich hoffe, es gibt nicht tatsächlich irgendein Gesetz oder eine Regel, von der mir niemand etwas gesagt hat. Die Sprecherinnen hatten ihn angewiesen, sich mit den Gesetzen des Sanktuariums vertraut zu machen und sie zu befolgen, und er war sorgfältig darauf bedacht gewesen, sich gewissenhaft daran zu halten.
Aber auch wenn seine Befürchtungen in dieser Richtung sich als unbegründet erweisen sollten, konnte er nicht so unbesorgt sein, wie Evar es war. Selbst wenn sie beide im Recht waren, hatte Chavas Reaktion die Furcht Lorkins bestätigt, dass er durch seinen Besuch der Höhlen das Vertrauen der Verräterinnen in ihn auf die Probe gestellt hatte. Er konnte nur hoffen, dass er nicht zu weit gegangen war und seine Hoffnungen auf einen Handel zwischen Verräterinnen und Gilde – oder die Möglichkeit, jemals zurückzukehren – für immer zunichtegemacht hatte.
2 Unerwartete Ankömmlinge
Dannyl legte seinen Stift beiseite, lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und seufzte.
Ich hätte nie gedacht, dass ich als Gildebotschafter – noch dazu in einem Land wie Sachaka – untätig, gelangweilt und allein herumsitzen würde.
Da Sachaka nicht zu den Verbündeten Ländern gehörte, kamen hier keine jungen Menschen zu ihm, um sich auf magische Fähigkeiten prüfen zu lassen, weil sie sich der Gilde anzuschließen hofften, und keine Gildemagier, für die er Quartiere und Treffen arrangieren musste. Ebenso wenig musste er sich um die Belange der hiesigen Gildemagier kümmern, da es ja keine gab. Es blieben gelegentliche Treffen, um das Gespräch zwischen der Gilde und dem sachakanischen König sowie der sachakanischen Elite zu pflegen und Botschaften zu diesem Zweck zu empfangen oder zu überbringen, und ab und an die Regelung oder Delegation von Handelsangelegenheiten. Er hatte also nur sehr wenig zu tun.
Bei seiner Ankunft in Sachaka war das ganz anders gewesen. Zwar waren seine spärlichen Aufgaben die gleichen gewesen, aber er hatte auch viel Zeit – für gewöhnlich die Abende – damit verbracht, wichtige und mächtige Sachakaner zu besuchen. Seit er von seiner Suche nach Lorkin und dessen Entführerin aus den Bergen zurückgekehrt war, gab es kaum noch Einladungen von Ashaki, die mit ihm speisen und sich mit ihm unterhalten wollten.
Dannyl stand auf, zögerte dann aber. Es gefiel den Sklaven nicht, wenn er im Gildehaus auf und ab ging. Sie huschten ihm aus dem Weg oder spähten um Ecken, um ihn zu beobachten. Ihre gewisperten Warnungen eilten ihm in solchen Fällen voraus, was immer eine Ablenkung war. Er ging auf und ab, um nachzudenken, und konnte keine getuschelten Störungen seiner Gedanken gebrauchen.
Irgendwann werden sie es schon schaffen, sich so zu verständigen, dass ich nichts mehr davon höre oder sehe, sagte er sich und trat hinter dem Schreibtisch hervor. Entweder das, oder ich werde mich daran gewöhnen müssen, in meinem Zimmer im Kreis zu laufen.
Als er aus seinem Arbeitszimmer in den Hauptraum seiner Wohnung trat, warf sich ein Sklave, der an der Wand gestanden hatte, zu Boden. Dannyl machte eine abschätzige Handbewegung. Der Sklave warf ihm einen vorsichtigen, forschenden Blick zu, dann rappelte er sich hoch und verschwand im Flur.
Langsam durchquerte Dannyl den Raum und trat ebenfalls in den Flur. Es war seltsam, aber die Anlage der sachakanischen Häuser selbst erhöhte den Reiz, darin umherzuwandern. Die Wände waren selten gerade, und die Flure des größeren, privaten Teils des Hauses wanden sich in eleganten Kurven, die irgendwann zusammenliefen.
Die nächste Gruppe von Räumen hatte Lorkin gehört. Dannyl hielt im Eingang dazu inne, dann ging er hinein. Er rechnete jetzt jeden Tag damit, dass ein Ersatz für seinen Assistenten eintraf und hier Quartier bezog. Schließlich ging er zur Schlafzimmertür und starrte auf das Bett.
Ich denke, ich sollte dem Nachfolger gegenüber lieber nicht erwähnen, dass dort einmal eine tote Sklavin gelegen hat, ging es ihm durch den Kopf. Mich würde dieses Wissen beunruhigen, und ich würde wahrscheinlich nächtens wach liegen und müsste mich zwingen, mir nicht vorzustellen, dass neben mir eine Leiche liegt.
Die Leiche war eine unangenehme Entdeckung gewesen, aber weniger schlimm als die Entdeckung, dass Lorkin zusammen mit einer anderen Sklavin verschwunden war. Zuerst hatte er sich gefragt, ob Sonea mit ihrer Befürchtung richtiggelegen hatte, dass die Familien der sachakanischen Eindringlinge, die sie und Akkarin vor über zwanzig Jahren getötet hatten, Rache an ihrem Sohn nehmen würden.
Nachdem er die Sklaven verhört hatte und den gesammelten Hinweisen gefolgt war – mithilfe des Repräsentanten des sachakanischen Königs, Ashaki Achati –, hatte er entdeckt, dass dies nicht der Fall war. Lorkin war vielmehr von Rebellen entführt worden, einer Gruppe, die sich die Verräterinnen nannte. Achati hatte veranlasst, dass sich ihnen fünf sachakanische Ashaki anschlossen, und sie hatten Lorkin und seine Entführerin in die Berge verfolgt. In das von den Verräterinnen beherrschte Territorium.
Lediglich sechs sachakanische Magier und ein einziger der Gilde hätten einem Angriff der Verräterinnen jedoch niemals standhalten können. Dannyl hatte inzwischen begriffen, dass die Verräterinnen nur deshalb nicht angegriffen hatten, weil das zu weiteren Einfällen in ihr Territorium hätte führen können. Wären Dannyl und seine Helfer allerdings dem Stützpunkt der Verräterinnen zu nahe gekommen, hätten diese sie getötet. Glücklicherweise hatten die Rebellen ein Treffen zwischen ihm und Lorkin arrangiert, und sein Gehilfe hatte ihm versichert, dass er mit den Verräterinnen gehen und mehr über sie herausfinden wolle.
Dannyl wandte sich von Lorkins ehemaligem Schlafzimmer ab und verließ langsam die Wohnung, wobei sich ein Gefühl der Düsternis in ihm ausbreitete. Er war erleichtert gewesen zu erfahren, dass Lorkin in Sicherheit war. Er hatte es sogar aufregend gefunden, dass Lorkin hoffte, etwas über Magie zu erfahren, von der die Gilde keine Kenntnis hatte. Eines war ihm jedoch nicht klar gewesen: wie peinlich diese Situation für die Ashaki gewesen war, die mit ihm ausgezogen waren, um Lorkin zu befreien.
Sie waren verpflichtet gewesen, so lange zu suchen, bis Lorkin gefunden wurde. Aus Furcht vor einem Angriff aufzugeben hätte für sie Gesichtsverlust bedeutet. Dannyl hatte ihnen diese Demütigung erspart, indem er die Entscheidung selbst traf. Es war ihm nur gerecht erschienen, nachdem sie sich für ihn und Lorkin in Gefahr gebracht hatten. Aber ihm war nicht klar gewesen, welchen Schaden dadurch sein Ansehen bei der sachakanischen Elite nehmen würde.
Der Flur zweigte nach links ab. Dannyl strich mit den Fingerspitzen über die weißgetünchte Wand, dann blieb er am Eingang zu einer weiteren Wohnung stehen. Diese Räume waren für Gäste bestimmt und in den vielen Jahren, in denen die Gilde das Gebäude schon benutzte, nur selten bewohnt gewesen.
Ich bin in Ungnade gefallen, überlegte Dannyl. Weil ich die Jagd aufgegeben habe. Weil ich wie ein Feigling vor den Verräterinnen geflohen bin. Und wahrscheinlich auch, weil ich zugelassen habe, dass ein Gildemagier, für den ich verantwortlich war und der im Rang unter mir stand, sich einem Feind des sachakanischen Volkes angeschlossen hat.
Hätte er sich noch einmal in dieser Situation befunden, hätte er die gleiche Entscheidung getroffen. Wenn die Verräterinnen tatsächlich über eine neue Art von Magie verfügten und Lorkin sie überreden konnte, ihn darin einzuweihen und ihm zu erlauben, nach Hause zurückzukehren, wäre dies das erste Mal seit Jahrhunderten, dass der Kernbestand der Gilde an magischen Künsten ergänzt wurde. Schwarze Magie zählte er nicht als neu; sie war eher eine Wiederentdeckung und wurde noch immer als gefährlich und wenig wünschenswert erachtet.
Ashaki Achati hatte ihm versichert, dass einige Sachakaner Dannyls »Opferung« seines Stolzes als eine bewundernswert noble Tat betrachteten. Dannyl hätte dieses Opfer vermeiden können, indem er seine Helfer bat, ihm bei der Entscheidungsfindung zur Seite zu stehen, so dass der Schaden sich auf sie alle verteilt hätte. Aber damit hätte er eine völlig nutzlose Fortsetzung der Jagd riskiert, die niemandem zum Vorteil gereicht hätte.
Dannyl ging am Eingang der Gästewohnung vorbei weiter den Flur entlang. Schon bald erreichte er das Herrenzimmer, den wichtigsten öffentlichen Raum des Gebäudes. Dies war der Ort, an dem der Besitzer oder die Person, die innerhalb des Hauses den höchsten Rang innehatte, Gäste begrüßte und bewirtete. Besucher betraten das Anwesen über den Haupthof, wurden von einem Türsklaven begrüßt und dann durch eine überraschend bescheidene Tür und einen kurzen Flur in diesen Raum geführt.
Er setzte sich auf einen von einer Handvoll Hocker, die in einem Halbkreis aufgestellt waren, und dachte an die vielen köstlichen Mahlzeiten, die man ihm vorgesetzt hatte, während er in ähnlichen Räumen auf ähnlichen Möbelstücken gesessen hatte. Achati, der Repräsentant des Königs, hatte die Aufgabe gehabt, Dannyl wichtigen Personen vorzustellen und ihm Anweisungen in Bezug auf Protokoll und Manieren zu geben. Es war gleichzeitig interessant und ein wenig besorgniserregend, dass dieser Mann der einzige war, der Dannyl immer noch besuchen konnte, ohne dass Dannyls beschädigter Ruf auf ihn abfärbte. War er immun gegen derartige gesellschaftliche Regeln, oder war es etwas anderes?
Kommt er mich besuchen, weil sein Interesse an mir nicht ausschließlich politischer Natur ist?
Dannyl erinnerte sich an den Moment, in dem Achati angedeutet hatte, er hätte gern eine engere Beziehung zu ihm als Freundschaft. Wie immer stieg eine Mischung von Emotionen in ihm auf: Er fühlte sich geschmeichelt, er empfand Furcht, spürte seine Neigung zu Vorsicht und hatte ein schlechtes Gewissen. Das schlechte Gewissen war nicht überraschend, überlegte er. Obwohl er frustriert aus Kyralia abgereist war, nachdem er sich von Tayend, seinem Liebhaber, entfremdet hatte, war von ihnen keine klare Entscheidung für eine Trennung getroffen worden.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich diese Trennung will. Vielleicht bin ich sentimental, dass ich etwas, das nur noch in der Vergangenheit existiert, nicht loslassen will. Doch wenn ich mich frage, ob ich an Achati interessiert bin, kann ich weder so noch so antworten. Ich bewundere den Mann. Ich habe das Gefühl, dass wir vieles gemeinsam haben – Magie, Interessen, unser Alter …
Ein Sklave betrat den Raum und warf sich zu Boden. Dannyl quittierte die Störung mit einem Seufzer.
»Sprich«, befahl er.
»Gildekutsche hier. Zwei Fahrgäste.«
Dannyl stand hastig auf, und sein Herz machte einen Satz, der auf jähe Erregung und Hoffnung zurückzuführen war. Endlich war sein neuer Assistent eingetroffen. Obwohl er keine Arbeit für ihn hatte, würde er zumindest ein wenig Gesellschaft bekommen.
»Schick sie herein.« Dannyl rieb sich die Hände, machte einige Schritte auf den Haupteingang zu und hielt dann inne. »Und sorge dafür, dass jemand etwas zu essen und zu trinken bringt.«
Der Sklave rappelte sich hoch und hastete davon. Dannyl hörte, wie eine Tür geschlossen wurde, dann Schritte im Eingangsflur. Der Türsklave trat in den Raum und warf sich Dannyl zu Füßen. Die junge Heilerin, die ihm folgte, betrachtete den Sklaven voller Entsetzen, dann schaute sie zu Dannyl auf und nickte respektvoll.
Er öffnete den Mund, um sie willkommen zu heißen, aber die Worte kamen ihm nicht über die Lippen, weil ein bunt gekleideter Mann, der hinter ihr herging, seine ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. Der Mann musterte den Raum mit lebhaften, neugierigen Blicken.
Dann traf der Blick des Mannes den Dannyls, und seine Augen funkelten, als ein vertrauter Mund sich zu einem breiten Lächeln dehnte.
»Seid mir gegrüßt, Botschafter Dannyl«, sagte Tayend. »Mein König hat mir versichert, dass die Gilde Elynes Botschafter in Sachaka ein Quartier geben würde, aber wenn diese Bitte ungelegen kommt, bin ich mir sicher, dass ich in der Stadt eine passende Unterkunft finden kann.«
»Botschafter …?«, wiederholte Dannyl.
»Ja.« Tayends Lächeln wurde noch breiter. »Ich bin der neue elynische Botschafter in Sachaka.«
Obwohl eine Verbindung zu Verbrechern nicht länger gegen irgendeine Regel der Gilde verstieß und es für Sonea nur folgerichtig war, sich bei der Jagd auf wilde Magier mit Cery zu beraten – er hatte ihr bereits in der Vergangenheit geholfen, einen zu fangen –, traf Sonea sich lieber heimlich mit ihm. Manchmal erschien er in ihrem Quartier in der Gilde, manchmal traf sie ihn in einem abgelegenen Bereich der Stadt. Der Lagerraum des Nordseite-Hospitals hatte sich als einer der sichersten Orte für solche Zusammenkünfte erwiesen; er war durch eine Geheimtür auch von einem Nachbarhaus aus zugänglich, das Cery gekauft hatte.
Es war sicherer, sich heimlich zu treffen, weil der mächtigste Dieb der Stadt, der wilde Magier, auf den sie Jagd machte, gewiss nicht erfreut darüber gewesen wäre zu erfahren, dass Cery der Gilde geholfen hatte, seine Mutter, Lorandra, zu fangen und einzusperren. Skellin besaß noch immer großen Einfluss in Imardins Unterwelt und hätte alles getan – einschließlich der Ermordung seiner Verfolger –, um zu verhindern, dass auch er gefangen wurde.
Allerdings gab es seit Monaten nicht mehr die geringste Spur von Skellin. Obwohl Sonea endlich die Erlaubnis erhalten hatte, sich frei in der Stadt zu bewegen, waren ihre Nachforschungen über das Versteck des wilden Magiers ergebnislos geblieben. Cerys Leute, die vermutlich leichter etwas über den Wilden in Erfahrung bringen konnten, hatten ebenfalls nichts herausbekommen. Ein in seinem Äußeren so exotischer Mann wie Skellin sollte eigentlich Aufmerksamkeit erregen, aber es hatten sie keine Berichte über einen schlanken Mann mit rötlich dunkler Haut und fremdartigen Augen erreicht.
»Seine Feuel-Verkäufer sind überall in meinem Territorium«, erzählte Cery ihr. »Sobald ich ein Glühhaus schließe, öffnet ein anderes. Ich kümmere mich um einen Verkäufer, und zehn weitere tauchen auf. Ganz gleich wie ich mit ihnen verfahre, nichts schreckt sie ab.«
Sonea wollte nicht fragen, wie es aussah, wenn Cery sich um jemanden »kümmerte«. Sie bezweifelte, dass es bedeutete, dass er ihn freundlich bat zu verschwinden. »Klingt so, als hätten sie vor Skellin größere Angst als vor dir. Das heißt gewiss, dass er noch in der Stadt ist.«
Cery schüttelte den Kopf. »Er könnte jemand anderem den Auftrag gegeben haben, die Verkäufer in seinem Namen einzuschüchtern. Wenn du genug Leute hast, die für dich arbeiten, und außerdem Verbündete, kannst du ein Geschäft aus der Ferne betreiben. Als einziger Nachteil bleibt, dass es immer etwas Zeit kostet, Nachrichten und Befehle zu übermitteln.«
»Können wir das überprüfen? Wir könnten etwas tun, worum Skellin sich persönlich kümmern muss. Etwas, das seine Verbündeten und Handlanger nicht für ihn entscheiden können. Wir werden herausfinden, wie lange es dauert, eine Reaktion zu erzielen, und das könnte uns verraten, ob er in Imardin ist oder nicht.«
Cery runzelte die Stirn. »Es könnte funktionieren. Wir müssten uns etwas ausdenken, das groß genug ist, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, das aber niemanden in Gefahr bringt.«
»Etwas Überzeugendes. Ich bezweifle, dass er der Typ ist, der in eine Falle tappt.«
»Das stimmt«, pflichtete Cery ihr bei. »Das Problem ist, ich kann nicht …«
Sonea runzelte die Stirn. Sein Blick war auf etwas über ihrer Schulter gerichtet, und er hatte sich vollkommen verkrampft. Von der Tür hinter ihr kam ein leises Kratzen. Als sie sich umdrehte, sah sie, dass der Knauf der Tür langsam gedreht wurde, zuerst in die eine, dann in die andere Richtung.
Sie hielt die Tür mit Magie geschlossen, so dass, wer immer sie zu öffnen versuchte, keine Chance hatte, in den Raum zu gelangen. Aber wer es auch war, er versuchte, es heimlich zu tun.
»Ich sollte besser gehen«, sagte Cery leise.
Sie nickte zustimmend, und sie standen gleichzeitig auf. »Lass uns beide darüber nachdenken.« Wie lange steht die Person, die den Knauf dreht, schon auf der anderen Seite der Tür? Hat sie irgendetwas von dem gehört, was wir gesprochen haben? Außer den Heilern und den Helfern sollte sich niemand in diesem Teil des Hospitals aufhalten, und jeder, der in der Nähe des Lagers herumlungerte, würde ihren Verdacht erregen. Es sei denn, es ist ein Heiler. Davon gab es eine Handvoll, die von ihren Treffen mit Cery wussten und sie unterstützten, doch es gab auch andere, die das nicht taten und die es fragwürdig finden könnten, dass sie zu diesem Zweck Räume des Hospitals benutzte.
Sie stand auf, ging auf die Tür zu und wartete, bis Cery lautlos durch die Geheimtür geschlüpft war, bevor sie sich straffte und ihr magisches Schloss entfernte.
Der Riegel klickte, und die Tür schwang nach innen auf. Ein kleiner, dünner Mann stand davor und schickte sich an, einzutreten. Ein wahnsinniges Grinsen verzerrte seine Züge. Als er sie sah und ihre schwarzen Roben bemerkte, verdrängte ein Ausdruck des Entsetzens das Grinsen. Er erbleichte und wich einige Schritte zurück.
Aber irgendetwas hielt ihn auf. Etwas zwang ihn, stehen zu bleiben, und ließ eine irrsinnige Hoffnung in seinem Gesicht aufscheinen. Etwas veranlasste ihn, alle Furcht vor dem, was sie war, beiseitezuschieben.
»Bitte«, jammerte er. »Ich brauche etwas. Gebt mir etwas.«
Eine Welle aus Mitgefühl, Ärger und Traurigkeit schlug über ihr zusammen. Sie seufzte, trat in den Flur, zog hinter sich die Tür zu und verriegelte das mechanische Schloss mit Magie.
»Wir bewahren es nicht hier auf«, sagte sie zu dem Mann. Er starrte sie an, dann verdüsterte sich sein Gesicht vor Zorn.
»Lügnerin!«, kreischte er. »Ich weiß, dass Ihr es habt. Ihr habt immer welches, um Leute zu entwöhnen. Gebt es mir!« Seine Händen wurden zu Klauen, und er stürzte sich auf sie.
Sie fing seine Handgelenke auf und bremste seinen Angriff mit einem sanften magischen Druck gegen seine Brust. Er war bereits erregt genug, auch ohne dass sie seine Verzweiflung noch vergrößerte, indem sie ihn ganz mit magischer Energie einhüllte. Aus dem Augenwinkel konnte sie das Aufblitzen von grünem Stoff sehen – es kamen bereits einige Heiler herbeigeeilt, um sich des Mannes anzunehmen.
Es dauerte nicht lange, da hatten zwei Heiler die Arme des Mannes ergriffen, dann schleppten sie ihn zurück durch den Flur. Ein dritter Heiler blieb in ihrer Nähe stehen, und als sie zu dem Mann aufblickte, erkannte sie ihn mit einiger Überraschung und großer Freude.
»Dorrien!«
Der Mann, der ihr Lächeln erwiderte, war ein paar Jahre älter als sie und gebräunt von vielen in der Sonne verbrachten Stunden. Rothens Sohn war der Heiler einer kleinen Stadt am Rand der südlichen Berge, wo er mit seiner Frau und seinen Kindern lebte. Vor langer Zeit, als sie noch Novizin gewesen war, war er zu einem Besuch in die Gilde gekommen, und zwischen ihnen war eine Freundschaft gewachsen – eine Freundschaft, die zu einer Romanze hätte werden können. Aber er hatte in sein Dorf und sie zu ihren Studien zurückkehren müssen. Dann habe ich mich in Akkarin verliebt, und nach seinem Tod konnte ich nicht einmal daran denken, mit jemand anderem zusammen zu sein. Dorrien war in Imardin geblieben, um nach der Ichani-Invasion beim Wiederaufbau zu helfen, aber sein Dorf hatte niemals aufgehört, sein wahres Zuhause zu sein, und schließlich war er dorthin zurückgekehrt. Er hatte eine Frau aus dem Ort geheiratet und war Vater zweier Töchter.
»Ja, ich bin wieder da«, sagte Dorrien. »Zu einem kurzen Besuch diesmal.« Er betrachtete den von Drogen um seinen Verstand gebrachten Mann. »Habe ich recht mit der Vermutung, dass die Ursache seines Problems etwas ist, das man Feuel nennt?«
Sonea seufzte. »Du hast recht.«
»Das ist der Grund, warum ich hier bin. Einige junge Männer in meinem Dorf sind vor ein paar Monaten vom Markt damit zurückgekommen. Als sie ihren Vorrat verbraucht hatten, waren sie bereits abhängig geworden. Ich hätte gern einen Rat, wie ich sie behandeln kann.«
Sie musterte ihn eingehend. Im Gegensatz zu den Heilern in der Stadt war er nicht verpflichtet, es zu vermeiden, seine Magie auf die Behandlung der Droge zu »verschwenden«. Hatte er versucht, heilende Magie zu benutzen, um die jungen Männer von ihrer Gewohnheit abzubringen, und war gescheitert, wie sie bei den meisten Patienten gescheitert war, die sie insgeheim behandelt hatte?
»Komm mit«, sagte sie, drehte sich um und schloss den Lagerraum wieder auf. Als er eintrat, folgte sie ihm und schloss die Tür hinter sich. Mit hochgezogenen Augenbrauen blickte er sich im Raum um, setzte sich jedoch ohne einen Kommentar auf den Stuhl, auf dem zuvor Cery gesessen hatte. Sie nahm auf dem Stuhl Platz, von dem sie sich gerade erhoben hatte.
»Hast du versucht, sie mit Magie zu heilen?«, fragte sie.
»Ja.« Dorrien berichtete, dass die jungen Männer ihn um Hilfe gebeten hätten, nachdem ihnen zu spät klar geworden war, dass sie sich Feuel auf die Dauer nicht leisten konnten. Es war ihnen peinlich gewesen festzustellen, dass sie auf ein Laster der Stadt hereingefallen waren. Er hatte mit seinen Heilersinnen in ihren Körpern nach der Ursache des Problems gesucht und es geheilt, wie Sonea es bei manchen ihrer Patienten getan hatte. Und genau wie sie hatte er unterschiedliche Erfolge erzielt. Einer der Brüder war kuriert worden, den anderen verlangte es noch immer nach der Droge.
»Ich habe das gleiche Ergebnis erzielt«, erwiderte sie. »Ich habe versucht herauszufinden, warum es möglich ist, einige Leute mit Magie zu heilen und andere nicht.«
Er nickte. »Also, was rätst du mir für die Patienten, die nicht geheilt werden können?«
»Sie sollten die Droge nicht wieder benutzen, für den Fall, dass die Wirkung stärker wird. Einige meiner Patienten sagen, es helfe ihnen, sich zu beschäftigen, um das Verlangen ignorieren zu können. Andere trinken. Aber keine kleinen Mengen – sie sagen, zu wenig schwäche ihre Entschlossenheit, Fäule zu meiden.«
»Fäule?«
»Das ist der Spitzname der Droge auf der Straße.«
Dorrien verzog das Gesicht. »Ich denke, es ist ein passender.« Er runzelte die Stirn und sah sie nachdenklich an. »Wenn wir die Sucht anderer Personen nicht mit Magie heilen können, können wir dann unsere eigene heilen? Nicht dass ich von Feuel abhängig wäre«, fügte er mit einem schwachen Lächeln hinzu.
Sie lächelte grimmig zurück. »Das ist eine Frage, nach deren Beantwortung ich ebenfalls gesucht habe, aber mit geringem Erfolg. Bisher habe ich keinen Magier, der Feuel benutzt, gefunden, der bereit wäre, sich untersuchen zu lassen. Ich habe einige befragt, aber auf diesem Wege werde ich nicht die Beweise finden, die ich brauche.«
»Die du wofür brauchst?«
»Um die Gilde davon zu überzeugen, dass dies ein ernsthaftes Problem ist. Skellins Plan, Magier mit Feuel zu versklaven, könnte erfolgreich gewesen sein – könnte immer noch erfolgreich sein.«
Dorrien lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und dachte darüber nach. Dann schüttelte er den Kopf. »Magier sind schon früher mit anderen Dingen erpresst und gekauft worden. Warum ist dies hier etwas anderes?«
»Vielleicht ist nur die Größenordnung des Problems eine andere. Deshalb müssen weitere Nachforschungen angestellt werden. Wie hoch ist der Prozentsatz von Magiern, die von Feuel dauerhaft geschädigt werden könnten? Wie sehr verändert Feuel das Denken und Verhalten seiner Benutzer?«
Dorrien nickte. »Wie lautet deine Vermutung? Für wie groß hältst du das Problem?«
Sonea zögerte, als ihr Schwarzmagier Kallen in den Sinn kam. Falls Cery recht hatte und Anyi den Magier tatsächlich dabei beobachtet hatte, wie er Feuel kaufte, konnte das Problem in der Tat sehr groß sein. Aber sie wollte nicht offenbaren, was sie wusste, bevor sie sicher war, dass Kallen wirklich Feuel benutzte, und sie einen Beweis dafür hatte, dass Feuel ein so großes Problem darstellte, wie sie es vermutete. Er könnte die Droge für jemand anderen gekauft haben. Wenn sie zu Unrecht behauptete, er sei ein Süchtiger, würde sie wie eine Närrin dastehen, und wenn sie ihr Wissen offenbarte, bevor sie bewiesen hatte, dass Feuel für Magier gefährlich war, dann würde es aussehen, als mache sie großen Wirbel um nichts.
Oh, aber ich wünschte, ich könnte mit jemandem darüber reden. Sie hatte es Rothen nicht erzählt, denn er würde sofort etwas unternehmen wollen. Es gefiel ihm nicht, dass Kallen sie behandelte, als könne man ihr nicht trauen. Rothen drängte sie immer, Kallen genauso scharf im Auge zu behalten, wie er sie im Auge behielt. Und Dorrien würde ihr das Gleiche raten.
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie seufzend.
Ironischerweise war der einzige Mensch, von dem sie dachte, sie könne es ihm wahrscheinlich erzählen und darauf vertrauen, dass es ein Geheimnis blieb, Regin – der Magier, der ihr geholfen hatte, Lorandra zu finden. Welche Ironiedarin liegt, dass aus dem Novizen, den ich gehasst habe,weil er mir das Leben zur Hölle machte, ein Magier geworden ist, dem ich vertraue. Er verstand die Bedeutung des richtigen Zeitpunkts. Obwohl sie sich mit Regin getroffen hatte, um über die Suche nach Skellin zu sprechen, hatte sie sich bisher nicht überwinden können, ihn auf Kallens vermutlichen Feuel-Konsum hinzuweisen.
Vielleicht habe ich noch größere Angst, dass Regin mir nicht glauben wird und dass ich mich zu einer absoluten Närrin machen werde. Unwillkürlich lächelte sie. Wie oft ich mir auch sage, dass wir keine Novizen und Todfeinde mehr sind, ich kann den Verdacht nicht abschütteln, dass er jede Schwäche gegen mich benutzen wird. Es ist lächerlich. Er hat bewiesen, dass er ein Geheimnis für sich behalten kann. Ich habe von ihm nichts anderes als Unterstützung erfahren.
Aber häufig schaffte er es nicht zu ihren Treffen oder erschien verspätet und geistesabwesend. Sie vermutete, dass er das Interesse an der Suche nach Skellin verloren hatte. Vielleicht fand er, dass es eine unmögliche Aufgabe war, den wilden Magier aufzuspüren. Gewiss fühlte es sich langsam so an.
Denn da Cery gezwungen war, sich zu verstecken, und seine Leute keine Spur von Skellin finden konnten, war sie selbst ratlos, wie sie den Mann aufspüren sollten – es sei denn, sie nahmen die Stadt Stein um Stein auseinander, und dem würde der König niemals zustimmen.
Im Speisesaal herrschte wie immer der Lärm von Besteckklappern, Geschirrklirren und den Stimmen der Novizen. Lilia stieß einen ungehörten Seufzer aus und gab den Versuch auf, zu verstehen, worüber ihre Gefährten sprachen. Stattdessen ließ sie den Blick langsam durch den Raum wandern.
Die Innenausstattung war eine seltsame Mischung aus Raffinesse und Schlichtheit, aus dekorativen und praktischen Elementen. Die Fenster und Wände waren ebenso elegant gearbeitet und dekoriert wie in den meisten anderen großen Räumen in der Universität, aber die Möbel waren solide, einfach und robust. Es war, als habe jemand die polierten, geschnitzten Stühle und Tische in dem prächtigen Speisesaal des Hauses, in dem sie aufgewachsen war, entfernt und durch die stabilen Holztische und Bänke aus der Küche ersetzt. Die Menschen im Speisesaal waren ebenso unterschiedlich. Hier aßen Novizen aus den mächtigsten Häusern und solche, die in den schmutzigsten Straßen der Stadt als Kinder von Bettlern geboren worden waren. Als Lilia mit ihren magischen Lektionen begonnen hatte, hatte sie sich gefragt, warum die Schnösis weiterhin hier ihre Mahlzeiten einnahmen, obwohl sie reich genug waren, um ihre eigenen Köche zu beschäftigen. Die Antwort war, dass sie keine Zeit hatten, jeden Tag das Gelände zu verlassen, um mit ihren Familien zu speisen – und ohnehin sollten sie das Gelände der Gilde nicht ohne Erlaubnis verlassen.
Sie hatte den Verdacht, dass auch ein gewisses Gefühl territorialen Stolzes im Spiel war. Die Schnösis aßen seit Jahrhunderten im Speisesaal. Die Prollis waren die Neuankömmlinge. Der Speisesaal war der Schauplatz vieler Streiche zwischen den Prollis und Schnösis gewesen. Lilia hatte niemals zu einer der beiden Gruppen gehört. Obwohl sie es nicht laut aussprach, stammte sie aus den besten Verhältnissen, die jemand in der Gruppe der Prollis vorweisen konnte. Ihre Angehörigen standen bei einer Familie in Diensten, die zu einem Haus von einiger politischer Macht und Einfluss gehörte – weder an der Spitze der politischen Hierarchie noch ganz unten. Sie konnte ihre Herkunft über mehrere Generationen zurückverfolgen und benennen, welcher ihrer Vorfahren für welche Familien dieses Hauses gearbeitet hatte.
Andere Prollis dagegen waren sehr schäbiger Abkunft: Söhne von Huren, Töchter von Bettlern. Sehr viele waren mit Verbrechern verwandt, vermutete sie. Zwischen dieser Sorte von Prollis hatte eine seltsame Art von Wettstreit begonnen, wer mit der beeindruckendsten niederen Herkunft aufwarten konnte. Wenn Gossen-Ravi als Eltern genannt werden könnten, würden selbst damit einige von ihnen prahlen, als sei es ein Ehrentitel. Diejenigen aus einer Familie von Dienstboten stammenden Prollis dagegen prahlten nicht mit ihrer Herkunft – es hätte ihnen auch eine Menge Ärger eingetragen.
Der Hass, den einige Prollis auf die Schnösis hegten, schien ihr nicht gerecht zu sein. Die Herrschaften ihrer Eltern hatten ihre Dienstboten gut behandelt. Lilia hatte mit ihren Kindern gespielt, als sie noch klein gewesen war. Sie hatten dafür gesorgt, dass die Kinder all ihrer Diener eine Ausbildung in den Grundlagen erhielten. Seit der Ichani-Invasion hatten sie alle paar Jahre einen Magier ins Haus geholt, um sämtliche Kinder auf magische Fähigkeiten prüfen zu lassen. Obwohl keins ihrer eigenen Kinder genug latente Macht besaß, um in die Gilde aufgenommen zu werden, waren sie überglücklich gewesen, als Lilia – und vor ihr andere Dienstbotenkinder – ausgewählt worden war.