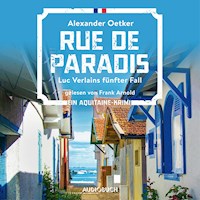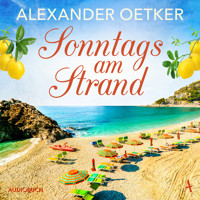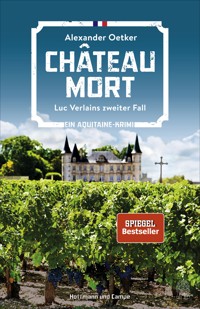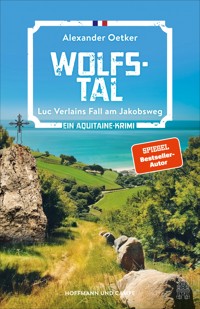11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautor Alexander Oetker erzählt von der Magie der Liebe im sommerlichen Italien Es ist der 15. August, Ferragosto, ganz Italien urlaubt, und der Strandabschnitt von Strandwärter Enzo ist so voll wie nie. Hingebungsvoll kocht er für seine Gäste Spaghetti Carbonara, und zwar erstmals nach dem Rezept seiner verstorbenen Frau. Er ist nicht der Einzige, der sich an diesem zauberhaften Sommertag für etwas Neues öffnet – unter seinen Augen vollzieht sich ein kleines Wunder: Vier ganz unterschiedliche Paare finden im Laufe der Stunden in seinem Bagno zusammen, sehen sich zum ersten Mal richtig an, oder erkennen, wie sehr sie sich selbst im Wege standen und finden die Liebe wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Alexander Oetker
Sonntags am Strand
Roman
Atlantik
Für Mateo & Jakob
»Das Meer ist keine Landschaft, es ist das Erlebnis der Ewigkeit.«
Thomas Mann
»Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.«
»Zwischen Reden und Tun liegt das Meer.«
Italienisches Sprichwort
Enzo
Am Morgen war er eine einzige Verheißung, dieser Strand. Wenn das Rattern des alten Motors von Signor Garivaldos Traktor gerade verklungen war, die feinen Linien, die sein Rechen im Sand hinterlassen hatte, noch nicht verweht waren, kein Fußabdruck zu sehen war, keine Spuren der Wandernden, Flaneure, springenden Kinder, höchstens eine Möwe wie eine Ballerina darübergestelzt war, ganz so, als fröre sie, und dreizackige Spuren zurückließ, zart hingetanzt. So unberührt wie der Tag lag der Strand da, bereit, neue Geschichten in seinen Sand schreiben zu lassen. Geschichten, wie sie nur hier geschrieben werden. Hier. Am Meer.
Die Sonnenschirme aufrecht, ihre langen Schatten gen Westen ausgerichtet, weil die Sonne von Osten kommt, ihre Strahlen einmal schräg übers Meer schickt, schimmernde Sprenkel auf dem Wasser hinterlässt. In Reih und Glied stehen die Liegen dicht beieinander, noch in ihrer künstlich erzwungenen Ordnung, nicht verrückt, nicht zusammengezogen, um mehr Nähe zu den Liebsten, oder auseinander, um mehr Abstand zu den lärmenden Nachbarn zu schaffen. Die Sonnenblenden hintenüber, als würden auch die Liegen noch die Morgensonne genießen wollen. Dort hinten, in der kleinen Bucht, zieht der Erste der Zurückgekehrten sein Boot an Land, es sieht ganz leicht aus, dann steigt er noch einmal hinein und holt zwei Kisten, die er übereinanderstapelt, als seien darin nur Wattebällchen und keine kiloschweren Fische. Die Nacht hat der alte Mann auf dem Meer verbracht, er ist einer der wenigen, die auch sonntags hinausfahren.
Überhaupt: das Meer. Es liegt da, ganz ruhig, erhaben, als wollte es die schlafenden Hotelgäste noch nicht mit seinem Rauschen stören. Da sind nur die ganz kleinen Wellen, das Wort fast schon übertrieben für ihre Gestalt, sanft und gleichförmig fließen sie heran und lassen den Sand und die feinen Kiesel leise knirschen.
Enzo sah das, gewiss sah er es, er war nicht gleichgültig geworden über die Jahre, gleichgültig wie all die Menschen, die an ihren Arbeitsplatz kamen und diesen gar nicht mehr wahrnahmen, ihn nur als Ort betrachteten, an dem sie dem Broterwerb nachgehen – nein, nein, er schüttelte den Kopf, weil er den Gedanken so absurd fand, nein, das würde ihm nie passieren, das war nicht möglich, nicht hier.
Wie jeden Morgen knirschte auch heute der feine Sand unter seinen Füßen, die paar Meter, bis die hölzernen Bohlen begannen, die er mal wieder austauschen müsste, dachte er, als er die dunkle Patina sah. Es wäre nicht gut, wenn sich ein Badegast einen Splitter in den Fuß rammen würde. Er folgte der Kurve, die der hölzerne Pfad beschrieb, alles war unberührt, die Jugendlichen waren in der Nacht also nicht auf dumme Ideen gekommen, gut so.
Enzo kramte in der Hosentasche nach dem Schlüssel, es klimperte, dann zog er ihn heraus und öffnete ruhig und gewissenhaft das Vorhängeschloss, bog es auf und nahm es ab, dann konnte er die hölzerne Platte anheben und mit zwei, drei Schritten um die Ecke wuchten, hinter die kleine Holzhütte, wo er sie in den Sand stellte. Neben die Hütte hatte der Bäcker zwei Tüten gestellt, er würde sie gleich holen. Ein weiteres Vorhängeschloss, diesmal an der Tür, auch das öffnete er und trat ein. In der Nacht hatten sich am Boden Staub und Sand abgesetzt, beim Öffnen der Tür aber wirbelte beides durch die Luft, kleine Flocken, kleine Körner, Schnee und Gold.
Das waren sie, seine sechs Quadratmeter. Am Abend hatte er wie stets alles aufgeräumt und sauber gemacht, deshalb genoss er die wohltuende Ordnung, der Sandwichgrill neben den durchsichtigen Gefäßen, in denen nachher die Granita rotieren würde, er würde sie gleich frisch ansetzen. Das einzige Geräusch war von der Truhe mit dem Eis zu hören.
Enzo aber lehnte sich erst mal an seinen Tresen und blickte hinaus. Da waren drei Farben: das Weiß des Sandes, das Blau des Himmels. Die dritte Farbe war ein leuchtendes Gelb. Das Gelb der Sonnenschirme und der Liegen, kein verblasstes Gelb, nein, ein richtig strahlendes Sonnengelb. Die Patina bei den Holzbohlen auf der Terrasse nahm er hin, aber das hier war ihm wichtig: Sein Bagno musste gelb leuchten, dafür liebten es die Gäste, die Stammgäste, die Kinder. Jeden Winter prüfte und reinigte er Sonnenschirme und Liegen mit jeder Menge Wasser und Reinigungsmitteln. War ein Schirm aber von der Sonne allzu sehr verblichen, dann tauschte er ihn aus.
Weiß – Blau – Gelb. Drei Farben, ein Ausschnitt. Sein Ausschnitt. Diesen Blick hatte er jeden Tag des Sommers, seit einundvierzig Jahren. Die Welt als Rechteck – für ihn gab es nichts Besseres.
Vor allem aber gab es keinen besseren Moment als diesen, so früh am Morgen, weil außer ihm noch niemand hier war. Nur er und die zwei Möwen, die in den Traktorfurchen herumstelzten. Sie nahmen die Hügel so stolz und aufrecht, als seien sie Bergsteiger. Enzo müsste nicht so früh hier sein, gewiss nicht, die meisten Gäste schliefen noch, nur die Alten, die schon in dunkler Nacht den Morgen herbeisehnten, weil der Schlaf sich nicht mehr einstellen wollte, saßen bereits beim Frühstück in den Hotels auf der Promenade. Aber selbst sie würden erst in die kleine Stadt gehen, ein paar Dinge einkaufen, einen Plausch im Café halten, bevor sie an den Strand kämen.
Er brauchte diese Ruhe, diese Zeit nur für sich. Gleich würde er hinausgehen, noch einmal die Liegen kontrollieren, dann würde er die Cornetti vom Bäcker in den kleinen Ofen schieben, damit sie für die ersten Gäste schön kross und noch warm wären. Und, das Wichtigste, er würde die alte Cimbali-Kaffeemaschine anstellen. Die zwei abgenutzten Knöpfe drücken, die das riesige zweigruppige Ungetüm in Gang setzten. Jetzt würden die alten Heizer in der Maschine anspringen und sie auf Temperatur bringen. Nichts war wichtiger als eine gut vorgeheizte Espressomaschine – wer wollte schon faden, kalten Caffè trinken?
Enzo hörte das Blubbern in dem Gerät und lächelte. Er lehnte sich wieder an den Tresen und blickte hinaus: Die Sonne schob sich dort hinten über das Meer, ihr Gelb war noch sehr hell, fast kontrastierte es mit den Sonnenschirmen, kein Wölkchen war an diesem Himmel zu sehen. Ein vollkommener Morgen. Und es würde ein vollkommener Tag werden. Warm und mit einem leichten Wind, der aus Westen kam. Warmem Wind also. Vielleicht würde es am Abend ein kleines Gewitter geben. Die Luft wäre ganz sauber, am Anfang dieser Woche. Besser ging es nicht.
Denn heute war Sonntag. Der wichtigste Tag der Woche. Ein Abschluss. Ein Neubeginn. Aber vor allem: der Tag, an dem die Familien kamen, um sich zu treffen. Zu essen, zu baden, am wichtigsten aber, um miteinander zu sprechen und das Leben zu feiern. Am liebsten dort vorne, mit den Füßen im Meer, kurz hinter der Wasserkante, leichte Kühlung von unten, mehr Meer brauchten sie nicht. Welcher Italiener wollte denn freiwillig schwimmen gehen? Das Meer war groß, unheimlich, mitunter gefährlich. Hier, am Ufer, war es sicher – und zudem sehr unterhaltsam. So ließ es sich aushalten, stundenlang.
Ein bisschen würde es aber noch dauern, bis sie alle anrückten: die Touristen aus ihren Hotels, die alten Bewohner des Ortes, die noch in die Kirche gingen, um zehn war die Messe, und die war so fest in ihrem Leben verankert wie der Caffè danach an seinem Tresen. Die jüngeren Leute, die nicht mehr in die Kirche gingen, weil sie Gott nicht mehr brauchten – oder einfach zu müde für Gott waren –, die also schliefen noch ihren Rausch aus, selbst in seiner Wohnung fernab von der einzigen Disco des Ortes hatte Enzo gestern Nacht noch das Rambazamba gehört. Aber statt sich zu ärgern, hatte ein leises Lächeln in seinem Gesicht gespielt. Damals, er erinnerte sich – mehr noch: Er konnte fast spüren, wie das gewesen war, derselbe Raum, aber dort waren bunte Lichter gewesen statt dieses blitzenden Spektakels, und auch die Musik war eine andere, man konnte mitsingen, klatschen, ein Jubel statt dieses wummernden Stakkatos von heute. Aber das Gefühl war wohl dasselbe gewesen, abzüglich der blauen Lichtflecken im Raum, weil alle auf ihre Smartphones starrten. Er hingegen hatte damals nur sie angesehen, den Schweiß auf seiner Oberlippe geschmeckt, die Bässe, die in seinen Körper gekrochen waren, die Sehnsucht nach der Frau und ihren Lippen, von denen er den Blick nicht lassen konnte.
Sein Blick wanderte sogleich zu dem kleinen Foto, das nur er sehen konnte und das ihn immer wieder anzog wie ein Magnet in diesem kleinen Raum. Es stand oberhalb der Eistruhe auf einem kleinen Bord und war nur zu ihm gerichtet. Er lächelte sanft, als er sie erblickte, die Lippen, die ihn in jener Nacht geküsst hatten, die lockigen dunklen Haare, ihre grünen Augen mit dem klugen Blick.
»Buongiorno, Enzo«, sagte der alte Signor Conte und trat an den Tresen.
»Ciao, caro«, erwiderte Enzo und machte sich an der alten Cimbali-Maschine zu schaffen. Sein erster Gast war in dieser Hinsicht der untypischste Italiener, den er sich vorstellen konnte. Denn er war immer pünktlich, gerade so, als wäre er ein Schweizer. Denn er war der Mann, der vorhin das Boot an Land gewuchtet und in Windeseile den Fang in die Kühlung gelegt hatte, später würde der Händler die frischen Fische abholen und an die Restaurants im Ort liefern – Contes Geschäft war in jenem Moment erledigt, in dem die Brassen, Barsche und Sardinen im Netz hingen.
In allem anderen außer der Pünktlichkeit hingegen war der Alte dann wieder der typische Mann von hier: Er trug an jedem Tag dasselbe Hemd, aber nein, weit gefehlt, es war kein speckiges Etwas, das erkennen ließ, welchem Beruf er nachging – draußen auf dem Meer trug er immer sein Ölzeug, an Land aber stets das in weichen Erdtönen gehaltene Karohemd. Jeden Tag das Gleiche, aber immer wieder ein sauberes. Enzo schätzte, es seien sieben, eines für jeden Wochentag.
Signor Conte rauchte zwar nicht mehr, er hatte das vor einigen Jahren aufgegeben, dafür trank er jeden Tag seinen ersten Espresso hier bei ihm, bei Enzo – und dazu, aber nur an Sonntagen, ein kleines Glas Weißwein bis zum Mittag und exakt nach der Mittagsstunde noch eines. Anfangs war der Wein eiskalt, und der Tau rann am Glas herunter, aber von Minute zu Minute wurde er wärmer, weil Conte so langsam trank. Und es war so, dass dieser alte Fischer an jedem Tag für eine halbe Stunde und an Sonntagen mehrere Stunden, sicher sieben oder acht, bei ihm am Tresen stand – und schwieg.
Er brauchte keine Worte, so schien es, er brauchte nur das Meer. Eines Tages, als Enzo einmal fand, dass Signor Conte ein wenig wackelig wirkte, hatte er ihm einen Barhocker hingestellt, exakt jenen, den er selbst manchmal benutzte, wenn ihm die Beine müde wurden. Doch Signor Conte hatte den Hocker nicht einmal angesehen, er hatte ihn mit Verachtung gestraft, ohne jedoch nur ein Wort an Enzo zu richten. Der Wirt hatte den Stuhl einfach stehen lassen, es war wie ein unausgesprochener Kodex gewesen. Am vierten Sonntag hatte der Fischer plötzlich auf dem Barhocker gesessen – wieder ohne ein Wort, ohne eine Erklärung. Auch Enzo hatte dazu geschwiegen. Fortan war es an Sonntagen der Stammplatz des Signor Conte. Niemand wagte es, ihm den besten Platz am Tresen streitig zu machen – nicht mal Enzo, der am Abend des siebten Tages der Woche stets besonders schlimme Fußschmerzen hatte – ihm fehlte sein Hocker. Aber so war es – und weil es nun geschehen war, wollte niemand mehr daran rühren.
Enzo stellte die kleine, heiße Tasse vor Signor Conte ab, er wusste, dass der Mann nun den Caffè genießen würde, anschließend würde er ihm sofort das kleine Glas Weißwein servieren, einen Malvasia Bianca von dem Winzer, der zwei Dörfer weiter wohnte und der ihnen hier in Qualität und Lokalpatriotismus zur Ehre gereichte – zwei Dinge, auf die es Enzo in seiner Bar immer ankam.
Aus dem Augenwinkel sah er, dass seine Nachbarin eine Tafel auf die Straße stellte. Was war denn nun schon wieder? Er würde gleich nachsehen gehen, aber vorher musste er noch sechs oder sieben Panini vorbereiten – gleich, in einer Stunde, würde es hier, wie immer an einem Sonntagmorgen, sehr hektisch werden.
Felice & Alberto
»Ah, so mag ich es«, sagte er, als sie gerade an der niedrigen Mauer angekommen waren, welche die Promenade von dem Lido trennte. Felice war ein kleines Stück hinter ihm gelaufen, und nun sah sie den Grund für seine Freude: Der Strand war leer. Freie Auswahl. Deshalb waren sie, wie immer am Sonntag, sehr früh in Turin losgefahren, die Sonne war noch nicht einmal ganz aufgegangen.
»Andiamo!«, rief er, fröhlich jetzt, nichts mehr von der vorfreudigen Ruhe, die im Auto geherrscht hatte. Er hatte seinen Willen.
Sie gingen ein Stück weiter südlich, ihr bevorzugtes Bad war jenes blau-gelbe, und doch blieb Felice an der Tafel stehen, die die Chefin des Lido mit den grün-roten Liegen und Sonnenschirmen gerade auf die Straße gestellt hatte. Offerta per Ferragosto stand da. »Schau mal«, sagte sie, »ein Schirm und zwei Liegen für den ganzen Tag – und eine Flasche Prosecco umsonst dazu.« Alberto sah die handgeschriebene Tafel nachdenklich an, als wollte sie ihm eine Falle stellen. Dann zog er seine Stirn kraus. »Es wird glühend heiß heute, meinst du wirklich, da sollten wir Alkohol trinken?« Sein Blick war längst weitergewandert zu seinem Ziel, und er hatte schon wieder die Tasche gegriffen, die er noch am Vorabend fein säuberlich gepackt hatte, mit allem, was nötig war. Für ihn zumindest.
Sie zog ihre Ballerinas aus und betrat den weichen Sand, der noch so kalt war, ausgekühlt von der langen Nacht. Sie liebte es, mit ihren Zehen diese Kühle zu spüren, während Alberto natürlich auf den Holzbohlen ging, die hinunterführten zu der kleinen Hütte.
»Salve«, grüßte Alberto, und Felice nickte dem Mann zu, der hinter dem Tresen stand, er war immer hier, morgens und abends und den ganzen Tag, er schien hier zu wohnen, anders konnte es nicht sein. Sie hätte gerne gewusst, ob er eine Familie hatte.
»Buongiorno,Signora, Signore«, antwortete der Wirt. »Wie immer?«
»Sì«, antwortete Alberto, »in der hinteren Reihe genau an der Mauer.«
Der Mann öffnete den Kasten an der Wand und nahm den kleinen Schlüssel heraus, Numero 17, er schien zu zögern, aber dann sagte er doch nichts und trat hinaus in die Sonne, um seine ersten Gäste zu ihrem Platz zu bringen.
Kaum angekommen, entfernte er das winzige Schloss von der Halterung des Schirmes, sodass der sich problemlos aufspannen ließ.
»Gibt es viel Vandalismus hier in der Nacht?«, fragte Alberto.
Der Wirt nickte. »Ja, die Kids machen sich einen Spaß daraus, die geöffneten Schirme als Boot zu nehmen. Oder es gibt einen Sturm, dann fliegen sie einfach so weg. Deshalb verschließe ich sie.«
»Diese Kids«, wiederholte Alberto und schüttelte den Kopf, als würde er deren Hitzköpfigkeit nie verstehen können. Sie sahen zu, wie der Mann die Liegen umdrehte, ein letztes Mal den Sand der Nacht abklopfte, um sie dann wie ein Hotelbesitzer, der sein schönstes Zimmer anpries, in voller Pracht zu präsentieren.
»Einen wunderbaren Tag«, sagte er.
»Ihre Nachbarin bietet eine Flasche Prosecco gratis an«, sagte Felice und setzte ihr schönstes Lächeln auf. »Sollten Sie auch tun …«
»Was?« Der Wirt schien überrascht. »Was macht sie?«
»Auf der Tafel vor der Tür. Ein Angebot zum Ferragosto. Liegen, Schirme und eine Flasche.«
»Viel zu heiß«, sagte Alberto leise, »da wird uns doch ganz düselig.«
»Hmm«, murmelte der Wirt. »Tolle Idee.« Und dann hörte Felice noch etwas, was klang wie »Wenn sie es nötig hat …«. Schien nicht die beste Stimmung zu sein unter den Konkurrenten, dachte sie. Als der Mann gegangen war und sie sich erst mal auf der Liege ausbreitete, hörte sie das Zungenschnalzen ihres Freundes. »Was denn?«, fragte sie mit geschlossenen Augen.
»Warum musstest du ihn denn danach fragen? Hast du nicht gemerkt, dass das total unangemessen war?«
Sie öffnete die Augen nicht, stattdessen spürte sie die Wärme auf ihrer Haut, eine Wohltat nach der langen Fahrt, die sie frierend in dem kleinen Auto verbracht hatte. Doch dann ratschte es schon, und Sekunden später kam der Sonnenschirm seiner Bestimmung nach und warf den unvermeidlichen Schatten über ihr Gesicht. Allora, der Sonntag am Strand hatte begonnen.
Ada
Ihr Haus hätte überall stehen können, in jeder beliebigen Vorstadt des Landes. Da waren die gleichförmigen Balkone, von denen der Putz rieselte, da waren die Fenster mit den geblümten Gardinen, die mal wieder gewaschen werden könnten, da waren die Satellitenschüsseln, nach Süden ausgerichtet wie Sonnenkollektoren, was irgendwie ganz passend war, weil jene, für die sie zum wichtigsten Objekt ihres Lebens geworden waren, nicht mehr rausgingen, um die echte Sonne zu sehen.
Ada aber ging hinaus, sie hielt sich nur zum Schlafen in diesem Haus auf, dabei war ihre Wohnung gar nicht so übel – »Ich habe das Beste daraus gemacht«, sagte sie stets bei sich. Sie war sehr ordentlich und sorgsam, in allen Fragen des Lebens, bei der Arbeit, in ihren wenigen Freundschaften und eben darin, dass ihre Wohnung stets so aufgeräumt war, wie es sich gehörte. »Was wäre denn, wenn ich mal die Ambulanz rufen muss, und dann erschrecken die, weil sie erst mal über Müllberge laufen müssen, und beim Rausgehen stolpern sie, und ich falle von der Trage.« Ihre beste Freundin hatte einiges gelernt, als Ada das erzählt hatte.
Sie hatte die kleine Stofftasche dabei, die sie sonntags immer mit sich trug, darin war alles, was sie brauchte. Aber eigentlich brauchte sie an dem Ort, zu dem sie unterwegs war, gar nichts. Trotzdem war es immer gut, etwas Feuchtigkeitscreme dabei zu haben.
Ada hatte die Treppe genommen, nun öffnete sie die Tür und trat in den strahlenden Vormittag.
Es war einer dieser Tage, an denen vier Blöcke südlich von hier ein leichter Wind ging, der den späteren Hitzezenit wenigstens einigermaßen erträglich machen würde. Hier aber, in diesem tristen Wohnblock, wehte kein Lüftchen, als würde den Leuten, die hier wohnten, nicht mal der Wind gegönnt und es nachher am späten Nachmittag so heiß werden, dass der Asphalt unter den Füßen weich wurde. Es roch dann in der ganzen Straße, als wäre frisch geteert worden – doch Ada musste zugeben: Sie mochte diesen Geruch, so wie sie ihre Straße mochte, ihre Nachbarn, das ganze kleine Städtchen, aus dem sie stammte.
Gerade schlug sie den Weg nach rechts ein, die kleine Anhöhe hinunter, da hörte sie Schritte, noch bevor sie die Stimme vernahm.
»Ada!«, rief diese junge, fröhliche Stimme, in der Überraschung lag, »wohnst du etwa hier? Na so ein Zufall.«
Sie drehte sich um, einen Moment langsamer, als es nötig gewesen wäre, weil sie Zeit brauchte, sich zu sammeln.
»Ciao, Isa«, antwortete sie, und sie wollte reserviert klingen, vorsichtig, aber es gelang ihr nicht, sie war nie gut darin gewesen, geheimnisvoll zu sein, nicht im Geringsten, obwohl ihr ganzes Leben irgendwie ein Geheimnis war. Hier ging es um ihre Privatsphäre, aber die junge Frau, die ihr nun gegenüberstand, sah so erfreut aus, so herzlich, so froh, sie zu sehen, dass Ada nicht anders konnte, als ihr die Hand entgegenzustrecken. Die große Blondine schien erst nicht so recht zu wissen, was sie nun tun sollte, denn sie trug schwer. Doch dann entschied sie sich und stellte zuerst die Tüte mit etwas ab, was in Geschenkpapier eingewickelt war, den großen Blumenstrauß legte sie vorsichtig obendrauf. »Was haben Sie denn vor?«, fragte Ada, »gehen Sie zu einem Geburtstag?«
»Das ist es ja, deshalb ist es ja so schön, Sie zu treffen: Sie wissen es ja, Chiara liegt doch im Ospedale. Wir wollten sie alle besuchen, alle Kolleginnen zusammen … Aber dass ich Sie auch noch treffe – wissen Sie, wir wussten nicht, ob wir Sie dazubitten sollten – wir … na ja, aber jetzt ist es Schicksal. Bitte, kommen Sie doch mit. Chiara würde sich so freuen, und dann wären wir alle zusammen.« Sie strahlte sie an, als wäre das nicht nur die beste Idee der Woche, sondern als wäre sie noch dazu stolz, dass ausgerechnet sie Ada getroffen hatte. Sie würde mit ihr im Schlepptau im Ospedale aufkreuzen – denn dass sie mitgehen würde, daran zweifelte sie nicht.
Also zuckte nun auch Ada mit den Schultern, griff nach dem Blumenstrauß, drückte ihn der verdutzten Isabella in die Hand, dann nahm sie die Tüte, die schwer aussah, aber ganz leicht war, und sagte: »Na, wenn ich schon mitgehe, dann kann ich auch tragen helfen.«
»Ottimo!«