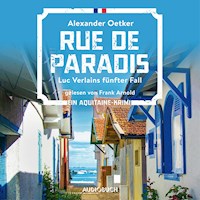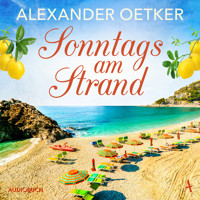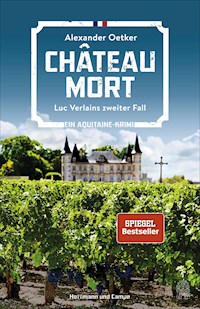Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Profilerin und die Patin
- Sprache: Deutsch
Zwei Schwestern – zwei Welten: Die ungleichen Zwillingsschwestern Zara und Zoë – Profilerin die eine, Mafia-Patin die andere – sind auch im 2. Frankreich-Thriller von Alexander Oetker zur Zusammenarbeit gezwungen Ein Terror-Anschlag erschüttert San Sebastián. Das Ziel: die Sommerakademie von Friedensnobelpreisträgerin Ashrami Rafiki. Die Opfer: über 1.500 junge Frauen aus aller Welt. Mit dieser schrecklichen Vorahnung schreckt Terror-Profilerin Zara von Hardenberg aus einem Alptraum hoch. Die beste Profilerin von Europol kann sich jedes Detail merken, entdeckt jeden noch so kleinen Hinweis und ahnt die nächsten Schritte ihrer Gegner voraus – doch sie kann keine Regeln brechen. Und um einen solchen schrecklichen Anschlag zu verhindern, werden legale Mittel nicht ausreichen. Zara sieht sich gezwungen, erneut ihre Zwillingsschwester Zoë um Hilfe zu bitten. Denn die Profi-Killerin der korsischen Mafia schert sich nicht um Regeln und Gesetze und kennt nur eine einzige Grenze: sich selbst. Also müssen sie wieder die Rollen tauschen, um den Terror zu stoppen und einen Fall zu lösen, der sie tief in ihre eigene Familiengeschichte führen wird. »Zara und Zoë – Tödliche Zwillinge« ist nach »Zara und Zoë – Rache in Marseille« der zweite Frankreich-Thriller um die ungleichen Zwillingsschwestern von Spiegel-Bestseller-Autor Alexander Oetker, der als Journalist und Frankreich-Korrespondent neben rasanter Spannung auch immer wieder Insider-Einblicke liefert.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Oetker
Zara und Zoë - Tödliche Zwillinge
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Zwei Schwestern – zwei Welten:
Die ungleichen Zwillingsschwestern Zara und Zoë – Profilerin die eine, Mafia-Patin die andere – sind auch im 2. Frankreich-Thriller von Alexander Oetker zur Zusammenarbeit gezwungen
Ein Terror-Anschlag erschüttert San Sebastián. Das Ziel: die Sommerakademie von Friedensnobelpreisträgerin Ashrami Rafiki. Die Opfer: über 1.500 junge Frauen aus aller Welt.
Mit dieser schrecklichen Vorahnung schreckt Terror-Profilerin Zara von Hardenberg aus einem Alptraum hoch. Die beste Profilerin von Europol kann sich jedes Detail merken, entdeckt jeden noch so kleinen Hinweis und ahnt die nächsten Schritte ihrer Gegner voraus – doch sie kann keine Regeln brechen. Und um einen solchen schrecklichen Anschlag zu verhindern, werden legale Mittel nicht ausreichen.
Zara sieht sich gezwungen, erneut ihre Zwillingsschwester Zoë um Hilfe zu bitten. Denn die Profi-Killerin der korsischen Mafia schert sich nicht um Regeln und Gesetze und kennt nur eine einzige Grenze: sich selbst.
Also müssen sie wieder die Rollen tauschen, um den Terror zu stoppen und einen Fall zu lösen, der sie tief in ihre eigene Familiengeschichte führen wird.
Inhaltsübersicht
Prolog
Isaakson
Zara
Navarro
Carlos Zuffa
Zoë
Anruf auf verschlüsseltem Mobiltelefon
Gianluca
Zeitungsartikel in El País
Renato
Zeitungsartikel in El País
Zoë
Zara
Maman
Zoë
Artikel in La Repubblica
Zoë
Shokran Al-Hamsi
Benito Bolatelli
Anruf auf verschlüsseltem Mobiltelefon
Navarro
Carlos Zuffa
Zoë
Zara
Zoë
Navarro
Carlos Zuffa
Zoë
Zoë
Zeitungsartikel in La Provence
Zara
Zoë
Navarro
Benito Bolatelli
Papa
Papa
Le Figaro
Zoë
Isaakson
Zara
Zoë
Zara
Zoë
Anruf auf verschlüsseltem Mobiltelefon
Bolatelli
Isaakson
Zara
Zoë
Zara
Zoë
Shokran Al-Hamsi
Aznar
Zoë
Zoë
Onlineartikel in El País
Benito Bolatelli
Zara
Zara
Shokran Al-Hamsi
Zoë
Navarro
Zara
SMS von Zara von Hardenberg an ihre Mutter
Zara
Zoë
Zoë
Onlineartikel in El Diario Vasco
Zara
Zoë
Zeitungsartikel in La Provence
Benito Bolatelli
Zoë
Zara
Zoë
Merci
Prolog
»Sie sehen BBC World News aus London, zu ungewöhnlich später Stunde, mein Name ist Don McMillan. Die Breaking News dieser Nacht werden uns noch tagelang in Atem halten, so schrecklich sind die Vorgänge und die Bilder, die uns aus dem Norden Spaniens, genauer aus der Altstadt von San Sebastián, erreichen. Und wir gehen direkt dorthin zu unserer Korrespondentin Kylie McDuffy. Kylie, Sie berichten seit fünf Stunden ununterbrochen aus dem Baskenland, fassen Sie uns die Ereignisse bitte noch einmal zusammen.«
»Ja, Don, es ist der wahrscheinlich schrecklichste Abend in meiner ganzen Karriere, und niemand, der diese Bilder hier sieht, wird sie jemals vergessen können.
Wir sind seit kurz nach 23 Uhr vor Ort, circa zwei Stunden nach dem schrecklichen Anschlag. Der erste Notruf bei der baskischen Polizei, der Ertzaintza, ging um 21 Uhr ein.
Mehrere Anrufer berichteten, dass ein schwerer Lkw, ein schwerer Schlepper, durch die Altstadt raste und dabei wahllos Menschen überfuhr. Wir konnten die Ereignisse inzwischen so weit rekonstruieren, dass der Lkw, den wir auch auf diesen Bildern sehen, ein gestohlener Dreißigtonner der Marke MAN, kurz vor 21 Uhr von der breiten Foru Pasealekua kommend, noch einmal Tempo aufnahm und an der Markthalle Mercado de la Bretxa ungebremst in die Altstadt raste. Sie müssen sich vorstellen, an einem solchen Abend ist hier ohnehin die Hölle los, 21 Uhr, da sind Zehntausende Flaneure unterwegs, wollen essen, trinken, Spaß haben, aber heute Abend findet ja auch noch die Sommerakademie statt − mit 2000 jungen Frauen aus aller Welt, die sich hier treffen, um für mehr Bildung zu kämpfen, unter ihnen auch die Initiatorin und Friedensnobelpreisträgerin Ashrami Rafiki.
Schon in den ersten kleinen Straßen, vor den unzähligen Bars dieser so belebten Stadt, überrollte der Lkw Dutzende Menschen, bis er dann über die etwas breitere Portu Kalea in Richtung des Plaza Constitución raste, eines zentralen Platzes in der Altstadt, auf dem die Abschlusskundgebung der Sommerakademie stattfand. Noch immer fuhr er mit etwa 70 Stundenkilometern durch die Gassen. Natürlich entstand sofort eine Massenpanik, aber Sie müssen sich das vorstellen, es gibt in diesen engen Gassen bei diesem Tempo natürlich keine Chance zu entkommen, der Sattelschlepper fuhr außerdem Slalom, um möglichst viele Menschen zu erwischen. Um 21 Uhr 05 fuhr er dann auf den Platz, dort kam es zu einem traurigen Höhepunkt, als er mitten durch die Kundgebung raste.«
»Kylie, gibt es schon eine Bilanz der Opfer?«
»Don, es ist eine Katastrophe, wie sie sich seit dem 11. September 2001, also seit genau 17 Jahren nicht mehr abgespielt hat. Wir beklagen hier zur Stunde 368 Tote und über 1000 zum Teil Schwerverletzte, darunter unzählige junge Mädchen der Sommerakademie. Ashrami Rafiki, die Friedensnobelpreisträgerin, wurde auch erfasst, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.«
»Wir hören, der Fahrer sei auf der Flucht? Wie ist das möglich?«
»Ja, in der Tat, das ist nach einem Anschlag mit diesen Dimensionen absolut ungewöhnlich. Aber es ist so, dass das Chaos hier am Tatort in den Sekunden nach der Tat so groß war, dass der Fahrer aus dem völlig zerstörten Führerhaus springen und im Chaos verschwinden konnte. Die Ertzaintza und die gesamte spanische Polizei suchen nach ihm. Er konnte mittlerweile identifiziert werden, doch die Polizei gibt die Identität des Mannes noch nicht bekannt. Jedoch ist vor zwei Stunden ein Bekennervideo im Internet aufgetaucht, es zeigt einen maskierten Mann. Aber sehen Sie selbst:«
Auf dem Bildschirm ist eine kahle Wand in einem Gebäude zu sehen, davor eine schwarze Fahne und ein Mann mit Sturmhaube.
»Ich bekenne mich zu der Tötung von unzähligen Ungläubigen heute Abend in der Altstadt von San Sebastián.
Diese Tat kann keiner einschlägigen Terrororganisation zugerechnet werden, sie ist die Tat einer neuen Zelle, die ihren Ursprung in den Kriegen der Ungläubigen gegen uns hat.
Mein Ziel war es, so viele Frauen zu töten, wie es mir möglich war. Die Zukunft des Islams hängt an uns Kämpfern – unsere Frauen sollen für Nachwuchs sorgen und uns Kämpfer umhegen – und sich nicht durch Verwirrte wie die Afghanin Rafiki auf Abwege führen lassen.
In den Schulen lernen sie die Umtriebe des Westens, doch sie lernen nichts von ihrem Glauben.
Unsere Zukunft sind wir selbst – und unser Glauben.
Wir Männer sind die Zukunft – das zeigt sich auch darin, dass es eine Frau war, die mich hierhergeführt hat: eine Kommissarin von Europol, die meiner List und Tücke erlegen ist. Sie hat mich hierhergebracht, in die Straßen Spaniens – um meine Tat zu vollbringen. Sie hat es mir durch ihr Unwissen ermöglicht, pünktlich von Afrika hierher nach Europa zu gelangen und meinen Plan umzusetzen.
Durch ihre Fehlbarkeit ist diese Katastrophe gelungen. Und das zeigt uns Kämpfern ein für alle Mal: Die Behörden im Westen haben keine Chance gegen uns. Weil sie ängstlich sind. Wir aber sind entschlossen.
Sollte ich diesen Anschlag überlebt haben, werde ich fortan der Anführer der neuen Zelle sein. Auf den Tod der Ungläubigen.«
Ende der Aufnahme
Ihr war gar nicht eingefallen, dass sie eingeschlafen war. Sie hatte seit Stunden in ihrem Bett gelegen, draußen kreisten einige Polizeisirenen, irgendein Fußballspiel im nahe gelegenen Jahn-Sportpark. Doch sie musste dann doch weggetrieben sein, in einen leichten Schlaf. Jedenfalls wachte sie nun so heftig auf, dass sie sich hinsetzen musste. Der kalte Schweiß stand ihr auf der Stirn, dabei war es im Zimmer herrlich kühl. Berliner Altbau eben.
Sie sah sich um, Stefan schlief neben ihr, so friedlich, wie es nur ein Mann ohne elementare Sorgen konnte.
Sie lauschte nach den Kindern im anderen Zimmer, doch die Wohnung lag still da.
Dieser Traum, er war realistisch gewesen, als würde sie selbst vorm Fernseher sitzen. Sie konnte jedes Wort nacherzählen, sogar jetzt noch, Minuten später.
Eine Spur zu realistisch. Sie wusste, was das bedeutete.
Isaakson
Ledras Street, Altstadt von Nikosia, Zypern
Sie habe keine Zeit, hatte es geheißen.
Familiäre Verpflichtungen in Berlin.
Er glaubte Rui, seinem Boss, kein Wort. Wahrscheinlich war sie an irgendeinem heißen Ding dran, ohne ihn.
Dabei war das hier das heiße Ding. Da hatte er nicht den geringsten Zweifel.
Isaakson hörte, wie der Muezzin auf der anderen Seite der geteilten Stadt wie wild rief, Freitag, Gebetszeit. Ohne Zweifel hatten die Türken den Lautsprecher in Richtung der Republik Zypern gedreht, damit es hier lauter zu hören war als im eigenen Land. Aus dem heißen Krieg während der türkischen Besetzung des Inselnordens im Jahre 1974 war über die Jahrzehnte ein kalter Krieg geworden, der aber nur noch kuriose Züge hatte: Kein Flugzeug ging in den Norden, außer es kam aus der Türkei. Selbst Briefe mussten über die türkische Küstenstadt Antalya geschickt werden. Die Grenze wurde bewacht von jungen Soldaten, die aber nur noch pro forma hinter den Sandsäcken standen, selbst die Blauhelme der UN betrachteten einen Zypern-Einsatz als Kurzurlaub im Mittelmeer. Dennoch war es ein Fakt: Nikosia war die letzte geteilte Hauptstadt der Welt.
Der Grenzübergang war dort vorne, eine Hütte für die griechisch-zypriotischen Beamten, eine weiter hinten für die türkischen. Dazwischen ein schmaler Steg, links und rechts Niemandsland. Entmilitarisierte Zone. Soldaten mit Gewehren, die Kaugummi kauend auf ihren Wachtürmen herumhingen.
Er konnte von der anderen Seite dieses Landes nicht viel sehen, nur die Spitze der Moschee und die omnipräsenten roten Flaggen mit dem Halbmond, die sie alle fünfzig Meter aufgehängt hatten – zweifellos auch reine Provokation.
Nach kurzer Suche hatte er ein Kafenion gefunden, das ohne Weiteres auch in Stockholm hätte stehen können.
Die Barista war atemberaubend, weißes Tanktop, kurze hellblaue Hotpants, ein Lächeln wie aus dem Griechenland-Urlaubskatalog. Dazu gab es eine richtige Kaffeemaschine, hausgemachte Kuchen und einen unverbauten Blick auf die Grenze.
Nachdem er mit der Zypriotin hinter der Bar ausreichend geflirtet hatte, bezog er Stellung an einem kleinen Tisch auf der Terrasse.
Er schaffte zwei ganze Cappuccini.
Dann hielt ein Stück die Straße runter der blau-weiße Ford Mondeo mit der kryptischen griechischen Beschriftung für Polizei, darunter kleiner Police.
Nur die hintere Wagentür öffnete sich, genau wie es verabredet war. Ein Mann stieg aus. Klein, schlank. Und hellblond. Er blickte sich kurz um, hielt die Hand vors Gesicht, als schütze er sich vor der Sonne. Ein zweiter Blick, die Straße hinunter. Der Mann war geschult darin, Gefahren zu erkennen. Das erkannte Isaakson sofort.
Nun ging er los, schüttelte an der Schlange vor dem KFC-Hähnchengrill den Kopf, lauschte kurz dem Muezzin, der noch immer von drüben rief, und ging dann weiter, langsam und doch irgendwie zielstrebig.
Als er fast bei dem griechischen Kaffeehaus angekommen war, stand Isaakson auf und ging ein Stück auf ihn zu. Leise und ohne eine Spur des Zögerns sagte er auf Arabisch: »Salam aleikum, Herr Al-Haddad. Ich habe auf Sie gewartet, setzen Sie sich bitte zu mir.«
Der junge Mann blickte ihn aus zusammengekniffenen Augen an und sagte ganz freundlich: »Ein Zwei-Meter-Riese mit dem Akzent meiner Heimat. Ich bin überrascht.«
»Ich nenne Beirut meine zweite Heimat«, gab Isaakson zurück. »Und meine erste Liebe.«
»Und dann sind Sie auch noch Poet. Ich fühle mich geschmeichelt.«
Sie setzten sich unter den hellen Sonnenschirm.
Die dunkelblonde Barista kam heraus, der Blick des Mannes ruhte einen Moment zu lange auf ihr, dann wandte er die Augen rasch ab und sagte zu Isaakson: »Sagen Sie ihr, ich nehme einen Kaffee. Schwarz.«
»Zucker?«
»Einen normalen Kaffee. Nicht dieses süße zypriotische Gesöff. Das hat mir schon im Gefängnis gereicht.«
»Gut, bring uns bitte einen schwarzen Kaffee, ich nehme ein Keo«, sagte er, und die Barista verschwand mit einem Lächeln für ihn und einem verächtlichen Blick für seinen Begleiter.
»Zu viel Weiblichkeit?«, fragte der Schwede, der gelernt hatte, dass es in diesem Kulturkreis unter Männern besser war, ohne Skrupel zu sein.
Der blonde Mann schien zu überlegen, wie viel von seinem Innenleben er preisgeben konnte.
»Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, dass sie so … frei sind«, sagte er. »So …«
»… verführerisch?«
»… nuttig. Leicht zu haben. Verstehen Sie? Ich war sehr froh, dass der Knast ein reiner Männerort war.«
»Ein Jahr?«
»Zehn Monate und fünfzehn Tage.«
Die junge Frau kam wieder heraus, stellte den Café und das Bier vor den Männern ab. Al-Haddad warf einen verächtlichen Blick auf das Bier.
Isaakson fand ihn schwer erträglich.
»Und wie sind Zyperns Knäste?«
»Wie Beiruts Wohnungen. Bisschen zu warm, aber einfach und sauber.«
»Sie sollten froh sein, dass Sie nicht in Spanien sitzen. Wenn die Sie da für Radikalisierung drangekriegt hätten, säßen Sie ’ne Ewigkeit ein. Und – was man so hört – ist der Terrorknast von Valdemoro nicht unbedingt zu empfehlen.«
Der Libanese schnaubte verächtlich.
»Nette Zellengenossen gehabt?«
»Diese Insel ist ein Phänomen. Selten so wenige Glaubenskumpanen kennengelernt.«
»Ist das der Grund, warum Sie sich die ganze Sache noch mal überlegt haben?«
Der Mann nahm einen Schluck von seinem Café, prüfte ihn auf der Zunge, dann trank er die Tasse rasch aus.
»Lassen Sie uns ein Stück gehen, ja?«
Isaakson sah sich um, doch außer älteren zypriotischen Herren, die auf den Holztischen Tavli spielten, war da niemand. Trotzdem sagte er: »Gut, gehen wir.«
Er brachte 20 Euro in die Bar und nahm sich vor, später am Abend wieder herzukommen. Nachdem er erstaunliche 11 Euro Wechselgeld erhalten hatte, liefen sie die Ledras hinauf Richtung Grenze.
»Können Sie mich Adel nennen? Das macht es einfacher«, sagte der Mann und sah Isaakson zum ersten Mal direkt in die Augen.
»Klar. Isaakson«, gab der zurück.
»Norweger?«
»Schwede.«
»Viele Glaubensgenossen in deinem Land.«
»Ja. Und viele von ihnen sind meine Freunde.«
»Und? Schlechte Erfahrungen?«
»Bei meinen Freunden? Nein. Hat aber auch niemand von ihnen versucht, innerhalb einer salafistischen Organisation Kämpfer für den Dschihad anzuwerben.«
»Wir sollten aufhören, uns gegenseitig zu beleidigen«, erklärte Al-Haddad, und seine Stimme war scharf. »Weißt du, Isaakson, ich mache das hier aus Überzeugung. Ich habe so viele Nächte wach gelegen …«
Er brach ab, als dächte er nach. Sie bogen in eine kleine Gasse, die ausgestorben dalag. Zu ihrer Rechten war eine Sackgasse versperrt mit Sandsäcken, dahinter Schießscharten und ein Wachturm, darauf ein junger Soldat, der ihnen gelangweilt nachsah. Über allem lag die Hitze des Spätsommers. Adel atmete schwer.
»Ich wusste von Anfang an, dass wir nicht richtigliegen. Aber was machst du als junger Libanese aus einer religiösen Familie, wenn du niemanden hast, an dem dir etwas liegt. Wenn alle in deiner Familie …«
Wieder eine Pause. Isaakson ärgerte sich, dass sein Bier noch beinahe unangerührt auf dem Tisch stand. Er hoffte, hier nicht seine Zeit zu verplempern. Der Typ nervte.
Aber wenn es stimmte, was der Libanese angedeutet hatte, dann hatte er derart gute Informationen, dass er der Schlüssel sein konnte, um die Bürger Europas zu schützen. Eine einmalige Chance.
»Wenn da niemand ist, der an dich glaubt … Wenn es einfach nichts gibt, was deinem verdammten Leben einen Sinn gibt? Meine Brüder waren für mich da – wohlgemerkt, meine Glaubensbrüder –, also habe ich ihre Idee nach Europa getragen.«
»Was leicht war, als Sohn eines Handelsreisenden, der gute Kontakte in die westliche Welt hatte?«
Al-Haddad nickte.
»Sind Sie deshalb so blond wie ich?«
»Mein Vater hat es wohl nicht so ganz genau genommen mit der Treue. Wir haben nie darüber gesprochen«, bekannte Al-Haddad bitter. »Deshalb war ich immer ein Ausgestoßener in Beirut.«
»Kindheitstrauma?«
Der Libanese überging die Bemerkung.
»Ich habe im Westen gesehen, was meine Brüder euch vorwerfen. Eure Maßlosigkeit. Eure Verführbarkeit. Euer Verrat an Familie und Zusammenhalt.«
Isaakson lachte laut auf.
»Ich weiß nicht, ob die Scheidung einer zerrütteten Familie ein größerer Verrat ist, als wenn ich mit einem Sprengstoffgürtel die Madrider U-Bahn in die Luft jage. Mit Frauen, die auch Familie haben. Mit Kindern, die zu jemandes Familie gehören.«
»Ich wusste, dass wir so ein Gespräch führen würden«, sagte der Mann und blickte ihn starr an, dann ließ er seine Augen wieder schweifen, sog durch die bebenden Nasenflügel die Luft ein und hielt inne, als er den Muezzin hörte, der aus der Moschee zu ihnen herüberrief.
»Hörst du, was er sagt?«
»Ja. Er sagt: ›Allah ist der Gesetzgeber. Allah schreibt vor, was Recht und Gesetz ist.‹«, übersetzte Isaakson.
»Genau. Und deshalb führt mich, was du sagst, in die Irre. Du weißt wie ich, dass der Islam Frieden verheißt.«
»Es sind deine Brüder, die das Wort umkehren und Taten begehen, die uns töten sollen. Und du warst einer dieser Männer.«
»Alles hat seine Zeit«, antwortete Adel. »Ich habe verstanden, dass der Hass uns vergiftet. Dass Allah uns sagen wird, wohin unser Weg führt. Dass wir es nicht allein können. Darum habe ich mich an die Behörden gewandt, an die zypriotischen Behörden, meine ich. Und deshalb bist du jetzt hier, so scheint es.«
»Ich will sicher sein, dass du deinen neuen Platz kennst.«
»Hat den Satz jemand für dich vorbereitet?«
Isaakson denkt an Zara und antwortet nicht. Adel hält inne und grinst.
»Ja, ich füge mich in die Ordnung der westlichen Welt. Ich werde für euch arbeiten. Ich übermittle euch alle Informationen über mein Handy. Wenn es zu unsicher wird, sende ich eine Postkarte per Luftpost.«
»Wir brauchen richtig gute Informationen, kein Blabla.«
Der Libanese blickte ihn intensiv an.
»Was du von mir kriegen kannst, wirst du von keinem anderen in der Szene bekommen. Die vertrauen mir, seit ich in Syrien …«
Er brach ab. Mehr war nicht nötig. Isaakson kannte die Geschichte. Die Bilder.
»Ich habe alles vorbereitet. Es gibt Papiere, die du unterzeichnen musst. Eine Verpflichtungsvereinbarung. Guck nicht so, ich hab mir das nicht ausgedacht. Ich habe deinen originalen Pass hier, mit dem du sofort hinüberkannst in die türkische Republik Nordzypern. Von dort bringt dich ein Boot nach Mersin in die Türkei, das Ticket ist in diesem Umschlag. Dort wird es für dich ein Leichtes sein, nach Rakka zu gelangen.«
»Werden meine Brüder die Geschichte glauben?«
»Dass dich die Behörden auf Zypern freigelassen haben? Einfach so? Ja, klar. Nach allem, was du unserem Kontakt auf der Insel erzählt hast, glaubt ihr doch eh, dass die Behörden in Europa allesamt Weicheier sind, die keine Ahnung haben, wen sie ins Land lassen. Deine Entlassungspapiere sind wasserdicht – wir konnten dir keine Anschlagsvorbereitungen nachweisen –, und das bisschen Radikalisierung führt zur Freilassung. So ist nun mal der Rechtsstaat.«
Isaakson stöhnte, weil es wahr war. Und der Libanese grinste, weil er das wusste.
»Was mache ich dann, wenn ich drüben bin?«
»Du tust, was sie dir sagen. Sie werden dich wieder ins Spiel bringen wollen. Du lässt dich darauf ein.«
Zwei zypriotische Mädchen hüpften zum Rhythmus des eigenen Gesangs vorbei, die Schulranzen wippten auf ihren Rücken. Adel schien kurz gebannt, sein Blick folgte ihnen, dann riss er sich los, sah wieder Isaakson an und wies auf die Passanten.
»Und wenn die wollen, dass ich viele von euch töte? Kuffar, Ungläubige?«
»Dann werden wir wissen, was sie vorhaben. Wir werden dich vorher rausholen.«
»Sie sind klug.«
»Wir sind klüger.«
»Inshallah.«
Zara
Landeskriminalamt Berlin
Der Raum war stets verschlossen. Kein deutscher Polizist durfte ihn betreten, darauf wies das Türschild Europol – Entrance prohibited deutlich hin. Außerdem war es die einzige Tür in diesem scheußlichen Sechzigerjahre-Bau mit antiker Technik, die elektronisch mit mehreren Codes gesichert war.
Die Zahlenfolgen waren nur drei Menschen bekannt.
Rui Vicentes. Dem Chef der Europol-Spezialabteilung Schwere Verbrechen und Terror. Zaras Mentor.
Zara von Hardenberg selbst.
Und einer dritten Person, einem anderen versteckten Fahnder, den nicht mal Zara kannte. Sie wusste nur, dass da noch jemand war, erkannte den Geruch des stets gleichen unbekannten Männerparfums, wenn sie nach mehreren Wochen mal wieder die Tür öffnete. Ein herber Duft, undurchdringlich.
In dem fensterlosen Raum tief im Inneren der verzweigten Flure stand ein einzelner Tisch und ein Stuhl. Keine Schränke. Auf dem Tisch ein Computer.
Zara drückte einen Knopf der Tastatur, sofort wurde der Raum in das blaue Licht des Monitors getaucht. Sie gab ihr Passwort ein, suchte in dem Ordner nach der Datei Adel Al-Haddad – Rakka/Syria.
Das Video begann ohne Vorwarnung. Sie kannte es schon auswendig, deshalb zuckte sie inzwischen nicht mehr zusammen, als dieser schlanke, kleine Blondschopf einem anderen, deutlich älteren Mann mit einem Schwert den Kopf abschlug. Sie war immer wieder überrascht, wie wenig Blut in so einem Moment floss. Und wie lange der Körper noch zuckte.
Sie hätte das Video nicht noch einmal sehen müssen, ihr Gehirn speicherte alle Einzelheiten schon, wenn sie etwas zum ersten Mal sah. Und dennoch hatte sie das Gefühl, sich einstimmen zu müssen.
Sie schloss die Datei und suchte im Ordner CCTV.
Sie fand den Namen Isaakson, sah, wie sich die Karte öffnete, dann war da das Icon eines Männchens, das Isaakson war. Es bewegte sich auf der Karte in Nikosia, irgendwo in der Altstadt der Hauptstadt Zyperns.
Sie dachte darüber nach, dass er sich sicherlich schuldig fühlen würde, wenn die ganze Geschichte umgekehrt gelaufen wäre – wenn er nun sie beobachten würde. Sie aber kannte diese Kategorie nicht. Schuld. Was sollte das sein? Es galt zu ermitteln.
Deshalb hatte sie die Experten der Abteilung, zwei sehr verschwiegene Männer in Den Haag, genau die drei Levi’s-Jeans manipulieren lassen, die Isaakson immer auf Reisen trug. Mit einer winzigen Weitwinkelkamera im Hosenknopf. Die Technik war mittlerweile so weit, dass sich die Kameras selber speisten und per WLAN in alle Welt sendeten.
Und so sah sie, als sie auf Observe klickte, wie sich die Kamera im Takt von Isaaksons Schritten bewegte. Die Auflösung war fantastisch.
Sie sah, wie die junge Kellnerin dem Schweden einen Cappuccino brachte, hörte das schmeichelnde Englisch ihres Partners. Und dann sah sie den Mann, der aus dem Polizeiwagen stieg und auf den Tisch zukam.
Hörte seine ersten Worte. Spürte, wie sich ihr die Armhaare aufstellten.
Als er von der Zeit im Gefängnis sprach, hörte sie genau hin. Von seiner Kindheit im Libanon.
Sie schaute in seine Akte.
Geboren 1979. Beirut. Sohn eines Handlungsreisenden. Mutter eine libanesische Hausfrau. Offiziell zumindest. Drei Schwestern, heute in alle Welt verstreut. Paris, Nizza, London. Weltläufig, gebildet. Eine gutbürgerliche Familie.
Ein Wunder, dass einer von ihnen derart an die falschen Leute geraten war.
Ein Wunder, dass sich so einer führen ließ – und nicht selbst führte.
Er war einer simplen Polizeistreife aufgefallen, als er in Nikosia herumlief. Die zypriotischen Beamten hatten ihn erkannt und festgenommen. Sie hatten nicht glauben können, dass sie den Schlächter von Rakka eingesackt hatten. Im Gefängnis hatte sich Al-Haddad einem V-Mann offenbart. Er würde gerne mit Europol zusammenarbeiten – seine Freiheit im Tausch gegen wichtige Anschlagspläne. Die Zentrale in Den Haag hatte nicht Nein sagen können. So hatten sie Isaakson geschickt, um den Kerl zu prüfen. Und das tat er jetzt. Nun würden sie den Libanesen zurückschicken – zu seinen Mitterroristen. Ihn herumwuseln und alles herauskriegen lassen, was er konnte. Vielleicht würde der IS ihn auch wieder Richtung Europa schicken – mit einem konkreten Anschlagsplan –, das wäre die absolute Wunschvorstellung. Denn dann hätten sie eine große Zelle aufgedeckt.
Die Worte des Libanesen brannten sich ein. Wie er über Frauen sprach.
Er war schwer zu ertragen.
Diese Stimme, diesmal jovial und irgendwie menschlich. Es war dieselbe Stimme, die eben tief und durchdringend gewesen war, während seine Hände einem anderen den Kopf abhackten.
Einige Tage später
Navarro
Hôtel de Police, Marseille
Erst der NATO-Stacheldraht, der um das komplette Gebäude herum auf dem Boden verlegt war. Dann die sechs CRS-Beamten in voller Kampfmontur, kugelsichere Westen, Sturmhauben, Schnellfeuermaschinengewehre in den Händen, auch die junge blonde Frau unter ihnen, die ihm grimmig zunickte. Dann ein neuer Zaun, drei Meter hoch, massiv, Stacheldraht obenauf.
Und dann erst das Hauptportal, Stahlbeton, fast einen Meter dick, in dem sich nun eine kleine Tür öffnete, die ihn einließ.
Das Polizeihauptquartier von Marseille eine Festung zu nennen, fand er reichlich untertrieben. Seinen Arbeitsplatz, in dem er seinen Dienst antrat, wie gestern, vorgestern, letzte Woche. Natürlich sollte er sich an die höchste Terrorwarnstufe und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen schon gewöhnt haben, genau wie alle seine Kollegen – und doch bereitete es ihm ein großes Unbehagen, sich jeden Tag durch diese Kaskade von Wahnsinn zur Arbeit begeben zu müssen.
Wenn der Bürgermeister erklärte, das hier sei das neue Marseille: das Marseille der Touristen, der Kunst und Kultur, des sauberen Handels – das herausgeputzte Marseille am alten Jachthafen, daneben das funkelnde neue MuCEM, das Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeerraums – dann konnte er nur lachen.
Sollten die Touristen mal hier runterkommen, zum Commissariat, da würden sie sehen, wie es um seine Hafenstadt wirklich bestellt war. Wie viel Schiss die Stadtoberen immer noch hatten. Vor Terroristen, Clans, der Mafia. Da würden sie aber schleunigst Reißaus nehmen.
Seit anderthalb Monaten durfte er wieder ran. Die zweiwöchigen internen Untersuchungen nach dem Tod von Petit waren abgeschlossen, keiner hatte ihm etwas nachweisen können. Die Waffe, mit der die tödlichen Schüsse abgegeben worden waren, war unauffindbar. Kein Wunder, sie war auch nicht registriert gewesen.
Dennoch hatte er einen Gang runtergeschaltet, sollten sie ruhig glauben, er habe eine »posttraumatische Belastungsstörung«, wie die verdammte Therapeutin immer wieder behauptet hatte.
So ließ es sich abends deutlich länger und ausgiebiger Pétanque unten am alten Hafen von Goudes spielen – und den Pastis konnte er auch unverdünnt trinken, wie es ihm am liebsten war.
Denn heute wie gestern wie vorgestern trottete er erst kurz vor elf ins Büro.
An der Sicherheitsschleuse lief er links vorbei, sie piepte trotzdem, die Knarre in seinem Holster war einfach zu metallisch.
Er nickte dem Wachposten hinter dem Sicherheitsglas zu und stieg die zwei Treppen hinauf in die zweite Etage, Sitz der Police Judiciaire de Marseille.
Seit zwei Wochen hatte seine Einheit wieder eine Führung, einen Wichser von Karrierebeamten der Police Nationale, ein junger Pariser, der sich hier um jeden Preis beweisen sollte. Immer Schlips und Kragen, dazu so eine tuntige Männerhandtasche von Louis Vuitton. Keyser hieß er. Jude war er also auch noch.
Gott sei Dank ließ ihn der Jüngling in Ruhe, Navarros Ruf eilte ihm wohl voraus. Eigentlich hatte er selbst der Boss des Reviers werden sollen – doch Navarro hatte daran nie geglaubt. Typen wie er wurden nicht Boss. Nicht in dieser Welt. Und so hatte ihm Keyser, der schwule Idiot, auch noch einen neuen Partner verpasst. Einen schwer erträglichen.
Er öffnete die Tür zu seinem Büro, das früher – als noch Petit und er hier gesessen hatten – schön dunkel und verstaubt gewesen war. Nun aber standen die Fenster weit offen, und die Sonne schien herein, dazu wehte der Wind vom Meer her, der den Duft der Stadt hereinbrachte, diese eigentümliche Mischung aus Fisch, Salz und den Gerüchen des Südens.
Auf seinem Schreibtisch herrschte immer noch das altbekannte Chaos, doch auf dem hinteren Schreibtisch war alles tadellos, aufgeräumt, geputzt, kein Staubkorn lag hier mehr herum, selbst die braunen Steinfliesen auf dem Boden glänzten.
Der Schreibtisch hinten war leer, doch der Monitor war angeschaltet, und: Richtig, dahinten erklangen schon die Schritte, und dann flog die Tür auf, dynamisch, jung, den Geruch von frischem Kaffee hinter sich herziehend. Sein neuer Partner.
Seine neue Partnerin.
Sophie Pegnac. Ein reiches Mädchen aus dem Süden. Er konnte es nicht anders sagen. Ende zwanzig war sie, hatte die Polizeiakademie als Jahrgangsbeste verlassen. Immer sah sie frisch aus, gepflegt, teuer gekleidet. Und nun hatte sie ihm dieser Pariser Wichser aufs Auge gedrückt.
Auch das war natürlich eine reine Imagekampagne der Stadtoberen. Die Bullen in Marseille durften nicht mehr so sein wie früher. Versoffen, geschieden, mit besten Kontakten in die Unterwelt, nicht immer ganz sauber.
Nicht mehr so wie er also.
Er war ein Relikt.
Sie war die Zukunft.
Sie war hocherfreut gewesen, an seiner Seite arbeiten zu dürfen. So hatte sie zumindest getan. Was sie hintenrum über ihn erzählte, wollte er gar nicht wissen. Wahrscheinlich erzählte sie am Abend ihren reichen Freundinnen von dem hässlichen alten Sack, mit dem sie arbeiten musste.
»Commissaire Navarro, guten Morgen, wie geht’s denn?«, rief sie, dann nahm sie einen Schluck von ihrem geeisten Kaffee im Starbucks-Becher, der so viel kostete wie drei Pastis unten in der Bar, in der die alten Bullen ihre Mittagspause machten.
»Hmm«, nickte er, während sie sich an ihren Schreibtisch setzte und sofort manisch auf der Tastatur herumhieb. Er sprach mit ihr nicht mehr als nötig. Immer nur ein paar kurze Worte. Sollte sie ihn ruhig für ein Arschloch halten, dann ließ sie ihn wenigstens in Ruhe.
Mehr als einmal hatte er sich in den letzten Wochen Petit zurückgewünscht. Er war ein korrupter, reaktionärer Scheißbulle gewesen – ein Schwerkrimineller mit dem Antlitz eines Pennälers –, aber wenigstens hatte er sein Büro nicht aufgeräumt.
»Ah, das Paket da ist heute Morgen gekommen, ich hab’s unter Ihren Schreibtisch gestellt«, sagte sie und vertiefte sich wieder in die Bildschirmlektüre.
Navarro wollte sich eben hinsetzen, hielt inne und schaute unter den Schreibtisch. Ein großer brauner Karton, fein verklebt mit durchsichtigem Tesa.
Er griff danach, stellte ihn auf den Schreibtisch und las seinen Namen und die Adresse des Commissariats, in Computerschrift, säuberlich aufgeklebt.
Ein Absender fehlte. Merkwürdig.
Sie würden es geprüft haben, dachte er. Hoffte er. Er wusste, dass die Sicherheitsvorkehrungen riesig waren, aber er wusste auch, dass es hier immer noch viele Bullen gab wie ihn – Bullen mit eigenen Problemen, die auf der Arbeit erst mal ’ne Runde pennen mussten. Wenn so einer das Paket nicht richtig geprüft …
Er nahm es hoch, schüttelte es sanft, innen schlug etwas hin und her, es knallte immer wieder an die Kartonwände. Keine Bombe, sicher nicht, das hier war nicht eckig.
Er sah sich die Poststempel an. Vor zwei Tagen aufgegeben in Antibes. Eilpost, datiert auf das Ankunftsdatum von heute.
Navarro drehte sich zu Sophie um, doch die las irgendwas im Internet, wahrscheinlich Modetipps auf irgendwelchen Frauenwebseiten.
Er verdeckte das Paket mit seinem Oberkörper und ritzte mit einem Kugelschreiber die Klebestreifen auf. Verdammt, dachte er und sah den Aschenbecher neben dem Monitor stehen, wie gerne hätte er geraucht. Doch das war verboten, neue Direktive des Pariser Jünglings. Klar, war ja in Amtsräumen schon seit einem Jahrzehnt verboten, aber der Typ setzte das Verbot auch wirklich um.
Er klappte den Karton vorsichtig auf, da lag ein kleiner Umschlag obenauf, und dann war da alles ausgekleidet mit Alufolie, sie bedeckte, was drinnen lag.
Nun schrillten alle Alarmglocken in Navarros Kopf. Er nahm die oberste Lage, versuchte, seine zitternde Hand ganz ruhig zu halten.
Er zog die Alufolie ab, roch das Blut, bevor er es sah, als wäre die Luft augenblicklich mit Eisen angereichert, und dann kam ihm das Rot schon an der Alufolie entgegen, und als er sie ein Stück weiter öffnete, erkannte er ihn sofort. Dabei war nur noch ein kleines Stück Weiß übrig, ein winziges Stück Fell, das noch nicht blutgetränkt war.
Navarro öffnete die Folie ganz, Wut durchströmte ihn, raubte ihm den Atem, als sei er plötzlich unter Wasser gedrückt worden, er bemühte sich, ruhig zu atmen, doch der Anblick war einfach zu scheußlich.
Sie hatten ihn zweigeteilt. Hatten den kleinen Körper zersägt. In der Mitte. Und ihm hatten sie den hinteren Teil geschickt.
Er kippte den Karton leicht an, achtete darauf, nichts zu berühren, doch er sah alles: den durchgeschnittenen Körper, sie hatten ihn genau am Magen zersägt, die Gedärme quollen ihm entgegen. Irgendetwas Schwarzes hing da auch, die Milz? Die Leber?
Dazu das kleine Stückchen weißes Fell und dann die zwei Beine, die Hinterläufe, der glatte kleine Schwanz, der nach oben ragte.
Als die Zeiten noch gut und schön waren – für ihn jedenfalls –, hatten Isabel und er der kleinen Sophie – ausgerechnet! – diesen Welpen geschenkt. Einen West Highland White Terrier.
Sie hatten ihn Zorro getauft. Er hatte den Hund von Anfang an gehasst.
Hier lag Zorro.
Zumindest der hintere Teil von ihm.
Bebend griff er zu dem Umschlag, öffnete ihn, entnahm ihm eine winzige Karte aus feinem Papier, die eng von Hand beschrieben war.
Werter Commissaire Navarro,
wir warten nun seit zwei Monaten darauf, dass Sie unser Problem lösen. Doch die Fürstin lebt, als hätten wir nie miteinander gesprochen. Das ist nicht hinnehmbar, nicht in den heutigen schweren Zeiten.
Als Beweis unseres Nachdrucks senden wir Ihnen anbei eine Probe unserer Durchsetzungskraft. Die andere Hälfte senden wir in den nächsten Tagen an die 3, Rue de Sèvres in Paris, Ihre Tochter wird sicher gern ein Geschenk auspacken.
Ihre Frist beträgt zehn Tage. Danach werden wir mit Ihrer Tochter tun, was Ihrem Hund widerfahren ist. Wir denken aber, dass das nicht nötig sein wird.
Kommen Sie, Navarro, was ist schon eine Kugel mehr?
Wir sind natürlich gänzlich angstfrei, dass Sie uns mit Ihrer Vorgeschichte ans Messer liefern werden. Deshalb grüßen wir Sie sehr freundlich und empfehlen zur Entsorgung den Container in der Rue du Panier, er steht im Schatten.
Die Gebrüder Al-Hamsi
Navarro wollte schreien, den Umschlag zerknüllen, seinen Monitor vom Tisch werfen, die Welt anzünden.
Stattdessen schloss er den Umschlag in seinem Rollcontainer ein, verschloss den Karton vorsichtig und wischte sich mit einem Taschentuch zwei Blutspritzer von seiner Hand ab, ehe er ihn hochhob.
»Gleich wieder da«, sagte er und ging hinaus, hörte noch, wie sie ihm »Bon appetit« hinterherrief.
Er stieg die Treppen hinunter, durchschritt die Sicherheitsschleuse, ging durchs Portal, am Zaun vorbei, an den CRS-Beamten, am Stacheldraht.
Bog nach rechts ab und wieder nach rechts und richtig, dort, in der Rue de Panier, stand unter zwei Bäumen ein großer leerer Abfallcontainer.
Vorsichtig ließ er den Karton hineingleiten.
Vor einer Woche hatte sie ihn angerufen.
Schreiend. Wimmernd.
»Zorro«, hatte sie gestammelt, nach einer Weile, »Zorro.«
»Was ist denn los?«, hatte er gefragt und gehofft, der dumme Köter sei einem Herzleiden erlegen. Damit sie seine Alimente nicht in Scheiß-Chappi anlegte, sondern Sophie etwas für die École Maternelle kaufte.
»Er ist weg«, hatte sie gesagt, wütend jetzt, »wir waren Gassi, Sophie und ich, und dann haben wir ihn im Luxembourg kurz abgeleint, es war schon abends, kaum noch jemand da. Und dann ist er um eine Kurve, hinten am Teich, und dann war er weg. Wir haben gerufen und gerufen, aber er ist nicht zurückgekommen. Sophie …«, hatte sie gesagt, und ihm war bang ums Herz geworden, »Sophie weint die ganze Zeit. Sie kann es gar nicht fassen. Was sollen wir denn machen?«
Er hatte versucht, sie zu beruhigen, sie hatte ihn angerührt, wie sie es immer getan hatte. Er hatte nur nie richtig darauf reagieren können.
Dann hatte er gesagt, sie solle die Polizei anrufen, aber gleichzeitig gedacht: In Paris, in diesen Zeiten, würde sich sicher nicht mal ein halber flic um einen entlaufenen Hund kümmern.
Irgendwann waren sie in einen Streit geraten, wie immer, und sie hatte aufgelegt. Und tief drinnen, in seinem Bauch, da hatte Navarro gefühlt, dass Zorro nicht einfach das Weite gesucht hatte.
»Ruhe in Frieden«, sagte er und ließ den Müllcontainer zuschnappen.
Carlos Zuffa
Montrouis, Haiti, Große Antillen
Die dunklen Wolken dort hinten zeugten von einem nahenden Gewitter, obwohl man hier in der Karibik nie sicher sein konnte, was tatsächlich heranzog: ein leichter Sommerregen, der einem das Hemd durchnässte – oder ein verfickter Tornado, der einen ins Meer zog und killte.
Carlos Zuffa hatte keine Angst. Er hatte nur keinen Bock draufzugehen.
Er trank den Long Island Ice Tea aus, seinen dritten heute. Die Palmen vor der Prince-Strandbar standen in Reih und Glied, als hätte ein neurotischer Architekt sie hier angeordnet, mitten im Chaos.
Er war sich sicher, dass er damals, vor zwölf Jahren, Haiti gewählt hatte, weil es genau das war: der geniale Ort, um unterzutauchen. Hier war zu viel los: Jeder Reiche hatte was auf dem Kerbholz, jedem Armen war alles egal. Und wenn es zu eng wurde, kam bestimmt ein Erdbeben, und alles ging wieder von vorne los.
Der Barkeeper betrachtete seinen einzigen Gast lange und ausgiebig, als bereite er sich auf etwas vor. Zuffa spürte das, dennoch sah er nicht zu dem großen Schwarzen, dem der Laden gehörte, in dem er seit zwölf Jahren jeden Tag mehrere Stunden an dem Tresen unter der Pagode saß.
Als Zuffa aber sein Glas abstellte und imstande war, vom Barhocker zu klettern, räusperte Carl sich.
»Äh, Monsieur Terriot?«
»Oui, Carl?«
»Ich will es gar nicht ansprechen …«
»Dann lass es doch …«
»Wissen Sie, die Zeiten sind nicht gerade rosig. Und Sie stehen bei mir mittlerweile in der Kreide mit …«
Er blickte auf den Zettel hinter seinem Tresen, der neben den Cocktailshakern und Limonenpressen lag, was Blödsinn war, weil er die Zahl ja kannte, sie seit Tagen geübt hatte, da war Zuffa sicher.
»… mit 12000 Dollar. Sie haben seit drei Jahren keinen Dollar bezahlt. Das geht so nicht weiter. Ich muss wirklich irgendwann mein Geld haben, sonst muss ich die Behörden …«
Zuffa stand auf und drehte sich rasch um, gerne hätte er den schwarzen Bastard mit dem Kopf auf seine Theke geschlagen und ihm den Hals gebrochen. Diese beschissene Drohung. Aber er hatte ja recht. Es ging wirklich nicht.
Er ging ein, zwei Schritte von der Theke weg, um seinen Ärger zu lüften, dann sagte er im Gehen: »D’accord, Carl, ich bin für ein paar Tage weg, danach zahle ich.«
Er spürte die Blicke des Schwarzen im Rücken.
Langsam ging er auf die Appartementanlage in dem kleinen Wäldchen zu, die er seit Jahren sein Zuhause nannte.
Er war blitzschnell ausgenüchtert worden durch Carls Worte, was ihn ärgerte, weil er all den Rum damit umsonst getrunken hatte.
Das zweite Haus auf der linken Seite, ein hübscher Neubau – was sie in Haiti eben so neu nannten.
Er stieg die Treppe hinauf, ein großer Singvogel machte in den Hortensien Krach.
Er schloss die Tür auf und ging hinein, die Kühle umfing ihn, sie hatte die Klimaanlage wieder auf volle Pulle gestellt.
Das Licht im Schlafzimmer war angeschaltet, obwohl sie schlief.
Er betrachtete sie, wie sie dort ausgestreckt lag, nackt, die Decke war ihr heruntergerutscht.
Ihre schwarze Haut war seidig, der Po makellos, eine leichte Gänsehaut lag auf ihrem Rücken, weil die Air Condition sie direkt anblies.
Sie sei 19. Hatte sie gesagt. Vor zwei Jahren. Dann wäre sie jetzt 21.
Wahrscheinlich hatte sie damals gelogen.
Aber älter als 25 war sie wirklich nicht.
Halb so alt wie er.
Eine gute Zeit.
Sie räkelte sich, drehte sich um, bemerkte ihn, wie er sie ansah, und lächelte, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen.
»Hey Darling, I wait for you.«
Sie winkte ihn mit der Hand heran.
»A second«, antwortete er und verschwand im Bad. Sein Schwanz regte sich.
Er ging hinein und setzte sich angezogen aufs Klo.
Sein Gesicht im Spiegel, die hellen Augen, wie die eines Huskys. Die kleine Hornbrille, die ihn aussehen ließ wie einen Dirigenten. Die grauen Haare, dicht und voll.
Das offene Karohemd, die blauen Shorts.
Die Bräune eines langen Sommers.
Sein Leben war perfekt.
Er war nicht bereit, das hier aufzugeben.
Nicht für den Sumpf, aus dem er kam.
Dafür würde er noch einmal zurückmüssen.
Er nahm sein Handy, sah auf die Nummer, ein Handy aus Frankreich. Seit Monaten versuchte der Kerl es.
Er wählte.
Der andere nahm sofort ab.
»Ja?«
»Ich bin es. Zuffa.«
»Beim elften Versuch. Ich bin froh.«
»Belabern Sie mich nicht. Ich mach den Job, und dann bin ich wieder weg.«
»Sie kennen die Fürstin persönlich?«
»Das wissen Sie. Ich bin einer von vielleicht fünf. Auf der Welt. Und ich bin der Einzige, der sie töten kann.«
»Ich werde Ihnen eine Gelegenheit bieten. Sie müssen sie nur identifizieren und dann für immer verschwinden lassen.«
»Sie kennen den Preis?«
»Was man so hört …«
»Der Preis hat sich geändert. Ich komme nur einmal zurück. Dann verschwinde ich für immer. Zwei Millionen. Vorab. Dafür gibt es eine Garantie.«
Stille am anderen Ende, ein Atmen.
»Sie sind verrückt.«
»Ich bin überzeugt.«
»Gut. Ich überweise heute. Wann können Sie hier sein?«
»Morgen.«
»Gut. Kommen Sie an. Vielleicht haben wir noch was anderes für Sie. Zum üblichen Tarif. Wir haben einen Bullen, der die Drecksarbeit machen soll – aber er spurt irgendwie nicht. Und ich hab die Schnauze voll.«
»Überweisen Sie die Kohle für die Fürstin. Kugeln für andere Zielpersonen kriegen Sie gratis.«
»Alors, dann guten Flug.«
Zuffa legte auf. Er wählte eine andere Nummer.
Es klingelte viermal, bis die Frau vom Reisebüro endlich abnahm.
»Ich möchte den Morgenflug mit Air France über Guadeloupe nach Paris, von dort weiter nach Marseille. First Class. Senden Sie mir das Ticket per Mail.«
Er legte auf.
Dann strich er sich die Haare glatt, ging zu dem verschlossenen Arzneimittelschrank und öffnete ihn mit dem kleinen Schlüssel.
Er entnahm den Schalldämpfer, schraubte ihn auf die Pistole, die er aus seinem Hosenbund nahm, und ging ins Schlafzimmer.
Sie war wieder eingeschlafen.
Er betrachtete ihren Po noch einmal, dann nahm er das Kissen von seiner Seite, legte es auf ihren Kopf und drückte ab.
Er hörte ein Geräusch wie ein leises Schmatzen, dann färbte sich das Laken unter dem Kopf rot. Er ließ das Kissen auf ihrem Kopf liegen. Er hatte noch eine Stunde, um aufzuräumen. Wenn es dunkel war, würde er sie mit dem Boot rausbringen.
Sie war bestimmt wirklich 25. Ihre Haut war nicht mehr so schön wie früher. Wenn er zurückkam, würde er sich eine Neue suchen. Mit zwei Millionen war das kein Problem.
Zoë
Präfektur, Imperia, Italien
Die dicke Frau in dem Leoparden-T-Shirt betrachtete ihren Pass.
»Signora Julie Goya. Darf ich Ihre aktuelle Adresse haben?«
Ein kurzer Stich, doch dann zog Zoë die Schultern aufrecht. Was sollten sie ihr anhaben?
Klar, Zara hatte ihr empfohlen, wegzuziehen. Sie hatte etwas gespürt. Aber hier war nichts. Zoë hatte es die letzten Wochen wirklich immer wieder geprüft und durchdacht. Sie war hier sicher.
»Via Papa Giovanni XXIII in Ventimiglia.«
Die Beamtin sah sie über den Schreibtisch hinweg an. Misstrauen war es nicht, was in ihrem Blick lag, eher die Lust an Klatsch und Tratsch.
»Keine Jobs in Frankreich?«, fragte sie.
»Ich mag Italien einfach mehr«, antwortete Zoë. »Ihre Leute sind freundlicher. Deshalb lebe ich hier …«
Die Antwort genügte der Frau. Die italienische Trikolore hing träge hinter ihrem Schreibtisch herab.
»Gut. Dann sind hier die neuen Fahrzeugpapiere. Und, was, sagten Sie, ist das für ein Motorrad?«
»Ach, nur ein kleines. Für den Weg zur Arbeit und zurück.«
»Bene«, antwortete die Frau, ohne den Hauch einer Ahnung. »Hier, nehmen Sie.«
Sie gab ihr das winzige Kennzeichenschild mit dem Siegel der Repubblica Italiana.
Zoë dankte ihr und trat in den Sonnenschein vor der Präfektur der Region, die Palmen standen in Reih und Glied, als hätte ein Landschaftsgärtner Hand angelegt.
Sie ging auf die rot-weiß-grüne Maschine zu, die neben dem Parkplatz des Amtsgebäudes an eine Laterne gelehnt stand.
Sie musste lächeln, ganz unwillkürlich, weil sie schon jetzt den Wind im Gesicht spürte. Sie hatte sich endlich diesen Traum erfüllt.
Ducati Panigale V4 Speciale.
226 PS.
300 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Von 100 auf 200 km/h in 3,7 Sekunden.
Sie brauchte jetzt endlich Urlaub. Sie musste etwas Gutes für sich tun.
Also war sie in den Bus gestiegen und gleich nach der Öffnung des Händlers in San Remo in den Ducati-Laden marschiert.
Das sei aber ein Ausstellungsstück, ein Rennmotorrad. Auf der Straße? Nein, das ginge ja gar nicht, also, er würde das nicht empfehlen, hatte der Mann erklärt, der wohl gedacht hatte, sie wolle einen Motorroller kaufen.
Sie hatte die 40000 Euro in bar aus der Tasche geholt und auf den Tresen gelegt. Dann war sie mit der Maschine aus dem Laden gefahren, ohne einen Kaufvertrag, ohne auch nur ihren Namen genannt zu haben.
Den Blick des Mannes im Rückspiegel würde sie nicht vergessen. Als sie zum ersten Mal am Gashebel gezogen hatte und die Maschine dabei fast abhob, hatte sie gejauchzt vor Freude.
Sie setzte sich den Helm auf und stieg auf.