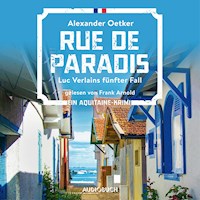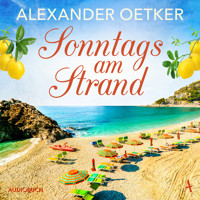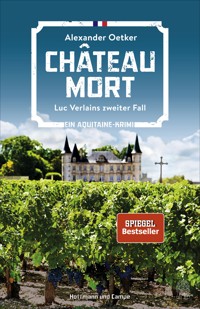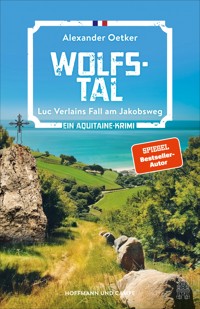Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Luc Verlain ermittelt
- Sprache: Deutsch
Süße Trauben, tödliche Geheimnisse - Luc Verlains gefährlichster Fall Im idyllischen Sauternes im Garonne-Tal wird der edelste Süßwein der Welt angebaut - und ausgerechnet hier wird mitten in der Erntezeit eine junge Winzerin tot in ihrem Weinkeller aufgefunden. Das bei der Vergärung entstehende giftige Gas hat sie umgebracht. Aber ist das schon die ganze Wahrheit? Während die örtliche Polizei von einem Unfall ausgeht, verlässt sich Commissaire Luc Verlain auf sein Bauchgefühl und setzt Ermittlungen durch. In der kleinen Gemeinde aber stößt er auf eine Mauer des Schweigens. Offenbar hat sich die Winzerin mit ihrem Kampf gegen Pestizide und gepanschte Weine so einige Feinde gemacht. Und dann gibt es da noch ein Geheimnis, dessen Wurzeln weiter in die Vergangenheit zurückreichen … Mord in der Aquitaine - Luc Verlain ermittelt: - Band 1: Retour - Band 2: Château Mort - Band 3: Winteraustern - Band 4: Baskische Tragödie - Band 5: Rue de Paradis - Band 6: Sternenmeer - Band 7: Revanche - Band 8: Wilder Wein Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Oetker
Wilder Wein
Luc Verlains gefährlichster Fall. Ein Aquitaine-Krimi
Kriminalroman
PrologMiniatures
Château Malroix, Hügel von SauternesSamedi, 30 septembre, 19:48
Die Luft war so mild und weich, geradezu samtig, wie sie es oft an späten Septembertagen war, wenn die Abendsonne die Dächer des Schlosses und seiner Nebengebäude wärmte und vom kühlen Wind des Herbstes noch nichts zu spüren war.
Morgens lag über dem Dorf ein Nebelschleier, weil der nahe Fluss seine Tautropfen schickte, abends aber waren die Schatten lang und die Konturen scharf gezeichnet. Dann ließ Charlotte von dem Hügel, der die nördliche Grenze ihrer Weinberge bildete, besonders gern den Blick über das Dorf zu ihren Füßen schweifen: die Kirche mit ihrem spitzen Turm, die Schieferdächer der alten Häuser im Zentrum, die Steinhäuser der Weinarbeiter, die sich um den Ortskern herumdrängten, die Platanen und Linden und die ausladende Trauerweide, die den Anblick der alten Kirche noch erhabener und zugleich rührender machte.
In solchen Momenten schlug ihr Herz schneller, weil ihr wieder einmal klar wurde, wie sehr sie diesen Ort liebte – und gleichzeitig spürte sie, wie sie immer ruhiger wurde, denn genau das gab ihr das Gefühl, endlich angekommen zu sein.
Sicher, mit ihrem Wissen hätte sie sich überall niederlassen können, an all den Orten, die die Herzen von Weinliebhabern und Gourmets weltweit höherschlagen ließen: in Saint-Émilion mit all seinen großen Châteaus und diesem wunderschönen Stadtkern mit dem alten Pflaster und der Felsenkirche, die aus dem Stein gehauen worden war. Oder im Médoc, wo der Boden perfekt war für all die großen Gewächse, die dort angebaut wurden, mit seinen Flussterrassen voller Kalk, Kies und Ton. Oder sie hätte sich am Rande von Bordeaux ansiedeln können, wo es berühmte Schlösser gab, in denen große Weiß- und Rotweine gekeltert wurden und die man mit der städtischen Straßenbahn erreichen konnte. Wo sonst auf der Welt gab es so etwas?
All das hatte sie nicht gewollt. Sie hatte nicht im Disneyland des Weines leben wollen, wie böse Zungen das Städtchen Saint-Émilion halb neidisch, halb hämisch nannten. Aber es stimmte schon: Dort wurde so viel Wirbel um den Wein gemacht, dass es am Ende oftmals nur noch um die Flaschenpreise und das große Geld ging – und das, was wirklich wichtig war beim Wein, nämlich der Genuss, auf der Strecke blieb.
Ebenso hatte sie sich gegen das Médoc entschieden. Dort lagen zwar große Schlösser, dort wurden die berühmtesten Weine der Welt angebaut, doch die kleinen Dörfer wirkten alle merkwürdig vernachlässigt, manche gar so gut wie ausgestorben. Aus irgendeinem Grund hatte die Halbinsel in den vergangenen Jahren viele junge Leute verloren. Sie waren nach Bordeaux oder gleich nach Paris gegangen – und so waren auch Infrastruktur, Läden und Gastronomie irgendwann auf der Strecke geblieben.
Stattdessen hatte sich Charlotte für Sauternes entschieden. Sauternes: ein winziges Dorf in der östlichen Gironde. Gerade mal achthundert Einwohner hatte dieser Ort und doch kannten Weinliebhaber in aller Welt seinen Namen. Weil es hier das berühmteste Château der Welt gab – mit Weinen, die alle großen Preise abgeräumt hatten und deshalb umso höhere Preise aufriefen. Weil es hier – und nur hier – genau die klimatischen Bedingungen gab, die eine echte Kostbarkeit hervorbrachten: die Süßweine von Sauternes. Genau jene Weine, denen sich auch Charlotte verschrieben hatte. Nur dass sie sie ganz anders produzieren wollte: gesund, nachhaltig, biologisch – auf eine Weise also, dass die Bewohner des Dorfes in keiner Weise darunter litten.
Denn Charlotte liebte Sauternes nicht nur wegen seines Süßweins. Sondern auch weil dieser Ort im Nirgendwo der Inbegriff des alten Frankreichs war. La France éternelle, das ewige Frankreich. Der simple Dreiklang von Kirche, Boulangerie und Marktplatz, ein schönes kleines Zentrum, ein paar Parkbänke, ein Bouleplatz. Und Bewohner, die das Leben liebten und den Genuss. Das war kein Klischee und auch keine Postkartenromantik. In Sauternes gab es dieses Leben noch. Es war an den meisten Tagen sogar so, als wäre hier die Zeit stehen geblieben. Und genau diese Langsamkeit wollte Charlotte gerne bewahren helfen.
Die Kirchturmuhr schlug zum ersten Mal, und der leichte Wind wehte den Glockenklang zu ihr herüber. Sie musste lächeln und begann unwillkürlich mitzuzählen: drei … vier … Ihr Blick glitt über die benachbarten Hänge, und sofort verschwand ihre Sorglosigkeit: Wie konnten all die anderen Winzer zulassen, dass dieses Paradies bedroht war, ebenso wie die Menschen, die darin lebten? Wie konnten sie es zulassen, dass all das, wofür sie arbeiteten und kämpften, zum schönen Schein verkommen war? Denn die Realität war längst eine schmutzige Angelegenheit und ganz und gar nicht genussvoll. Fünf … sechs … Sie würde sich jedenfalls nicht damit abfinden. Und selbst wenn alle anderen hier um des lieben Friedens willen schwiegen wie eh und je – nicht sie, nicht Charlotte Malroix. Sie würde den Mund aufmachen. So würde es nicht weitergehen – nur über ihre Leiche. Sie würde diesen Saustall aufmischen. Charlotte grinste. Sieben … acht … Der letzte Glockenschlag hallte durch die warme Nacht, die Steinwände warfen sein Echo zurück.
Sie pfiff vor sich hin, blickte noch einmal über die Landschaft und strich über ihre Trauben, ehe sie sich zu ihrem Landhaus aus Sandsteinen aufmachte. »Château Malroix« stand in dicken Lettern auf der Wand. Darunter »Vin biologique« und das bekannte grüne Logo, das für all das stand, was sich hier ändern sollte – endlich.
Maison des Vins de Bordeaux, 122, Quai des Chartrons, BordeauxDimanche, 1er octobre, 10:17
Genervt ließ er die Kippe über das schmiedeeiserne Geländer seines Balkons segeln. Auf der anderen Straßenseite schüttelte eine Mutter, die einen Kinderwagen schob und das sah, entsetzt den Kopf. Ein Tadel aus zehn Metern Entfernung.
»Was glotzt du denn so?«, murmelte er und verzog sich trotzdem lieber nach drinnen. Das Fenster ließ er offen und setzte sich an seinen Schreibtisch, doch er konnte den Blick nicht von der Szenerie lösen, die sich draußen bot. Gilbert le Piqué war gar nicht zufrieden.
Wie hatte sich hier alles verändert!
Früher hatten hier am Ufer der Garonne nur die alten Häuser aus Sandstein gestanden, alle angenehm patiniert. Der Stein war über die Jahrzehnte schwarz angelaufen vom Regen und dem Salz, das der Wind vom Atlantik her in die Stadt trug. Die alten Hangars des Flusshafens waren Ruinen gewesen, und niemand hätte sich ausmalen können, dass das Leben wieder dorthin zurückkehren würde.
Es war die goldene Zeit der négociants gewesen, der Weinhändler, die das Viertel Chartrons damals beherrscht hatten. Sie waren die glorreichen Herren, nobel und respektiert, hatten die besten Kontakte zu den großen Châteaus, durften sogar in die heiligen Keller; nicht als Besucher, sondern als Eingeweihte. Ihnen war es vergönnt, die neuen Weine vor allen anderen zu probieren. Und sie hatten die Macht zu entscheiden, wer eine Kiste Latour oder Margaux zugewiesen bekam – und wer leer ausging.
Die Négociants hatten Bordeaux beherrscht, als die Stadt noch grau und trüb aussah. Denn die eigentliche Schönheit lag in den Weinfeldern ringsum – und in den Kellern und Weinkühlschränken der Bewohner.
Und nun? Heute? Glich Bordeaux einem einzigen Rummel, seitdem der Bürgermeister die Stadt auf links gekrempelt hatte. Natürlich, auch Gilbert gefiel es, dass sein altes Haus nun eine glänzende Fassade hatte. Der Sandstein war so weiß wie damals, als er aus dem Steinbruch am Ufer der Gironde geschlagen worden war. Und auch das Zentrum der Stadt war wie aus dem Ei gepellt, mit dem Wasserspiegel am Flussufer, den die Kinder so liebten, mit der malerischen Place de la Bourse – und dem alten Opernhaus, auf dessen Stufen die jungen Leute saßen und sich gegenseitig Selfies schickten, obwohl sie keine zehn Meter voneinander entfernt waren. Als Bordeaux vom großen Boom erfasst worden war, dachte sich ein findiger Unternehmer, dass doch auch die alten, zerfallenden Hafenhallen für etwas gut seien. Also sanierten Handwerker jahrelang lärmend vor sich hin, was das Arbeiten in den Gebäuden gegenüber fast unmöglich machte. Doch das Schlimmste kam erst noch: das Einkaufszentrum Bord’Eau Village in den alten Quai-Anlagen, das jeden Tag Menschenmassen vor sein Fenster schickte. Die Bordelais und die Familien aus den Vororten kamen, um irgendwelchen Krimskrams, Klamotten und teure Handtaschen zu erstehen. Und Gilbert wettete, dass niemand von denen auch nur eine winzige Ahnung davon hatte, dass in den alten Häusern am Quai die wahre Seele der Stadt zu finden war. Und das war der Wein.
Aber auch der litt ja seit Jahrzehnten unter dem allgemeinen Ausverkauf. Woran konnte man das besser erkennen als an diesem schrecklichen Museum, das sie dem Wein gewidmet hatten? Wenn Gilbert auf den Balkon trat, kam er kaum umhin, diese monströse Scheußlichkeit zu seiner Linken auszumachen, kurz hinter der Hubbrücke Chaban-Delmas. Da reckte sich die Cité du Vin mit ihren glänzenden Platten, die sich in der Sonne spiegelten,gen Himmel. Das Museum hatte die Form einer Weinkaraffe – und es sollte sogar Leute geben, die sich von dieser grässlichen Architektur angezogen fühlten.
Gilbert le Piqué gehörte nicht dazu. Ganz und gar nicht.
Einmal, kurz nach der Eröffnung, war er in die Ausstellung gegangen und hatte gehofft, dass die Stadtoberen dem Rotwein der Region ein echtes Denkmal gesetzt hätten. Doch nach einer halben Stunde war er vor Wut mit hochrotem Kopf wieder hinausgestürmt. »Wie ein Kindergarten«, hatte er gemurmelt, und seine Frau hatte immer wieder seine Hand genommen, um ihn zu beruhigen. »Mal ehrlich, Isabelle«, hatte er gefaucht, »wir sind die Welthauptstadt des Genusses, und hier drinnen sieht es aus, als würde man ausschließlich Dreijährigen den Wein erklären.« Alles hatte ihn aufgeregt: die Duftstube, in der Kinder und Erwachsene die verschiedenen Aromen des Weines erschnüffeln konnten. Die Schautafeln, die die weltweite Geschichte des Weinbaus erklärten. Und besonders die Probiertheke in der obersten Etage. Dort gab es eine tolle Aussichtsplattform, die einmal ums Museum herumführte und von der aus die ganze Stadt zu sehen war; Bordeaux lag den Besuchern zu Füßen. Als Highlight durfte sich hier jeder ein Glas Wein von der Bar holen und damit über den Rundweg flanieren – doch als Gilbert sah, was den Leuten kredenzt wurde, ging seine ohnehin schlechte Laune noch mehr in den Keller.
»Es gibt wirklich nur einen Roten aus Bordeaux?«, hatte er die junge Kellnerin angeraunzt, die ihn eingeschüchtert ansah. »Und einen aus Spanien, einen aus Italien, einen aus Südafrika und einen aus … aus Algerien?« Gilbert war so laut geworden, dass sich die anderen Gäste nach ihnen umdrehten. Aber er war nicht zu bremsen gewesen. »Seit wann ist Algerien ein Weinland? Was soll das denn hier sein – ein Zirkus für Geschmacksverirrte, oder was? Die Cité du Vin in Bordeaux sollte sich nur mit dem Wein aus Bordeaux beschäftigen – und nicht mit irgendeiner Plörre aus Nordafrika.« Und dann hatte er den Wein in den Ausguss gekippt und war wütend abgezogen. Isabelle hatte sich noch schnell bei der Kellnerin mit einem Zehner entschuldigt, das hatte er aus dem Augenwinkel gesehen.
Seither hatte er das Weinmuseum nicht mehr betreten. Und während er jetzt über den Bestellungen dieses Jahres brütete, kam er wieder einmal zu der Erkenntnis: Früher war die Weinwelt eine Sache für die feinen Leute gewesen, für ehrbare Geschäftsleute wie ihn, für Winzer, die mehr Bauern waren als Großunternehmer, für Kunden, die den Geschmack schätzten und den Ruf eines Hauses.
Und heute? War das alles nur noch ein Zirkus. Es ging um Geld, natürlich, auch für ihn. Aber vor allem ging es darum, die teure Flasche auf dem Tisch zu fotografieren und das Bild bei Instagram zu posten. So, wie sich die Leute da drüben im Einkaufszentrum darum drängten, Taschen von Dior oder Gucci zu kaufen. Es ging nur noch um Status, nicht mehr um den Geschmack. Gilbert le Piqué konnte gar nicht sagen, wie sehr er das verachtete.
Und dann noch all die Asiaten, die Japaner, die Chinesen. Sie waren seit Jahren die Hauptkunden im Bordelais. Sie kauften die Weine. Und die besonders reichen Ausländer kauften gleich ganze Schlösser. Dabei verstanden sie rein gar nichts von Wein. Niente. Nada. Rien.
Die Chinesen kauften die Pullen nur deshalb, weil »Margaux« draufstand oder »Lynch-Bages«, weil sie nach Jahrzehnten kommunistischer Knappheit endlich der Schöner-schneller-weiter-Philosophie des Westens nacheifern konnten – und die Winzer dabei mit so viel Geld bombardierten, dass die gar nicht anders konnten, als kistenweise edle Tropfen nach Fernost zu schicken. Dabei hätten die Winzer lieber auch Kunden gehabt, die etwas von Wein verstanden und ihn nicht nur dazu missbrauchten, sich einen Schwips anzutrinken. Aber gut, auch er machte phänomenale Geschäfte mit asiatischen Kunden, auch wenn er diese lieber einem Subunternehmer übertrug.
Gilbert wollte nicht nach Peking fliegen, wirklich nicht. Er blieb lieber in dieser Stadt, die seine Heimat war und die er liebte. Gut, die er mal geliebt hatte. Jetzt liebte er nur noch die Erinnerung an die Zeiten, als Bordeaux zwar hässlich, er aber der heimliche Bürgermeister der Stadt gewesen war. Heute war Bordeaux schön, vielleicht die schönste Stadt Frankreichs. Seine Arbeit aber war nur noch ein Schatten. Doch das war etwas, was Gilbert le Piqué nur zugab, wenn niemand in der Nähe war. Wie an diesem Sonntag, an dem er alleine im Büro saß und Akten durchblätterte.
Er musste zugeben: Sie sahen wieder nicht gut aus, die Zahlen dieses Jahres. Klar, die berühmten Châteaus würden wie gewohnt Rekordumsätze machen. Allerdings vertrieben sie ihre Weine mittlerweile direkt oder über internationale Handelsvertreter in China und anderswo. Da waren die Margen dann noch viel höher.
Gilbert le Piqué beschäftigte sich mit den mittleren und kleinen Weingütern. Und dort lag entweder jede Menge unverkäuflicher Mist in den Kellern, oder sie hatten beim Frost im April die Hälfte ihrer Reben eingebüßt. Also würde sich Gilbert ganz schön nach der Decke strecken müssen, um auf seine Margen zu kommen. Andererseits: Er war so lange im Geschäft, dass ihn diese Aussicht nicht schreckte. Auch wenn er nicht so recht wusste, ob die Schlaflosigkeit, die ihn seit einigen Monaten plagte, vielleicht doch daher rührte, dass er Angst hatte. Angst vor der Zukunft.
Rue de Leyre, Barsac bei SauternesDimanche, 1er octobre, 17:15
Es war schon fast ein Ritual geworden. Je näher er der Haustür kam, desto langsamer ging er. Desto interessierter sah er sich die kleinen Wege an, die sich rechts und links des Hauses durch die Weinfelder schlängelten. Desto lauter kam ihm der Gesang der Vögel vor, weil er so im Kontrast stand zu der schrecklichen Stille, die in diesem Haus herrschte. Totenstille.
Damien nahm den Schlüssel aus der Tasche und hielt an der Tür inne, senkte den Blick und atmete einmal tief durch. Dann drehte er den Schlüssel im Schloss. Erstaunlich, dass es derselbe Schlüssel war, mit dem er als Schulkind diese Tür aufgeschlossen hatte. Er hatte ihn nie verloren, nie abgeben müssen, die Familie hatte auch nie das Schloss ausgewechselt.
Wie schön ihm diese Zeit vorkam. Die Sorglosigkeit. Tun und lassen zu können, was er wollte. Aus dem Schulbus aus Langon zu hüpfen und zu überlegen, ob er mit dem Fahrrad durchs Dorf fahren solle – oder mit Freunden in den Weinfeldern Hasen jagen oder heimlich ein winziges Glas Roten abzufüllen und sich danach herrlich kindlich beschwipst zu fühlen und eine Woche über nichts anderes mehr zu reden. Abends kamen Maman und Papa aus dem Weinfeld und aus der Grundschule nach Hause, und dann saßen sie zusammen um den alten Holztisch, aßen Baguette, Käse und Salat und redeten über den Tag.
Zwanzig Jahre war das jetzt her. Und Damien Arbois wünschte sich, er könnte wieder ein sorgenfreies Kind sein. Sorgenfrei. Das Wort klang, als würde jemand einen Kübel Hohn über ihm ausschütten. Er war alles Mögliche, aber ganz sicher nicht sorgenfrei. Seit Jahren nicht mehr. Jeden Morgen, wenn er aufwachte, kamen die finsteren Gedanken, die Sorgen – und die Wut.
Eine Wut, die er tagsüber einigermaßen im Zaum halten konnte, aber wenn er diese Tür von innen hinter sich schloss wie jetzt und das Piepen hörte … Dieses sonore Piepen der Maschinen, fast das einzige Geräusch, das hier auf die Anwesenheit menschlichen Lebens hindeutete … dann, ja dann schoss die Wut in ihm hoch und war nicht zu bändigen.
Der Flur war dunkel, es roch nach Desinfektionsmittel und Eisen. Krankenhausgeruch. Damien betrachtete die Bilder an den Wänden, auf denen er zu sehen war, mal mit Maman, mal mit Papa, manchmal auch nur er. Lachend, strahlend, Grimassen schneidend. Es kam ihm vor, als würde er sich die Bilder eines Fremden im Museum ansehen.
Das jüngste Bild war ein Foto seines Vaters. Schwarz-weiß, wie es sich gehörte. Der schwarze Schleier hing in der rechten oberen Ecke.
Er wusste noch nicht, was er mit diesem Bild tun würde, wenn er eines Tages hier lebte. Eigentlich würde er es gerne abnehmen und durch ein fröhlicheres ersetzen. Aber Maman mochte dieses Bild, deshalb hatte er sich noch nicht entschieden, ob er es wirklich tun könnte.
Die Tür zum Wohnzimmer stand offen. Wohnzimmer. Noch so ein Hohn. Denn das Wohnzimmer, in dem er mit Papa die Tour de France geschaut hatte, war nun alles in einem: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Krankenzimmer.
Damien trat langsam ein, bemüht, mit den Schuhen auf dem Laminat kein Geräusch zu machen. Das hatten sie letztes Jahr verlegt, weil es sich besser wischen ließ. Vielleicht würde Maman einfach weiterschlafen und ihn gar nicht hören. Dann könnte er ihre Hand halten und sich nach einer Viertelstunde einfach davonstehlen, auch wenn er dann den ganzen Abend ein schlechtes Gewissen haben würde, weil er sie nicht geweckt hatte.
Er betrachtete die Szenerie wie ein Stillleben: die alten Bücherregale, die voller Staub waren, weil seit Jahren niemand mehr ein Buch herausgenommen hatte. Die Maschinen an den Wänden, die Sauerstoffflasche, die zwei Schränke mit Medikamenten, Einmalhandschuhen und Desinfektionsmittelflaschen. Das große Bett mit den Schaltern und Hebeln in der Mitte. Und darin, so klein, dass sie nicht einmal die Hälfte des Bettes auszufüllen schien, lag seine Maman. Wie ein winziges Vögelchen, die Beine angezogen wie immer. Er sah die faltige Haut auf ihren Armen, die früher so schön und gebräunt und stark gewesen waren, als sie ihn in die Luft gehoben hatte, um mit ihm zu spielen.
Tagsüber brauchte sie die Atemmaske nicht, weil sie noch einigermaßen gut Luft bekam. Ihre Arme aber waren mit Maschinen verbunden, die über die Parameter ihres Lebens wachten: Puls, Blutdruck, Herzfrequenz. Zahlen, die ziemlich normal waren dafür, dass es bald vorbei war, dieses Leben.
Schlugen die Maschinen Alarm, wurde automatisch der Pflegedienst informiert, der dann binnen fünfzehn Minuten bei ihr war. Eine dauerhafte Pflege konnten sie sich nicht leisten, und ihr Haus wollte Jacqueline Arbois nicht verlassen. »Jamais« – »niemals« –, hatte sie gesagt. Einmal nur, aber so klar und deutlich, dass Damien nicht einmal versucht hatte, sie zu überreden. Er wusste, dass sie immer noch so stur war, wie er sie zeit ihres Lebens gekannt hatte. Vielleicht, dachte er, war er ihr in dieser Hinsicht gar nicht so unähnlich. Die Wut jedenfalls war seine sture und zumeist stumme Begleiterin.
Er trat auf das Bett zu. Sie lag auf der Seite und atmete flach. Ihre Haut war so grau, dass es ihn ein bisschen gruselte – und er schämte sich sogleich dafür, dass er dieses Gefühl hatte. Und dann war da der kahle Kopf, die grünblauen Adern auf der Kopfhaut, die wenigen Härchen, die übrig geblieben waren, weil die Ärzte sie völlig sinnloserweise noch mal zu einer Chemo überredet hatten, die genauso wenig gebracht hatte wie die drei vorher.
Sie hat noch ein paar Wochen, hatte der Arzt gesagt. Machen Sie das Beste draus. Und Damien hätte ihm gerne eine reingehauen. Das hatte geklungen, als hätte er seine Maman noch auf eine Weltreise schleppen sollen – oder in die Opéra von Bordeaux, um ihr Lieblingsstück Romeo und Julia zu sehen. Als müsste er mit ihr noch einmal tanzen gehen. Oder sie in ein schickes Restaurant ausführen – eine Frau, die seit Monaten nur noch zu sich nahm, was aus den Schläuchen kam, mehr Überlebensration als Verpflegung. Machen Sie das Beste draus. Wenn nicht einmal ein Arzt gut damit umgehen konnte, über den Tod zu sprechen, dann wusste Damien auch nicht mehr weiter.
Aber je länger er mit Medizinern zu tun gehabt hatte in diesen letzten Monaten ihres Kampfes, desto sicherer war er sich geworden, dass nicht das perfekte Baccalauréat und die perfekte Unikarriere aus einem Menschen den besten Arzt machten. Andererseits: Vielleicht waren die Mediziner auch einfach nur überfordert von den immer gleichen unangenehmen Wahrheiten, die niemand hören wollte. Von der Vergänglichkeit. Dem immer irgendwann nahenden Ende. Und all der Trauer.
Damien sah auf den Sessel neben ihrem Bett. Nur ein paar Minuten, dachte er bei sich, als er ihre Stimme hörte.
»Mon fils …« Sie hatte lange keinen ganzen Satz mehr gesprochen, sei er auch noch so kurz, und ihre Stimme klang eingerostet. Die Worte aber kamen so klar aus ihrem Mund, dass sie Damien eine Gänsehaut machten. »Du bist hier …«
Er drehte sich zu ihr und suchte ihre offenen Augen, als Beweis dafür, dass sie wirklich gesprochen hatte. Aber ihre Lider waren so angeschwollen, dass es schwierig war, ihre Pupillen zu erkennen.
»Ich bin da, Maman«, sagte er und wollte sich in den Sessel setzen, doch sie sagte mit knarzender Stimme: »Non, mon cher, komm, komm, setz dich zu mir …«
Damien zögerte, weil er dieses Bett nicht berühren wollte, aber dann tat er es doch. Er setzte sich auf die Kante und spürte die weiche Matratze. Er konnte sie riechen, seine Maman, auch wenn sie wegen all der Medikamente und Desinfektionsmittel anders roch als früher. Er musste die Augen schließen. Ihre kleine faltige und so raue Hand griff nach seiner, und er spürte sogar einen leichten Druck, als sie seine Finger umfasste.
»So schön«, murmelte sie, leiser nun und so, als könnte sie zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder ruhig atmen. »Du hast so viel zu tun und kommst mich trotzdem immer besuchen«, sagte sie leise und langsam, »aber … aber lange musst du das nicht mehr.«
Damien beugte sich ein Stück hinab. Nun sah er, dass ihre Augen offen waren. Ihre Hand war kalt, obwohl die Bettdecke ihr bis unters Kinn gezogen war.
»Aber … Maman, sag das nicht, ich komme dich so gerne besuchen«, sagte er und lächelte, weil es stimmte. »Bitte, Maman, du sollst das nicht sagen …«, da sah er das Lächeln auf ihrem Gesicht, ein feines, ironisches Lächeln, das er von früher kannte.
»Wir wissen doch beide, dass es so ist«, sagte sie. »Noch ein paar Tage wird es gehen, aber ich spüre schon diese große, schwere Müdigkeit. Wie bei Papa. Damals habe ich es ja gesehen, dieses Blei, das plötzlich auf ihm lag. Dieses Blei, das ist der Tod.«
»Ich … Ich hoffe, dass du noch sehr lange bei mir bist«, sagte Damien und spürte, wie ihm Tränen in die Augen traten. Er wollte sie wegwischen, aber seine Maman hielt seine Hand fest, fester, als er es ihr noch zugetraut hätte.
»Ich möchte gehen«, sagte sie leise, »und ich weiß, dass es besser ist. Ich habe damals, als dein Papa so krank war, auch gehofft, dass er noch lange lebt – weil ich mir mein Leben ohne ihn nicht vorstellen wollte. Oder konnte. Er war doch immer da gewesen.« Sie fing an zu husten. Er hörte den Schleim in ihren Lungen rasseln. Es dauerte lange, dieses Husten, Er wollte ihr ein Glas Wasser eingießen, doch sie schüttelte nur den Kopf. Sie wollte weiterreden. »Aber als er dann gegangen ist, habe ich gespürt, wie groß die Last gewesen war. Ich habe es nie gesagt, aber ich war wirklich erleichtert. Und ich weiß, dass es dir genauso gehen wird.«
»Ich …« Jetzt wischte er sich mit der freien Hand doch über die Wangen. »Ich möchte nicht, dass du gehst. Wirklich nicht. Ich …«
»Habt ihr noch etwas unternommen?«, fragte sie.
Er verstand nicht, was sie meinte, weil er sicher war, dass sie an alles Mögliche dachte, aber nicht daran. Doch dann begriff er: Sie meinte genau das.
»Wir … Wir sind da dran. Wir überlegen uns gerade einen Plan – aber eins ist sicher: Das muss aufhören.«
»Die können das nicht so weitermachen«, sagte sie und nickte. Sie klang dabei fast so unternehmungslustig wie früher. »Ich möchte nicht, dass es noch mehr Leuten so geht wie uns. Du weißt es ja, da sind die crèche und die école maternelle – wie soll das denn weitergehen?«
»Maman, wir kümmern uns darum. Versprochen.«
Sie zog an seiner Hand. Er verstand und beugte sich zu ihr hinab. Er gab ihr einen Kuss auf die Stirn, und als er den Kopf wieder hob, sah er zwei Tränen, die ihre faltigen Wangen hinabrannen.
»Ein Teil von mir will auch nicht gehen«, sagte sie mit brüchiger Stimme. »Ich habe keine Angst vor dem Tod, nein. Aber ich möchte nicht, dass du alleine bleibst …«
»Aber ich bin ja nicht alleine, Maman«, erwiderte er und war sich nicht sicher, ob er gerade log oder nicht. »Ich bin nicht alleine.«
Er streichelte ihre Hand und spürte die Wärme, die ihn durchflutete, und die Wut über all das, was sie hierher geführt hatte in dieses Bett in ihrem Zuhause. Wut über die wenigen Tage, die ihr noch blieben.
»War er schon hier?« Damien hätte hinzufügen können: um sich zu verabschieden? Aber er ließ es.
»Nein, dein Bruder kommt morgen.« Sie hatte es ihm vom Gesicht abgelesen. Das hatte sie immer gekonnt und konnte es noch auf ihrem Sterbebett. »Stéphane ist ein guter Junge. Er ist nur anders als du. Ihr müsst wieder miteinander sprechen. Damien, ich bitte dich …«
Er drückte fest ihre Hand. Es konnte Einverständnis bedeuten oder Widerstand. Dann nickte er.
»Komm noch einmal her«, sagte sie. Sie wirkte erschöpft, hielt ihn aber immer noch fest. Ihre kalten Finger streichelten seine warme Hand. »Ich muss dir noch etwas erzählen«, sagte sie. »Es ist ein großes Geheimnis – aber es wird dir helfen bei dem, was du vorhast …«
Château Lefranck, SauternesLundi, 2 octobre, 07:02
Der Nebel waberte unten durch das Tal der Ciron, dort, wo die Weinfelder endeten. Er sah fast überirdisch schön aus an diesem Morgen, wie eine gewaltige Wolke, die vom Fluss aufstieg.
Doch Guillaume Lefranck sah nur kurz hinunter, dann blickte er wieder zum Himmel. Er lebte schon zu lange hier, um nicht alles bereits erlebt zu haben. Heute war der Himmel zwar wolkenlos, aber irgendetwas an seiner Färbung sagte ihm, dass sich das bald ändern könnte. Und ein Gewitter kurz vor der Weinlese – das wäre die Katastrophe im Quadrat.
Er würde heute halbstündlich den Wetterbericht checken müssen. Vielleicht würden sie sogar die Lesehelfer vorzeitig herbitten müssen. Eigentlich sollten sie erst in ein paar Tagen starten.
Auch das noch, dachte Guillaume. Als hätte dieses Jahr nicht schon genug Überraschungen bereitgehalten. Was sind die größten vier Feinde des Winzers?, fiel ihm ein alter Spruch ein. Frühling, Sommer, Herbst und Winter.
So pauschal das klang, so wahr war es. Die besten Trauben, die besten Fässer, das beste Terroir: Alles konnte perfekt sein, doch das Wetter konnte alles versauen.
So war es dieses Jahr schon im Winter gewesen. Und das konnte sich wiederholen, kurz vor der Lese.
Guillaume bog von der Rebenallee nach rechts ab in die Weinstöcke. Vorne standen wie stets die herrlichen Rosenbüsche, aber die nahm er heute kaum wahr. Er betrat die Reihe mit den Sémillon-Trauben, ging zu einer Rebe und knipste mit Daumen und Zeigefinger eine Traube ab. Er nahm sie in den Mund und biss vorsichtig darauf, bis die dicke, feste Haut aufplatzte. Sogleich wurde sein Gaumen geflutet vom süßesten und aromatischsten Saft, den er sich nur wünschen konnte. Es war einfach … hmm, Guillaume schloss die Augen … herrlich. Dann nahm er einen Kern aus dem Mund und betrachtete ihn genau. Er knibbelte ein wenig daran herum und runzelte die Stirn.
Mon dieu, murmelte er. Sie waren wirklich noch zu früh dran. Die Traube war fast reif, aber ein winziges Stückchen des Kerns schimmerte hellgrün. Also fehlten noch zwei oder drei Tage bis zur vollkommenen Reife. Das war nicht viel – aber später in der Flasche wären es genau die Tage, die den Unterschied machten zwischen einem großen Wein und einer echten Legende. Zwischen einer Flasche, die Weinkenner nur zehn Jahre im Keller lagern könnten – oder fünfzig. Die hundert Euro kosten würde oder tausend.
Der Unterschied lag in diesen drei Tagen. Das heraufziehende Gewitter würde ihm die Entscheidung abnehmen, befürchtete Guillaume. Dabei brauchte er einen Erfolg. Sehr dringend sogar.
Es war das dritte Jahr in Folge, in dem das Wetter seinem Wein derart zusetzte, dass sich die Erträge der Vergangenheit dagegen wie eine Zeit im Schlaraffenland ausnahmen.
Darüber, dass sich irgendwelche Klimajünger in Paris auf die Straße klebten – was gottlob wegen der ruppigen Polizei nicht mehr vorkam –, konnte er nur lachen. Die hatten keine Ahnung, was der Klimawandel wirklich anrichtete. Aber Guillaume wusste es nur zu genau.
Mon dieu, er brauchte endlich mal wieder einen großen Wein. Und zwar jede Menge davon. Nicht nur ein paar Tausend Flaschen, sondern mehr. Viel mehr.
Guillaume hörte den Wagen hinter sich erst, als er auf dem Schotter bremste. Er wandte sich um und erblickte den Pick-up mit der Aufschrift des Châteaus. Der junge Mann, der ausstieg, sah wieder mal so aus, als wäre er einem Modemagazin entsprungen. Die halblangen Haare, die ihn genauso dandyhaft wirken ließen wie die Designersonnenbrille im Haar, das Hemd, aus dem Brusthaar herauslugte, und das Tattoo auf dem Hals. Früher waren Kellermeister alte Männer mit Trinkernase gewesen. Doch die Zeiten hatten sich geändert, nicht nur in Sachen Klima.
»Und?«, fragte der junge Mann, »wie steht es?«
»Wir müssen die Lese beginnen«, erwiderte Guillaume und wies gen Himmel. »Da kommt was auf uns zu. Ich habe Angst, dass es nächste Nacht richtig losgeht. Lass uns heute starten.«
Der Kellermeister Stéphane Arbois wusste, dass sein Chef den siebten Sinn hatte. Er griff sofort zum Handy, wählte eine Nummer und sagte Sekunden später in den Hörer: »Stéphane hier. Hört zu, trommelt alle zusammen. Wir starten die Lese jetzt. Ja, jetzt gleich. Ich will, dass wir die wichtigen Rebsorten bis übermorgen reingeholt haben.«
Guillaume sah, wie sein Kellermeister kurz zuhörte, bevor er eine Spur lauter und ernster sagte: »Ja. Wir starten sofort. Und wer damit ein Problem hat, kann seine Sachen packen und zurückfahren nach Rumänien oder Bulgarien oder wo die alle herkommen. Also, in einer halben Stunde fangen wir an.«
Avenue des Dunes, Carcans PlageMercredi, 4 octobre, 08:48
Luc saß vor seiner Holzhütte, der winzigen Cabane. Die Sonne warf kleine goldene Sprengsel durchs Astgewirr der Seekiefern und tauchte die Terrasse in morgendliche Wärme.
Er roch die salzige Luft und die Kiefernzapfen über sich, vor allem aber den würzigen Duft des Kaffees, weil eine dampfende Tasse direkt unter seiner Nase stand. Noch war der Espresso zu heiß, weil er ihn gerade erst auf dem alten Gasherd in der Bialetti-Kanne gekocht hatte. Und nun saß er hier und las in aller Seelenruhe die Morgenzeitung.
Das hatte ihm auch keiner gesagt, dass genau das ihm als Papa fehlen würde: der Genuss, in aller Stille eine Zeitung zu lesen – und zwar von vorn bis hinten, vom Politikteil über das Regionale bis zum Sport und dem Wetter. Aber es war genau das, was ihm zuletzt am meisten gefehlt hatte. Deshalb war es an diesem Morgen das Größte, sich dabei alle Zeit lassen zu können.
Anouk war mit Aurélie zu ihrem Opa nach Venedig geflogen. Eine Woche wollten sie dort verbringen. Seit Anouks Mama vor zwei Jahren gestorben war, hatte sie die Stadt nicht mehr besucht, stattdessen war ihr Vater zweimal nach Bordeaux gekommen. Luc wusste nicht, ob seine Freundin die Lagunenstadt scheute, weil sie ihre Maman dort in einem alten Krankenhaus am Canal Grande hatte sterben sehen. Jedenfalls hatte er sie ermuntert, diese Reise zu unternehmen. Nach der Schwangerschaft und dem ersten Jahr mit Aurélie war Anouk ausgesprochen urlaubsreif, schließlich war sie auch noch zur Leiterin der Kriminalpolizei der Stadt Bordeaux und der umliegenden Départements ernannt worden. Es war ein anstrengendes Jahr gewesen, mit vielen aufsehenerregenden Fällen. Und dazu kam ihr wunderbares Baby, das – wie alle Eltern ahnen – meist nur tagsüber wunderbar war, sie nachts aber gehörig auf Trab hielt.
Luc wäre gerne mitgereist, allerdings wäre die Abteilung dann unterbesetzt gewesen, da Brigadier Hugo Pannetier eine Weile ausfiel. Seine Frau hatte einen Bandscheibenvorfall, und er wurde zu Hause gebraucht. Also war Luc in Bordeaux geblieben und genoss nun das simple Glück, vor seiner Cabane die Zeitung zu lesen, so lange er wollte.
Die Hauptsaison war vorüber, es war ein herrlicher Sommer gewesen. Heiß, aber ohne die verheerenden Waldbrände der vergangenen Jahre. Sie hatten die meisten Abende am Strand verbracht, im Atlantik gebadet, und Luc war jeden Tag gesurft, während Aurélie am Strand spielte. Der Spätsommer war ausgeklungen mit vielen barbecues bei Freunden, Apéros im Herzen von Bordeaux und endlosen weinseligen Gesprächen auf ihrer Terrasse.
Doch nun nahte der Herbst, und auch wenn es immer noch warm war, spürte Luc in manchen Nächten schon einen kühleren Wind, der durch die Gassen von Carcans Plage zog. Die Sommertouristen waren sowieso schon lange verschwunden, nun waren die Nebensaisongäste im Dorf: Paare aus Deutschland und Belgien, deren Kinder schon aus dem Haus waren und die deshalb den Stress der Hauptsaison mieden. Fahrradsportler, die auf dem Radwanderweg in den endlosen Seekiefernwäldern im Hinterland der Küste unterwegs waren. Und Surfer mit ihren alten VW-Bussen, die auf die perfekte Welle warteten.
Luc hob den Kopf. Die perfekte Welle … Er legte die Zeitung auf den Tisch. Weiterlesen könnte er auch heute Abend noch. Zum Surfen aber wäre es wohl schon zu dunkel, wenn er später aus dem Hôtel de Police nach Hause käme. Vielleicht könnte er vorher auch mit Yacine noch durch die Bars der Altstadt ziehen …
Also ging er schnell in die Cabane, holte seinen Neoprenanzug aus dem Schrank und klemmte sich das Brett unter den Arm. Dann trat er hinaus auf die Avenue des Dunes, ging gen Westen vorbei an dem kleinen Lokal von Chez Heidi, das nur noch ein paar Wochen geöffnet sein würde, bevor es in die Winterpause ging.
Hinter dem Restaurant begann der steile Weg, der hinauf auf die Düne führte. Oben angekommen, wehte ihm die steife Meeresbrise ins Gesicht. Luc hielt inne wie jedes Mal – und mit der gleichen Ergriffenheit, als sähe er die Szenerie, die sich ihm bot, zum ersten Mal.
Und auf gewisse Weise war es auch so: Dieser weite Ozean mit seiner ungezähmten Kraft zu seinen Füßen sah jedes einzelne Mal anders aus. Manchmal war er spiegelglatt und sanft, als könnte er niemandem etwas zuleide tun. Und dann wieder türmten die Wellen sich wild auf, dass die Gischt bis hoch zur Düne spritzte. Heute aber war der Anblick so friedlich schön, dass Lucs Surferherz zu hüpfen begann. Die Wellen rollten gleichmäßig und glatt heran, alle zehn bis zwölf Sekunden eine, sodass der Commissaire nicht lange hier oben bleiben wollte. Nein, er wollte hinein ins Meer. Schon auf der Düne zwängte er sich in den Neoprenanzug, dann trug er sein Board über den mit hölzernen Bohlen ausgelegten Weg hinab zum Strand.
Die Hütte der Rettungsschwimmer war schon verlassen. Zu dieser Zeit des Jahres hatte sich die CRS, die Polizeisondereinheit, die während der Badesaison die Strände der Aquitaine bewachte, längst wieder anderen Aufgaben zugewandt.
Wenn Luc daran dachte, was er in diesem Sommer mit den Rettungsschwimmern erlebt hatte, wurde ihm flau. Aber er erinnerte sich auch an den Adrenalinrausch, als er mitten im Ozean den Täter verfolgt hatte. Es war ein Kampf auf Leben und Tod gewesen.
Luc schüttelte den Gedanken an den wohl tragischsten Fall seiner bisherigen Karriere ab. Als er den Strand betrachtete, hielt er kurz inne. Klar, es war nie viel los zu dieser Jahreszeit. Aber bei diesem schönen Wetter – warum war es so leer? Doch dann musste er lächeln. Was war er nur für ein vergesslicher Commissaire!
Schließlich war es Anfang Oktober. Die Einheimischen hatten einfach keine Zeit mehr, um sich am Strand zu vergnügen. Wie jedes Jahr um diese Zeit hatte hier oben im Médoc die Weinlese in den weltberühmten Appellationen rings um Bordeaux begonnen, auch östlich davon in Saint-Émilion und im Pomerol, südlich im Entre-deux-Mers und in Sauternes. In den Landes hatten sie sicher schon gelesen. Die Trauben dort waren nicht so hochwertig wie hier im Bordelais und früher reif. Hier in seiner Region aber begannen nun die wichtigsten, lukrativsten und arbeitsreichsten Wochen des Jahres. Das vertrug sich gerade für die jungen Leute, die neben dem Studium oder der normalen Arbeit bei der Lese halfen, nicht mit einem frühen Surf am Morgen. Deshalb hatte Luc die Wellen heute ganz für sich allein.
Er befestigte das Board, das er gestern Abend noch gewachst hatte, an seinem rechten Fuß und glitt mit der Hand über die raue Oberfläche. Das Surfbrett hatte ihm Rod, der alte Boardshaper aus Carcans Plage, vor Jahren gebaut – und er liebte es bis heute. Es hatte eine Holzstruktur und lief vorne spitz zu; ein Brett, das im Wasser richtig Tempo machen konnte. Auch wenn Luc seit Aurélies Geburt ein wenig zugenommen hatte: Er und sein Board harmonierten noch immer prächtig.
Er nahm es und machte den ersten Schritt ins Wasser, das seit dem Hochsommer bestimmt fünf Grad kühler geworden war. Der Neoprenanzug kompensierte die Kälte im Nu. Einige Meter watete er, doch als ihn die ersten Wellenausläufer erwischten, legte er das Board aufs Wasser, strich noch einmal darüber und legte sich darauf. Er paddelte gen Westen, weg vom Strand, hinaus aufs Meer, hinaus ins Line-up. Zunächst musste er die Brechungszone überwinden. Er paddelte und kraulte, das Brett unter ihm glitt mühelos nach vorne. Selbst als seine Armmuskeln zu brennen begannen, ließ er nicht nach. Das hier war sein liebster Frühsport. Er war ganz nah bei sich und dem Ozean, den Elementen ausgeliefert, Wasser, Wind und Wellen und der Sonne.
Luc paddelte wie ein Besessener. Eine Welle war zu hoch. Er musste sich ducken und das Brett nach unten drücken, dann tauchte er unter dem Brecher durch. Dahinter kam gleich eine zweite, und wieder machte Luc den duck dive, der unter Surfern so hieß, weil er ans Abtauchen einer Ente erinnerte.
Und dann … war Luc endlich im Line-up, er stand auf und setzte sich hin, Kopf und Brett zum Horizont gerichtet. Seine Füße hingen im Wasser, und er genoss die Kühle und die Frische hier draußen. Und die Stille. Bis auf das Säuseln des Meeres war kein anderes Geräusch zu hören, der Strand war zu weit weg. Es war einfach herrlich. Der Commissaire sah nach draußen. Die Endlosigkeit, die Ewigkeit des Ozeans hatten ihn seit frühester Kindheit fasziniert. Dieses Blau, das keine Grenze kannte und sich erstreckte über die ganze Weite des Meeres.
Luc ließ Welle um Welle unter dem Brett hindurchrollen, weil er die Ruhe hier draußen so liebte. Er hätte Stunden hier verbringen können. Er trug keine Uhr, konnte also gar nicht sagen, wie lange er hier schon saß. Aber er wollte auch nicht erst mittags im Büro aufschlagen, er war ja kein Kollegenschwein. Sein junger Kollege Yacine war momentan allein in der Brigade Criminelle im Hôtel de Police. Erst seit einigen Monaten verstärkte er sie hier in der Aquitaine.
Am Horizont sah Luc mehrere große Wellen heranrauschen. Perfekt. Das waren seine.
Er wendete das Brett in Richtung Strand. Dann legte er sich flach darauf und paddelte ein-, zweimal an, um das Board in Schwung zu bringen. Dann drehte er sich wieder um, und erst als die Welle ganz nah war, paddelte er los, indem er mit seinen Armen drei-, nein, viermal durchs Wasser schlug. Das Brett beschleunigte, dann sauste es richtig los, wurde von der Welle erfasst, die es nach vorne schob. Rasend schnell wurde die Fahrt nun, Luc aber nutzte den perfekten Augenblick und sprang auf, so wie er es als junger Mann gelernt hatte. Er stand nun aufrecht, die Füße quer auf dem Brett, und verlagerte den Druck auf den vorderen Fuß. Das Brett senkte sich und glitt quer vor die Welle, es raste immer schneller an ihrer Kante entlang. Rechts von ihm türmte sich die Welle auf und schob und schob und schob. Luc hörte ihr Tosen. Er musste lachen, weil alles um ihn herum so laut und schnell und schön war. Dann begann er immer wieder in die Welle hineinzulenken. Sie brach noch immer nicht zusammen. Erst als er bemerkte, wie nah er schon am Strand war, blickte er nach rechts, sprang vom Board und in die Welle hinein. Luc tauchte unter und verschwand sofort in der blauen Gischt. Das Brett sauste hinter ihm her. Nach einigen Sekunden tauchte er wieder auf und jauchzte – das Glück hier draußen war einfach vollkommen.
Luc schwamm die restlichen Meter zum Strand und nahm das Board unter den Arm. Seine Füße sanken in den weichen Sand. Er trat hinaus in die Sonne und schloss die Augen.
Welch ein Morgen! Welch ein Glück, in diesem Paradies leben zu dürfen!
Jeudi, 5 octobre–Donnerstag, 5. Oktober
Les raisins de la mort–Traubentod
Kapitel 1
Charlotte trat aus der Tür und spürte die leichte Frische auf der Haut. Sie hatte noch den Geschmack des ersten Kaffees am Morgen auf der Zunge, ein wundervolles Gefühl. Leichter Nebel waberte durch die Luft und gab der Szenerie, die vor ihr lag, ein geheimnisvolles Antlitz. Die Weinfelder lagen noch im Schatten. Wie brave Soldaten standen die Reben in Reih und Glied, eingehüllt von der wassersatten Luft, die für Sauternes typisch war.
Charlotte blickte seit ein paar Tagen anders auf das Dorf, weil ihr nun noch klarer war, wo ihre Wurzeln lagen: hier in den Weinfeldern. Auch wenn sie noch für sich einordnen musste, was all die Neuigkeiten zu bedeuten hatten. Doch heute war das erst einmal zweitrangig. Alles würde sich finden.
Sie genoss die Stille. Selbst die frühen Vögel waren noch nicht zu hören, geschweige denn die schweren Maschinen, die bei der Weinlese halfen: die Transporter, die Lieferwagen oder die Vollernter, die, riesigen Mähdreschern gleich, über die Rebstöcke glitten und jede Traube abernteten, leider aber auch viel zu viel Weinlaub mit sich rissen und unzählige Tiere töteten.
Sie und ihre Leute hingegen lasen die Trauben per Hand, der Qualität und der Umwelt zuliebe. Auch wenn es länger dauerte. Nachher, am Mittag, würde sie selbst mit Hand anlegen. Jetzt aber galt es erst einmal, sich um den Traubensaft zu kümmern, der in der großen Scheune gärte.