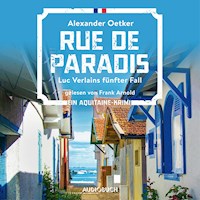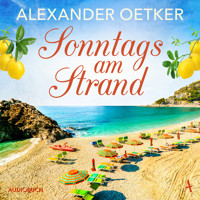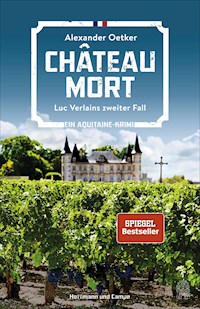14,99 €
Mehr erfahren.
Dolce Vita, Vino und bizarre Morde: ein Toskana-Krimi der Extraklasse In Florenz kommt es zu einer rätselhaften Mordserie – der Täter lässt die Toten mit einem starren Lächeln im Gesicht und den Initialen des nächsten Opfers zurück. Ein Fall für die dynamische Commissaria Giulia Ferrari. Doch auch Giulia steht hier vor einem Rätsel, denn nichts scheint die Toten miteinander zu verbinden. Ein Glück, dass der Commissaria ein einzigartiges Team zur Seite steht: der blinde Polizist Enzo, ein Recherchegenie, der Hund Tulipan mit seiner unbestechlichen Spürnase und Luigi, ein ehemaliger Kripobeamter, der jetzt als Wirt eine urgemütliche Bar betreibt. Zusammen finden Giulia und ihre Freunde eine erste Spur – und machen sich daran, Licht ins Dunkel um das Geheimnis des lachenden Todes zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alexander Oetker
Signora Commissaria und der lachende Tod
Ein Toskana-Krimi
»Wer die Sehnsucht stillen mag, nach einem Sommertag,
ein Paar in trauter Umarmung,
umgeben von Hainen, hochaufragend und leicht verschwommen,
wie ein Gemälde, erdacht von einem Verliebten,
unter einer lauschigen Pergola,
die Gesichter der Sonne zugeneigt,
der findet sein Wohl in der Toskana.«
(A. H.)
Prologo
Gianluca streckte sich und ließ die Finger knacken. Zu gerne hätte er gegähnt, aber das schickte sich nicht. Es war ein langer Tag gewesen, gerade am Nachmittag, als die Hitze groß gewesen war und der Bus krachend voll, weil zu all den Touristen noch die Pendler kamen, die er zu den Stadttoren bringen sollte. Nun endlich nahte der Feierabend – und doch war seine Maxime: Konzentration bis zur letzten Tour, denn hier, auf diesem historischen Pflaster, konnte noch etwas schiefgehen: ein wilder Rollerfahrer, der ihn um ein Haar touchierte, eine streunende Katze, die eine Vollbremsung nötig machte, ein Touristenpaar aus Asien, das eine Frage hatte, die er beim besten Willen weder auf Englisch noch mit Händen und Füßen verstand.
Die letzte Fahrt des Tages, die war immer etwas ganz Besonderes. Wie hatte er mal zu seiner Freundin gesagt? Es war, als wäre er es, der die Stadt abschloss.
Nachts, wenn Florenz dalag wie eine müde Prinzessin, wenn all die Plätze mit den Sehenswürdigkeiten, die sonst vor Besuchern überquollen, auf einmal ganz verlassen waren, dann entfaltete diese seine Stadt eine Magie, die auf dieser Welt ihresgleichen suchte.
Und er, Gianluca Viccione, durfte das erleben, von seinem Fahrersitz aus. Die Linie C1 war die wichtigste Busverbindung der Stadt, daran gab es gar keinen Zweifel. Weil nur diese Linie alle Sehenswürdigkeiten der Stadt verband, weil nur er mit seinem Minibus durch die engen Gassen fahren konnte.
Einzig und allein die besten Fahrer der Firma durften diese Linie fahren, und er fuhr sie schon sehr lange, als jüngster Chauffeur, dem diese Aufgabe je anvertraut worden war.
Ja, natürlich war er stolz darauf, wie sollte es anders sein?
Er liebte seinen Beruf. Und er liebte es, seinen Bus bei Dunkelheit über das alte Pflaster zu steuern, auch wenn zu so später Stunde naturgemäß nur sehr wenige Fahrgäste mit ihm in diesen Genuss kamen – manches Mal machte er die letzte Fahrt des Tages gänzlich allein.
Aber es musste sein, der Fahrplan wollte es so – und der Fahrplan, den die Stadt Florenz vorgab, war nun mal heilig.
An der Ponte alle Grazie überquerte er den Arno, links lag die Ponte Vecchio, die ehrwürdigste aller Brücken, die angestrahlt aussah, als würde sie über dem Fluss schweben. Beinahe hätte er den winkenden Fahrgast übersehen, weil er so überrascht war, dass ausgerechnet hier, an dieser Haltestelle, jemand auf ihn wartete.
So war das in Italien. Wer Bus fahren wollte, der musste winken.
Gianluca riss das Lenkrad nach rechts und hielt an. Der Mann, der einstieg, war dick eingemummelt, was merkwürdig war, weil die Nacht ganz mild war. Aber gut, wahrscheinlich hatte er auf einer der Terrassen am Fluss zu Abend gegessen, da war es immer von Vorteil, auf eine leichte Brise vorbereitet zu sein.
»Buona sera«, grüßte Gianluca freundlich.
Der Mann antwortete nicht, stattdessen zeigte er eine abgestempelte Fahrkarte. Der Fahrer nickte, der andere stieg ein und setzte sich in die letzte Reihe. Hm, dachte Gianluca, nicht sehr höflich. Aber gut, wer steckte schon in den Leuten drin? Vielleicht hatte er einen anstrengenden Tag gehabt. Oder seine Freundin war am Abend nicht nett zu ihm gewesen. Oder ein Angehöriger war krank. Er schaute noch einmal in den Rückspiegel, der Mann lehnte in seinem Sitz und sah aus dem Fenster. Gianluca setzte den Blinker, dann fuhr er auf die nördliche Stadtseite und nahm Kurs auf die kleinen Gassen von Santa Croce.
Er genoss es, den Bus durch das Gassengewirr zu lenken. Am Tage war es hier beinahe unmöglich, durchzukommen, ständig musste er hupen oder klingeln, damit die Reisegruppen aus Amerika oder Fernost Platz machten. Manchmal war ihm, als hätten die noch nie einen Bus gesehen.
Nun aber beleuchteten die goldenen Straßenlaternen nur noch leere Bürgersteige und raue Pflastersteine, die Gassen lagen wie ausgestorben da. Es war tatsächlich so: Florenz war keine Partystadt wie Rom, keine Glamourmeile wie Mailand, kein lauter Moloch wie Neapel. Florenz war schick und schön – und die Touristen, die hierherkamen, waren nachts so erschöpft von den Museen und den kilometerlangen Fußmärschen, dass sie nur noch in ihre Betten fielen. Die jungen amerikanischen Studentinnen hingegen konnten die Nächte nicht zum Tag machen, weil sonst das Geld nicht mehr für das Mini-Appartement reichte. Und die Florentiner? Die gingen tatsächlich nur ganz selten in der Altstadt aus. Klar, es wohnten ohnehin nicht mehr viele echte Florentiner innerhalb der Stadttore, weil die Mieten und Kaufpreise in den letzten Jahren noch mal angezogen hatten. Die besten Partys fanden aber sowieso außerhalb der historischen Mauern statt, in den Wohnvierteln und auf den alten Industriebrachen. Und deshalb hatte er, Gianluca, seine Stadt zu dieser Stunde meist ganz für sich allein.
Die nächsten zwei Haltestellen nahm er, ohne anzuhalten, weil niemand auf ihn wartete. Erst an der Piazza di Santa Croce, mitten auf dem weiten Platz, winkten zwei junge Mädchen, beide hatten blonde Haare und trugen viel zu kurze Kleider. Gut, dass sie nach Hause kamen, dachte Gianluca. Er hielt und öffnete die Tür.
»Buona sera«, grüßte er freundlich. »Fahrkarten?«
»Müssen wir?«, fragte die eine mit deutlich toskanischem Akzent. Gianluca lächelte und winkte sie herein. »Grazie«, sagte das Mädchen und strahlte ihn an. Kaum hatte er die Tür geschlossen, hörte er ihr fröhliches Kichern hinter sich. Er fuhr wieder an, umrundete den Platz mit der wunderschönen Basilika, er nickte einmal kurz Enrico Pazzis Dante zu, der unverwandt und in Marmor gehüllt auf der Piazza stand. Und dann setzten sich wieder die engen Gassen fort, die Reifen holperten über das Pflaster, irgendwo knallte die Fehlzündung eines Rollers.
Gianluca freute sich auf daheim, sicher hatte Franca gekocht. Er würde sich ein Bier aufmachen, die Pasta aufwärmen und sich dann eine halbe Stunde später an ihren warmen Rücken kuscheln. Vielleicht würden sie sogar noch miteinander schlafen. Aber er würde sie nicht wecken, schließlich musste sie früh aufstehen, der Job im Rathaus war anstrengend.
Sie würden am Morgen miteinander quatschen und einen caffè trinken, danach würde er sich wieder hinlegen, seine Schicht begann erst um 16 Uhr. Er mochte diesen Rhythmus, lange arbeiten, lange schlafen, das war genau seins.
Das Klingeln des Halteknopfes riss ihn aus seinen Gedanken. Er sah in den Rückspiegel, dann bremste er und hielt auf der Piazza Santa Maria Nuova. Er öffnete die Tür, und die beiden Mädels stiegen aus, die eine winkte ihm noch zu, dann verschwanden sie in der Dunkelheit.
Er sah ihnen nach, Gianluca war immer besorgt um seine Fahrgäste. Er schloss die Türen wieder, dann rollte er an, nur noch zwei Ecken – und er wäre am schönsten Platz der Stadt.
Es war beinahe unglaublich, weil er zehnmal am Tag hier vorbeifuhr, mindestens, manchmal waren es auch zwölf- oder achtzehnmal. Und dennoch geschah es nie, dass er gleichgültig an den Mauern nach oben sah oder gar den Blick abwandte. Jedes Mal bekam er Gänsehaut, erfüllte ihn ein Gefühl von Staunen, von Ehrfurcht, wenn der Duomo in sein Blickfeld kam.
Der große, erhabene, stolze Dom von Florenz. Mit der Kuppel, die für die Ewigkeit geschaffen war. Die drei Farben des Marmors, die Skulpturen, das Rot des Daches, die Portale und die Fensterbilder – dieses Gebäude war einfach vollkommen. Und dazu das goldene Licht der Nacht, das ihn noch romantischer und stolzer wirken ließ, wenn das überhaupt möglich war.
Gianluca bog um die Ecke, jetzt begann der letzte Abschnitt seiner Tour, nur noch Richtung Norden und hinaus aus der Stadt, dann wäre Feierabend. Aber da öffnete sich der Blick, da stand er, der Dom. An der Haltestelle war niemand mehr, so konnte er weiterfahren, dann endlich erlaubte er es sich und sah hinauf. Betrachtete die ziselierten Reliefs und die Fensterrose mit den farbigen Glasscheiben.
Er wollte um die nächste Ecke biegen, der Campanile, der Glockenturm, war da vorne nur noch ein gewaltiger Schatten, da bemerkte er plötzlich den Schatten hinter sich. Er bremste, wollte sich umdrehen, um den Passagier zu fragen, ob er aussteigen wolle, doch da sah er aus dem Augenwinkel die Klinge eines Messers. Er konnte nichts sagen, weil der Schreck so groß war, er konnte nur der Bewegung folgen, dann wurde es schon ganz warm, der Schmerz war so gewaltig, dass seine Hände sich krümmten, er sah das Rot auf dem Lenkrad, doch ehe er begriffen hatte, dass es sein eigenes Blut war, war er schon fast weggetreten, ein letzter Blick zum Dom, der Bus stand nun, er bemerkte noch schwach, wie sich der Fahrgast über ihn beugte, um die Tür zu öffnen, dann tat Gianluca Viccione seinen letzten Atemzug.
Uno – 1
»Buongiorno, Sergio«, rief Luigi über den Tresen, als der Postbote sein gelbes Wägelchen durch die Tür zerrte. Der alte Mann hatte schon die Briefe von Santa Croce zugestellt, als Berlusconi noch ein Kind gewesen war, mutmaßte Luigi. Und deshalb war er auch immer erstaunt, dass so viele Postsendungen tatsächlich richtig ankamen. »Caffè? Oder starten wir gleich mit einem kleinen Weißen?«
Er war bester Laune. Es war ein guter Morgen, ohne Frage, die Rückenschmerzen der letzten Tage hatten sich verzogen – und als er vorhin die Cimbali-Kaffeemaschine auf dem Tresen angestellt hatte, war sogar die Sicherung im hundert Jahre alten Stromnetz seiner Bar dringeblieben. Viel bessere Aussichten auf einen sorglosen Tag waren kaum denkbar.
»Muss ich mich entscheiden?«, fragte Sergio und zwinkerte dem Barista zu. Luigi leerte den Siebträger und befüllte ihn mit neuem Kaffeepulver aus der großen Mühle, dann fädelte er wieder ein. Einmal drückte er den Knopf, Sergio mochte seinen Espresso so schwarz und stark, wie es nur ging. Es war eine Sache von zwanzig Sekunden, dann stand das Tässchen vor dem Postboten, ebenso wie das kleine, eiskalte Glas Weißwein.
»Grazie, caro.«
»Wie ist die Schicht?«, fragte Luigi und sah auf die alte Bahnhofsuhr überm Tresen. Kurz nach neun. Zu dieser Stunde hatte er ein wenig Zeit, der Ansturm der Frühpendler war schon durch, jetzt kamen jene, die in Santa Croce Dienst taten, auf ihren zweiten oder dritten caffè des Tages: die Müllfahrer, die Damen aus dem Rathaus und eben Sergio, der Postbote.
»Ganz entspannt«, murmelte der Alte und wies auf seinen Wagen. »Zum Glück schreibt ja niemand mehr Briefe, sind alles nur Rechnungen. Und die riesigen Pakete müssen die jungen Kollegen austragen. Na ja, bis zur Rente schaff ich’s noch …«
Luigi fragte sich, ob Sergio nicht schon seit zehn Jahren in Rente hätte sein müssen.
»Aber da unten ist ganz schön was los«, fügte der Postbote hinzu.
»Wo unten?« Der Barista runzelte die Stirn.
»Warst du noch nicht draußen? Na unten. In Florenz. Da ist so viel Blaulicht, man glaubt, der Donald Trump kommt zu Besuch.«
»Na, bloß das nicht«, erwiderte Luigi unwillkürlich. »Carla«, rief er in die Küche, »ich geh mal kurz nach draußen.« Es kam nur unverständliches Gebrabbel zurück, doch das war schon in Ordnung. Wenn Carla über ihren Töpfen fuhrwerkte, dann hörte sie nichts und niemanden mehr. Aber Luigi war klar, dass seine Frau dennoch den Tresen im Blick behielt. Sie hatte ihm noch gar nicht gesagt, was sie heute als Mittagsgericht zauberte, aber dem Duft nach war es etwas Leichtes, Würziges.
»Salute«, murmelte Luigi, aber Sergio hatte schon den ersten Schluck genommen. »Tulipan, komm, wir gehen an deinen Baum.«
Der große Golden Retriever erhob sich voller Vorfreude hinterm Tresen und kam auf sein Herrchen zugerannt. Gemeinsam gingen sie zur Tür der Bar. Als er öffnete, sprang Tulipan sofort hinaus, die ersten Schritte nahm er im Lauf, dann wurde er langsamer und schnüffelte alle fünf Platanen an, die hier oben auf der kleinen Piazza standen. Dies hier war sein Revier. Für das Panorama unter ihm hatte der Hund keinen Blick übrig.
Dafür aber sein Herrchen. Er musste nur die kleine Straße überqueren, dann war da die niedrige Mauer – und schon öffnete sich der Blick auf die große Stadt zu seinen Füßen. Was für eine Gnade, dachte Luigi, dass sein Heimatdorf Santa Croce ausgerechnet auf dem schönsten Hügel über Florenz lag, mit dieser einmaligen und unverbaubaren Aussicht. So konnte er all die Dächer sehen, die Schornsteine, die ganze Pracht der Renaissance-Architektur. Dort unten lag die Wiege der Moderne – alles Schöne dieser Welt hatte für Luigi hier seinen Anfang genommen.
Das Beste an diesem Aussichtspunkt aber war: Er hatte ihn ganz für sich alleine. Der Piazzale Michelangelo im Süden der Stadt war mittlerweile nur noch ein gewaltiger Busparkplatz, auf dem es von Andenkenläden und Souvenirhändlern wimmelte. Asiatische Touristengruppen lieferten sich ein Hauen und Stechen mit irgendwelchen Influencerinnen aus aller Welt um die beste Kulisse für das immergleiche Foto. Dieses Fleckchen hier oben auf dem Berg aber war allen Reiseführern der Welt bisher verborgen geblieben. Gottlob. So waren Tulipan und er an diesem Morgen unter sich – und selbst der Hund interessierte sich nur für die Duftmarken seiner Artgenossen.
Am liebsten betrachtete Luigi von hier oben die Kuppel des Doms, die erhaben über der Stadt zu schweben schien. Aber heute war es tatsächlich anders. Da waren wirklich viele Blaulichter auf der Piazza, von hier sah es aus, als blicke man auf eine riesige Spielzeugwelt, in deren Mitte ein Kind ein paar Autos hatte zusammenstoßen lassen – und nun war die halbe Polizei von Florenz auf den Beinen. Dazu erschollen unzählige Sirenen, die von überallher zu kommen schienen.
Luigi runzelte die Stirn. »Merda«, flüsterte er.
Was war da unten bloß los? Andererseits: Sie wussten ja, wo er war. Und sie wussten, dass sie ihn holen konnten, wann immer sie ihn brauchten. Bisher hatte sein Telefon nicht geklingelt. Ihm war aber auch klar, dass sie im Zweifel persönlich kommen würde, um ihn abzuholen. Sie. Er hatte sie lange nicht mehr gesehen. Eine Woche? Auch das war merkwürdig, schließlich war sie in den letzten zwei Monaten jeden Morgen zu ihm gekommen, auf einen Kräutertee. Seit einer Woche aber blieb sie verschwunden. Er hatte sie nicht angerufen, weil es nicht sein Stil war, einer Frau nachzutelefonieren, die ihm klar signalisiert hatte, wie stark sie war und wie viel Freiheit sie brauchte. Aber er musste zugeben, dass er sich schon ein wenig Sorgen machte.
Sollte er sie anrufen? Einen Anlass hätte er jetzt. Zwei Dutzend Polizeiwagen auf dem Domplatz von Florenz – das sollte genügen. Andererseits: Seine Welt war jetzt hier oben, in der schönsten Bar der ganzen Toskana. Und eben kamen zwei Gäste, junge Männer aus einem dieser neuen, coolen Büros im Dorf, die irgendwelche Apps für Handys entwickelten. Er hatte keine Ahnung, was sie genau machten, aber sie liebten seinen caffè am Morgen und seinen Spritz zum Feierabend – und mehr musste Luigi nicht wissen.
Doch, eines musste er unbedingt wissen: Was genau Clara heute zum Mittag zauberte. Er würde es gleich auf die Tafel schreiben, die täglich das Mittagsgericht anpries.
»Tulipan«, rief er und pfiff, der Hund löste sich von seinem Baum, dann machte er einen Satz und war sofort neben Luigi. Die beiden gingen zurück zur Bar. Doch an der Tür drehte sich der Barista noch einmal um und betrachtete das Flackern der Blaulichter unten in der Stadt.
Due – 2
»Basta.« Giulia klopfte sich den Sand von den Händen, eben hatte sie die letzten Samen in die kleine Pflanzrinne geworfen, die sie mit den Händen ausgebuddelt hatte. Wenn alles gutging, würde sie hier in ein paar Wochen Bohnenkraut, Pimpinelle und wilden Fenchel ernten können. Sie hatte auch Koriander angebaut, aber das würde sie hier niemandem erzählen. Schließlich wollte sie damit den Nachbarn ein Schnippchen schlagen und etwas gänzlich Unitalienisches hochziehen, womit sie dann ganz andere Gerichte kochen würde, Speisen von weit her, aus Fernost, aus Indien, eben alles, was anders schmeckte als das, was sie hier in jedem Haus und hinter jedem Fenster kochten.
Giulia musste grinsen, als ihr klarwurde, worüber sie hier überhaupt nachdachte. Sie wollte kochen. Nein: Sie würde kochen.
Sie, die nie darüber nachgedacht hatte, irgendetwas anderes zu tun, als zu arbeiten. Die sich morgens einen Tee und ein Tramezzino irgendwo im Stehen einverleibt hatte, mittags einen Salat am Schreibtisch und abends irgendwo ein Essen als Begleitung zu einem Date in einem angesagten Schuppen im römischen Trastevere-Viertel. Nie ging es dabei um Genuss oder dergleichen, nicht um gute Produkte, um Jahreszeiten oder Garzeiten – es ging um reine Nahrungsaufnahme, in Verbindung mit interessanten Gesprächen, bei denen sie etwas lernen konnte, Wissen sammeln, weiterkommen. Sich füttern mit Kontakten, Informationen und Erfahrungen – nicht mit ungesättigten Fettsäuren.
Jetzt aber hatte sich ihr Leben verändert. Sie war hier. Sie war allein. Und sie begann, Obst und Gemüse anzupflanzen, und italienische Kräuter, in dem Garten, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte. Merkwürdigerweise gefiel es ihr. Sie hatte es am Tag zuvor sogar geschafft, nicht auf ihr Handy zu schauen und keine E-Mails zu lesen. Einen ganzen Tag lang. Ihr Chef in Rom hatte ihrer Versetzung nach Florenz nur unter der Bedingung zugestimmt, dass sie erst einmal runterfahren würde. Den Jahresurlaub nehmen. Sie hatte gefragt, wie lange das sei, weil sie noch nie Urlaub genommen hatte. Giulia hatte mit zehn Tagen gerechnet, höchstens zwölf. Der Innenminister hatte gelacht. Sie habe nicht nur den Jahresurlaub von diesem, sondern auch von den zwei vorangegangenen Jahren zu nehmen. Der Urlaub vorher sei leider verjährt. Aber auch so seien es drei Monate, die sie nun freinehmen könne. Drei Monate. Giulia hatte die Furcht in sich aufsteigen spüren. Drei Monate ohne einen Fall. Ohne Anrufe aus dem Innenministerium. Ohne eine sinnvolle Beschäftigung.
Wobei sie mittlerweile ahnte, dass sinnvoll vielleicht auch etwas ganz anderes sein könnte, als hinter Mördern herzujagen. Sie hatte am Morgen gelächelt, als sie die Strahlen der frühen Sonne in der Nase kitzelten, als sie gesehen hatte, wie ihr Cavolo nero, der toskanische Kohl, keimte, als sie den würzigen Tee getrunken hatte, den sie nun immer zum Frühstück aufgoss. Sie vermisste sogar Luigi ein wenig, mit ihm hatte sie die letzten Wochen am Morgen stets für eine halbe Stunde gesprochen, bevor sie wieder in ihr Haus zurückgekehrt war. Er war einer der wenigen, mit denen sie Kontakt gehabt hatte. Seit einer Woche aber war sie in der Gartenarbeit so aufgegangen, dass sie es nicht einmal mehr nach oben in die Bar geschafft hatte. Sie wollte nur hier sein, mit den Händen in der Erde. Gerade am Morgen, wo alles so ruhig, so sanft und so unberührt war. Der Tau auf dem Gras, der Reif auf den Blättern. Der Frühling war fast vorbei, bald würde die große Hitze des Sommers einsetzen. Dann würde auch ihr Urlaub enden, und sie würde als Sonderermittlerin in den Dienst der Questura von Florenz eintreten.
Hier. Am Ort ihrer Kindheit. In der Toskana. In ihrer neuen Heimat. Neue Heimat. Wie das klang.
Giulia hatte nie eine Heimat gehabt. Na ja, das stimmte nicht. Früher war ihre Familie ihre Heimat gewesen. Und dieses Stückchen Land hier, mit dem alten Bauernhof. Ein herrliches Fleckchen Erde, hatte Papa immer gesagt. Dolce vita in giardino, hatte Mama immer gesagt. Ihre Schwester hatte noch nichts sagen können, sie war zu klein gewesen.
Ab dem Tag, an dem sie alle ums Leben gekommen waren, in diesem traurigsten aller Momente auf Sardinien, war Giulia die einzige Überlebende gewesen – und fortan heimatlos.
Bis sie ein komischer Zufall wieder hierherschickte, obwohl sie sich mit aller Kraft dagegen gewehrt hatte. Doch Gott und der Innenminister hatten entschieden – und so hatte sie sich ausgerechnet in Santa Croce wiedergefunden. Hatte das Haus ihrer Familie wieder in Besitz genommen, das seit zwanzig Jahren leergestanden hatte. Die Spinnweben von den Wänden gekratzt. Gelüftet, bis alle dunklen Erinnerungen herausgeweht waren. Alles neu gestrichen. Und nun war der Garten dran.
Sie besah sich ihr Werk und nickte zufrieden. Das hier war fruchtbares Land. Im Unterdorf von Santa Croce wuchs alles, was das Herz begehrte, Obst, Gemüse, sogar Wein und Oliven. Die Bürger von Florenz pilgerten hierher, um einzukaufen, weil die Produkte noch besser waren als die in der altehrwürdigen Markthalle der Stadt.
Santa Croce bestand aus zwei Teilen: dem Unterdorf im Tal, wo ihr Haus und all die großen Anwesen mit Gärten, Pools, Olivenhainen und Rebstöcken lagen – und dem Oberdorf, wo die kleine Kirche und das Rathaus standen, wo es geschäftig war und historisch zugleich. Wo auf der schönsten Piazza mit Blick auf Florenz Luigi seine Bar hatte. Der berühmteste Barista von Santa Croce. Und vor Jahren der berühmteste Polizist von Florenz. Bald würden sie zusammenarbeiten – und Giulia, die bisher Teamarbeit gemieden hatte, wo immer sie konnte, freute sich sogar darauf. Und sie freute sich auf noch jemanden, den sie bei ihrem ersten Fall kennengelernt hatte. Ja, Tulipan, klar, Luigis Hund. Aber eben auch auf Enzo Aleardi. Diesen stillen, feinen jungen Mann, der so ganz besonders war. Besonderer als jeder andere Mann, den sie kennengelernt oder in Rom in einem teuren Restaurant gedatet hatte. Auf Enzo Aleardi freute sie sich, und wenn sie an ihn dachte, dann war es tatsächlich so, als würde ihr Herz einen Zehnteltakt schneller schlagen. Sie hatte ihn lange nicht gesehen. Wie auch? Sie arbeitete ja nicht. Und sie war nicht die Frau, die einfach anrief, um zu sagen: Ciao, Enzo. Wollen wir zusammen einen Spritz trinken? Abgesehen davon, dass sie nicht trank – und davon, dass Enzo sie noch nie gesehen hatte. Sie auch nie würde sehen können.
Ein Geräusch riss sie aus ihren Gedanken. Merkwürdig. Sie … ach, natürlich. Sie hatte tatsächlich für einen Moment vergessen, wie ihr Handy klingelte. Wenn ihr das einmal jemand gesagt hätte.
Sie rannte ins Haus und sah den Namen auf dem Display. Nein, es war gar kein Name. Da stand nur Il Ministro. Sie runzelte die Stirn. Das war seltsam. Hatte sie ihren Dienstantritt vergessen? Sich schlicht im Monat vertan?
Sie drückte das grüne Symbol und hielt sich das neue Handy ans Ohr.
»Sì?«
»Signora Commissaria?«
»Ja, ich bin dran. Verzeihen Sie, Signore Ministro …«
»Sie müssen sich nicht entschuldigen. Vielmehr muss ich das tun, denn Sie sind ja im Urlaub, aber … da ist etwas passiert, in Florenz, was ich nicht ignorieren kann. Und ich weiß, dass ich niemand anderen schicken kann als Sie. Ich …«, er stammelte etwas, was ungewöhnlich war, er war normalerweise nie um ein Wort verlegen, »ich würde Sie nicht wegen eines simplen Mordes aus dem Urlaub holen. Allerdings gab es in der vergangenen Nacht einen Mordfall, der uns alle beunruhigt.«
»Was ist denn passiert?«, fragte sie und spürte, wie das Adrenalin in ihr aufstieg, das sie so gut kannte. Wie ihr Jagdinstinkt erwachte.
»Ein Mann wurde ermordet, ein Busfahrer, mitten in der Stadt.«
»Hm, klingt nach einem Raubmord.«
»Ja, so könnte es klingen. Das Problem ist nur, dass der Mord sehr ungewöhnlich war – und überaus brutal. Und dass das Opfer in einer Weise zurückgelassen wurde, die es uns nicht ermöglicht, zum Tagesgeschäft überzugehen.«
»Was soll das heißen?«
Der Minister räusperte sich, und Giulia spürte, dass sie diesen Moment nicht so schnell vergessen würde.
»Es gab einen ersten Mord, vor einer Woche. Wir haben ihm keine große Bedeutung beigemessen, ich habe nicht einmal etwas davon erfahren, bis auf eine kleine Nachricht in der Morgenlage. Die Kollegen in der Toskana dachten, es sei einfach ein Raubmord gewesen. Aber nun – da der zweite Tote genauso präpariert wurde wie der erste …«
Giulia atmete einmal tief durch, dann sagte sie: »Signore Ministro, ich habe die Hände voller Erde, weil ich den Garten umgrabe. Würden Sie mir jetzt einmal sagen, was passiert ist?«
»Der erste Tote – und der Busfahrer heute Nacht, beiden wurde die Kehle durchtrennt.«
»Das ist nicht ungewöhnlich …«
»Und sie wurden mit einem Lächeln im Gesicht inszeniert.«
»Sie wurden was?«
»Der Täter hat den Busfahrer aufrecht hinters Steuer gesetzt – und sein Gesicht so verzerrt, dass es aussieht, als würde er lächeln.«
»Oh …«, sagte Giulia und spürte, wie ihre Stimme ganz heiser wurde, »ist gut. Ich komme.«
Tre – 3
Seitdem Clara ihn einmal scherzhaft ermahnt hatte, er sei doch kein Arzt, er solle ordentlich schreiben, gab er sich besonders viel Mühe damit, die Tafel zu beschriften. Die Gäste sollen doch nicht raten müssen, was es zu essen gibt, hatte sie gesagt – und sie hatte damit natürlich recht. Aber auch wenn er kein Arzt war, so war er eben doch Polizist – und die hatten erwiesenermaßen eine noch größere Sauklaue, auch damit Zeugen beim Mitschreiben des Verhörs nicht recht lesen konnten, was ihr Gegenüber da in seinen Block notierte.
Nun aber galt es, und so formte er konzentriert jeden Buchstaben und fühlte sich dabei wie ein Drittklässler.
Oggi: Gnocchi Burro e Salvia – buon appetito.
Hm, er freute sich schon auf die Mischung aus Butter und krossgebratenen Salbeiblättern, auf die cremige Sauce und auf den Parmesan, den Clara wie immer reichlich über die Kartoffelklößchen reiben würde. Hoffentlich würde eine Portion übrig bleiben. Es hatte sich längst in Santa Croce herumgesprochen, wie gut Luigis Frau kochte – und so war die Bar zum Pranzo an Werktagen stets voll bis auf den letzten Platz. Aber gut, im Zweifel würde sie ihm abends noch einmal eine Portion kochen – ein wirklicher Grund zur Sorge bestand also nicht.
Die Fenster zur Terrasse waren weit geöffnet, so hörte er den Motor bereits von Weitem. Ein alter Boxermotor. Es durchfuhr ihn. Konnte es sein, dass sie einfach so vorbeikam? Sie war spät dran für ihren Frühstückstee. Oder konnte es sein … Luigi dachte wieder an die Blaulichter unten in der Stadt. Er hatte sie im Frühstückstrubel und über die Mittagsvorbereitungen schon fast wieder vergessen.
Eine Minute später hielt der gelbe VW Käfer auf dem Bürgersteig genau vor der Bar. Und wie sie ausstieg, in ein Kostüm gekleidet, die hohen Absätze auf dem alten Pflaster, mit der Beretta 92, die sich unter ihrem Blazer abzeichnete, war er sich sicher, dass dies kein bloßer Besuch auf einen Kräutertee war. Sie war wieder im Dienst – und wenn Giulia Ferrari wieder im Dienst war, dann hieß das: Auch Commissario Luigi Batista war es wieder.
Sie trat ein, und er eilte ihr entgegen. Auch Tulipan schien Morgenluft zu wittern, er folgte ihm auf dem Fuße.
»Signora Commissaria, wie geht es Ihnen?«, fragte Luigi, und seine Stimmung schwankte zwischen Vorfreude und Interesse.
»Eigentlich war ich mir selbst genug«, erwiderte sie. »Sie können es sich vielleicht nicht vorstellen, aber ich habe an meinem grünen Daumen gearbeitet.«
Er gab ihr die Hand, dann trat er einen Schritt zurück, weil er wusste, dass ihr informelle Freundlichkeit schnell zu viel wurde.
»Nein, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, Commissaria.«
»Nun gut, ist ja jetzt auch erst mal vorbei. Mich hat eben der Innenminister angerufen. Haben Sie gerade viel zu tun, Commissario?«
»Nur das ganz normale Mittagsgeschäft.«
»Das heißt: Ja. Haben Sie Ersatz?«
»Ich kann meine Kellnerin anrufen. Was gibt es denn?«
»Einen Mord, unten in der Stadt.«
»Am Dom?«
»Ich habe kaum Informationen. Aber es scheint, dass es mitten in der Stadt geschehen ist.«
»Dann fahren Sie bitte schon einmal voraus, Signora. Ich warte, bis meine Vertretung hier ist, dann komme ich sofort nach unten. Wer ist der Tote?«
»Ein Busfahrer der Linie C1. Und es war offenbar ein sehr seltsamer Mord.«
»Ich ahne, dass das der Grund ist, warum Sie gerufen wurden.«
»Und Sie, Commissario«, entgegnete Giulia. »Schließlich sind wir ein Team, und deshalb bitte ich Sie: Beeilen Sie sich. Es scheint, der Questore ist schon am Tatort eingetroffen.«
»Bis eben hatte ich Lust auf den Fall.«
»Man kann sich seine Ermittler nicht aussuchen. Also, sehe ich Sie gleich?«
»Geben Sie mir eine halbe Stunde. A dopo, Signora Commissaria.«
Quattro – 4
Als er die steilen Serpentinen nahm, fiel Luigi auf, wie selten er eigentlich hinunterfuhr in die Stadt. Aber ehrlich gesagt: Warum sollte er auch?
Er hatte hier oben alles, was er brauchte. Unten waren die Straßen voller, die Leute eitler und die Getränke viermal so teuer wie oben in seinem Dorf.
Und Tulipan wurde auch immer schräg angeschaut, wenn er ohne Leine durch die engen Gassen streunte. Dabei war sein Golden Retriever der wohlerzogenste Hund des ganzen Landes. Und der beste Rollerhund, wie er eben mal wieder bewies: Er saß auf der gelben Vespa zwischen den Beinen seines Herrchens, seine Ohren flatterten im Wind, und er legte sich in jeder Kurve in die entsprechende Richtung. Kein Wunder, er war von klein auf bei Luigi auf dem Roller mitgefahren.
Je dichter der Verkehr wurde, desto forscher fuhr der Commissario. Bald quetschte er sich zwischen den Fahrzeugen hindurch, weil kurz hinter der Stadtgrenze nur noch Stau war. Offenbar war tatsächlich die halbe Stadt abgesperrt, was zu einem ohrenbetäubenden Hupkonzert führte.
Hinter der Porta alle Carra wollte Luigi nach links abbiegen, um den Stadtring zu nehmen, aber er sah schon die vielen roten Lichter vor ihm, die Busse, die im Stau standen, er hörte die vielen wütenden Autofahrer, die hupten.
Also fuhr er entgegen der Einbahnstraße in die Altstadt hinein, schlug enge Kurven in den kleinen Gassen und war am Ende reichlich froh, als er schon nach fünf Minuten die Kuppel des Duomo vor sich sah. Weiter ging es aber auch nicht, denn hier war schon das rot-weiße Absperrband gespannt – und zwar einmal um den ganzen Platz.
»Merda«, sagte Luigi, halb zu sich selbst und halb zu Tulipan, der interessiert aufsah. Ein Carabiniere stand am Absperrband, der stolze Blick hätte wie stets bei diesen Beamten auch aus einem Männermagazin stammen können. Luigi ließ die Vespa ausrollen.
»Buongiorno«, sagte er, »ich bin Commissario …«
Doch der Mann in der schicken schwarzen Uniform ließ ihn gar nicht ausreden, er nahm das Band hoch und rief freudig: »Commissario Batista, natürlich, willkommen. Und Tulipan, ciao … Es ist da hinten, auf der anderen Seite des Doms. Sie können es nicht verfehlen.«
Luigi lächelte dem Mann dankbar zu und fuhr hindurch. Er spürte, dass ihn diese Zuneigung der einfachen Beamten immer wieder mit ein wenig Scham erfüllte. Aber ein kleines bisschen Stolz war da auch, natürlich.
Der Duomo stand vor ihm wie ein großes Wunder, hochaufragend und voller Patina – nun waren all die Details zu sehen, die er von seinem Berg nicht erkennen konnte, die Anmut der behauenen Steine, die Feinheit des Marmors der Skulpturen. Es war ein Meisterwerk, nein, es war das Meisterwerk der Architekten eines sehr fernen Jahrhunderts.
Doch als Luigi hinter diesem Wunder um die Ecke bog, bremste er abrupt ab.
»Merda«, flüsterte er wieder und streichelte Tulipan zwischen den Ohren. Der Hund knurrte leise, als hätte er den Grund für die Aufregung seines Herrchens längst erkannt.
Luigi hatte gewusst, dass er ihm früher oder später begegnen würde – aber doch noch nicht jetzt, in den ersten Minuten dieses Falls.
Da vorne stolzierte der Questore mit hochrotem Kopf vor einem abgestellten Linienbus auf und ab – und schrie in ein Handy. Er war zu weit weg, als dass Luigi seinen genauen Wortlaut hätte hören können. Aber der schrille Tonfall reichte bereits für eine Gänsehaut.
Das Déjà-vu des Luigi Batista war komplett. Er hasste diesen Mann.
Cinque – 5
Giulia war schon zehn Minuten vorher angekommen, ihr Käfer war durch die Kurven gerast, als habe er nie etwas anderes gemacht und als sei der Wagen nicht schon vierzig Jahre alt. Doch als sie den Questore unten vor dem Tatort erblickte, wünschte sie fast, sich doch nicht so beeilt zu haben.
Er stolzierte vor einem Haufen von Beamten der Spurensicherung herum, die alle etwas ratlos dastanden und nicht recht wussten, ob sie nun seinem Befehl folgen sollten.
Giulia stemmte die Hände in die Hüften und ging auf den Mann im schwarzen Anzug zu.
»Signore Questore«, sagte sie und streckte schon die Hand aus, doch der Chef der Florentiner Polizei nahm sie nicht an. Stattdessen rief er: »Ah sieh an, die Gesandte des Innenministers. Seit wann glaubt Rom eigentlich, dass das Ministerium selbst hier über alles wachen kann? Für was bin ich eigentlich ernannt worden?«
Giulia runzelte die Stirn. »Ich denke, Sie sind für Ihre unglaublichen Verdienste um die Sicherheit dieser Stadt ernannt worden«, antwortete sie und meinte, auf den Gesichtern der Spurensicherer mehrere Grinser erkennen zu können. »Allerdings weiß ich nicht so recht, warum der Bus immer noch in der prallen Sonne steht. Ich hatte doch verfügt, dass das Zelt aufgebaut …«
»Signora Ferrari …« Er wurde ganz rot im Gesicht, für einen kurzen Moment hatte sie Sorge, er würde umfallen – vielleicht war es aber auch eine Hoffnung. »Ich habe bereits dem Präfekten gesagt, dass wir den Fall übernehmen, genau wie den ersten Mordfall. Und wir sind hier fertig. Ich sehe also gar nicht ein, warum wir …«