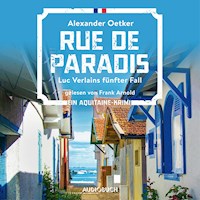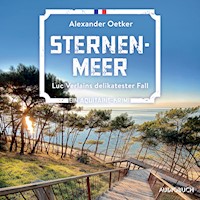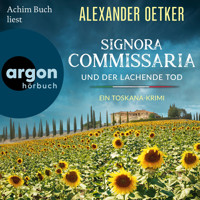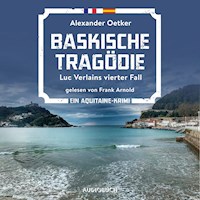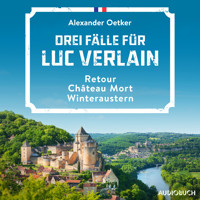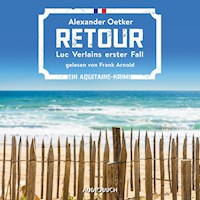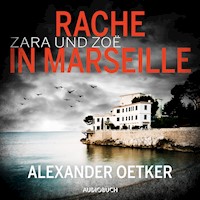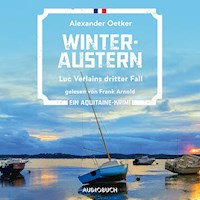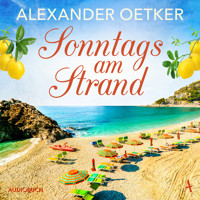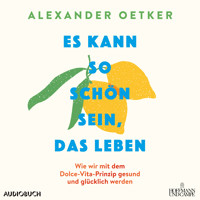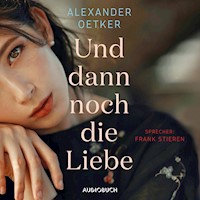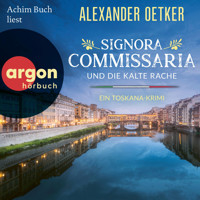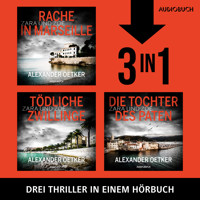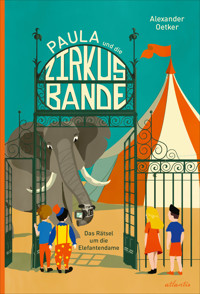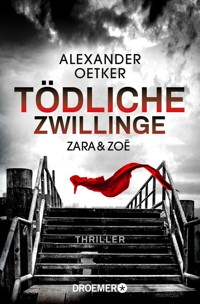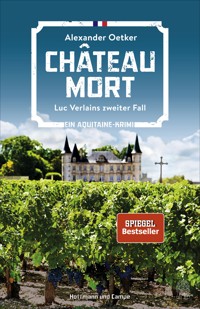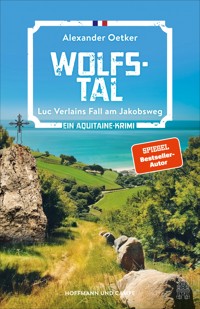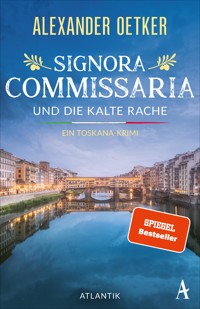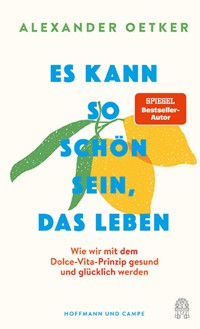
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In unserem schnelllebigen Alltag nehmen Stress und schlechte Laune allzu oft eine große Rolle ein. Wir nehmen uns keine Zeit, um zu genießen, machen Überstunden und ärgern uns über Kinderlärm. Wie gerne würden wir dagegen so leben wie die Menschen im Süden: innerlich gelassen, naturverbunden und der Lebensfreude zugeneigt bis ins hohe Alter. Alexander Oetker, als Korrespondent stets auf Reisen und als Restaurantkritiker Genießer von Beruf, erzählt uns auf wunderbar leichte Weise von den Menschen in den südlichen Ländern und von den Geheimnissen des Dolce-Vita-Prinzips. Diese bestehen nicht nur aus Olivenöl und Siesta, sondern machen eine ganze Philosophie aus, die immer wieder aufs Neue beweist: Es kann so schön sein, das Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alexander Oetker
Es kann so schön sein, das Leben
Wie wir mit dem Dolce-Vita-Prinzip gesund und glücklich werden
Sachbuch
Vom Glück des Südens — ein Vorwort
Ich weiß noch ganz genau, wann mir zum ersten Mal klar war, dass ich hier alt werden möchte. Besser: dass ich hier alt werden muss. Hier, im Süden.
Es war vor fünfzehn Jahren. Ich war fünfundzwanzig, und wir fuhren durch den Norden Sardiniens. Ich litt seit einigen Jahren an einer heftigen Angsterkrankung, im Grunde seit ich siebzehn geworden und aufs Abitur zugesteuert war. Die Zeit war furchtbar. Ich schmiss das Studium, weil ich mir ständig einredete, ich sei faul. Dabei hielt ich es einfach nicht in den geschlossenen Hörsälen aus. Dennoch arbeitete ich bereits als Journalist, das ging merkwürdigerweise. Meine Angst wusste scheinbar, dass ich von irgendetwas leben musste, also tauchte sie während meiner Arbeitstage so gut wie nie auf. Anders im Privatleben: An guten Tagen schaffte ich es mit dem eigenen Auto an die Ostsee, an schlechten Tagen war sogar der Briefkasten an der Straßenecke unerreichbar. An Fernreisen oder Wochenendtrips ins Ausland gar nicht zu denken.
Irgendwann entschied ich, dass es so nicht weitergehen konnte. Ich machte eine Therapie. Fuhr unentwegt U-Bahn, um mich mit meiner Angst zu konfrontieren – was zu ständigen Schweißausbrüchen führte –, und buchte schließlich eine Flugreise, was bisher der absolute Albtraum für mich gewesen war. Ich wusste: Wenn ich jetzt noch einmal zum Flughafen fahren und unverrichteter Dinge wieder umkehren würde, würde ich nie wieder fliegen. Und was soll ich sagen: Meine damalige Freundin und ich stiegen tatsächlich ein. Drei Stunden später leuchtete vor uns auf einmal, einer Fata Morgana gleich, das von der Sonne beschienene Mittelmeer. Die Wellen wogten weiß glänzend über das gold-blau schimmernde Wasser.
Ich weinte, weil der Augenblick so schön und die Überwindung so groß gewesen war. Ich weinte aber auch, weil mir klar wurde, dass ich so lange auf dieses Panorama verzichtet hatte, nur wegen meiner Angst. Bei aller Freude waren da auch Bitterkeit und die Frage: Warum trage ich dieses quälende Etwas in mir?
In den ersten Tagen waren wir viel am Meer, erkundeten aber auch die Insel, das Landesinnere. Und bei einem dieser Ausflüge passierte, was ich seither nicht wieder vergessen habe. Obwohl, wenn ich es recht überlege: Es ist eigentlich gar nichts passiert. Mir ist in den Bergen nur das südliche Leben begegnet, in all seiner Schönheit. Nicht laut oder ereignisschwer, sondern ganz leise und sanft.
Das Dorf in den Bergen, das wir besuchten, zwischen Olbia und Palau gelegen, hieß San Pantaleo. Als wir am Dorfplatz parkten, sah ich sie schon: die alten Männer, die auf einem Mäuerchen saßen und miteinander schwatzten, Rotweingläser zwischen ihnen, es war später Vormittag. Und ich konnte mir ausmalen, worüber sie sprachen: über die Regierung in Rom genauso wie über das Wetter und wohl auch über die Ehefrauen zu Hause, die ihnen die Hölle heißmachen würden, wenn sie wieder zu spät zum Mittagessen kämen. Es war ein friedliches Bild – und ein zutiefst lebendiges. Ich habe es nie mehr vergessen. Und ich habe mir mehr als alles andere gewünscht, eines Tages auch auf einer solchen Mauer zu sitzen. Mit Falten im Gesicht und grauen Haaren – oder eben auch gar keinen Haaren mehr –, aber glücklich.
Als wir dann durch das Dorf gingen, sahen wir in einer der engen Gassen gleich hinter der Kirche die weibliche Variante des südlichen Lebens. Die Frauen trugen Kittelschürzen und toupierte graue Dauerwellen, die Hände hatten sie in die Hüften gestemmt. Sie standen vor einem der winzigen Häuser, die Hausherrin hing aus dem Fenster, irgendwas kochte auf dem Herd, der Geruch strömte bis auf die Gasse, und die alten Damen schwatzten so laut und fröhlich, dass es mich rührte und amüsierte zugleich.
Ich sah ihnen noch lange nach. Und ich bin seitdem bei jeder Sardinien-Reise wieder nach San Pantaleo gefahren, um zu schauen, ob sich die Szenerien wiederholen würden. Und sie taten es, jedes Mal. Vielleicht änderten sich die einzelnen Figuren, weil doch mal jemand auf den örtlichen Friedhof übergesiedelt war, aber es waren stets mehrere ältere Herrschaften, die zusammenstanden oder zusammensaßen und in trauter Gemeinsamkeit den Tag verbrachten, immer in Gespräche vertieft, das Leben genießend.
Nur wenige Jahre später zog ich selbst – nun ja – nicht in den Süden, aber immerhin in die Hauptstadt Frankreichs. Paris war zwar ein Fest fürs Leben, aber sicher keine Schule dafür, wie man glücklich und gesund alt werden konnte. Zu viel Hektik lag über der Stadt und bis vor wenigen Jahren auch zu viel Smog. Letzteres hat sich durch die zahlreichen Fahrradwege und die komplett autofreien Quais gottlob geändert. Meine Arbeit als Frankreich-Korrespondent fürs deutsche Fernsehen erlaubte mir aber, das ganze Land zu bereisen, und die Menschen, die ich dabei kennenlernte, betrachteten das Leben aus der südlichen Perspektive – sie schienen mir alle eine Spur glücklicher, ausgeglichener, ja sonniger.
Seitdem suche ich nach Antworten auf die Frage: Was unterscheidet die Menschen im Süden von uns Mitteleuropäern? So unterschiedlich sind die Grundlagen doch gar nicht: Auch an der Algarve hetzt die arbeitende Ehefrau noch kurz vor Ladenschluss in den Supermarkt, weil das Müsli für die Kinder alle ist. Auch in Neapel kommt noch eine Mail kurz vor Büroschluss, die den nahen Feierabend unangenehm nach hinten verschiebt. Und auch in Marseille ist im November das Wartezimmer des Hausarztes voll, weil die Influenza durch die Hafenstadt fegt.
Und dennoch: Die Stimmung ist eine andere. Als wären all diese Ärgernisse eben nicht die Hauptdarsteller des eigenen Lebens. Die Menschen reden darüber, schimpfen kurz und vehement – aber innerhalb von wenigen Augenblicken ist der Ärger verflogen also alles wieder gut. Gemeinsam gehen sie erst zum Apéro und dann zum dîner.
Kennen wir nicht alle diese vermeintlichen Klischees, die wir uns erzählen, wenn wir auf dem Weg in den Sommerurlaub und die südlichen Länder nicht mehr weit sind?
Gleich sind wir in Italien, dort sind die Menschen so kinderlieb. Niemand guckt unsere Kinder schief an, wenn sie mal laut sind, sie streicheln ihnen durch die Haare, weil die bambini so süß sind. Und wenn wir erst mal in Frankreich sind, sitzen wir abends alle zusammen an der großen Tafel, trinken Wein und schwelgen im Kerzenmeer und im Duft der Platanen. In Spanien ist einfach alles viel gemächlicher, ich liebe die Siesta. Also, wenn ich könnte, würde ich die in Deutschland auch einführen. Klar, die Spanier sind nicht so produktiv wie wir, aber die wissen zu leben. Und ach, in Portugal, da herrscht diese Melancholie, da spürt man den Fado. Wie die Sonne die Menschen träge macht. Dabei sind sie so gastfreundlich. Jeder ist dort willkommen. Die Griechen sind so ein stolzes Volk. Sie leben mit ihren Traditionen und sie schätzen die Familie. Dort zählen die alten Leute noch etwas. Schließlich waren sie es, die die Jungen durch die Krise gebracht haben.
So oder so ähnlich klingt das Schwelgen. Aber handelt es sich dabei wirklich um Klischees? Oder geben wir mit diesen Sehnsuchtserzählungen nicht doch gelebte Realität wieder?
In diesem Buch mache ich mich mit Ihnen gemeinsam auf die Suche nach dem Dolce Vita, nach diesem süßen Leben, von dem wir alle eine Ahnung haben, von dem wir aber nicht wissen, was sich genau dahinter verbirgt. Braucht es dafür Palmen und weißen Sandstrand, eine Pergola mit wildem Wein und zirpenden Zikaden am Abendhimmel? Oder sind die Glücksprinzipien des Lebens universell anwendbar, auch in Oer-Erkenschwick, Delmenhorst, in Linz, Luzern oder in Detmold?
Gemeinsam mit vielen Menschen aus dem Süden werde ich versuchen, die Geheimnisse dieses schillernden Begriffs, dieses mythenumrankten Lebens zu lüften. In der Hoffnung, dass daraus ein Pfad erwächst, eine Art Dolce-Vita-Prinzip, das Sie, liebe Leserinnen und Leser, inspiriert und zu einem gesünderen und glücklicheren Leben führt.
Also los. Denn: Es kann so schön sein, das Leben.
Geben und Nehmen – das sind zwei Dinge, die in Deutschland oft untrennbar miteinander verbunden sind. Meistens wird genau abgezählt: Ich gebe dir etwas, dafür möchte ich aber auch etwas von dir bekommen.
Im Süden ist das anders: Da gibt man und erwartet erst mal gar nichts von seinem Gegenüber. Die Abrechnung gerät eher langfristig, auf den Lauf der Dinge vertrauend. Vielleicht kommt eines Tages etwas zurück, vielleicht schon morgen, vielleicht aber auch nie.
Es ist eine Funktionsweise der Gesellschaft, die auf zahlreichen Krisen beruht: Denn nur, wenn sich die Menschen gegenseitig stützen, werden sie auch überleben. Eine Lebensversicherung, die funktioniert, schon seit Hunderten von Jahren.
1Eine Hand wäscht die andere
»Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich.«
André Gide, französischer Schriftsteller
Kurz vor der Geburt meines ersten Sohnes schenkte mir eine Kollegin ihr Babybett. Es war fünfzehn Jahre alt, sie hatte es schon oft verliehen, es hatte viele Schrammen und knarzte ganz schön. Trotzdem freute ich mich darüber, es war etwas Besonderes.
Als die Kollegin uns das Bett übergab, tat sie es jedoch mit den Worten: »Ist ja ein Geschenk. Du kannst mir eine richtig gute Flasche Wein dafür geben.« Das wiederholte sie noch zwei Mal, bis ich ihr dann wirklich eine gute Flasche überreichte.
Bis heute muss ich über diese Geschichte lachen. Natürlich hätte ich ihr etwas für das Bett gegeben, vielleicht sogar mehr als eine Flasche Chablis. Aber die wiederholte Aufforderung war einfach zu komisch, und vor lauter Unverständnis hätte ich gerne ins Bettgitter gebissen. Die Kollegin hatte lange im Ausland gelebt und war trotzdem so deutsch.
Ganz ähnlich war mir zumute bei einer ehemaligen Bekannten, die uns für einige Zeit ihren gebrauchten Kindersitz auslieh. Leider fiel der bereits sehr betagte Autositz einem Brand in unserem Ferienbungalow zum Opfer, so wie das gesamte Inventar. Als die Bekannte wieder ein Kind erwartete, wollten wir den Sitz ersetzen, woraufhin sie uns die zehn Jahre alte Originalrechnung schickte und die Überweisung des Neupreises erwartete. Als ich vorsichtig infrage stellte, ob es richtig sei, einen abgenutzten Sitz nach so langer Zeit vergolden zu wollen, sprach sie nie wieder ein Wort mit mir.
Beide Vorgehen sind natürlich legitim, sowohl die wenig subtile Weinforderung als auch die überzogene Kindersitzgeschichte. Sie sind aber das genaue Gegenteil von einem der wichtigsten Glücksprinzipien des Südens.
Eine Hand wäscht die andere. Das ist keine Phrase, sondern im Süden gelebte Realität. Versuchen Sie mal, in Nizza oder in Neapel dem Kellner klarzumachen, dass der Zehnertisch getrennt bezahlen möchte – Sie werden Kopfschütteln ernten, mindestens. In Italien zahlt man alla romana, einer löhnt für alle, und hinterher teilt man sich die Kosten – oder es wird gleich eine Einladung draus, bis zum nächsten Mal, dann ist es andersrum. In Frankreich gilt das Aufteilen der Rechnung genauso als verpönt.
Wie oft höre ich in deutschen Freundeskreisen von Problemen mit der Bezahlung, egal ob im Restaurant oder bei der Urlaubskasse. Neulich unternahm eine Freundin eine Reise mit ihren Freundinnen. Vor der Reise hatte man die Kosten für die Unterkunft brav per PayPal durch fünf geteilt, diejenige, die die anderen im Auto mitnahm, bekam das Benzingeld. So weit, so gut. Schon beim Einkauf fürs abendliche Dinner, der natürlich auch durch fünf geteilt werden sollte, war der Ärger aber programmiert: Eine Freundin war Veganerin, sie lehnte es ab, fürs »ach so teure Steak« mitzubezahlen – nicht aus Geiz, wie sie sagte, sie wolle aber auch nicht den bestialischen Mord an dem armen Rind unterstützen. Eine andere Freundin war schwanger und forderte deshalb, man müsse den Wein aus ihrem Anteil herausrechnen, sie habe ja schließlich nichts davon. So dauerte die Abrechnung der Einkaufskosten doppelt so lang wie der Einkauf selbst – und hinterher hatten alle genug Gelegenheit, um zu lästern oder sich zu ärgern.
Solch ein Auseinanderdividieren im Restaurant beobachte ich oft hierzulande, wenn Gruppen ihre Rechnungen aufteilen, bevorzugt mit dem Handy-Taschenrechner: Sabine hatte doch keine Suppe, und Thomas hatte das viel teurere Hauptgericht. Da müsse man jetzt mal rechnen, einfach alles durch vier, das geht natürlich nicht.
Ich persönlich habe schon Urlaube abgesagt, weil im Vorfeld die Forderung nach einer Urlaubskasse laut wurde. Allein diese Ankündigung macht mir schon Angst. Es ist nicht das Teilen an sich – ich teile jedoch lieber Pi mal Daumen, statt meine Kosten mit Strandblick auseinanderzuklamüsern. Mal gewinnt man, mal verliert man.
Klar, man kann die finanzielle Sorglosigkeit auch übertreiben: Silvio Berlusconi ließ sich jahrzehntelang korrumpieren und korrumpierte seinerseits, hinterzog Steuern und bestach Amtsträger, was das Zeug hielt. Seinem Volk lieferte er damit die Vorlage, um zu sagen: Na, wenn die da oben das machen, dann können wir das auch, dann müssen wir uns auch nicht an die Regeln halten.
Derlei wilde Buchhaltung und kriminelle Energie sind natürlich mit dem Glücksprinzip nicht gemeint. Aber eben auch nicht das komplette Gegenteil, dieses penible, übergenaue Aufrechnen von allem, wie es in Deutschland oft praktiziert wird. Wenn Bekannte ihre Leihgaben aufrechnen, Freunde ihre Geschenke und Ehepartner die Hausarbeit.
Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Keine Erbsenzählerei und kein Prassen um des Prassens willen, es geht schließlich nicht um angloamerikanische Großkotzigkeit, sondern um ein Gleichgewicht der Kräfte, und das betrifft längst nicht nur das Finanzielle, sondern unser tagtägliches Wirken: etwa ein Ratschlag, eine gute Tat oder auch nur das Bekanntmachen mit jemandem, der einem weiterhelfen kann.
Es ist das Geschäftsprinzip des Südens. Ich gebe dir heute was – und du gibst mir etwas, wenn die Zeit reif dafür ist, vielleicht ist das morgen, vielleicht erst in einigen Monaten. Dass etwas gar nicht vergolten wird, tritt so gut wie nie ein: Das Leben ist lang, und es findet sich immer eine Gelegenheit, ein gutes Wort oder eine gute Tat zurückzugeben.
Und: Um die Höhe des Betrags oder des Aufwands geht es bei diesen Tauschgeschäften nicht. Es spielt keine Rolle, ob es sich um sehr viele oder sehr wenige Euros handelt, manchmal ist die Unterstützung auch nur ideell. Denn es geht bei alledem ja eben nicht ums Geschäft, sondern um Gemeinschaft. Es geht darum, dass die Tauschgeschäfte für viele Familien auch heute noch eine Überlebenshilfe sind, gerade in den armen Regionen des Südens.
Eine gute Freundin von mir stammt ursprünglich aus einer süditalienischen Familie. Sie wuchs in Campobasso auf, der Hauptstadt der Region Molise, im Süden Italiens. Ihre Eltern kamen wie so viele aus der strukturschwachen Gegend als Gastarbeiter nach Deutschland, doch der Großteil der Familie blieb an dem Ort, den sie immer noch ihre Heimat nennt. Als Kind war meine Freundin oft im sonnigen Süden – und lernte schnell, wie das Überleben funktioniert. Das System prägt sie bis heute.
Es gab nie viel zu essen in dieser kargen Region, es herrschte eine Mangelwirtschaft, aber eine, die durch das Prinzip des Teilens erträglich war: Da war Tante Lucia, die auf ihrem Grundstück Hühner hielt, und die Großmutter meiner Freundin, die den ersten Backofen im ganzen Dorf hatte, mit Holz und offenem Feuer. Die alten Damen besuchten sich gegenseitig, genossen Gemeinschaft und ein wenig Geplauder – und anschließend ging die eine mit einem halben ofenwarmen Brot nach Hause, während die andere ein wenig Olivenöl in die Pfanne ließ, um die frischen Eier zu braten, die sie eben bekommen hatte.
Derlei Tauschgeschäfte kennen wir natürlich auch in Deutschland – aber sie sind deutlich weniger geworden, wie ich finde. Meine Nachbarn auf dem Dorf lassen sich ihre Eier zumeist mit Geld bezahlen. Die unbewachten Kassen vor den Haustüren sind seltener geworden oder ganz verschwunden, weil irgendwie auch das Vertrauen ineinander nicht mehr da ist.
Das selbstlose Geben und Nehmen scheint ein Relikt vergangener Tage zu sein – aber eines, dem alle nachtrauern. Gerade hier in Brandenburg höre ich oft: Herrje, in der DDR, da waren wir noch füreinander da, da haben wir einander noch geholfen. Das war gelebte Solidarität.
Das ist natürlich eine Verklärung der Zustände: Meine Eltern mussten mit anderen tauschen, Zement gegen Autoteile, Nutella gegen Strumpfhosen, weil es in den Läden der ehemaligen DDR oft keine Waren gab. Es war eine Mangelwirtschaft, genau wie im ländlichen Italien. Man musste tauschen, um über die Runden zu kommen, um den Hausbau fortsetzen zu können, um wieder mit dem Trabi zu fahren. Die Menschen halfen einander, und ich kann diejenigen verstehen, die sich wieder mehr Miteinander in der Gesellschaft wünschen. Die andere Wahrheit ist aber: Gerade jene, die die alten Zeiten vermissen und das Verschwinden der Solidarität beklagen, sind oft die, die sich ihre Eier bezahlen lassen.
»Ich bin ja gebürtig aus Schwaben«, sagt Katina Papadomanolakis, die ich für dieses Buch in Athen getroffen habe. »Deshalb weiß ich, wie Sparsamkeit funktioniert und wie ungern die Deutschen etwas abgeben wollen.« Die junge Frau muss lachen, als sie an ihre Kindheit in Stuttgart denkt. Sie ist die Tochter einer Deutschen und eines Griechen und lebt seit mittlerweile siebzehn Jahren in Athen. Wir treffen uns in einem Gartencafé in einem Arbeiterviertel, es ist laut und quirlig hier, nur junge Griechen, die trinken und das Leben genießen, endlich wieder. Die Krise ist überwunden, und viele haben sie nur überlebt, weil die ganze Gesellschaft ein geschlossenes System war, in dem die Menschen einander halfen. Ob derlei auch in Deutschland funktioniert hätte?
Ich bezweifle das – weil wir Deutschen in der Krise, noch mehr als sonst, von Misstrauen geprägt sind und darum bemüht, unsere Schäfchen ins Trockene zu bringen. Natürlich nur unsere eigenen. Leider ist das keine gute Methode, um durch eine Krise zu kommen.
Katina sagt es in anderen Worten: »Wir Deutschen sind wahnsinnig hart zu uns selbst, wir sind alle viel zu selbstkritisch. Dabei gibt es so viele gute Tugenden, aber die sehen wir oft nicht. Und wer hart ist zu sich selbst, der ist auch hart zu anderen.«
Sie erinnert sich an die Zeit der Krise, an die Angst vorm Staatsbankrott, den am Ende die Ärmsten in Griechenland ausbaden mussten – aber damals hat sie zum ersten Mal gelebte Solidarität gespürt.
»Wir Deutschen haben es wahnsinnig schwer, über Geld zu sprechen«, sagt Katina. »Es schwankt ständig zwischen dem Neid auf andere und der Angst, unbescheiden zu sein. Niemand würde sagen: Ich verdiene soundso viel. Hier in Griechenland ist das ganz anders. Schon beim Gespräch unter Bekannten erzählen sich manche, was sie verdienen. Es ist ein ganz normales Thema. Und so war es auch ganz normal, in der Krise zu sagen: Hey, ich war heute Morgen beim Bankautomaten, da kam aber nichts mehr raus. Oder: Ich bin seit zwei Wochen arbeitslos, weil meine Firma mich entlassen hat – aber ich muss morgen meine Stromrechnung bezahlen und den Tierarzt, kannst du mir mal schnell dreihundert Euro leihen?«
Auch ihr ging das so, und sie erzählt, wie ihr jemand aus der Familie oder Freunde halfen – und sie es genauso bei anderen machte, die einen Engpass hatten. »Es gibt hier gar keine Hemmungen zu sagen, ich bin gerade eng mit dem Geld – und auch keine Scham, um Hilfe zu bitten. Das kann man merkwürdig finden, gerade wenn man mit dem deutschen Spruch ›Über Geld redet man nicht‹ aufgewachsen ist. Ich habe dazu aber meine Haltung geändert. Hier hätten viele Menschen ohne diese Hilfe von Freunden nicht überlebt. Und ich glaube, nur durch diese Gemeinschaft sind wir stärker aus der Krise gekommen, als wir es vorher waren – weil wir wissen, dass wir uns in der Not auf die Gemeinschaft verlassen können.«
Es ist nicht nur das gemeinschaftliche, solidarische Denken, sondern das Leben für den Moment. Man denkt im Süden nicht so weit in die Zukunft, man bleibt eher im Hier und Jetzt. »Es gibt nicht diese Vollkaskomentalität«, so erklärt es Katina, als wir das zweite Glas eiskalten Weißwein trinken. »In Deutschland wird so viel an später gedacht – und an alle möglichen Katastrophen, die eintreten können. Da gibt es eine Riester-Rente, die am Ende ohnehin nichts bringt, und alle schließen irgendwelche Lebensversicherungen ab. Das geht ja so weit, dass das alte Auto noch vollversichert wird und sogar das Handy und der Hund, und alle denken: Was mache ich denn mit siebzig? Habe ich da noch Geld? Wird die Rente reichen?«
Sie sieht sich um und zeigt auf die jungen Griechen am Nachbartisch, die noch eine Flasche bestellen. Eine andere Tischgesellschaft bricht gerade auf, die Taverne nebenan wartet für ein spätes Abendessen. »Hier denkt niemand viel über das Alter nach. Und auch nicht darüber, was kommen wird. Die Menschen wissen es nicht – oder sie wollen es nicht wissen. Weil sie schon zu viele Krisen gesehen haben. Warum sollen sie Angst vor etwas haben, von dem sie noch nicht einmal etwas ahnen? Es kommt eh immer anders, als man denkt. Und deshalb sagen sich hier alle: Ich lebe jetzt. Und wenn ich jetzt Geld habe, dann kann ich auch etwas abgeben, wenn ein anderer nichts hat. Das ist ein befreiendes Gefühl, ganz ehrlich.«
Es führt zu einer inneren Freiheit, nicht nur denen zu helfen, von denen man irgendwann selbst Hilfe erwarten kann, sondern auch einfach so etwas abzugeben. Ich habe das auf meinen Reisen durch die Länder des Südens oft erlebt – und beim Schreiben dieser Zeilen wird es mir ein weiteres Mal bewusst.
Zur Veranschaulichung, wie einfach diese Lebensweise umzusetzen wäre, zwei Beispiele – zunächst das abschreckende, dann das positive: Im Berliner Nachtleben kursiert seit einigen Jahren die Frage: »Kann ich dir eine Zigarette abkaufen?« Eine Frage, die im Süden unvorstellbar wäre. Die Leute würden völlig verständnislos den Kopf schütteln, als sei allein das Angebot, sich eine Zigarette bezahlen zu lassen, unmoralisch. In Berlin aber steht die Chance fünfzig-fünfzig: Die Hälfte gibt dem Fragenden eine Zigarette, ohne etwas dafür zu verlangen, die andere Hälfte sagt »Klar« und lässt sich dann aus dem Portemonnaie fünfzig mühsam zusammengeklaubte Cents aushändigen.
In Athen hatte ich vor kurzem zwei Erlebnisse: Ich fragte einen Wildfremden auf der Straße nach Feuer, er gab es mir und sagte: »Behalte es.« Auf meine Widerrede, ich könne ihm auch Geld dafür geben, winkte er so entschieden ab, als hätte ich ihn beleidigt. Eine ähnliche Geschichte trug sich in einer kleinen Taverne zu. Der Wirt entschuldigte sich mehrfach, das Essen sei ihm über den Tag ausgegangen, es sei so viel los gewesen. Wir wollten ohnehin nur etwas trinken, also brachte er uns drei Bier. Geld wollte er dafür nicht – wir seien so nett, er wolle uns gerne einladen.
Großzügigkeit ohne die geringste Erwartung einer Gegenleistung – das ist der Höhepunkt der Gastfreundschaft. Und der Menschenfreundlichkeit. Sie hinterlassen sofort ein warmes Gefühl im Bauch.
Das gilt für Einladungen. Und für Hilfestellungen. Ich bin ein Experte im Sich-Festfahren. Neulich passierte es wieder, auf einer wirklich unwegsamen Straße auf Zypern. Die Akamas-Halbinsel liegt ganz im Westen der Insel, es gibt dort einen wunderschönen Strand namens Lara Beach, an dem die Meeresschildkröten ihre Eier ablegen. Ich wollte diesen Strand mit meiner Freundin erkunden, nicht im Sommer wohlgemerkt, sondern an einem sehr regnerischen Tag im Dezember. Auf dem Weg in die staubige Einöde kamen uns mehrere Wagen entgegen, die Fahrer winkten alle ab, was so viel hieß wie: Wir sollten hier besser nicht weiterfahren. Ich hingegen war überzeugt: Ich kann super Auto fahren, wir ziehen das jetzt durch.
Doch auch der schönste Größenwahn kann nichts gegen zypriotische Matschstraßen ausrichten. Zwanzig Minuten später steckten wir mit unserem kleinen Mietwagen in einem riesigen Schlammloch fest. Und zwar nicht nur ein bisschen. Unsere Reifen waren so voller feuchter Erde, dass sie nicht einmal ansatzweise in die sogenannte Straße greifen konnten. Es war Dezember, wir waren allein hier am Ende der Welt, und zusätzlich fing es an, heftig zu gewittern. Der nächste Ort war zu Fuß drei Stunden entfernt, mindestens. Wobei wir einen Fußmarsch durch die unwirtliche Gegend bei diesem Unwetter ohnehin nicht gewagt hätten.
Gott sei Dank funktionierte das Telefon. Es gab eine Taverne im nächsten Dorf, dort rief ich an. Das Gasthaus hatte natürlich geschlossen, aber der Wirt ging glücklicherweise trotzdem ans Handy. Er sei heute in der Hauptstadt, drei Stunden entfernt. Aber er versuche mal, Freunde zu erreichen. Wir kannten uns nicht, waren uns noch nie begegnet, ich hatte nie bei ihm gegessen. Ich war nur ein Tourist, der ihn an seinem freien Tag störte und ihm Mehrarbeit zumutete – ohne Aussicht auf eine Gegenleistung. Und dennoch versprach er, sich zu kümmern.
Ich hörte nichts mehr von ihm, aber eine Dreiviertelstunde später waren Motorengeräusche zu vernehmen. Er hatte Freunde verständigt, gleich sechs kamen, verteilt auf zwei Jeeps. Alte Männer mit sonnengegerbter Haut, die unseren Wagen ansahen, den Kopf schüttelten über unsere Dummheit und dicke Seile herbeischafften, um uns aus unserer misslichen Lage zu befreien. Sie arbeiteten schnell, und die wenigen Worte, die sie miteinander wechselten, machte ich als zypriotischen Dialekt aus. Am Ende zogen sie mit einem der Jeeps – unter der Gefahr, sich selbst festzufahren, sich aber in jedem Fall sehr dreckig zu machen – unser Auto aus dem Matsch. Die ganze Aktion dauerte zwanzig Minuten und erforderte sehr viel Anstrengung – doch eine Gegenleistung lehnten die Männer ab. So sei es nun mal, in der Not helfe man sich, radebrechte einer von ihnen auf Englisch. Uns blieb nur, mehrmals efcharistó zu sagen, danke.
Ein anderes Mal war die Hilfe noch unwahrscheinlicher: Es war der Finaltag bei der Fußballeuropameisterschaft 2016, ungefähr zehn Minuten vor Anpfiff des Spiels Portugal gegen Frankreich. Wir fuhren gerade in jenen Strandort ein, in dem mein fiktiver Commissaire Luc Verlain wohnt, Carcans Plage, ein wunderschönes Dörfchen direkt am Atlantik. Kurz vor dem Ortseingang kam mir die grandiose Idee, für meine künftigen Lesungen das Schild mit dem Namen des Dörfchens zu fotografieren. Also riss ich das Steuer nach rechts und hielt genau vor dem rot-weißen Schild. Leider hatte ich nicht darauf geachtet, dass der Untergrund hier aus demselben Dünensand bestand wie die ganze Gegend. Sekunden später steckte der Wagen fest, ohne Chance auf ein Entkommen.
Ich sah auf die Uhr. Noch acht Minuten bis zum Finale. Ich wollte das Spiel gerne sehen, in der Bar genau hinter der Düne, allez les bleus, doch nun würden wir es sicher verpassen. Ich rechnete nämlich in Gedanken die Wahrscheinlichkeit aus, dass in Deutschland irgendjemand so kurz vor einem wichtigen Spiel – vor einem Finale mit eigener Beteiligung – Lust hätte, irgendeinen dämlichen Touristen aus seinem selbst verursachten Schlamassel zu befreien.
Es waren kaum noch Autos unterwegs, schließlich saßen alle Franzosen längst vor den Bildschirmen, zu Hause oder in den Bars der Region. Ich stellte mich trotzdem an die Straße, und tatsächlich, nach drei Minuten kam ein Wagen. Noch fünf Minuten bis zum Anpfiff. Ich streckte die Hand aus, nicht sehr forsch, weil ich ja wusste, wie gering die Chance war, doch der Wagen bremste sofort – und hielt.
»Festgefahren?«, fragte der Mann.
»Ja«, sagte ich und entschuldigte mich, »gleich ist ja das Spiel, Sie wollen es doch bestimmt ansehen, ich kann den Wagen auch hier stehenlassen und …«
»Non«, erwiderte er, machte den Warnblinker an und stieg aus. Ohne viele Worte nahm er ein Seil aus dem Kofferraum, wir befestigten es, und ein paar Minuten später hatte er meinen Wagen aus dem Sand gezogen. Auch er wollte nichts dafür, kein Geld, keine Gegenleistung, obwohl er den Anpfiff des Finales verpasst hatte.
»Gutes Match«, wünschte er noch, und ich war viel zu perplex, um irgendetwas zu erwidern außer einem mehrfachen Dankeschön. Es war Edelmut, nicht weniger, Großzügigkeit in ihrer seltensten Form.
Und vielleicht ist genau das etwas, was wir auch hierzulande wieder mehr tun sollten: Geben ohne Gegenleistung. Vertrauen auf das Gute im anderen. Ohne Erwartungen. Die Erwartungshaltung kann viel kaputtmachen. Wenn andere die eigene Erwartung nicht erfüllen. Oder wenn man selbst einfach zu viel erwartet. Besser ist es, weniger zu erwarten und selbst anzufangen, mehr zu geben. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber es ist ein Anfang. Und ein wichtiger Bestandteil des Dolce-Vita-Prinzips – eine Hand wäscht die andere.
Rechnen Sie nicht auf. Nicht in der Familie, nicht mit den Nachbarn, nicht mit Freunden während einer Urlaubsreise. Seien Sie großzügig, und Sie werden Großzügigkeit erfahren. Wenn Sie sich ausgenutzt fühlen, sprechen Sie es an. Es wird für Klarheit sorgen. Wenn nicht, dann passt es womöglich mit den Menschen, die Sie ausnutzen, nicht.
Verreisen Sie nicht mit Menschen, die das Führen strenger Urlaubskassen und überpenible Abrechnungen fordern.
Seien Sie hilfsbereit, auch wenn Sie nicht mit einer Gegenleistung rechnen können. Ein Leben ist lang, und es werden sich immer ungeahnte Momente ergeben, in denen Sie Hilfe von den anderen erfahren können.
Seien Sie vorsichtig mit Erwartungen. Formulieren Sie lieber Ihre Wünsche und bitten Sie Ihr Gegenüber, das Gleiche zu tun.
Chi va piano, va sano e va lontano – so lautet ein italienisches Sprichwort: Wer langsam geht, geht gesund und geht lange. Darin steckt viel Weisheit. Denn es geht beim gesunden Älterwerden ja gar nicht darum, wie ein Besessener Sport zu treiben und Muskulatur und Knochen im Zustand ewiger Jugend zu konservieren. Es geht nicht um die Optimierung des Körpers, um irgendwelche merkwürdigen Vorsätze oder gemeine Diäten.
Es geht bestenfalls um Bewegung. Um stete und fordernde Bewegung – aber auch: um einen Sinn im Leben. Die Menschen im Süden haben sogar Wörter dafür erfunden: Der Flaneur ist ein Stadtstreifer, die passeggiata das allabendliche Treibenlassen über die Piazza. Beides ist Bewegung im schönsten Lebenssinne.
2Lauf langsam
»Zu unserer Natur gehört die Bewegung; die vollkommene Ruhe ist der Tod.«
Blaise Pascal, französischer Philosoph
Bergauf, bergab, jeden Tag, einmal früh, einmal spät, vielleicht sogar zwischendurch noch einmal. Die Gasse, die in Carvoeiro an der Algarve von Oma Marias Haus hinunter zum kleinen Supermarkt in der Rua dos Pescadores führt, ist so steil, dass ein unkundiger Nordeuropäer sie wahrscheinlich nur mit zwei Nordic-Walking-Stöcken bewaffnet bewältigen möchte. Oder gleich mit dem Auto. Oma Maria aber nimmt die bergige Straße mit ihren Gesundheitsschuhen ganz stoisch, langsam und behäbig, aber dennoch zielstrebig – sie ist zeit ihres Lebens noch nicht gestolpert.
Sie hat ja auch keine andere Wahl. Wenn sie am Abend für ihren Ehemann eine Cataplana auf den Tisch bringen will, braucht sie frischen Seeteufel, Kartoffeln, Paprika, Tomaten und Weißwein. All das kriegt sie eben nur in dem kleinen Einkaufsladen unten an der Straße. Deshalb geht Maria diesen Weg – und sie wird ihn so lange gehen, bis die Füße sie eines fernen Tages nicht mehr tragen.
Wenn es nicht mehr geht, geht es eben nicht mehr. Dann wird ihre Tochter ihr den Fisch und das Gemüse bringen, denn eine bessere Cataplana als die von Oma Maria gibt es in ganz Carvoeiro nicht. Aber bis es so weit ist, geht Maria weiterhin den Weg, mit Gelassenheit und ohne Angst.
Einer der Hauptgründe für ein langes südliches Leben ist diese Art von sinnvoller Bewegung. Die Orte, die für uns den Süden ausmachen, sind voller solch steiler Gassen. Ob hier an der Algarve oder an der Amalfi-Küste, ob in Lissabon, das eigentlich nur aus bergigen Straßen besteht, oder in Neapel. Genua, Marseille, die kleinen Dörfer auf Kreta oder Zypern – der Gott des Südens mag Höhenmeter, so scheint es.