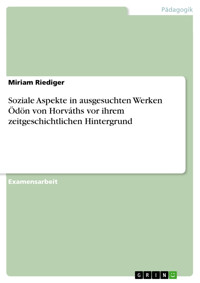
Soziale Aspekte in ausgesuchten Werken Ödön von Horváths vor ihrem zeitgeschichtlichen Hintergrund E-Book
Miriam Riediger
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Literatur, Werke, Note: 1,0, Universität Regensburg (Germanistik), Sprache: Deutsch, Abstract: Im Zuge dieser Arbeit wurden einige bekannte Stücke von Ödön von Horváth, darunter auch "Geschichten aus dem Wienerwald " und "Glaube- Liebe- Hoffnung" danach untersucht, inwiefern der Autor soziale Aspekte seiner Zeit, vor allem die vorherrschenden, gesellschaftlichen Missstände mittels der Handlung und des entsprechenden Personals aufgreift und verarbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Page 4
Vorwort
Sind wir denn schon mitten drin im Weltuntergang?1
Diese Frage haben sich die Menschen bis heute immer wieder gestellt, gerade wenn es um Probleme ging, von denen sie glaubten, sie seien so schwerwiegend, dass es keinerlei Ausweg aus der Misere geben könnte. Besonders bei Naturkatastrophen, Attentaten oder politischen Machtkämpfen wurden in der Vergangenheit immer wieder Worte nach einem möglichen Weltuntergang laut. Wenn sich nun aber der Schriftsteller Klaus Mann die Frage stellt, ob die Menschheit sich bereits vor dem Ende der Welt befände, so hat dies in gewisser Weise auch den Hintergrund eines vermeintlichen Attentats, bei dem der Dichter und Autor Ödön von Horváth am 1. Juni des Jahres 1938 im jungen Alter von 37 Jahren erschlagen wurde. So geschehen auf den Champs-Elysées in Paris, nachdem ein Unwetter aufgezogen war. Der Blitz schlug gerade in den Baum ein, an welchem Horváth in diesem Augenblick vorüberspazierte. Ein morscher Ast brach ab und traf den Autor tödlich am Hinterkopf. Diese Meldung vom unglaublichen und plötzlichen Tode Horváths löste besonders unter seinen Verwandten und Freunden Fassungslosigkeit und Entsetzen aus. Es gab Stimmen, die behaupteten, dass die Tragik der Todesumstände die Tragik in seinen Werken wiederspiegle. Sein Freund Franz Werfel konstatierte in seinem Nachwort, dass die Art des Sterbens aus seinen Stücken entnommen sein könnte.
Alle Freunde Ödön von Horváths fühlten: Dieser Tod ist kein Zufall. Mancher sagte: Dieser Tod passt zu ihm.2
So außergewöhnlich die Umstände seines Ablebens auch waren, so außergewöhnlich gestaltete sich sein Leben. Als Sohn des Diplomaten Dr. Ödön Josef von Horváth und seiner Frau Maria Hermine von Horváth geboren, war sein Leben schon als Kind sehr abwechslungsreich. Er lernte die verschiedensten Städte kennen, wie beispielsweise seine Geburtstadt Fiume, Budapest, Wien, München, Berlin oder aber Murnau und somit auch Länder wie Ungarn, Österreich, Deutschland oder die Schweiz. Durch die unzähligen Reisen, die er zwangsläufig aufgrund des Berufes seines Vaters unternehmen musste, genoss er aber auch das Privileg, auf unterschiedliche Kulturen und Menschen zu treffen. Das, was Horváth und sein Werk heute noch auszeichnet und was in gewisser Weise damals neu in der literarischen Welt war, besteht darin, dass er seine Geschichten, Schauplätze und besonders seine Figuren sehr realistisch, für manchen zu realistisch gestaltet. Es liegt ihm fern, das große Geschehen in seinen Werken zu thematisieren, sondern er versucht vielmehr das, was um ihn
1Vgl.: Krischke, Traugott:Materialien zu Ödön von Horváth.S. 129.
2Vgl.: Ebd. S. 133.
Page 5
herum passiert, die Menschen, die Umstände der Zeit, seien sie wirtschaftlicher, politischer oder gesellschaftlicher Art, in unbeschönigter Weise darzustellen.Sein Segen, den er dem Leben gab, war die Darstellung dessen, was um uns vorgeht, und er holte nicht den Kosmos, sondern die kleine Welt auf die Bühne, die Episode, in der das ganze Leben nicht weniger ist als in Stücken, die den Sternenraum mit umfassen.3
Horváths Stücke waren wegen seines typischen Realismus oft verpönt. Viele Regisseure weigerten sich, diese auf der Bühne zu inszenieren, und dennoch blieb der Autor seiner Linie treu. Er beugte sich eben nicht den Zwängen, wie sein Personal in seinen Werken, die die Gesellschaft der damaligen Zeit ihm auferlegen wollte. Erst Jahre nach seinem Tod setzte eine Art Horváth- Renaissance ein, indem immer mehr ihn zu verstehen begannen und somit auch sein Schaffen würdigten. Einer der bereits in früherer Zeit schon eine hohe Meinung von Horváth besaß, war Klaus Mann. In einer Art Nachwort stellt er Gedanken an, wieso gerade Horváth verunglücken musste.
Denn Ödön von Horváth ist einer unserer Besten gewesen. Er war ein Dichter, nur wenige verdienen diesen Ehrennamen. Die Atmosphäre echter Poesie war in jedem Satz, den er geschrieben hat, und sie war auch um seine Person, war in seinem Blick, seiner Rede.4
Schon beim Lesen seiner Volksstücke zeigt sich eine gewisse Präferenz für bestimmte Themengebiete, die er von seinem Personal aufgreifen und äußern lässt. Dabei fällt stark seine kritische Haltung gegenüber der zeitgenössischen Gesellschaft auf. Kurz gesagt scheint es ihm ein besonderes Anliegen gewesen zu sein, die Ungerechtigkeit, Unmenschlichkeit, Verlogenheit und den Egoismus, vor allem des Mittelstandes und Kleinbürgertums, möglichst unzensiert aufzuzeigen.
Horváth zog also mit seinen „Volksstücken“ die ästhetische Konsequenz aus der Beschaffenheit individuellen Bewusstseins(...) und das heißt aus der Beschaffenheit der Gesellschaft seiner Zeit (...). Die im Zeichen des Profits durchrationalisierte Gesellschaft ist eine von Lemuren, sie beseitigt systematisch alles Lebendige, denn sie vermag ihrem Prinzip gemäß (Reduktion auf Quantität) nur Totes zu integrieren. Sie begegnet dem noch lebendigen Menschen als übermächtiger Apparat, dem er hoffnungslos ausgeliefert ist.5
Die obengenannte Aussage Herbert Gampers wird im folgenden anhand einiger Werke Ödön von Horváths auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Bereits von Gamper angedeutet, muss in besonderem Maße auf äußere Einflussfaktoren und auf die zeitgeschichtlichen Geschehnisse Bezug genommen werden, die sehr stark auf die Verhaltensweisen und Ansichten der Menschen eingewirkt haben dürften.
3Vgl.: Ebd. S. 128.
4Vgl.: Ebd. S. 129f.
5Vgl.: Aussage von Herbert Gamper aus dem Programmbuch 7/ Württ. Staatstheater Stuttgart, März 1975. In: Hildebrandt, Dieter:Ödön von Horváth.S. 131.
Page 6
1. Literaturauswahl
Es würde zu weit führen, wenn man alle Werke aus der Feder Ödön von Horváths zur Analyse der in seinen Schriften angeführten sozialen Aspekte heranziehen würde. Aus diesem Grund war es zwingend notwendig, eine Selektion vorzunehmen und sich somit auf einige einschlägige Titel zu konzentrieren. Sehr passend erschien es mir, seine dramatischen Stücke, vielmehr als seine Romane, in gesellschaftlicher Hinsicht näher zu beleuchten. Zu diesem Zweck entschied ich mich für die beiden VolksstückeKasimir und KarolineundGeschichten aus dem Wiener Wald,für den kleinen TotentanzGlaube Liebe Hoffnung,sowie für die PosseRund um den Kongressund für eines seiner ersten Werke, dem VolksstückDie Bergbahn.Es gibt einige Merkmale, die die eben genannten Titel zueinander in Beziehung setzen. Übereinstimmende Züge weisen zum einen das Personal mit ihren Handlungs - und Sichtweisen auf, aber auch Figurenbezeichnungen und Schicksale ähneln einander. So behandeln beispielsweise die ersten vier der genannten Werke das Scheitern und die Verzweiflung einer Frau in einer patriarchalischen Welt und Gesellschaftsform, deren Suche nach Liebe und Glück eben an und durch die Gesellschaft vergebens bleibt. Die weibliche Hauptfigur wird im Gegenzug nur noch weiter in ihr Unglück gestürzt oder sogar in den Tod getrieben. Kurz gesagt ist es in allen Fällen die stark materialistische Gesellschaft, die viele schwerwiegende Probleme aufwirft und die Menschen in ihrer Not immer weiter ausbeutet, sogar bis in die Ausweglosigkeit treibt. Horváth beschreibt Schicksale, oftmals ausgelöst durch die Unmenschlichkeit und Gleichgültigkeit der Mitmenschen, so wie auch er sie teilweise am eigenen Leib in der Zwischenkriegszeit und im Nationalsozialismus erleben musste, den Egoismus gegenüber dem Nächsten, physische und psychische Gewalttaten, insbesondere ausgeübt auf Frauen und auf diejenigen Mitmenschen, die nicht mit dem Gesellschaftsideal und den moralischen Wertvorstellungen der damaligen Zeit konform zu sein schienen.
In dieser Arbeit gilt es, die eben genannten Gesichtspunkte aus den fünf selektierten Stücken des Dramatikers Horváth anhand der Figurenkonstellationen, der sprachlichen Äußerungen des Personals und deren Handlungsweisen innerhalb jener kapitalistischen Gesellschaft in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen herauszufiltern und vor allem zwischen den Zeilen zu lesen.
Horváths Werk dahingehend heranzuziehen, damalige soziale Gegebenheiten und Strukturen, sowie das zwischenmenschliche Miteinander, oder sollte man besser sagen, Gegeneinander, näher zu beleuchten, scheint geradezu ideal. Trotzdem die realistische Art seiner Schilderung nur allzu häufig auf Kritik seitens vieler Zeitgenossen gestoßen war, zieht Peter Handke ein
Page 7
positives Resumée. Im Vergleich zu seinem Zeitgenossen Bertold Brecht und dessen Art des Schreibens äußert er sich folgendermaßen über Horváth:
Ich ziehe Ödön von Horváth und seine Unordnung und unstilisierte Sentimentalität vor. Die verwirrenden Sätze seiner Personen erschrecken mich, die Modelle der Bösartigkeit, der Hilflosigkeit, der Verwirrung in einer bestimmten Gesellschaft werden bei Horváth viel deutlicher. Und ich mag diese irren Sätze bei ihm, die die Sprünge und Widersprüche des Bewusstseins zeigen, wie man das sonst nur bei Tschechow oder Shakespeare findet.6
Was in jenem Zitat bereits anklingt, ist die Ungewöhnlichkeit der sprachlichen Gestaltung bei Horváth. Die Sprache wird zu einem essentiellen, wenn nicht sogar zum wichtigsten Medium, um seine Figuren sowohl gesellschaftlich als auch menschlich zu klassifizieren. Es wird sich im Verlauf der Analyse zeigen, dass gerade durch sprachliche Äußerungen, getätigt durch seine Personen in den einzelnen Stücken, oder durch den Autor selbst mittels seiner Regieanweisungen, der Dramatiker sein Bestreben nach derDemaskierung des Bewusstseinsdurchführen kann.
Die Fassadenhaftigkeit sowohl der Schauplätze, man denke zum Beispiel an das Anatomische Institut oder das Wohlfahrtsamt inGlaube Liebe Hoffnung,im besonderen aber seiner Figuren wie Alfred, Zauberkönig, Oskar in denGeschichten aus dem Wienerwaldoder aber dem Präparator, dem Schupo Alfons Klostermeyer inGlaube Liebe Hoffnung,ist in allen fünf ausgesuchten Werken mehr oder weniger ausgeprägt vorhanden und eignet sich deshalb gut, um die sozialen Aspekte bei Horváth herauszustellen.
Sehr wichtige Gesichtspunkte, die hier weiterhin anzusprechen und die allesamt auch Themenbereiche innerhalb jener Werke sind, beziehen sich auf die problematische Stellung der Frau, auf verschiedenste Gewalttaten, vor allem durch die männlichen Personen der Stücke verübt, auf den gesellschaftlichen Auf -und Abstieg und, zu guter letzt, auf die aufgebürdeten Zwänge der gesellschaftlichen Moral- und Wertvorstellungen. Diese und weitere Charakteristika jener sozialen Schicht des Mittelstandes, respektive des Kleinbürgertums, die Horváth als Milieu, in der sich seine Figuren bewegen, auswählt, sollen als Hauptbestandteil der Arbeit diskutiert und mit diversen Zitaten aus den hier vorliegenden fünf Titeln untermauert werden.
6Vgl.: Aussage von Handke, Peter . In: Hildebrandt, Dieter:Ödön von Horváth.S. 131.
Page 8
2. Der zeitgeschichtliche Hintergrund nach dem ersten Weltkrieg als wichtiger
Bezugspunkt in Horváths Werk
Wenn man die Lebzeiten des Dramatikers Horváth betrachtet, 1901-1938, so weiß man, welche enormen kriegerischen, verbrecherischen und ökonomisch sehr problematischen Zeiten dieser Mann erleben musste. In einer autobiographischen Notiz, entstanden gegen Ende der zwanziger Jahre, reflektiert der Autor seine Situation, denn obwohl er in behüteten familiären Verhältnissen aufgewachsen ist, gingen auch an ihm die politischen Ereignisse nicht spurlos vorüber:
Mein Leben beginnt mit einer Kriegserklärung.(...) Als der sogenannte Weltkrieg ausbrach, war ich dreizehn Jahre alt. An die Zeit vor 1914 erinnere ich mich nur wie an ein langweiliges Bilderbuch. Alle meine Kindheitserlebnisse habe ich im Krieg vergessen.7
Wenn man heute Horváths Stücke liest und darüber Reflexionen anstellt, ist es unabdingbar, die zeitgeschichtlichen Ereignisse, die die Menschen damals direkt betroffen hatten, zu berücksichtigen. Der erste Weltkrieg brachte in der Folge viele Missstände politischer und wirtschaftlicher Art mit sich. Es gab kaum jemandem, der durch den Krieg nicht Haus und Hof, oder seine Arbeit verloren hatte. Der große materielle Verlust war sicherlich schwerwiegend, viel schmerzlicher aber war es, die Nachricht der im Krieg gefallenen Freunde und Familienangehörigen zu erhalten. Auffallend ist aber, dass Horváth eben nicht das historische Ereignis des ersten Weltkrieges an sich oder dessen politischen Ausgang und Verlauf thematisiert, sondern seine verheerenden Folgeerscheinungen, wie sie besonders vom Kleinbürgertum erfahren werden mussten.
Nicht die großen historischen Ereignisse, sondern die Ungeheuerlichkeiten des täglichen Lebens im und mit dem Krieg prägen wohl letztlich auch das Bild, das sich ein junger Mensch wie Horváth von dieser Zeit gemacht hat.8
Es handelt sich demnach nicht um historisch exakte Schilderungen großer Geschehnisse. Das, was Horváth am Herzen liegt, und das, was er seinem Publikum aufzeigen möchte, sind die alltäglichen Ereignisse und Probleme, mit denen in erster Linie die Bürgerklasse der unteren und mittleren Schicht umgehen musste.
Welche zeitgeschichtlichen Hintergründe lassen sich nun beiDie Bergbahn, Glaube Liebe Hoffnung, Kasimir und Karoline, Rund um den KongressundGeschichten aus dem Wiener Walderkennen?
7Vgl.: Hildebrandt, Dieter:Ödön von Horváth.S. 14.
8Vgl.: Oellers, Piero:Das Welt -und Menschenbild im Werk Ödön von Horváths.S. 37.





























