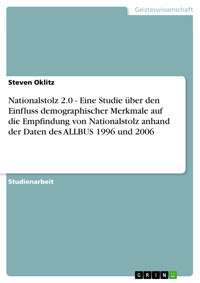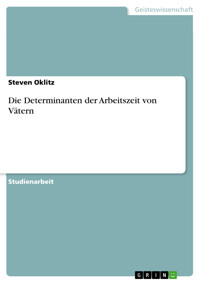Soziale Realität im Zeichentrick? Eine exemplarische Analyse in "Springfield" E-Book
Steven Oklitz
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Soziologie - Allgemeines und Theorierichtungen, Note: 2,0, Universität Rostock (Institut für Soziologie und Demographie), Veranstaltung: Symbolischer Interaktionismus, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Thema der Arbeit ist eine soziologische Analyse der Simpsons aus der Perspektive des Symbolischen Interaktionismus. Es wird geprüft, ob und wie es der Serie gelingt, eine der Realität ähnliche Welt abzubilden. Dafür werden einzelne Konzepte aus der Tradition des Symbolischen Interaktionismus auf ihre Übertragbarkeit auf die Fiktionalität mittels einzelner Sequenzen der Serie geprüft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Page 2
1. Einleitung
Das Massenkommunikationsmedium Fernsehen ist ein Hauptbestandteil unser heutigen Kultur. Wie wichtig das Fernsehen ist, kann darin erkannt werden, dass immer mehr Modelle mit immer größeren Bildflächen und noch besseren Auflösungen auf den Markt kommen und es mittlerweile sogar möglich ist, mit dem Mobiltelefon Fernsehen zu schauen. Der Mensch von heute möchte permanent Zugang zum TV und den Unterhaltungs- oder Informationsprogrammen haben. Als ein wesentlicher Eckpfeiler der Fernsehlandschaft hat sich das Format der Serie herauskristallisiert. Jeder Sender hat mittlerweile eine erfolgreiche Sendung im Programm, sei esGute Zeiten, schlechte ZeitenbeiRTL, Lindenstraßebei derARDoderJulia - Wege zum GlückbeimZDF.Alle Serien, egal ob national (Unteruns)oder international (Roseanne), egal ob romantisch (Verliebtin Berlin)oder abenteuerlich (Alarmfür Cobra 11)und unabhängig davon ob mit echten Darstellern (O.C.,California)oder mit gezeichneten Figuren (FamilieFeuerstein)- gemeinsam ist allen Serien, dass sie versuchen ein reales Abbild der Gesellschaft und des alltäglichen Lebens auf den Bildschirm zu bringen. Je nach Genre und Intention der Serie gelingt dies entweder mit einer humoristischen Note, oder mit einer besonders abenteuerlichen. Die Frage, warum solche Serien so erfolgreich sind, muss von Serie zu Serie neu gestellt und kann niemals einheitlich beantwortet werden. Jede neue Sendung hat es schwer sich gegen die etablierte Konkurrenz zu behaupten und muss eine Nische im mittlerweile sehr umfangreichen Seriengebiet finden. Eine solche Nische hat Matt Groening damals gefunden, als er vor knapp zwanzig JahrenDie Simpsonsauf die Mattscheibe brachte. Der außerordentliche Erfolg dieser Serie, gekrönt durch einen Kinofilm im Jahr 2008, ist nur ein Grund, warum diese Serie Thema der vorliegenden Arbeit ist. Wie alle anderen Serien auch, versuchtDie Simpsonseine relativ reale Welt darzustellen. Die Frage, die in dieser Arbeit behandelt werden soll, ist, ob und wie sie es schafft, diese Realität zu vermitteln. Anspruch einer Serie ist es nicht nur zu unterhalten, sondern auch abzubilden, denn Unterhaltung funktioniert nur, wenn die Macher einer Serie wissen, wie der Zuschauer unterhalten werden kann. Hierbei spielen Erwartungen und Interpretationen eine Rolle. Im Jahr 2008 sind die Simpsons verstärkt in den Blickpunkt der Wissenschaft gerückt, und sind nun Thema diverser Vorlesungen und wissenschaftlicher Publikationen. Philosophen beschäftigen sich mit dieser Familie, Medienwissenschaftler mit der Darstellung der Nachrichtenwelt und Feministinnen mit dem Rollenbild. Die Simpsons haben sich also als Forschungsgegenstand etabliert, weswegen sie auch Teil dieser Arbeit sind.
Page 3
Die Kombination aus der gelben Realität in Springfield und der grauen Realität in unser Welt ist der Mittelpunkt dieser Arbeit, in der untersucht werden soll, wie es die Macher um Matt Groening schaffen soziologische Tatsachen und Theorien aus unser Welt nach Springfield zu übertragen. Die Konzentration der Theorien liegt in dieser Arbeit auf dem Symbolischen Interaktionismus, weil es bisher wenig wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Theorie und Springfield gibt. So wie die Simpsons eine Nische im Unterhaltungssektor gefunden haben, soll diese Arbeit ebenfalls eine Lücke schließen. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden die theoretischen Grundlagen geklärt, um einen Überblick über die relevanten Theorien zu geben. Die Konzentration liegt hierbei auf den Soziologen George Herbert Mead, Herbert Blumer und Erving Goffman, sowie die Theorien der sozialen Rolle und der Devianz. Mead, Blumer und Goffman sind als wichtigste Personen des Symbolischen Interaktionismus unverzichtbar, und die Basis, um die Simpsons auf soziale Realität zu untersuchen. Soziale Realität soll in dieser Arbeit aus den Punkten Identität, Rollen und Interaktionen bestehen, da diese drei Konzepte Schlüssel für die Realitätsübertragung sind. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte der Simpsons, sowie einer Kurzdarstellung der wichtigsten Seriencharaktere, wird im Hauptteil der Arbeit versucht werden die Realitätsübertragung als Erfolgsbaustein zu beweisen. Im Laufe der Arbeit wird oftmals von unser grauen Realität geschrieben, damit ist die Wirklichkeit gemeint, die uns tatsächlich betrifft. Wenn von einer Gesellschaft die Rede ist, so wird in der Regel die westliche Gesellschaft gemeint, demzufolge die Industrienationen. Diese haben durch ihr System gleiche Verständnisvoraussetzungen und wesentliche Überschneidungen in der Kultur.
Der Aufbau dieser Arbeit soll den Leser über die theoretischen Grundlagen des Symbolischen Interaktionismus und die Grundlagen der SerieDie Simpsonszu dem Versuch hinführen, die graue Realität im gelben Springfield nachzuweisen und die Frage, ob es diese Realität wirklich gibt, und die Serie vielleicht deshalb so erfolgreich ist, zu beantworten. Dazu wurden im Hauptteil diverse Sequenzen und Folgen ausgewählt, die am besten geeignet sind, um das jeweilige Thema darzustellen und zu behandeln. Bei über 400 Folgen ist dies kein leichtes Unterfangen, aber zeigt, dass die Simpsons eine genauso vielfältige Realität haben, wie wir. Oder etwa doch nicht?
Page 4
2. Der Symbolische Interaktionismus - Die Chicago School und deren Denker
Der Symbolische Interaktionismus ist ein Theorieentwurf und Antwortversuch auf die Frage, warum soziale Interaktion funktioniert. Die Berücksichtigung des Individuums bei der Betrachtung gesellschaftlicher Phänomene war in der Soziologie Ende des 19. Jahrhunderts nicht üblich, weswegen sich Wissenschaftler wie Park, Mead, Blumer und Goffman um den Jahrhundertwechsel verstärkt damit befassten. In ihren Arbeiten und Untersuchungen rückten sie den Menschen und seine Alltagserfahrungen in den Mittelpunkt. Diese haben einen wesentlichen Einfluss auf die Handlungen des Individuums, da die Realität, die der Mensch konstruiert immer von der Situation abhängt, in der er sich befindet, oder wie Abels schreibt: „Für den Symbolischen Interaktionismus gibt es keine Welt an sich, sondern nur Welten, wie Menschen sie sich füreinander konstruieren.“ (Abels: 2002, 169). Aufgrund dieser Realitätskonstruktion erfolgt eine Handlung des Menschen, die William I. Thomas zu seinem Theorem geführt hat: „If men define situations as real, they are real in their consequences.“ (http://www.forschungsportal.ch/unizh/p9117.htm, 01.12.2008). Thomas war es auch, auf den Goffman sich mit seiner Rahmen-Analyse (1977) bezog, was später in dieser Arbeit noch ausführlicher behandelt wird. Nicht nur die situative Rahmen ist hierbei von Bedeutung, sondern auch die symbolische Handlung, die das Individuum in einem solchen Rahmen vollzieht. Diese Handlung ist eine symbolische Interaktion zu verstehen und setzt bestimmte Erwartungen an den Sender und den Empfänger der Kommunikation voraus. Weil der einzelne Mensch im Fokus des Symbolischen Interaktionismus steht, ist dieser Forschungsansatz der Mikrotheorie zuzuschreiben, die Betrachtung des Wissenschaftlers erfolgt also von unten auf das Objekt. Dennoch flossen makrosoziologischer Theorien und andere Wissenschaftsdisziplinen in den Symbolischen Interaktionismus ein. Ausschlaggebend für die Etablierung dieser jungen Richtung der Soziologie war die sogenannteChicago Schoolmit ihren Forschern Mead, Blumer und Goffman, welche in den folgenden Kapiteln gesondert vorgestellt und behandelt werden.
Page 5
2.1 Die Chicago School als Ausgangspunkt des Symbolischen InteraktionismusDer Begriff derChicago Schoolbezeichnet eine soziologische Forschungsströmung
bezeichnet wird, welche an der Universität Chicago ihren Ursprung fand. Im Jahr 1892 wurde dort der erste ordentlich soziologische Lehrstuhl eingerichtet (Friedrichs: 1981, 29). Die Stadt erwies sich als ideal für die Erschaffung eines solchen Stuhls, da die Zeit der Jahrhundertwende in Amerika, gerade in Chicago, viele Veränderungen, wie beispielsweise die Masseneinwanderung, mit sich brachte. Durch neue Methoden wie die teilnehmende Beobachtung, wollten die Soziologen vor Ort unter anderem die Zunahme des abweichenden Verhaltens analysieren. Prägend für diese neuen Einflüsse in der Forschung war der Begründer dieser Strömung, Robert Ezra Park (1864 - 1944). Parks Ansatz war die Fokussierung auf das Individuum. Dies steht hierbei in einem Konflikt mit der Gesellschaft, wenn es um die Bedürfnisse geht. Die Kontrolle seiner eigenen Bedürfnisse verbindet drei Formen der Interaktion - den Konflikt, die Anpassung und die individuelle Angleichung. Das Produkt dieser drei Interaktionen führt zu einer moralischen und politischen Ordnung, da sich Individuum und Gesellschaft über die jeweiligen Bedürfnisse, direkt oder indirekt, austauschen.
Neben Park war George Herbert Mead (1863 - 1931 ) ein wichtiges Mitglied derChicago School.Er gilt als Begründer des Symbolischen Interaktionismus und konzentrierte sich bei seinen Forschungen besonders auf die Alltagsphänomene. Im Zentrum seiner Untersuchung stand das Individuum, welches in dreifacher Hinsicht am Interaktionsprozess beteiligt ist (Korte, 2004: 102). Auf der einen Seite durch dasI,die Individualität, auf der anderen Seite durch dasme,die gesellschaftlichen Vorerfahrungen bzw. die Vergesellschaftung, und durch dasself,die Persönlichkeit mit den individuell und gesellschaftlich gesammelten Eindrücken. Durch Interaktionen mit anderen Menschen soll das Individuum die Bedeutung von Verhaltensmustern und Ereignissen erlernen (Joas, 2003: 33). Die dafür notwendigen Zwischenhandlungen mit den Menschen erfolgt mittels Symbolen. Die Kommunikation mit „Worten, Gesten, Mimik, Tönen und Handlungen, deren Bedeutung weithin verstanden wird“ (Joas, 2003: 33) macht unser Innenleben für den Gesprächspartner ersichtlich und verständlich.
Page 6
Ein weiterer wichtiger Vertreter derChicago Schoolund zugleich ein Schüler Meads, war Herbert Blumer (1900 - 1987). Blumer, ein ehemaliger Football - Spieler und Namensgeber des Symbolischen Interaktionismus, übernahm nach Meads Krankheit dessen Posten und führte die Forschung in seinem Sinne weiter (Joas, 2003: 98). Seine Beschäftigung mit dieser Theorie der Soziologie fasste er in drei Prämissen zusammen, welche im nächsten Abschnitt ausführlicher behandelt werden. Blumer versuchte damit die Soziologie als eigenständiges Paradigma voranzutreiben. Die Bedeutung einer Sache wird, laut Blumer, durch die soziale Interaktion produziert (Blumer, 1969: 81). Alles was der Mensch wahrnehmen kann, Gegenstände, Menschen, Institutionen, Leitideale, etc., unterliegt einem ständigen Wandel und bekommt seine Wichtigkeit durch die soziale Interaktion. Es wird zwischen einer horizontalen und einer vertikalen Bedeutung unterschieden. Die horizontale Bedeutung ist die zwischen zwei Personen zu einem gleichen Zeitpunkt, während die vertikale Bedeutung die Entwicklung beschreibt. Blumer war der Meinung, dass zwischen Objekt und Handlung immer die Bedeutung steht und der Mensch nach dieser handelt.
Als letzter wichtiger Vertreter der Chicagoer School soll an dieser Stelle Erving Goffman (1922 - 1982) genannt werden. Goffman war ein Schüler Blumers, allerdings von diesem nicht sonderlich beeinflusst. Seinen wissenschaftlichen Durchbruch erlangte der passionierte Sammler von Zeitungsartikeln durch die Publikation seiner Erfahrungen auf den Shetland-Inseln in dem BuchWir alle spielen Theater(1959). Der meistgelesene Soziologe der Welt, suchte nach Regelmäßigkeiten in der sozialen Interaktion. Ein prägender Begriff in seinem Schaffen wurde dasStigma.1963 schrieb er darüber ein Buch und beschäftigte sich mit der Situation eines Menschen, in welcher er von der Gesellschaft sozial nicht akzeptiert wird. Nicht nur das Stigma eines Menschen, sondern auch die Vergleichbarkeit der Interaktion in der alltäglichen Welt stand in seinem Forschungsinteresse. Hierbei stellte er diverse Gemeinsamkeiten zwischen den Verhaltensweisen von professionellen Schauspielern auf einer Bühne, und dem normal interagierendem Individuum im Alltag fest.
Page 7
2.2 Meads Überlegungen zum Symbolischen Interaktionismus
Meads Überlegungen können im Grunde durch fünf Begriffe zusammengefasst werden:, „(1) the self, (2) the act, (3) social interaction, (4) objects, and (5) joint action.“(Blumer, 1969: 10). Bezüglich desselfsah Mead den Menschen als ein Wesen „having a self“ (Blumer, 1969: 10). Dieses Selbst macht den Menschen in seinen Handlungen einzigartig. Es beschreibt die Fähigkeit des Menschen, sich als Objekt zu sehen, was dazu führt, dass er die Anforderungen an sich selbst immer wieder überprüfen, korrigieren und anpassen kann. Der Akt an sich, ist ein Zusammenspiel von Interpretation und Verhaltenserwartungen, sowohl eigenen, als auch die des Gegenübers. Um handeln zu können, muss der Mensch wissen, was er möchte, welche Intentionen er verfolgt und eine Verhaltenslinie entwickeln, um zu einem Ziel zu gelangen. Die Handlungen der Anderen muss er bewusst wahrnehmen, interpretieren und analysieren und sein Verhalten anpassen. Die Unmöglichkeit alle Handlungen richtig zu interpretieren führt dazu, dass die Entwicklung einer jeden Situation schwer vorhersagbar ist, besonders wenn Menschen unterschiedlicher sozialen Schichten oder Kulturkreise aufeinandertreffen. Der soziale Akt eines Menschen wird also von psychologischen Stimuli beeinflusst.