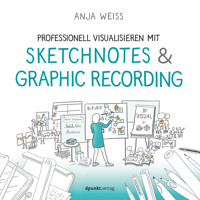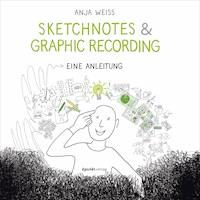17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die Soziologie glaubt immer noch an eine Welt starker nationaler Wohlfahrtsstaaten, die für ihre Bürger sorgen. Viele Menschen leben jedoch in Gebieten schwacher Staatlichkeit oder in Staaten, die sie bedrohen. Andere wandern zwischen Staaten oder arbeiten für transnationale Unternehmen. Anja Weiß plädiert in ihrem Buch für einen soziologischen Blick auf globale Ungleichheiten, der diese Kontexte jenseits des Staates endlich ernst nimmt. Dazu unterscheidet sie Räume, die territorial gebunden sind, von sozial differenzierten Feldern und politisch umkämpften Zugehörigkeiten. Lebenschancen, so eine ihrer Thesen, entstehen zwischen Personen und Kontexten – entsprechend heftig wird um den Zugang zu letzteren gekämpft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
2Die Soziologie glaubt immer noch an eine Welt starker nationaler Wohlfahrtsstaaten, die für ihre Bürger sorgen. Viele Menschen leben jedoch in Gebieten schwacher Staatlichkeit oder in Staaten, die sie bedrohen. Andere wandern zwischen Staaten oder arbeiten für transnationale Unternehmen. Anja Weiß plädiert in ihrem Buch für einen soziologischen Blick auf Globale Ungleichheiten, der diese Kontexte jenseits des Staates endlich ernst nimmt. Dazu unterscheidet sie Räume, die territorial gebunden sind, von sozial differenzierten Feldern und politisch umkämpften Zugehörigkeiten. Lebenschancen, so eine ihrer Thesen, entstehen zwischen Personen und Kontexten – entsprechend heftig wird um den Zugang zu Letzteren gekämpft.
Anja Weiß ist Professorin für Makrosoziologie und Transnationale Prozesse an der Universität Duisburg-Essen.
3Anja Weiß
Soziologie Globaler Ungleichheiten
Suhrkamp
4Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2220
© Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
eISBN 978-3-518-75164-0
www.suhrkamp.de
5Inhalt
1. Einleitung
Das Problem
2. Soziale Ungleichheit
2.1 Erklärungen für soziale Ungleichheiten
2.2 Beschreibung mehrdimensionaler Ungerechtigkeiten
2.3 (Wie) Bilden sich strukturierte Soziale Lagen?
2.4 Sozialstrukturanalyse und Gesellschaftstheorie
3. Ungleichheit und Globalisierung
3.1 Ungleichheitsforschung im Ländervergleich
3.2 Mehrebenenanalyse
Exkurs: Hält die Mehrebenenanalyse methodisch, was sie theoretisch verspricht?
3.3 Befunde der Globalisierungsforschung
3.3.1 Migration
3.3.2 Transnationale Eliten?
3.3.3 Staatsbürger im Nationalen Wohlfahrtsstaat
3.3.4 Im Globalen Süden
3.4 Gerechtigkeit in Zeiten der Globalisierung
3.5 Perspektiven für die Ungleichheitssoziologie
Die These
4. Ungleichheit ist relativ
4.1 Sozial-räumliche Autonomie
4.2 Struktur Sozialer Lagen in der Welt
4.3 Sozialstrukturanalyse der Welt?
Die drei Kontextrelationen
5. Territorial gebundene Kontexte
5.1 Inhaltliche Überdehnung territorialer Kontexte
5.2 Kleinräumige Regionalisierungen?
Methodologischer Exkurs
5.3 Transnationale soziale Räume
5.4 (Virtuelle) Soziale Aktionsräume
5.5 Territorial gebundene oder sozial differenzierte Kontexte?
6. Sozial differenzierte Kontexte
6.1 Die Leistungen der Funktionssysteme und das Primat funktionaler Differenzierung
6.2 Organisation: Karriere, Überflüssigkeit und Semantik
6.3 Netzwerke
6.4 Regionsbildung
6.5 Interaktionssysteme und Action Settings
6.6 Die territoriale Segmentierung des Funktionssystems Politik
6.7 Der Exklusionsbereich
6.8 Soziale Ungleichheit in sozial differenzierten Kontexten
7. Politische Kämpfe um Anschlusschancen
7.1 Spielarten von Nicht-Anerkennung
7.1.1 Diskriminierung
7.1.2 Soziale Schließung
7.1.3 (Symbolische) Herrschaft
7.1.4 Die Verweigerung von Anschlusschancen
7.2 Staat und Staatsbürgerschaft
7.3 Im Weltmaßstab: Ungleichheitsrelationen zwischen Zentrum und Semiperipherien
7.3.1 Der Staat bei Wallerstein
7.3.2 Interregionale Verflechtungen und die Ausbeutung der Subsistenzarbeit
7.3.3 Transnationale Perspektiven in der neueren Weltsystemtheorie
7.4 Sozial differenzierte Felder
7.4.1 Felder und Systeme
7.4.2 Feldtheorie in Zeiten der Globalisierung
7.4.3 Gesellschaftstheoretisches Zwischenfazit
7.5 Homologe Erfahrungen oder: Wie wird »Kultur« ungleichheitsrelevant?
7.5.1 Wissenssoziologische Milieuforschung
7.5.2 Mehrdimensionalität von Lagerungen und grenzüberschreitende Homologien
7.5.3 Milieus und Organisationen
7.6 Der Nationalstaat als Institutionalisierung von Kämpfen über Anschlusschancen
8. Die drei Kontextrelationen in der empirischen Forschung
8.1 Sozial differenzierte und politisch umkämpfte Kontextrelationen
8.2 Die Unmöglichkeit, gut ausgestattete Territorien zu erreichen
8.3 Sozial-räumliche Autonomie in der empirischen Forschung
8.3.1 Wie verbinden sich Ungleichheiten in der Ressourcenausstattung und sozial-räumliche Autonomie in spezifischen Sozialen Lagen?
8.3.2 Taxonomien sozial-räumlicher Autonomie
9. Ungleichheit in und zwischen den Welten
Danksagung
Literatur
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Namenregister
Sachregister
91. Einleitung
Denn die einen sind im Dunkeln
Und die andern sind im Licht.
Und man siehet die im Lichte.
Die im Dunkeln sieht man nicht.
Bertolt Brecht
Barack Obama schrieb früh in seinem Leben eine Autobiographie. Er schildert, wie er sich als junger Mensch in einer Welt orientiert, in der jemand wie er nicht vorgesehen ist: Er ist ein Schwarzer aus einer Familie weißer amerikanischer Kleinbürger. Als Kind lebt er in Indonesien, aber nicht in einer amerikanischen Enklave, sondern in einer Wohngegend für die einheimischen Mittelschichten, zu denen seine Familie zählt. Dort wird er mit extremer Armut konfrontiert. Offensichtlich hat er diese Erlebnisse mit seinem indonesischen Stiefvater besprochen, und offensichtlich war seine Mutter eine großherzige Frau. Denn als er dem Beispiel seiner Mutter folgt und den Bettlern Almosen gibt, erinnert ihn sein Vater an das Missverhältnis zwischen der Zahl der Bettler und seinem Taschengeld: »Du solltest dein Geld lieber sparen und zusehen, dass du nicht selbst irgendwann auf der Straße hockst.« Außerdem macht er dem jungen Barack deutlich, dass es zwar schön ist, wenn Frauen ein weiches Herz haben. »Aber du wirst mal ein Mann sein, und ein Mann muss mehr Verstand haben.«[1]
In dieser Episode bildet sich ab, wie die Reichen der Welt mit globaler Ungleichheit umgehen: Die »Weichherzigen« unter uns geben Almosen – ein Weg, der irrational erscheint und das Problem nicht wirklich lösen kann. Zugleich schotten wir uns ab und tragen dabei Sorge, dass wir selbst niemals arm werden. Diese Strategie ist in einem System von Nationalstaaten institutionalisiert, deren Status mit darüber entscheidet, ob sie über die Mittel verfügen, um die Armen innerhalb ihrer Grenzen vor Verelendung zu schützen oder nicht.
Während andere Episoden der Autobiographie mit Auflösungen enden, die die Position Obamas zumindest erahnen lassen, bleibt 10diese Episode eigenartig unabgeschlossen. Die Antwort des indonesischen Vaters funktioniert, und sie findet heute mehr Anhänger denn je, aber sie befriedigt nicht. Etwas später in der Erzählung entschließt sich die Mutter, ihren Sohn um jeden Preis in den USA und nicht in Indonesien zu platzieren. Sie lernt täglich vor der indonesischen Grundschule mehrere Stunden mit ihm und schickt ihn baldmöglichst aufs Internat nach Hawaii. Diese Entscheidung hat sich als weltgeschichtlich bedeutsam erwiesen, aber auch die (Re-)Migration weniger bietet keine Antwort auf das Problem globaler Ungleichheiten. Im Angesicht existenzieller Armut erscheinen Almosen, Abschottung und Migration unzureichend. Und uns fällt nichts Besseres ein.
Dennoch ist die Episode an einem Punkt anregend für die Sozialwissenschaft. Es ist bemerkenswert, dass sie überhaupt existiert. Jemand, der später amerikanischer Präsident wurde, war unmittelbar mit absolutem Elend konfrontiert, und er schrieb darüber. Im Mittelalter hatten wenige Adelige und Bürger ein gutes Leben, während der größere Teil der Bevölkerung direkt neben ihnen am Existenzminimum lebte und zugleich von Adel und Kirche besteuert wurde (Borgolte 1996, S.254f.). Dass Menschen ungleich geboren sind, war in mittelalterlichen Feudalgesellschaften weithin akzeptiert, anders als heute,[2] weil alle glaubten, ihr Stand sei ihnen von Gott zugedacht, und weil die vorhandenen Ressourcen ohnehin zu knapp waren, um Wohlstand für alle in den Bereich des Möglichen zu rücken.
Heute ist es unwahrscheinlich geworden, dass die Mächtigen der Welt absoluter Armut begegnen, denn die geographische Distanz zwischen den Reichsten und den Elenden der Welt ist fast überall groß, und sie ist im System der Nationalstaaten politisch effektiv institutionalisiert. Dennoch werden weltweite Ungleichheiten in Zeiten der Globalisierung instabil. Dank globaler Medien und politischer Vernetzung können die Reichen und die Entscheidungsträger wissen, dass die Ressourcen der Welt genügen würden, um allen Menschen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen (Pogge 2010, S.62). Die Idee globaler Menschenrechte setzt sich langsam durch (Beck, Drori und Meyer 2012). Nationale Abschot11tung bleibt zwar stark, und aktuell gewinnt sie sogar an Gewicht, aber sie kann Ungleichheit nicht mehr in dem Maß legitimieren wie die Religion im Mittelalter. Ein Indiz dafür ist die Widersprüchlichkeit nördlicher Grenzpolitik. Niemand will, dass Kinder im Mittelmeer ertrinken. Zugleich werden diejenigen, die die Kinder aus dem Wasser ziehen, als kriminelle Schlepper behandelt. Im Norden entsteht langsam ein Gefühl für die Gleichheit aller Menschen, ohne dass Institutionen geschaffen würden, die diese Gleichheit garantieren könnten. Für die Milliarden, die außerhalb der OECD-Welt leben, führt das Wissen um den Reichtum, den es in der Welt gibt, schon seit längerem dazu, dass ihr Leben arm erscheint, selbst wenn es ihnen »vor Ort« relativ gutgehen sollte. Und es gibt keinen Grund, keine Legitimität für die Spaltungen der Welt.[3]
Die Soziologie ist womöglich noch ratloser als die Politik. Denn mit wenigen Ausnahmen hat sich die soziologische Ungleichheitsforschung genauso abgeschottet wie Obamas indonesischer Vater. Sie untersucht die Bevölkerung der OECD-Länder, für die sich mit immer besseren Theorien und Methoden immer wieder zeigen lässt, dass Ungleichheiten von Einkommen, Beruf und Bildung innerhalb dieser Länder fortbestehen. Diese Engführung auf »Klasse« wird von theoretischen Arbeiten kritisiert, die Ungleichheiten als Ausdruck symbolischer Kämpfe über Kategorien wie Geschlecht, Ethnizität und – unter anderem – Klasse denken (Klinger und Knapp 2008; Winker und Degele 2009; Yuval-Davis 2011; Knapp 2013; Amelina 2016; Anthias 2016). In etlichen dieser theoretischen Arbeiten gerät allerdings aus dem Blick, dass Ungleichheiten nicht nur identitätspolitisch umkämpft sind, sondern auch durch Institutionen wie Arbeitsmarkt und Bildungssystem hervorgebracht werden (Beck 2009).
Wie auch immer man sich in solchen Debatten positioniert: Die Grenzen des Nationalstaats werden von ihnen nur ganz am Rande thematisiert.[4] Während die Politikwissenschaft schon früh beobachtete, dass in ganz Europa rechtspopulistische Bewegungen entstehen (Kriesi et al. 2008), so dass der alte Konflikt zwischen Ar12beit und Kapital um einen Konflikt zwischen Globalisierungsprofiteuren und Nationalisten ergänzt wurde, ist die Soziologie davon abgekommen, politische Einstellungen vor dem Hintergrund von Klasseninteressen zu deuten. Aber ist das Bedürfnis, sich in einem Nationalstaat abzuschotten, nicht auch Ausdruck einer Art von »Klassen«-Interesse? Solange die Staatsbürgerschaft stärker als Einkommen und Beruf über Lebenschancen entscheidet (Milanovic 2016) und solange sie über eine Art Lotterie der Geburt vergeben wird (Shachar 2009), werden sich Menschen dafür einsetzen, dass »ihr« Staat der »beste« ist. Sind also Ungleichheiten, die nicht durch die Ökonomie, sondern durch das Staatensystem hervorgebracht werden, die nicht auf Leistung, sondern auf dem Zufall der Geburt beruhen, vielleicht doch wichtig für die Sozialstrukturanalyse?
Die Soziologie sozialer Ungleichheit hat die Anliegen der Privilegierten, die in den reichen Staaten des Zentrums leben, zur Perspektive der Soziologie insgesamt verallgemeinert. In Zeiten der Globalisierung[5] ist aber nicht länger nachzuvollziehen, warum man nach Klassenunterschieden und symbolischen Kämpfen unter den privilegierten Bewohnern reicher Länder suchen sollte und zugleich die zentralen strukturellen Antagonismen dieser Zeit aus der Ungleichheitsforschung ausgegliedert oder als regionale und kulturelle Heterogenität euphemisiert werden.
Dass die Soziologie an dieser Stelle versagt, hat historische Gründe. Das Fach hat sich während der Blütezeit der europäischen Nationalstaaten als Disziplin ausdifferenziert. Es lag von daher nahe, den Begriff der Gesellschaft empirisch mit der Institution des Nationalstaats gleichzusetzen. Da die institutionelle Logik des Nationalstaats eindeutig über die Zugehörigkeit von Personen zur nationalen Bevölkerung entscheiden muss, geht auch die soziologische Ungleichheitsforschung davon aus, dass Menschen im 13Regelfall einem Nationalstaat zuzurechnen sind, der ihnen in sich homogene Lebensbedingungen bietet.
Es ist diese Perspektive auf Sozialität, die heute als methodologischer Nationalismus kritisiert wird (Beck 1997; Wimmer und Glick Schiller 2002; Chernilo 2011) und die auch neuere Versuche, Ungleichheiten global zu denken, prägt (Korzeniewicz und Moran 2009; Walby 2009; Therborn 2013; Rehbein und Souza 2014). Diese Perspektive unterstellt, dass alle Nationalstaaten ihre Grenzen weitgehend kontrollieren. Menschen, die in mehreren Staaten leben, Staaten, die in supranationale Einheiten wie die Europäische Union eingebettet sind oder die grenzüberschreitende Bewegungen von Menschen, Gütern und Ideen nicht kontrollieren können, werden vor diesem Hintergrund zur vernachlässigbaren Ausnahme erklärt. Die Kritik am methodologischen Nationalismus behauptet, dass die »Ausnahmen« interessante Gesichtspunkte enthalten, die auch die unterstellte »Normalität« informieren könnten.
Für die soziologische Ungleichheitsforschung ist eine Überwindung des methodologischen Nationalismus mehr als ein – hoffentlich fruchtbares – Gedankenexperiment. Sie geht einerseits davon aus, dass Ungleichheit ein zentrales Strukturprinzip von Gesellschaft ist, will aber andererseits möglichst wertfrei und »empirisch« sein und vermeidet von daher die philosophische Frage, welche Menschen in welcher Weise Anspruch auf Gleichstellung haben. Dieser Grundwiderspruch der Ungleichheitssoziologie wird bisher durch das pragmatische Argument umschifft, dass für die Bürger von Nationalstaaten ein gewisses Maß an Gleichheit nicht nur gewünscht, sondern erforderlich sei (Marshall 1950). Dadurch können normative Fragen ausgeblendet und Gleichheit innerhalb des Nationalstaats zur nicht hintergehbaren Notwendigkeit erklärt werden. Eine solche Selbstbeschränkung ist aber nicht wirklich wertneutral, sondern sie lässt weltweite Ungleichheiten als Nebensache erscheinen (Beck 2002, 2004, 2009). In Zeiten der Globalisierung bricht diese Selbstverständlichkeit auf, und der Soziologie fehlt es an Begriffen und Daten, die der Welt, in der wir leben, angemessen wären.
Dieses Buch tut einen ersten Schritt und entwickelt ein Modell für die Beschreibung und empirische Analyse globaler Ungleichheiten. Das Modell berücksichtigt den Nationalstaat, aber ohne die Fiktion zu übernehmen, die Welt sei empirisch in klar gegliederte 14Kästchen unterteilt. Ausgangspunkt sind die im zweiten Kapitel dargestellten neueren Ungleichheitstheorien (Bourdieu 1982; Sen 1985; Hradil 1987), die neben Geld und Bildung weitere Dimensionen sozialer Ungleichheit berücksichtigen.
Das dritte Kapitel stellt empirische Befunde aus der international vergleichenden Ungleichheitsforschung dar und zeigt, wie diese durch die empirische Globalisierungsforschung und die philosophische Diskussion zu transnationaler Gerechtigkeit herausgefordert werden. Die Veränderungen, die Interesse an globalen Ungleichheiten wecken, werden bewusst vage als »Zeiten der Globalisierung« benannt, denn das im vierten Kapitel dargestellte Argument dieses Buches steht auf eigenen Beinen, auch wenn es von empirischen Entwicklungen angeregt ist: Der Wert der Ressourcen, die über die Lebenschancen von Menschen entscheiden, ist nie eindeutig, sondern er entsteht im Wechselspiel zwischen Ressourcen und den Kontexten, in denen sie produziert und eingesetzt werden. Ob eine Eigenschaft (property) zu einer ungleichheitsrelevanten Ressource wird, entscheidet sich im Kontext.
Der Nationalstaat bleibt als Spezialfall wichtig, in dem mehrere Kontexte zur Deckung kommen. Grundsätzlich muss die Theorie sozialer Ungleichheit aber Kontexte im Plural denken. Zum Beispiel arbeitet eine weißrussische Pflegekraft im Vergleich zu deutschen Pflegekräften für einen sogenannten Hungerlohn im informellen Sektor Deutschlands. Solange der Euro in Weißrussland mehr wert ist als in Deutschland und sie einen Teil ihres Einkommens dort ausgibt, ermöglicht ihr der »Hungerlohn« aber Lebenschancen, die besser sein können als die der deutschen Kolleginnen, die ihr Einkommen allein in Deutschland ausgeben. Im besten Fall kann die weißrussische Pflegekraft trotz teilweiser Illegalität ein Haus im Herkunftsland bauen und eine gehobene Bildung für ihre Kinder finanzieren. Der Wert von Ressourcen wird also zweideutig, wenn man sie auf mehr als einen Kontext bezieht. Damit sind die, die sich strategisch zwischen mehreren Kontexten bewegen können, im Vorteil.
Wenn man den Wert von Ressourcen auf die Kontexte bezieht, in denen sie erworben und eingesetzt werden, stellt sich als Nächstes die Frage, was ein Kontext ist.[6] Für manche sesshaften Bevöl15kerungsgruppen mag es angehen, »ihren« nationalen Wohlfahrtsstaat als einzigen und ausschlaggebenden Kontext vorauszusetzen. Schon wenn man so denkt, fällt aber ins Auge, dass Staaten in sich beträchtliche regionale Unterschiede aufweisen. Das zeigt sich z.B., wenn man andere »Container« für die empirische Forschung nutzt. Heidenreich hat für Mittel- und Osteuropa NUTS2-Regionen, die in etwa dem deutschen Regierungsbezirk ähneln, und die noch kleinteiligeren NUTS3-Regionen verglichen (vgl. Heidenreich 2003, S.18, 20). Er konnte zeigen, dass etliche Hauptstadtregionen Mittel- und Osteuropas von der Reintegration in die kapitalistische Weltwirtschaft profitierten, während ihr Umland peripher geblieben ist (Mau und Verwiebe 2009, S.266f.). Die beträchtlichen Unterschiede innerhalb von Staaten werden von der Soziologie als weniger wichtig denn nationalstaatliche Grenzen angesehen. Dieses Argument überzeugt aber nur für starke und relativ finanzkräftige Staaten, die regional ungleiche Lebensverhältnisse zumindest ein Stück weit angleichen können.
Blickt man in die Semiperipherie, so wird die Frage, was der eine entscheidende Kontext zur Bewertung von Ressourcen sein soll, akuter. Ist es wirklich sinnvoll, Durchschnittswerte für die Bevölkerung Südafrikas zu errechnen, wenn die Lebensbedingungen von Schwarzen und Weißen so stark auseinanderklaffen, dass das Bild von »erster« und »dritter Welt« sehr viel treffender ist als das eines in sich homogenen Nationalstaats? Immerhin ist Südafrika aber ein starker, klar umgrenzter Staat, der wohlfahrtsstaatliche Transfers organisiert – was man vom Sudan und Afghanistan eher nicht behaupten kann. Wie soll man staatsfreie Räume, wie soll man marginalisierte ländliche Regionen wie den Osten der Türkei zu einem nationalstaatlichen Kontext erklären, wenn sie von »ihrem« starken Nationalstaat nur noch als Kontrollproblem wahrgenommen werden? Für die soziale Lage einer Kurdin in der Osttürkei ist das transnationale Netzwerk, das ihre Familie mit Westeuropa verbindet, ebenso wichtig wie die Ressourcen, die der türkische Staat zur Verfügung stellt. Ähnliches gilt für benachteiligte »ethnische« Gruppen wie die Schwarzen in den USA. Deren Lebenserwartung lag vor der Einführung der Krankenversicherungspflicht deutlich hinter der von Menschen mit sehr viel geringerem Einkommen im indischen Bundesstaat Kerala (Sen 1999a, S.96ff.).
Die Welt ist ein Flickenteppich von Kontexten, die national16staatlich organisiert sein können, aber nicht müssen. Und auch wo starke Nationalstaaten existieren, ist nicht garantiert, dass alle Bewohner die gleichen Chancen haben, ihre Ressourcen einzusetzen. Das Problem ungleicher Zugangschancen betrifft nicht nur den schwarzen Südafrikaner während der Apartheid oder die afghanische Frau unter den Taliban, für die der Bildungstitel des Arztes oder der Ärztin kaum etwas wert war – davon abgesehen, dass sie ihn nur im Ausland erwerben konnten. Auch in Bereichen, die scheinbar meritokratisch geregelt sind, stiftet das Nationalstaatsprinzip rechtliche Ungleichheiten, die häufig unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bleiben. In Deutschland konnte die Software der Bundesagentur für Arbeit auch 50 Jahre nach Beginn der Gastarbeiterzuwanderung ausländische Berufsabschlüsse nicht verarbeiten – auch dann nicht, wenn es sich um Abschlüsse von Deutschen handelte, die im Ausland studiert hatten.[7] Dadurch wurden eine chilenische Ingenieurin, ein kenianischer Pharmakologe oder eine israelische Buchhändlerin von der Bundesagentur als Menschen ohne berufliche Bildung behandelt (Englmann und Müller 2007; Brussig 2010, S.117ff.). Das spiegelt sich im IAB-Datensatz wider, der die Daten der Bundesagentur für die sozialwissenschaftliche Forschung aufbereitet und eine der wichtigsten Grundlagen zur Erforschung des deutschen Arbeitsmarktes darstellt. Man kann mit Hilfe solcher Daten trefflich darüber diskutieren, was die Erkenntnis wert ist, dass über 40 Prozent der Ausländer und über 20 Prozent der Deutschen, die nach einer Migration in Deutschland leben, keinen berufsqualifizierenden Bildungsabschluss haben (vgl. Statistisches Bundesamt 2015, Abbildung 12).[8] Auch solche Beispiele zeigen, dass der Wert von Ressourcen mit den Kontexten, in denen sie zum Einsatz kommen sollen, steht und fällt.
Wie kann man Kontexte jenseits des Nationalstaats denken, wie das Verhältnis, das Personen und ihre Ressourcen zu Kontexten 17haben, und wie wird beides ungleichheitsrelevant? Das sind die Fragen, die dieses Buch beantwortet. Das vierte Kapitel zeigt, dass eine Theorie sozialer Ungleichheit, die einen Flickenteppich von Kontexten berücksichtigt, zwar differenzierter wird. Die Berücksichtigung vielfältiger Kontextrelationen mündet aber nicht in eine Auflösung des Ungleichheitsbegriffs – was angesichts empirisch bestehender extremer Ungleichheiten ohnehin recht »welt«-fremd wäre. Wenn man Lebenschancen von der Person her denkt und beschreibt, lässt sich die Vielfalt der Kontextbezüge unter wenigen Gesichtspunkten zusammenfassen: Jenseits der Quantität und Qualität der eigenen Ressourcenausstattung sind Soziale Lagen[9] auch danach zu beurteilen, ob der Zugang zu vorteilhaften Kontexten gewährleistet ist und ob und wo die als Ressourcen wahrnehmbaren Teilaspekte von Personen Anerkennung finden. Sozial-räumliche Autonomie strukturiert Ungleichheit in der Welt, und wir können Soziale Lagen nur verstehen, wenn wir dem Rechnung tragen.
In den dann folgenden Kapiteln wird systematischer untersucht, wie ungleichheitsrelevante Kontexte und das Verhältnis von Personen zu diesen Kontexten gedacht werden sollten. In diesen Kapiteln steht je eine Theorietradition im Vordergrund, die ungleichheitsrelevante Relationen zwischen Personen und Kontexten als territorial gebundene, als sozial differenzierte oder als politisch umkämpfte Relationen denkt. Durch den Vergleich dieser drei Theorietraditionen werden die Vorteile, aber auch die Verkürzungen der jeweiligen Perspektive erkennbar: So gilt das Interesse der ländervergleichenden Forschung, der Regionalsoziologie, aber auch der Transnationalisierungsforschung der Bedeutung territorialer Kontexte für Personen und ihre Lebenschancen. Dadurch neigen sie dazu, die soziale Bedeutung des Territoriums zu übertreiben (Kapitel 5). Im Gegensatz dazu spielt die Luhmannsche Systemtheorie die Bedeutung des Territoriums herunter und geht von in erster Linie sozial differenzierten Verhältnissen zwischen Teilaspekten von Personen und Teilsystemen aus, die als ortlose Kommunikation in der Weltgesellschaft operieren (Kapitel 6). In dieser Theorietradition wird Ungleichheit zu einem nachrangigen Strukturprinzip, das 18vor allem in Organisations- und Interaktionssystemen stabilisiert wird. Als einziges Funktionssystem ist die Politik auch in systemtheoretischer Lesart territorial segmentiert, was Interesse an der Ungleichheitsrelevanz politischer Grenzen weckt. Allerdings gehen politische Theorien sozialer Ungleichheit deutlich über das systemtheoretische Politikverständnis hinaus (Kapitel 7). Sie interessieren sich für die Kämpfe und Institutionen, durch die die Politik ein eindeutiges Verhältnis zwischen Person und Kontext schafft.
Das Buch kritisiert die Verwendung des Nationalstaats als unhinterfragten Rahmen für die Forschung zu sozialer Ungleichheit, weil im Nationalstaat territoriale, sozial differenzierte und politische Kontextrelationen in eins gesetzt werden, obwohl sie hinsichtlich ihrer Inhalte und Grenzen deutlich verschieden sind. Die Kritik zielt nicht darauf ab, das Ende des Nationalstaats zu behaupten, sondern es soll genauer geklärt werden, wofür der Kontext Nationalstaat stehen kann. Damit trägt dieses Buch zur ungleichheitssoziologischen Theoriebildung bei.
Dadurch, dass die hier vorgeschlagene Theorie ihren Ausgangspunkt bei der Person und ihren Lebenschancen nimmt, ist sie mit empirischer Forschung in der methodologisch individualistischen Tradition vereinbar. Differenzierte Kontextrelationen lassen sich aber besser mit fallvergleichender Forschung erfassen. Das achte Kapitel schlägt Taxonomien vor, mit denen sich das Zusammenspiel der drei analytisch verschiedenen Kontextrelationen in beiden empirischen Traditionen der Ungleichheitsforschung erfassen lässt. Dabei wird auch diskutiert, welche Fragestellungen mit Blick auf welche Kontextrelationen untersucht werden sollten (Weiß 2010b; Weiß und Nohl 2012a). Die Auswirkungen der Hartz-IV-Reform auf die soziale Lage von Alleinerziehenden in Deutschland sind z.B. ganz überwiegend von Faktoren abhängig, die sich einem starken nationalen Wohlfahrtsstaat zurechnen lassen, und können daher auch im nationalstaatlichen Rahmen erforscht werden. Andere Fragen, wie die berufliche Qualifikation von Zugewanderten oder die Beschäftigungschancen von IT-Fachkräften, lassen sich dagegen besser mit einer analytisch präzisen Unterscheidung der drei Kontextrelationen erfassen. Wenn man sieht, dass Eliten und die migrierte Bevölkerung ein anderes Verhältnis zum Nationalstaat haben als von konventionellen Sozialstrukturanalysen unterstellt, kann man schließlich auch die Dringlichkeit besser verstehen, mit 19der die weniger Reichen im Norden für die Grenzen »ihres« Staates kämpfen. In den reichen Ländern vertieft sich eine Spaltung zwischen denen, die von offenen Grenzen profitieren, und jenen, die den Schutz eines abgeschotteten Staates zu brauchen meinen.
Bourdieu (Bourdieu, Chamboredon und Passeron 1991; Wacquant 2004) hat argumentiert, dass gute Sozialwissenschaft zwangsläufig kritisch ist, weil sie zeigt, wie das, was ist, geworden ist, so dass sie nolens volens auch zeigt, dass es hätte anders kommen können. Solange die Soziologie im Rahmen des Nationalstaats gefangen bleibt, übersieht sie die Bedeutung globaler Ungleichheiten und trägt damit zu deren Stabilisierung bei. Dieses Buch zeigt, wodurch »die im Dunkeln« aus dem Blick verschwinden, und es lenkt den Blick auf Formen sozialer Ungleichheit, die oft als nachrangig ausgeblendet werden. Die Soziologie kann und will Barack Obama nicht raten, was politisch gegen Globale Ungleichheiten zu tun wäre, aber sie kann die Sprachlosigkeit beenden, die zwischen der karitativen Antwort seiner Mutter und der Abschottung seines Vaters entstanden ist.
21Das Problem
232. Soziale Ungleichheit
Das Museum im Neandertal zeigt am Ende der Ausstellung ein nacktes Baby, das im Zentrum seiner Familie liegt. Das Baby ist von Schattenrissen umgeben, auf deren Vorderseite die Familie der Neandertaler und auf deren Rückseite vergleichbare Verwandte heute abgebildet sind. Der Vergleich soll zeigen, dass es in der Frühgeschichte der Menschheit Familien gab, die den heutigen ähneln. Ob das richtig ist, sei dahingestellt. Man kann jedoch vermuten, dass Kinder damals wie heute mehr Aufmerksamkeit erfuhren als in manch anderen Zeitaltern der Geschichte. Wer mit 20 bis 25 Verwandten alleine in einer menschenleeren Wildnis lebt, wird jedes einzelne Kind wichtig finden. Wahrscheinlich ist außerdem, dass Rollenverteilungen flexibel waren, weil in einer Kleinstgruppe alle auf wechselseitige Hilfe angewiesen sind. Man kann sich schlecht vorstellen, dass eine junge Frau, die gut sehen konnte, am Feuer sitzen blieb, um einem kurzsichtigen Mann das Jagen zu überlassen. Solche Projektionen in die Frühzeit faszinieren das Publikum. Und da historische und interkulturelle Vergleiche zeigen, dass es im Familienleben nichts gibt, was es nicht gibt, sind diese Vermutungen ebenso plausibel wie ihr Gegenteil.
Für die Ungleichheitssoziologie funktioniert ein solcher historischer Vergleich nicht. Sie interessiert sich für die objektiven Handlungsbedingungen, die Menschen vorfinden (vgl. Hradil 1987; Schwinn 2004), die ihnen Chancen bieten, ihre Lebensziele zu verwirklichen (Sen 1985), und die sie zugleich einschränken (Bourdieu 1987; Giddens 1995a). Die Handlungsbedingungen heutiger Menschen sind nicht nur deutlich anders als die der Neandertaler. Sie werden auch durch differenziertere soziale Formationen hervorgebracht. Zum Beispiel ist das Baby, das heute geboren wird, nicht nur Kind einer (Patchwork-)Familie, sondern auch Staatsbürger. Es wird nicht nur in einen Clan, sondern in eine Vielzahl sozial differenzierter Teilsysteme der Gesellschaft hinein sozialisiert – was sich z.B. zeigt, wenn die Großeltern schon nach wenigen Tagen das erste Sparbuch eröffnen oder wenn die Großmutter das Baby in einem ehemaligen »Homeland« am Rande Südafrikas betreut, während die Mutter bei einer weißen Familie in Kapstadt als Dienst24mädchen arbeitet. Eine Gemeinsamkeit ist vielleicht, dass sich das heutige Kind ebenso wie das damalige nicht aussuchen kann, in welche Verhältnisse es hineingeboren wurde. Aber auch hier endet der Vergleich schnell, denn die Lebensbedingungen der Neandertaler waren primär von natürlichen Umständen wie dem Wetter, der Fruchtbarkeit ihrer Umwelt und der Gesundheit der Familienmitglieder geprägt, während heutige Ungleichheiten weniger auf eine objektive Knappheit verfügbarer Ressourcen als vielmehr auf deren sozial institutionalisierte ungleiche Verteilung zurückgehen.
Wir können nicht ausschließen, dass das Kind der Neandertaler auf seinen Onkel neidisch war, weil dieser gut jagen konnte und das beste Essen bekam. Wahrscheinlicher ist, dass es froh war, einen solchen Onkel zu haben, denn mit einem guten Jäger in der Familie hatten alle mehr zu essen. Anthropologische Arbeiten über Jäger und Sammler zeigen, dass Verteilung in diesen Gesellschaften egalitären Prinzipien folgte (Binmore 2006, S.6f., FN 2), während sich komplexe Strukturen sozialer Ungleichheit mit einer größeren Zahl von Menschen und dem Ackerbau entwickelten. Im europäischen Mittelalter wurden Kinder als Bauern, Mägde, Diebe oder auch Fürsten geboren, und dann blieb es trotz einzelner Aufstiege (Herlihy 1973) meist dabei. Da Ungleichheit gottgegeben erschien, waren eine übergreifende Solidarität und abstrakte Überlegungen, dass alle Menschen gleichgestellt sein sollten, abwegig.[1]
Erst im Übergang zur Moderne hat sich dann wieder ein Anspruch auf Solidarität entwickelt, der nicht zwischen Ständen unterscheidet, sondern alle Menschen, die in einer Welt leben, umfasst. Mit dem wichtigen Unterschied, dass die eine Welt nicht aus 25 Menschen, sondern aus einer großen und heterogenen Masse besteht, die als »Nation« von Gleichen imaginiert wird. Mit dem Aufstieg des Bürgertums und den nationalen und liberalen Revolutionen entstanden abstrakte und breit geteilte Gleichheitsideale, denen zufolge alle Bürger eines Gemeinwesens[2] gleiche Rechte ha25ben und über genügend Geld und Bildung verfügen sollten, damit sie politisch mitwirken können (Marshall 1950). Das war die Geburtsstunde der Soziologie sozialer Ungleichheit, denn man muss an die Gleichheit von Menschen glauben, um mittels empirischer Forschung zwischen ihnen zu vergleichen.
Die Soziologie sozialer Ungleichheit bestätigt das Argument der politischen Theorie, dass kollektiv bindende Entscheidungen nur dann getroffen und legitimiert werden können, wenn sich Bürger (und Bürgerinnen) als Gleiche gegenübertreten. Damit ist sie ein Kind unserer Zeit, und sie ist eng an die Institution des nationalen Wohlfahrtsstaats geknüpft. Außerdem richtet sie ihr Augenmerk auf sozial verursachte Ungleichheiten, in der Annahme, dass diese von staatlichen Institutionen verändert und an ein wie auch immer formuliertes Gleichheitsideal angenähert werden können (Berger und Schmidt 2004). Dabei übernimmt sie die Janusköpfigkeit der Institution Nationalstaat, denn der Nationalstaat ermöglicht zwar in seinem Inneren Solidarität unter Gleichen (Nussbaum 2008), ist aber nach außen scharf abgegrenzt. Die Soziologie analysiert Ungleichheit zwischen Bürgern und das mit Hilfe von Daten, die in und vom Nationalstaat gesammelt werden. Bisher hat sie wenig Aufwand betrieben, um veränderten Gleichheitsidealen in Zeiten der Globalisierung gerecht zu werden.
Dieses Kapitel führt in zentrale Debatten der Soziologie sozialer Ungleichheit ein. Die großen Theorien der Ungleichheitssoziologie stellen eine institutionelle Sphäre – meist die Ökonomie – ins Zentrum, und sie leiten soziale Ungleichheit insgesamt von diesem einen »Hauptwiderspruch« ab (2.1). Damit orientieren sie sich an Marx, der annahm, dass Ungleichheiten durch die Produktionsweise hervorgebracht würden und dass die Stellung einer Person im Produktionsprozess ausschlaggebend für deren Lebenschancen sei.
Die Marxsche Klassentheorie ist ein zentraler Bezugspunkt ungleichheitssoziologischen Denkens, und Marx setzt sich intensiver als spätere Autoren mit der Möglichkeit einer grenzüberschreitenden Klassenbildung auseinander (vgl. Marx und Engels 1969 [1848]-a, S.60-1). Die soziologische Diskussion nach Marx zeigt 26allerdings, dass die Identifikation einer Ursache nicht ausreichend ist, um die Mehrzahl der Ungleichheiten und der ungleichheitsgenerierenden sozialen Prozesse zu erfassen. Wenn man akzeptiert, dass es verschiedene Dimensionen sozialer Ungleichheit gibt, die nicht alle auf einen Nenner gebracht werden können, steht man vor der zweiten und der dritten Frage, die in diesem Kapitel behandelt werden: Welche Differenzen sollten eigentlich als Ungleichheiten beschrieben werden? Oder etwas anders gewendet: Wie sollte Gerechtigkeit verstanden werden (2.2)? Heben sich die verschiedenen Ungleichheiten wechselseitig auf, oder verdichten sie sich zu sozialen Strukturen und »Klassen« (2.3)?
Die meisten Antworten auf diese Fragen sind in ihrer Geltung eingeschränkt, weil sie die Gesellschaftstheorie im Allgemeinen und das Problem sozialer Ungleichheit im Besonderen nur im Rahmen des Nationalstaates denken. Das eigentliche Anliegen dieses Buches ist es daher, Theorien zu nutzen, die für die Frage nach Ungleichheit in Zeiten der Globalisierung Anknüpfungspunkte bieten (2.4).
2.1 Erklärungen für soziale Ungleichheiten
Von Ungleichheit konnte erst die Rede sein, als Unterschiede nicht mehr als gottgegeben oder natürlich wahrgenommen wurden, sondern als sozial verursacht. Damit entwickelte sich dann auch die Frage, welche sozialen Institutionen durch welche sozialen Prozesse Ungleichheiten hervorbringen. Als Materialist ging Marx davon aus, dass die gesellschaftliche Arbeitsteilung der vorherrschenden Produktionsweise auf einer historischen Entwicklungsstufe entspricht (Marx und Engels 1969 [1848]-a). Zum Beispiel bringt die ackerbauende Produktionsweise den Feudalismus mit der Unterscheidung zwischen (adeligen) Grundbesitzern und Leibeigenen hervor. Nachdem sich Städte als Orte spezialisierter Tätigkeiten in Handel und Industrie vom Land differenziert hatten, entstand eine weitere Form der Arbeitsteilung zwischen den in Zünften organisierten Handwerkern und dem städtischen Pöbel. Mit der Ausdifferenzierung zwischen Produktion und Verkehr kommt es zusätzlich zur Arbeitsteilung zwischen Handwerk und Kaufleuten (vgl. Marx und Engels 1969 [1848]-a, S.52).
27Während Marx im historischen Rückblick mehrere Formen der Arbeitsteilung identifiziert, setzt er für die Industrialisierung einen Widerspruch zentral: Auf der einen Seite stehen die Kapitalisten, die über die Produktionsmittel verfügen und sich durch Ausbeutung Mehrwert aneignen können. Auf der anderen Seite steht die Masse der Lohnabhängigen, die auf die Veräußerung ihrer Arbeitskraft angewiesen sind. Mit dieser Begrifflichkeit hat Marx Ausbeutung als zentrale Ursache für sozial verursachte Ungleichheiten im Kapitalismus erkannt. Wenn Tauschbeziehungen so organisiert sind, dass eine Seite die Bedingungen diktiert und sich auf Kosten der anderen Seite bereichert, sind sie ausbeuterisch. Dass Ausbeutung ein wichtiger Mechanismus der Ungleichheitsgenese ist, ist bis heute Konsens (Therborn 2013, S.57-58), auch wenn sich die marxistische Lesart von Ausbeutung verändert hat (Wright 2009). Klar ist aber auch, dass das klassisch marxistische Denken der Entstehung von Ungleichheit außerhalb von Märkten nicht gerecht wird (Bourdieu 1992).
In einer zweiten, Max Weber folgenden Traditionslinie hat sich schon früh ein Zugang zu Ungleichheiten entwickelt, der etwas breiter angelegt war. Weber unterscheidet einerseits zwischen ökonomischen Ungleichheiten, die unter anderem durch ungleichen Beruf oder Besitz hervorgebracht werden (Weber 1980 [1922], S.177). Andererseits betont er, dass ständische Vergesellschaftung Ungleichheit hervorbringt (Weber 1980 [1922], S.180). Zum Beispiel verhalten und kleiden sich Ärzte auf eine Weise, durch die sie sich wechselseitig erkennen (»Stand«), und es ist eher unwahrscheinlich, dass die Kinder von Ärzten Arbeiterkinder heiraten (»soziale Klasse«). Parkin (1979) hat sozialer Schließung[3] in Anschluss an Weber einen zentralen Stellenwert für die Klassenbildung zugesprochen. Interessengruppen monopolisieren Ressourcen, indem sie Außenstehenden den Zugang erschweren. Das ist z.B. dann der Fall, wenn Ärzte bestimmte medizinische Tätigkeiten für sich reservieren, um den Abstand zu Pflegekräften zu wahren und eine höhere Vergütung für diese Tätigkeiten zu erzwingen.
Gruppen können nicht nur durch strategisches soziales Handeln 28Ungleichheit hervorbringen, sondern auch der Zusammenhalt, der selbstläufig z.B. durch »Ähnlichkeit« entsteht, ist ungleichheitsrelevant. Bourdieu (1992) hat argumentiert, dass das Aufwachsen unter bestimmten Lebensbedingungen einen diesen Bedingungen entsprechenden (Klassen-)Habitus hervorbringt und dass sich Menschen mit ähnlichem Habitus wahrscheinlicher zu Gruppen zusammenfinden als solche, bei denen der Habitus divergiert. Bis heute ist umstritten, ob die Ungleichheitssoziologie Menschen überhaupt als Individuen behandeln kann, da Familienbande heute ähnlich wie im Neandertal eine ganz grundlegende Solidarität stiften, die Lebenschancen zumindest für Kinder, oft aber für das ganze Leben strukturiert (Mahlert 2008).[4] Hierauf wird im nächsten Kapitel zurückzukommen sein.
In jedem Fall kann man Bourdieus Gedanken, dass Ähnlichkeit Nähe stiftet, auf verschiedene Lagerungsunterschiede wie Generation, Geschlecht und Migrationserfahrung anwenden (Bohnsack 2014). Viele soziale Gruppen – seien es jugendliche Peergruppen oder Aufsichtsräte – sind sich in sozialstruktureller Hinsicht ähnlich und schließen damit implizit »andere« aus. Wenn in solchen Gruppen Ressourcen vergeben werden, verstärkt die Gruppenbildung Ungleichheiten (Portes und Sensenbrenner 1993). Man kann aber schwer sagen, ob es sich hier um eine strategische Ausgrenzung handelt, um Gruppenbildungsprozesse mit mittelbaren Auswirkungen auf Ungleichheit oder um beides.
Ein dritter Theoriestrang stellt daher nicht soziale Gruppenbildung, sondern die herrschaftsförmige Konstruktion sozialer Kategorien in den Vordergrund des Interesses. In Anlehnung an Foucault oder auch Bourdieu streichen eine ganze Reihe neuerer Theorien in der Gender- und Rassismusforschung[5] heraus, dass die kulturell stabilisierten Kategorien »Mann« und »Frau« oder 29»deutsch« und »türkisch« als solche geeignet sind, herrschaftsförmige Praktiken und Klassifikationen und damit soziale Ungleichheiten hervorzubringen (siehe auch Weiß et al. 2001; Amelina 2012; Weiß 2013). Damit werden solche Ungleichheiten erfasst, die zwar für Ökonomie und soziale Gruppenbildung wichtig sind, deren Kern sich aber besser als herrschaftsförmiges kulturelles Konstrukt verstehen lässt. Man kann also ökonomisch argumentieren, dass Männer Frauen dadurch ausbeuten, dass sie ihnen die unbezahlte Reproduktionsarbeit überlassen, was negative Folgen für die Arbeitsmarktposition der Frauen hat. Die Ausbeutung der Frauen allein von der kapitalistischen Wirtschaftsweise abzuleiten, ist aber schon deshalb nicht überzeugend, weil patriarchale Verhältnisse schon deutlich vor dem Kapitalismus herrschten. Überzeugender scheint das Argument, dass sich das kulturelle Konstrukt, dass Frauen »anders« sind als Männer, in unterschiedlichen Alltagspraktiken und Präferenzen spiegelt, die dann unter anderem auch in einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung institutionalisiert sind. Die Erklärung von Geschlechterungleichheit als Herrschaftsverhältnis macht plausibel, warum die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern als kategoriale Ungleichheit so hartnäckig auch dann bestehen bleibt, wenn sich Produktionsweisen und Vergesellschaftungsformen verändern. Bourdieu spricht von symbolischer Herrschaft (Bourdieu 1991a), um deutlich zu machen, dass manche Ungleichheiten selbstverständlich geworden sind, so dass sogar die Beherrschten sie für naturgegeben halten.
Theorien gewinnen an Überzeugungskraft, wenn sie einfach und elegant sind. Das spricht dafür, sozial verursachte Ungleichheiten primär vom Kapitalismus oder von sozialen Kämpfen zwischen Gruppen oder von kulturell-symbolischen Herrschaftsverhältnissen abzuleiten. Soziologische Ungleichheitstheorien stellen eine oder wenige Erklärungen für soziale Ungleichheiten in den Mittelpunkt,[6] und bis heute lassen sich neue Vorschläge oft ei30ner der drei genannten großen Schulen zuordnen.Schon dass man mindestens drei solcher Schulen identifizieren kann, spricht aber nicht unbedingt für die Tragfähigkeit dieser Lösung. Wäre es nicht besser, mehrere Prozesse der Ungleichheitsgenese gleichzeitig und in ihrem Zusammenwirken zu[7] berücksichtigen?[8] Leider wird es dann aber kompliziert. Als derzeit prominenteste mehrdimensionale Theorie sozialer Ungleichheit stellt die Intersektionalitätsforschung[9] die These auf, dass sich verschiedene Kategorien sozialer Ungleichheit nicht einfach addieren lassen, nach dem Muster: »Schwarze Frauen der Arbeiterklasse sind am stärksten benachteiligt«. Vielmehr müsse nachvollzogen werden, wie verschiedene Prozesse der Ungleichheitsgenese ineinandergreifen. Zum Beispiel werden türkeistämmige Männer im Bildungswesen und im Dienstleistungssektor Deutschlands stärker diskriminiert als Frauen mit gleicher Ethnizität,[10] weil Rassismen in der Regel Männer als gefährlich und Frauen als dienstfertig konstruieren.
Wenn man die Kritik ernst nimmt, dass sich Dimensionen sozialer Ungleichheit je nach Kontext verstärken, ergänzen, überschneiden oder auch abschwächen, liegt es nahe, den Anspruch 31älterer Ungleichheitstheorien, dass sich die Struktur der gesamten Gesellschaft primär von einer Ursache ableiten ließe, aufzugeben.[11] Eine neuere, vierte Theorietradition verzichtet auf die Analyse ganzer Gesellschaften und interessiert sich stattdessen für mesosoziale Mechanismen der Ungleichheitsgenese als Formen sozialer Organisation (Diewald und Faist 2011). Tilly plädiert z.B. dafür, nicht handelnde Menschen zu untersuchen, sondern die Art, wie soziale Relationen organisiert sind (1998, S.84ff.). Dann fällt auf, dass sich wenige organisationale Formen immer wieder wiederholen. Eine dieser Formen ist das asymmetrische kategoriale Paar, das z.B. das Verhältnis zwischen Herr und Knecht oder zwischen Chef und Sekretärin reguliert. Tilly zufolge ist diese Organisationsform die Grundlage ganz verschiedener sozialer Ungleichheiten, weil sie Ausbeutung und Chancenhortung erleichtert. Sie verbreitet sich durch Nachahmung, und sie ist stabil, weil sie in alltägliche Routinen eingeschrieben ist.
In seiner Analyse von Mechanismen der Ungleichheitsgenese schließt Therborn explizit an Tilly an, ist aber deutlicher in der Gesellschaftstheorie verortet, weil er die von ihm identifizierten Mechanismen der Ungleichheitsgenese auf strategisches Handeln von Einzelnen und Kollektiven zurückführt und sie als institutionalisiert begreift (Therborn 2013, S.55). Wie Tilly und wie die großen Theorien sozialer Ungleichheit benennt Therborn Ausbeutung und Ausschließung als zwei wichtige Mechanismen der Ungleichheitsgenese. Mit der hierarchischen Organisation als drittem Mechanismus werden unter anderem bürokratisch vermittelte Statusunterschiede erfasst.
Als vierten Mechanismus analysiert Therborn die Abstandsvergrößerung. Damit sind Handlungen und Institutionen gemeint, die bestehende Unterschiede verstärken, also z.B. ein Schulsystem, das aus mehrsprachigen Kindern Schüler mit Sprachdefiziten macht. Damit trägt Therborn zur alten Debatte über Meritokratie und Leistungsgerechtigkeit bei. Dieser Punkt wird hier etwas ausführlicher dargestellt, weil die Luhmannsche Systemtheorie, die im 32sechsten Kapitel diskutiert wird, ähnliche Argumente nutzt, um zur Ungleichheitsforschung beizutragen.
Im Streit darüber, ob moderne Gesellschaften meritokratisch seien, stellen sich die meisten Ungleichheitstheorien auf den Standpunkt, dass Leistungsgerechtigkeit allenfalls als legitimierende Ideologie angesehen werden kann. Denn die empirische Forschung zeigt in überwältigender Deutlichkeit, wie scheinbare Leistungsunterschiede zwischen Menschen durch die oben schon dargestellten sozialen Mechanismen hervorgebracht werden (Solga 2009). Im Unterschied hierzu hält die Luhmannsche Systemtheorie an einem modifizierten Funktionalismus fest. Das Matthäusprinzip »Wer hat, dem wird gegeben« wird als kaum vermeidbar angesehen. Zugleich erscheint eine Genese von Ungleichheiten nach diesem Prinzip als instabil und gegenüber den Funktionssystemen der Gesellschaft nachrangig (Stichweh 2005a). Während Davis und Moore (1945) noch meinten, dass ungleiche Belohnungen für ungleiche Leistungen funktional für die Gesellschaft seien, damit die Besten die wichtigsten Funktionen bekleiden, nutzt die Luhmannsche Systemtheorie zwar trotz aller Kritik (Mayntz 1961) funktionalistische Argumente, hält das Matthäus-Prinzip und andere ungleichheitsgenerierende Mechanismen aber für vergleichsweise unwichtige Gliederungen einer funktional differenzierten Gesellschaft.
Therborns Überlegungen können zwischen der ungleichheitssoziologischen Kritik an Meritokratie als Legitimationsideologie (Sachweh 2010) und der systemtheoretischen Überzeugung vermitteln, dass sich das Matthäusprinzip kaum vermeiden lässt. Therborn schlägt in seiner mechanistischen Erklärung sozialer Ungleichheiten vor, »Leistung« wertneutraler als Mechanismus der »distanciation«, also der Abstandsvergrößerung zu fassen (2013, S.55-7). Wenn soziale Institutionen so angelegt sind, dass sie bestehende Ungleichheiten verstärken, trägt das zur Ungleichheitsgenese bei. Ob man Prozesse der Abstandsvergrößerung als Möglichkeit zur Optimierung von Leistung schätzt[12] oder als »Wer hat, dem wird gegeben« kritisiert: In jedem Fall tragen sie zur Verstärkung sozialer Ungleichheiten bei.
33Die mechanismischen Theorien ermöglichen also eine präzise Analyse von ungleichheitsgenerierenden Mechanismen. Allerdings halten sie – wohl bewusst[13] – offen, was das für die Organisation ganzer Gesellschaften heißt. In beiden Hinsichten geht die Systemtheorie Niklas Luhmanns gegensätzlich vor, die hier abschließend als paradigmatisch für einen fünften, differenzierungstheoretischen Zugang zu sozialen Ungleichheiten diskutiert wird. Luhmann stellt die Gesellschaftstheorie ins Zentrum und widmet dem Thema Ungleichheit nur dann Aufmerksamkeit, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Die heutige Weltgesellschaft sei primär dadurch strukturiert (»differenziert«), dass institutionelle Sphären (»Funktionssysteme«) eine in sich stimmige Eigenlogik entwickelten. Solche Eigenlogiken können auf Ungleichheiten aufbauen und diese mit Hilfe des schon genannten Mechanismus der Abstandsvergrößerung steigern. Sie müssen das aber nicht.
Mit seiner Formulierung der Systemtheorie wird Luhmann dem hohen Differenzierungsgrad und der Komplexität moderner Gesellschaft(en) gerecht. Auch handelt es sich um eines der seltenen Theorieangebote, die den Nationalstaat nicht von vorneherein zum Rahmen der Analyse erklären. Allerdings trifft Luhmann etliche theoriestrategische Entscheidungen,[14] die es sehr erschweren, dem Gegenstand der sozialen Ungleichheit überhaupt noch gerecht zu werden (siehe dazu auch Kapitel 6 und 7).
In der differenzierungstheoretischen Tradition finden sich neue Arbeiten, die Ungleichheit gesellschaftstheoretisch denken und die Möglichkeit offenhalten, dass Ungleichheiten durch analytisch ganz verschiedene Prozesse entstehen können. Walby (2009) unterscheidet vier Institutionengefüge (institutional domains) in der Welt – Ökonomien, politische Gemeinwesen, Zivilgesellschaften und institutionalisierte Gewalt –, die jeweils sehr breit definiert 34werden. Zum Beispiel rechnet Walby auch die Reproduktionsarbeit zur Ökonomie, und sie fasst Kulturelles unter Zivilgesellschaft. Wie Luhmann verzichtet Walby darauf, diese institutionellen Sphären eindeutig mit bestimmten Ungleichheiten zu verbinden. Im Unterschied zu Luhmann verwendet sie den Systembegriff aber nicht nur für institutionelle Sphären, sondern auch für komplexe Ungleichheiten, die sie als regimes of inequality bezeichnet. So kann sie sowohl die institutionellen Felder als auch die Ungleichheitsregime als Systeme denken, die im Rahmen einer Komplexitätstheorie wechselseitig Umwelten füreinander bilden. In einem Prozess der »Koevolution« entwickelt sich jedes System autonom, verändert dadurch aber zugleich die Spielräume für andere Systeme, was im Gesamt zu einem Prozess der »Koevolution komplexer Systeme in sich wandelnden Landschaften der wechselseitigen Anpassung« (vgl. Walby 2009, S.90) führt. Die Leistung Walbys liegt darin, dass spezifische Zusammenhänge zwischen bestimmten Ungleichheiten und Institutionen analysiert werden können, ohne dass Ungleichheiten nach dem Muster »Klasse entspringt der Ökonomie, Geschlecht der Familie« jeweils nur einem institutionellen Bereich zugeordnet werden. Auch ergänzt Walby die militärische und interpersonale Gewalt als institutionelle Sphäre, die weltweit mit am deutlichsten zu Ungleichheiten beiträgt.[15]
Betrachtet man die klassischen und die aktuellen Debatten in der Soziologie sozialer Ungleichheit im Überblick, so stechen gemeinsame Themen ins Auge, auch wenn diese je nach gesellschaftstheoretischem Anspruch ganz unterschiedlich »aufgehängt« werden. Dass der absichtliche oder selbstverständliche Zusammenschluss von Menschen die Ausgeschlossenen benachteiligt, lässt sich z.B. im Rahmen fast aller Theorien zeigen. Bei Marx ist die Gruppenbildung notwendiger Teil der politischen Selbstorganisation der Arbeiterklasse. Bei Weber und Parkin handelt es sich um ständische Schließung mit dem Zweck der Ressourcenmonopolisierung. In 35der Gender- und Rassismusforschung werden Gruppenidentitäten als Ausdruck herrschaftsförmiger sozialer Kategorien relevant, und mechanismische Ansätze sprechen von Exklusion.
Außerdem ringen die meisten neueren Vorschläge darum, der mehrdimensionalen Genese von Ungleichheiten gerecht zu werden, bleiben in ihren sozial- und gesellschaftstheoretischen Bezugnahmen dann aber doch auf je eine zentrale Erklärungsdimension (Ausbeutung, Gruppenbildung, Herrschaft) beschränkt. Eine überzeugende Aufarbeitung all dieser Theorien zu einer mehrdimensional erklärenden und zugleich gesellschaftstheoretischen Theorie sozialer Ungleichheit ist derzeit nicht in Sicht. Das muss jedoch kein Nachteil sein, wenn man einen anderen – eher deskriptiven – Zugang zur Analyse sozialer Ungleichheiten wählt.
2.2 Beschreibung mehrdimensionaler Ungerechtigkeiten
Wenn man begründen will, dass eine bestimmte Art der Ungleichheit sozial verursacht ist, muss man erklären, wie diese Ungleichheit entstanden ist. Alternativ hierzu kann man Ungleichheit auch beschreiben. Man denkt dann von der Person her und bewertet, in welchen Hinsichten Menschen handlungsfähig sein müssen, um ein gutes Leben zu führen.[16] Die empirisch vergleichende Ungleichheitsforschung bezieht sich zwar auf verschiedene erklärende Sozial- und Gesellschaftstheorien, spitzt das eigene Interesse aber auf die Frage zu, in welchen Hinsichten die Spielräume, die Handelnde haben, objektiv ungleich sind (Hradil 1987). Dabei geht es einerseits um eine inhaltliche Unterscheidung von verschiedenen Dimensionen sozialer Ungleichheit, wie z.B. nach Einkommen, Beruf/Bildung, Geschlecht, Ethnizität/Rassenkonstruktion, Gesundheit etc. Implizit ist mit solchen deskriptiven Unterschieden aber auch angesprochen, dass das Ziel der Gleichheit je nach den Ressourcen, um die es geht, verschieden ausformuliert werden muss.[17]
36Bourdieu würde Marx z.B. grundsätzlich zustimmen, dass der Besitz an ökonomischem Kapital ein wichtiges Machtmittel ist. Er weitet den Kapitalbegriff aber ähnlich wie Weber aus und unterscheidet mindestens drei inhaltlich verschiedene Kapitalsorten. Allen Kapitalsorten ist gemeinsam, dass sie Ausdruck der Produktivität der vergangenen Generationen sind, so dass die Möglichkeitsspielräume der heute Lebenden dadurch mit bestimmt sind, was sie geerbt haben (Bourdieu 1983, S.183). Die Produktivität der vergangenen Generationen vergegenständlicht sich nicht nur als ökonomisches Kapital. Auch diejenigen, die über gutes Benehmen, Computer und Bildungstitel verfügen, also über inkorporiertes, objektiviertes und institutionalisiertes kulturelles Kapital, können einen größeren Teil der gesellschaftlich hervorgebrachten Werte für sich in Anspruch nehmen. Ebenso haben Menschen Vorteile, die hohes soziales Kapital, z.B. ein einflussreiches Netzwerk wechselseitiger sozialer Verpflichtungen, besitzen.
In diesem Katalog von ökonomischen, kulturellen und sozialen Ressourcen sind Überlegungen dazu enthalten, wie man Gleichheit erreichen könnte, und damit implizit auch Erklärungen dazu, wie Ungleichheit entsteht. Während man Geld »einfach« umverteilen könnte – was ja auch geschieht –, lässt sich eine Gleichverteilung des kulturellen Kapitals weniger leicht bewerkstelligen. Kulturelles Kapital muss im Laufe des Lebens angeeignet werden, d.h., es ist in stärkerem Maße an eine bestimmte Person gebunden als ökonomisches Kapital. Hinzu kommt, dass der Wert des kulturellen Kapitals ganz deutlich von der Anerkennung für bestimmte Distinktionspraktiken, Kompetenzen und Bildungstitel abhängt und damit von politischen und symbolischen Kämpfen mitbestimmt wird. In diesem Zusammenhang hat Bourdieu Paradoxien beobachtet wie z.B., dass das im staatlichen Schulsystem institutionalisierte Versprechen von Chancengleichheit in der Praxis systematisch Ungleichheit reproduziert und legitimiert. Im Schulsystem werden subtile Unterscheidungen zwischen kleinbürgerlichen und bürgerlichen Formen des kulturellen Kapitals (Fleiß versus Schöpfergeist) reproduziert und als Zuschreibung von Bildungsferne institutionalisiert (Bourdieu 2001b).
Deskriptive Unterscheidungen von Ressourcen, die das Handeln ermöglichen, enthalten also die eingangs diskutierten Erklärungen für sozial verursachte Ungleichheiten. Sie setzen aber einen anderen 37Schwerpunkt. Wenn man die Frage zurückstellt, ob Ungleichheiten sozial oder natürlich verursacht sind, und stattdessen beschreibt, in welchen Dimensionen Handlungsfähigkeit eingeschränkt und erweitert sein kann, muss man genauer klären, was das Ideal von Handlungsfähigkeit ausmacht. Geht es darum, dass alle Menschen ungeachtet ihrer Unterschiede über das gleiche ökonomische und kulturelle Kapital verfügen sollten (Ressourcengleichheit)? Oder ist Gleichheit erreicht, wenn alle die gleiche Chance haben, ökonomisches und kulturelles Kapital zu gewinnen (Chancengleichheit)? An dieser Stelle ist eine Auseinandersetzung mit der philosophischen Diskussion über Gleichheit und Gerechtigkeit unabweisbar (Berger und Schmidt 2004).
In der Philosophie wiederum wird problematisiert, dass Gleichheit nicht automatisch gerecht sein muss (Krebs 2000). Gleichheit könnte ungerecht sein, wenn Menschen verschiedene legitime Bedürfnisse haben. Zum Beispiel würde ein Bürgereinkommen, das allen Menschen ungeachtet ihrer Bedürfnisse den gleichen Betrag zuspricht, und Körperbehinderte, die auf regelmäßige Hilfe angewiesen sind, massiv schlechter stellen als eine »bedarfsgerechte« Sozialhilfe. Auch »gleiche« Bildungschancen sind ungerecht, da die Kinder von Suchtkranken, die Kinder von Analphabeten und die Kinder von Dichterinnen ihre Schulkarriere mit deutlich verschiedenen Ausgangsvoraussetzungen beginnen. Außerdem wird in der Philosophie problematisiert, dass Vorstellungen eines »Guten Lebens« unterschiedlich ausfallen können. Nicht alle Menschen wollen das Gleiche.
Amartya Sen (1985) und Martha Nussbaum (2007) schlagen daher vor, nicht Ressourcen ins Zentrum der Gerechtigkeitsforschung zu stellen, sondern capabilities, also eine Mehrzahl von Verwirklichungs- oder Lebenschancen.[18]Capabilities umfassen sowohl die tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten einer Person als auch die Freiheiten, also die Potenziale, die ihr für Entscheidungen über das, was ihr wichtig ist, zur Verfügung stehen.[19] Ein reicher Mensch, der 38fastet, hat die Wahl, gut zu essen, während ein armer Mensch, der gerade eben satt wird, auch dann von der Chance auf gesunde Ernährung und Langlebigkeit abgeschnitten ist, wenn er oder sie sich mit begrenzten Lebenschancen abgefunden hat. Dass Menschen Unterschiedliches wollen können, ist für den Capability-Ansatz kein Problem, denn er betrachtet nur die Chance, Ziele zu erreichen, nicht die Frage, ob alle diese Ziele erreichen wollen. Freiheit und Gleichheit stellen in diesem Ansatz keine Gegensätze dar.
Außerdem streicht der Capability-Ansatz heraus, dass Lebenschancen im Verhältnis zwischen den Merkmalen von Personen und den Kontexten, in denen sie sich befinden, entstehen (im Folgenden vgl. Sen 1999a, S.70f.). Erstens sind die persönlichen physischen Voraussetzungen der Menschen unterschiedlich. Eine Schwangere braucht mehr Essen, um satt zu werden, als ein Greis. Der Greis wiederum kann ein Fahrrad nicht so nutzen wie seine jugendliche Enkelin. Zweitens sind Menschen je nach der physischen Umwelt, in der sie sich befinden, unterschiedlichen Chancen und Gefahren ausgesetzt. Epidemien, aber auch kalte Temperaturen können ursächlich dafür sein, dass es ihnen trotz des Besitzes von Gütern schlecht ergeht. Gleiches gilt drittens für die soziale Ausstattung von Umwelten, also die Bildungsangebote, die sich in der Nähe befinden, oder die Belastung durch Gewaltverhältnisse und Umweltverschmutzung. Viertens ist der Druck, dem Arme in reichen Gesellschaften ausgesetzt sind, kontextabhängig. Die relative Armut einer deutschen Jugendlichen ohne Smartphone lässt sich auch als absolute Armut hinsichtlich ihrer Chancen auf sozialen Respekt interpretieren. Fünftens verweist Sen darauf, dass auch Menschen, deren Haushalte über Güter verfügen, von deren Nutzung ausgeschlossen sein können, wenn es z.B. nicht genügend Essen für alle gibt und sich immer die Männer zuerst nehmen dürfen.
Der Capability-Ansatz hat politisch große Aufmerksamkeit erregt. Amartya Sen erhielt 1998 den Nobelpreis für Ökonomie. Der Human Development Index der Weltbank nutzt den Capability-Ansatz, und seit 2005 ist das Konzept für die Armuts- und Reichtumsberichterstattung der deutschen Bundesregierung maßgeblich (Anand et al. 2009; Arndt und Volkert 2011; Burchardt und Vi39zard 2011). Allerdings hat es sich in der empirischen Forschung als schwierig herausgestellt, Capabilities als Verhältnis von Bedarfen, Gütern und Kontexten zu operationalisieren. Der Human Development Index kann z.B. nicht unterscheiden zwischen realisierten Zielen und der Freiheit, diese – wenn gewünscht – zu erreichen.
In der Armutsforschung und der Entwicklungssoziologie betrachtet der Livelihoods-Ansatz (Bebbington et al. 2007) Ressourcen als Mittel auf dem Weg zu Zielen, wobei sowohl das, was als Ressource in Betracht kommt, als auch die Frage, für welches Ziel eine Ressource eingesetzt wird, als in soziale und kulturelle Kontexte eingebettet begriffen wird. White und Ellison (2007, S.168-74) illustrieren das Argument am Beispiel einer wohltätigen Bürgersfrau, die im Haushalt der Nachbarn unbeaufsichtigte hungrige Kinder vorfindet. Die Kinder sagen, dass sie kein Essen haben, obwohl Eier im Schrank liegen. Daher macht die Nachbarin den Kindern ein Omelett, was alles durcheinanderbringt, weil die Eier Teil eines Vertrages mit dem Krämer waren, der im Gegenzug das Getreide und die Hülsenfrüchte geliefert hätte, die die Familie während einer Woche braucht. Für die Kinder in diesem Beispiel sind die Eier also kein Essen, sondern ein dringend benötigtes Tauschmittel. Empirische Forschung, die sich auf den Livelihoods-Ansatz bezieht, kann zwischen der »objektiven« Seite von Ressourcen und ihrem Wert in den Kontexten, in denen sie zum Einsatz kommen, unterscheiden.
Wenn man Dimensionen von Ungleichheit mit Blick auf die Handlungschancen von Personen beschreibt, die Gerechtigkeit erfahren sollen, zeichnet sich ein noch unscharfer Konsens zwischen Teilen der Philosophie und der empirisch forschenden Ungleichheitssoziologie ab. Erstens besteht eine gewisse Einigkeit darüber, dass Lebenschancen relational zu denken sind. Um diese Relationalität sozialer Ungleichheiten hervorzuheben, wird im Folgenden in losem Anschluss an Amartya Sen von »Capabilities« oder »Lebenschancen« gesprochen. Mit Ressourcen sind dann Eigenschaften im Sinne von properties gemeint, die potenziell ungleichheitsrelevant werden können. Inwiefern sich Eigenschaften von Personen tatsächlich in Ungleichheiten übersetzen, muss dann jeweils im Verhältnis zu den Kontexten, in denen sie zum Einsatz kommen, bestimmt werden. Zweitens ließ sich zeigen, dass das gute Leben mit Blick auf mehrere inhaltlich verschiedene Dimensionen beschrie40ben werden kann und sollte, die menschliche Handlungsfähigkeit begrenzen und erweitern. Dabei ist es sinnvoll, die Chance oder auch Freiheit, ein Ziel zu erreichen, ins Zentrum des Interesses zu stellen und nicht die Güter, über die eine Person verfügt, oder den tatsächlich erzielten Nutzen (Sen 1985). Drittens teilen beide Perspektiven eine Schwäche, die sich zu den erklärenden Ungleichheitssoziologien, die in 2.1 diskutiert wurden, genau spiegelbildlich verhält: Sie entwickeln zwar dezidierte Vorstellungen dazu, wie das gute Leben aussehen könnte, setzen sich aber nicht systematisch mit den sozialen Institutionen auseinander, die das gute Leben vieler Menschen verhindern. Hierauf wird in Kapitel 3.4 zurückzukommen sein.
2.3 (Wie) Bilden sich strukturierte Soziale Lagen?
Die Erklärungen für die Genese von Ungleichheiten sind ebenso vielfältig wie die Dimensionen, in denen die empirische Ungleichheitsforschung Ungerechtigkeit aus der Perspektive von Personen beschreibt. Was bedeutet das für die Gesellschaftstheorie, insbesondere wenn sie verfestigte soziale Ungleichheiten als soziale Strukturen oder Klassen benennen will? Sollte sie Luhmann folgen, der die Bildung von Klassen ungleich gestellter Personen angesichts des hohen Differenzierungsgrades moderner Gesellschaften für unwahrscheinlich hält (Luhmann 1985)? Oder mit Walby Regime sozialer Ungleichheiten postulieren, deren Relevanz für die Gesellschaftsanalyse dann ähnlich wie bei der Intersektionalitätsforschung empirischen Studien überlassen bleibt? Oder lässt sich die Frage, wie sich die Mehrzahl der Ungleichheiten zu strukturierten Mustern der Ungleichstellung, also zu einer Sozialstruktur entwickelt, auch theoretisierend beantworten? Provokant formuliert: »Was spricht […] dagegen, dass Nobelpreisträger sich selbst die Schuhe putzen müssen und ihre Freunde auf ihrem Sofa schlafen lassen?« (Luhmann 1985, S.145)
Im Gefolge von Marx neigte und neigt die Soziologie zu einer relativ eindeutigen Antwort auf diese Problematik. Wenn Gesellschaften durch den Gegensatz zwischen Kapitalisten und Lohnarbeitern strukturiert sind, handelt es sich um Klassengesellschaften, d.h., die Basis ökonomischer Ungleichheit bestimmt alle weiteren 41sozialen Formationen. Die Eindeutigkeit dieser Antwort war im zeitgenössischen Kontext plausibel, weil die Vorläufer industrieller Gesellschaften jeden Menschen qua Geburt einer Schicht zuteilten. In diesen Gesellschaften waren Ressourcenausstattung und Selbstwahrnehmung von Personen in weitgehend kongruenter Weise »objektiv« ungleich, so dass sich die Sozialstruktur als primär »stratifikatorisch differenziert« (Luhmann 1997) begreifen ließ.
Selbst Marx hatte allerdings Probleme, in der frühen Industriegesellschaft derart eindeutige Vergesellschaftungsformen zu finden. In seiner Theorie war klar, dass es »objektiv« zwei Klassen »an sich« geben müsste: Kapitalisten und Proletarier. Keineswegs selbstverständlich war aber, dass eine objektiv bestehende Ungleichstellung in den Produktionsverhältnissen auch in eine entsprechende soziale Organisation als »Klasse für sich« münden würde: »Die Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur politischen Partei, wird jeden Augenblick wieder gesprengt durch die Konkurrenz unter den Arbeitern selbst. Aber sie ersteht immer wieder, stärker, fester, mächtiger. Sie erzwingt die Anerkennung einzelner Interessen der Arbeiter in Gesetzesform, indem sie die Spaltungen der Bourgeoisie unter sich benutzt.« (Marx und Engels 1969 [1848]-b, S.471) Die Geschichte des Marxismus ist eines der drastischsten Beispiele dafür, wie sich sozialwissenschaftliche Analysen auf ihren Gegenstand auswirkten. Denn das obige Zitat zeigt doch, dass Marx seine sozialwissenschaftliche Analyse um politisches Wunschdenken ergänzen musste, denn es war keineswegs klar, dass sich die Proletarier zur Klasse würden organisieren können. Seine Schriften trugen sehr dazu bei, dass die Arbeiter trotz aller Konkurrenz untereinander zu einer »Klasse für sich« wurden.
Dennoch setzten sich längerfristig wieder die heterogenen Formen der Arbeitsteilung durch,[20] die Marx im historischen Rückblick mit viel Präzision analysiert hatte. Angesichts sozialer und sozialdemokratischer Reformen und angesichts der ungeklärten Klassenlage des Kleinbürgertums war spätestens im frühen 20.Jahrhundert klar, dass sich kapitalistische Gesellschaften nicht immer in zwei Klassen spalten. Über viele wichtige Argumentationsschritte, die hier nicht ausführlich dargestellt werden, entwickelte die Soziologie bis zum Ende des 20.Jahrhunderts Vorschläge 42zur Sozialstrukturanalyse, die auch dann noch sehr viel differenzierter sind als Marx, wenn sie weiterhin am Gedanken einer Klassengesellschaft festhalten.
Bourdieu geht mit dem Problem so um, dass er zwar mehrere Kapitalsorten unterscheidet. Da er alle Kapitalsorten als Ausdruck der Produktivität vergangener Generationen interpretiert, sind sie aber ineinander konvertierbar. Nationalstaatlich gerahmte soziale Räume sind durch wenige zentrale Gegensätze strukturiert (Bourdieu 1998c). In Frankreich ist die Struktur des sozialen Raumes zweidimensional: Die herrschende Klasse scheidet sich in eine Fraktion mit mehr ökonomischem und eine mit mehr kulturellem Kapital. Außerdem geht Bourdieu davon ab, in der Selbstwahrnehmung und politischen Organisation ein einfaches Abbild dieser Struktur zu suchen (Bourdieu 1992). Stattdessen hebt er hervor, dass er »Klassen auf dem Papier« konstruiere, die nicht zwangsläufig in »Klassen für sich« münden müssen.
So besteht der zentrale theoretizistische Fehler – Marx begeht ihn – darin, die Klassen auf dem Papier als reale Klassen zu behandeln, von der objektiven Homogenität der Bedingungen, Konditionierungen, folglich der Dispositionen – einer Homogenität, die aus der positionalen Identität im sozialen Raum erwächst –, auf die Existenz als vereinigte Gruppe, als Klasse zu schließen. […] Die Gruppen – die sozialen Klassen zum Beispiel – müssen hergestellt werden. Sie sind in der sozialen Wirklichkeit nicht schlicht gegeben. (Bourdieu 1992, S.141f.)
Die Bedeutung der sozialen Organisation wird bei Bourdieu nicht nur durch den Begriff der sozialen Klasse unterstrichen, der notwendig einen Akt der (Selbst-)Repräsentation in politischen Kämpfen voraussetzt. Bourdieu betont auch, dass sich die Struktur des sozialen Raums selbst durch politische Kämpfe wandele (vgl. auch Kreckel 1997; Barlösius 2004), was an seinen späteren Arbeiten zu sozialen Feldern besonders deutlich wird (Bourdieu 1991b, 1998d, 1999, 2001a). Weil in Feldern ständig um relative Positionsmacht gekämpft wird, wandeln sich deren Regeln fortwährend: »Das literarische (usw.) Feld ist ein Kräftefeld, das auf alle einwirkt, die es betreten, und zwar je nach der Position, in die sie sich begeben […], in verschiedener Weise; und zugleich ist es eine Arena, in der Konkurrenten um die Bewahrung oder Veränderung dieses Kräftefeldes kämpfen.« (Bourdieu 1999, S.368)
43Obwohl Bourdieu also darauf verzichtet, die Sozialstruktur in den sozialen Kämpfen wiederzufinden, und obwohl er in seinem Spätwerk unterstreicht, dass in den verschiedenen Feldern einer Gesellschaft unterschiedliche Positionshierarchien entstehen, kann er das Problem nicht wirklich lösen: Wenn Kapital mehrere Formen annimmt und Kämpfe über den Wert des Kapitals entscheiden, die obendrein in verschiedenen Feldern unterschiedlichen Regeln folgen, kann dann noch von einer Sozialstruktur die Rede sein? Dieses Problem hat Luhmann in seiner Kritik der Klassengesellschaftstheorien auf den Punkt gebracht:
Ganz abstrakt kann das Problem als ein Problem der Abweichungsverstärkung oder der Steigerung von Ungleichheit in mehreren Dimensionen zugleich umschrieben werden. Es geht also nicht um Chancengleichheit schlechthin, also nicht darum, […] dass von zwei Bewerbern um Kredit derjenige die besseren Aussichten hat, der über mehr oder über sichereres Einkommen verfügt; oder dass die Schulerziehung diejenigen Schüler besser fördern kann, die schon mehr gelernt haben. Das Problem liegt in der Bündelung und in der wechselseitigen Verstärkung solcher Tendenzen zum Aufbau von Ungleichheiten. Es sind nicht die Ungleichheiten als solche, sondern ihre Interdependenzen, die als ›Klasse‹ (oder wie immer sonst) identifiziert werden. (Luhmann 1985: 144)
Luhmann selbst behauptet, dass die Funktionssysteme der Gesellschaft weitgehend autonom voneinander funktionierten, so dass eine Abweichungsverstärkung zwischen Ungleichheiten unwahrscheinlich sei (Luhmann 1995b, S.249). Allerdings interessiert sich Luhmann auch nicht für die Perspektive personaler Systeme, deren Handlungsfähigkeit zur Debatte steht, sondern er will ein Primat funktionaler Differenzierung in der Weltgesellschaft begründen und zeigt daher vor allem, dass die Weltgesellschaft zumindest nicht primär als Klassengesellschaft begriffen werden kann.
Bourdieu und Luhmann legen beide Differenzierungstheorien vor (Kieserling 2008), aber sie kommen zu gegensätzlichen Antworten auf die Frage, ob die Ausdifferenzierung von Gesellschaften mit stabilen und übergreifenden Strukturen sozialer Ungleichheit vereinbar ist (Weiß 2004). Während Bourdieu eine Reihe von Argumenten dafür findet, warum am Ende doch ökonomisches und kulturelles Kapital zentral zu stellen sind (Petzke 2009), ist Luhmann – auch aus Gründen, die nur theorieintern zu verstehen sind 44und die im sechsten Kapitel ausführlich erörtert werden – überzeugt, dass sich Ungleichheiten zwischen Funktionssystemen nur im Ausnahmefall verdichten.
Im Anschluss an diese zeitgenössischen Extrempositionen schlägt Schwinn (2004; 2013) vor, die Analyse ungleicher Handlungsbedingungen von Personen (»soziale Ungleichheit«) von der Analyse sozialer Differenzierung zu unterscheiden und beide Soziologien in die Gesellschaftsanalyse einzubeziehen. Ein Bindeglied, das für handlungs- und systemtheoretische Theorien bedeutsam ist, könnte der Lebensverlauf bilden: Individuen durchlaufen über die Zeit hinweg eine Reihe von Ordnungen, so dass Leistungsabhängigkeiten zwischen den Funktionssystemen entstehen. »So können wissenschaftliche und ökonomische Institutionen nur in Austausch treten, wenn Kohorte für Kohorte Menschen in Bildungseinrichtungen Wissen erwerben, das sie in späteren Phasen ihres Lebens als Arbeitskompetenz zur Verfügung stellen.« (Schwinn 2000: 473) Wenn man diese Leistungsabhängigkeiten benennt, »erweisen sich drei Machtressourcen als in besonderer Weise ungleichheitsrelevant und konvertibel: Wissen und damit verbundene Deutungskompetenz, ökonomische Marktchancen und politische Macht« (Schwinn 2000, S.472). Manche differenzierten Ordnungen (z.B. die Bildung) erzeugen Ressourcen, die für andere Ordnungen (z.B. das Beschäftigungssystem) wichtig sind, während andere (z.B. künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten) auf eine bestimmte Ordnung beschränkt bleiben (vgl. Schwinn 2000, S.476). Diese gesellschaftstheoretischen Argumente passen gut zur ungleichheitssoziologischen Debatte über die Dynamisierung der Ungleichheit im Rahmen (institutionalisierter) Lebensverläufe (Kohli 1985; Mayer 2000).
Von Seiten der Ungleichheitssoziologie wird der Anschluss an Differenzierungstheorien dadurch erleichtert, dass seit den 80er Jahren des 20.Jahrhunderts »Statusinkonsistenzen« zwischen verschiedenen Dimensionen von Handlungsbedingungen für möglich gehalten wurden. Klassische Beispiele sind die taxifahrenden Akademiker oder die armen, aber dank sozialer Vernetzung, Bildungsreichtum und Zukunftschancen glücklichen Studierenden. Damit wird die Eindeutigkeit von Hierarchien, die für Klassentheorien typisch ist, aufgegeben, ohne dass das Desiderat, stabile Strukturen sozialer Ungleichheit zu beschreiben, obsolet wird.
45In dieser Debatte hat Hradil ein Argument dazu entwickelt, warum es trotz Statusinkonsistenz zu strukturierten Sozialen Lagen kommen wird: Die gleichen Lebensziele lassen sich mit Hilfe unterschiedlicher Mittel erreichen. Das bringt die Möglichkeit mit sich, dass Überfluss in einer wichtigen Ressource Mängel in einer anderen Dimension substituieren oder kompensieren kann: »Nimmt man die Situation eines sehr reichen Menschen als Beispiel, so sind für ihn weder Arbeitsbedingungen noch die Leistungen des Systems sozialer Sicherheit, noch Wohn- und Umweltbedingungen oder staatliche Infrastrukturmaßnahmen in der Freizeit sonderlich wichtig.« (Hradil 1987, S.149) Da für alle genannten Lagerungsdimensionen Geld als direktes oder indirektes funktionales Äquivalent fungiert, kann der Reiche viele Lebensziele unabhängig von sonstigen Handlungsbedingungen mit Geld erreichen oder kompensieren. Entsprechend sind die oberen Lagen in Hradils Modell sämtlich durch eine primäre Dimension ungleicher Lebensbedingungen wie »Formale Macht«, »Geld« oder »Formale Bildung« gekennzeichnet, was inhaltlich nicht zufällig den Bourdieuschen Kapitalsorten oder den Schwinnschen Machtressourcen entspricht.