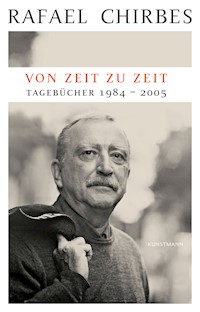31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit seiner Spanien-Trilogie spannte Rafael Chirbes (1940-2015) einen großen Bogen von der Herrschaft der Faschisten und der Politisierung der Jugend in den 1960er Jahren (»Der lange Marsch«) über den spannungsgeladenen Tag im November 1975, als Franco starb (»Der Fall von Madrid«), bis zum Aufbruch in die Demokratie und zur ernüchternden Bilanz der früheren Revolutionäre in den 1990ern (»Alte Freunde«). In feinen Momentaufnahmen aus dem Leben ganz gewöhnlicher Leute – ob Schuhputzer, Großindustrielle, Bauern oder Hausangestellte, Kollaborateure oder linke Studenten im Widerstand – verwebt Chirbes deren Hoffnungen und Enttäuschungen zu einer Geschichte des Landes von unten, einer Geschichte, die von den Menschen her erzählt wird. Ein großes literarisches Panorama der spanischen Gesellschaft im 20. Jahrhundert von ungebrochener Relevanz: Wer verstehen möchte, welche Schäden der Faschismus in Gesellschaften anrichtet, sollte Chirbes' Bücher lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1296
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
RAFAEL CHIRBES
DIE SPANIEN-TRILOGIE
Der lange Marsch
Der Fall von Madrid
Alte Freunde
Aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz
Verlag Antje Kunstmann
INHALT
DER LANGE MARSCH
TEIL I: DAS EBRO-HEER
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
TEIL II: DIE JUNGE GARDE
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
DER FALL VON MADRID
DER MORGEN
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
DER NACHMITTAG
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
ALTE FREUNDE
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
DER LANGE MARSCH
Roman
Aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz
TEIL I
DAS EBRO-HEER
ES WAR VIER UHR MORGENS an einem Tag im Februar. Trotz der geschlossenen Fensterläden war der Wildbach hinter dem Haus zu hören. Mehrere Tage hintereinander hatte es geschneit, dann war die Sonne durchgebrochen, danach hatte es geregnet, und jetzt führte der Bach viel Schmelzwasser und riss unter großem Getöse verdorrte Äste und Steine mit sich. Im Haus war eine besondere Aufregung zu spüren. Die Frauen kamen in die Küche und verließen sie mit dampfenden Töpfen, und im Kamin loderte ein mächtiges Feuer, das die Szene rötlich einfärbte, das Licht der Deckenlampe und auch der Lampe über dem Tisch übertönte, auf den, schweigsam und bewegungslos, ein gut dreißigjähriger Mann die Ellbogen stützte. Um die Schultern hatte er eine gestreifte Decke gelegt. Er saß auf der langen Holzbank, die zwei der vier Wände des Raumes säumte und einen Winkel bildete, in den sich der Tisch einfügte. Zu seiner Rechten rauchte ein anderer Mann eine Zigarette. Er war doppelt so alt, beider Gesichter aber waren – abgesehen von den Unterschieden, die das Alter mit sich brachte – fast identisch: so nebeneinander gesehen, hätten die beiden als Modell dienen können für einen der im Barock so beliebten moralisierenden Stiche, auf denen mit den Lebensaltern das Vergehen der Zeit am Körper der Menschen symbolisch dargestellt wurde. Wo sich die Züge des Sohnes noch der Linie des Kiefers und der Backenknochen anschlossen, verbreiterten sich die des Vaters, wurden in ihrer Zeichnung verschwommen und dadurch eher formlos; auch die Nase des Vaters sah aus, als hätte die des Sohnes gewissermaßen an Halt verloren und wäre zusammensinkend in die Breite gegangen. Die rosig gesunde Farbe der Wangen des Jüngeren war auf dem Gesicht des Alten ins Purpurne übergegangen und wies, vor allem seitlich der stumpfen Nase, Flecken von geplatzten Äderchen auf. Die blauen Augen waren jedoch von gleicher Lebendigkeit, obwohl die des Vaters eingesunken und, umgeben vom Saum dünner Wimpern, in die Feuchtigkeit des Tränensekrets getaucht waren, vielleicht aber gerade deshalb mit größerer Intensität zu glänzen schienen. Beide Körper strahlten eine unmäßige, fast rohe Kraft aus. Die machte sich in der Stimme des Jüngeren Luft, als in der Tür, die den Rest des Hauses mit der Küche verband, ein barfüßiges Kind in einem grün-weiß gestreiften Schlafanzug erschien. »Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich hier nicht sehen will, Lolo. Du gehst jetzt sofort ins Bett und bleibst da, bis es Zeit ist, zur Schule zu gehen«, sagte der Mann. Der Junge kam nicht dazu, ein Wort zu sagen, obwohl er den Mund schon geöffnet hatte. Er machte kehrt und tauchte in die Dunkelheit des Ganges ein. Sein Erscheinen hatte das Bild vom Vergehen der Zeit abgerundet. Denn das Gesicht war das der beiden Männer, vor vielen Jahren gesehen. Die drei Lebensalter. »Und Sie sollten sich auch hinlegen, Vater«, fuhr der junge Mann, nun in einem anderen Ton, fort. Der Alte machte keinerlei Anstalten zu antworten. Er führte die Zigarette an die Lippen, nahm einen tiefen Zug, stieß eine Rauchwolke aus und griff dann mit der rechten Hand das Kaffeeglas und trank einen Schluck. Der Kaffee im Glas dampfte. Die Gegenstände erschienen verzerrt im Wechselspiel von Licht und Schatten, das vom Kaminfeuer ausging, und dann und wann, wenn die Flammen an den feuchten Scheiten leckten, war ein Pfeifen zu hören und, ebenfalls nah, das Tosen des Wildbachs. Es war noch stockfinster. Wahrscheinlich brannten in keinem anderen Haus in Fiz die Lichter. Und vermutlich liefen in dieser Nacht nicht einmal die herrenlosen Tiere über die vom winterlichen Sturm gepeitschten Straßen und das Grenzgebiet zwischen dem Wald und den abseits liegenden Häusern, die nichts als eine Schattenmasse unter dem mondlosen Himmel waren. Manuel Amado hatte sich die gestreifte Decke kurz zuvor übergeworfen, als er durch die Hintertür hinaus zum Pferch gegangen war, um zu pinkeln. Draußen hatte er bemerkt, wie kalt es war und dass ein feiner Schneeregen einsetzte, der kaum zu spüren war, ihn jedoch in die warme Küche zurücktrieb. Ein neuer Optimismus beflügelte ihn. Der Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur hatte ihm ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Er fühlte sich als Herr und Besitzer dieses angenehmen, vom Küchenfeuer geschaffenen Klimas und alles dessen, was es einhüllte: die riesigen Töpfe, in denen das Wasser kochte, die weißen Laken auf dem Bett im Obergeschoss, von wo man Schritte hörte; seine Frau lag dort und sollte mit Hilfe der Hebamme und seiner ledigen Schwester Eloísa, die bei ihnen wohnte, erneut gebären. Vom Pferch zurückkommend, hatte er seinen Vater betrachtet, der einst das solide Steinhaus gebaut hatte, und er, der Sohn, führte dieses Werk fort, das eines Tages ihm gehören würde; er fühlte sich als Herr über die Granitmauern, das Schieferdach, die strohgewärmten Stuben, die Teller aus Ton, den Nussbaumtisch, das in der Speisekammer verwahrte Trockenfleisch, das Schmalz vom letzten Schlachtfest, die Würste in den Einwecktöpfen, über die Kühe, die in dem Stall im unteren Teil des Hauses muhten, die Hühner, die er, als er hinausgegangen war, sich im Gehege hatte regen hören. Er empfand für das alles eine zufriedene Zärtlichkeit, und mit ihr, mit der Sicherheit, die sie ihm gab, kam die Gewissheit, dass bei der Entbindung alles gutgehen würde. Sein zweites Kind, das schon seit Monaten im Inneren der Mutter lebte und das er, Ohr und Hand an Rosas aufgeschwollenem Leib, gehört und gespürt hatte, und das jetzt gleich ans Licht kommen musste, dieses Kind würde ein neu hinzugefügtes Teil des Familienwerks sein, so wie er selbst ein Stück des Werks gewesen war, das sein Vater, die Arbeit der Großväter aufnehmend, fortgeführt hatte; und die Zukunft, wenn auch noch in fernem Dunst liegend, erschien ihm in neuen, hoffnungsvollen Farben. Er liebte dieses Kind, das zweite, das ihm gewährt wurde und das, auch schon vor der Geburt, seiner helfenden Kraft am meisten bedurfte. Auch er war der Zweitgeborene gewesen und hatte vielleicht deshalb zusätzliche Gründe, es zu lieben. Als Lolo – so nannte man im Haus den Jungen, der ab heute der Älteste sein sollte und der, wie er selbst, Manolo hieß – in der Küchentür erschienen war, hatte Manuel Amado das Antlitz seines Vaters und das seines Erstgeborenen mit einem Blick erfassen können, und er war zufrieden gewesen, so wie er auch beim Wasserlassen in der dunklen Nacht Zufriedenheit verspürt hatte. Vom Strahl seines Urins war eine Wärme emporgestiegen, von der Erde als Dampf zurückgegeben, und diese Wärme war Ausdruck des Lebens, das er in sich trug: Es war ihm, als ob die beiden Szenen aufeinander bezogen wären; er, der in der Dunkelheit urinierte, seine Kraft auf den Mist im Pferch fallen ließ, und oben seine Frau, ihr Bett umgeben von Gefäßen voll kochenden Wassers, vom Dunst des Räucherwerks und dem Aroma der Kräuter, die in dem Kohlebecken schmorten; sie hatte teil an seiner Kraft, dieser inneren Kraft, die das, was nun geboren werden sollte, gezeugt hatte, und der anderen Kraft, die jene Landschaft der Gewissheit erschaffen hatte, die sie umgab. Er fühlte sich stark, als er zu dem Alten sagte: »Vater, gehen Sie schlafen«, als gewähre er ihm das großzügige Geschenk des Ausruhens nicht nur für diese Nacht, sondern für alles, was kommen mochte. Ohne sich dessen ganz bewusst zu sein, ließ er ihn wissen, dass nunmehr allein er, der Sohn, über die notwendige Kraft verfügte, den Reichtum des Hauses zu mehren. Er war sich seiner so sicher, dass er in eben dem Augenblick die Gewissheit zu haben glaubte, dass, was da kam, wieder ein Junge sein musste, und er wusste, welchen Namen er ihm zu geben hatte. Seine Frau und er hatten bei mehreren Gelegenheiten besprochen, welchen Namen sie nehmen sollten für den Fall, dass es ein Mädchen wäre – was seine Frau wünschte –, oder falls es, so wie er es wollte, wieder ein Junge würde, und sie waren sich noch nicht einig geworden. Jetzt, in diesem Augenblick, beschloss er den Namen und auch, dass es nicht mehr wichtig war, ob seine Frau ihn gut fand oder nicht, immerhin wusste er, dass sie, wenn er ihr unzweideutig seinen Willen kundtat, nichts dagegen einwenden würde. Er sollte Carmelo heißen, in Erinnerung an den Bruder, der ihm, dem Zweitgeborenen, vorangegangen war. Dessen Lebenskraft war in der fernen Steinödnis von Tafersit nutzlos vergeudet worden, ein Ort, den er, Manuel Amado, als er zum Militärdienst nach La Coruña beordert wurde, in kaum noch lesbarer Schrift auf einer alten Karte von Marokko entdeckt hatte, die in der Offiziersmesse der Kaserne hing. Tafersit. Dieser winzige schwarze Punkt auf der Landkarte hatte Carmelos Blut getrunken, das nicht einmal dazu getaugt haben dürfte, irgendein Kraut wachsen zu lassen: Carmelo hatte ihnen die Trockenheit jenes wüstenhaften Orts beschrieben, die unfruchtbaren Dünen, die Steine, die Sonne, die unversöhnlich die Böden schlug, auf denen sich Skorpione krümmten, das unheilvolle Lachen der Hyänen, das die Stille der Nächte brach. Dort war er für immer geblieben. Niemand schaffte die Leiche von Carmelo Amado Souto fort, um sie irgendwo würdig zu bestatten, noch schickte jemand den Angehörigen seine Sachen. Einige Zeit lang hatten sie unter dem Dach dieses Hauses die Hoffnung gehegt, dass er, von den Truppen Abdelkrims gefangen, bei einer Kampfaktion oder bei einem Gefangenenaustausch befreit und zurückgebracht würde, doch das Vergehen der Monate nahm ihnen diese Hoffnung. Abends klagte die Mutter um den verschwundenen Sohn, wenn sie in der dämmrigen Küche Kartoffeln schälte, Mais entkörnte, die abgetragenen Unterhosen stopfte, Socken ausbesserte und Pullover strickte. Sein Vater reiste vergeblich nach Lugo und auch nach La Coruña auf der Suche nach jenem Leichnam, der Manuel in seinen Träumen erschien, den Mund voller Sand. Nachts, im Schlaf, sah er diese Leiche, und er hörte den Sand zwischen ihren Zähnen knirschen und wachte schwitzend in dem Schlafzimmer auf, in dem die beiden Brüder das Bett geteilt hatten, bis Carmelo zum Militär gegangen war. Damals, in den langen Winternächten, als der Leichnam sich neben ihn legte und knirschend klagte, so wie der Wind wohl in der endlosen Wüstenlandschaft klagte, dachte Manuel, dass die Dinge auf geheimnisvolle Weise die Präsenz derer bewahren, die sie – Kleider, Räume, Plätze – benutzt haben, und dass dieser Traum sich wiederholte, um sich all dessen zu bemächtigen, was der Tote oft benutzt hatte: das Bett, das Waschbecken aus weißem Steingut, die Seife, den Spiegel in seinem Nussbaumrahmen, das Foto, das den kleinen Carmelo auf einem Papppferdchen zeigte, zweifellos ein Requisit des Fotografen aus Lugo, in dessen Studio das Bild aufgenommen worden war und dessen Unterschrift in einer Ecke des gelblichen Kartons zu sehen war. Die Leiche seines Bruders, die den Tag über friedlich zu schlafen schien, wachte nachts auf und kam, ihm den Schlaf zu rauben; knotige Finger umklammerten Manuels Schulter, und traurig knirschte der Sand zwischen den Zähnen. In seiner Verlassenheit, in den langen Stunden des Schweigens unter der Erde hatte Carmelo Amados Leichnam womöglich Zeit gehabt wahrzunehmen, dass hinter dem untröstlichen Leid seines Bruders sich etwas ganz anderes regte: nicht Genugtuung noch Freude, sondern nur ein bescheidenes und trauriges Gefühl der Erleichterung, als er erfuhr, dass Carmelos Tod ihn zum Erstgeborenen machte und ihm damit den ungewissen Horizont einer unersehnten Ferne, unbekannter Landschaften und auch Menschen ersparte, die, in auffällige Kleider gehüllt, mit fremdartigem Akzent sprachen. Er hatte bei Kirmesfesten die drei Indianos der Gegend gesehen, die in Übersee zu Reichtum gelangten Heimkehrer. Einer von ihnen lebte in dem großen Haus an der Plaza von Fiz; sie unterhielten sich, redeten gleichzeitig aufeinander ein, trugen weiße Kleidung, um den Hals hängende Schals und auffallende Panamahüte. Die Kinder gafften sie neugierig an und liefen um sie herum, während die Frauen und die Erwachsenen wisperten und ihnen scheele Blicke zuwarfen, in denen sich der Neid und die Angst vor dem Fremden mischten. Was hatten diese ermatteten Augen gesehen? Was hatten diese Hände mit den hervortretenden Adern berührt? Was hatten diese welken Münder wohl verzehrt und geküsst? Im Garten des Indiano von Fiz wuchsen fremdartige Pflanzen mit prächtigen Blüten: Glyzinien, Jacarandás, die an Fleischliches und Teuflisches denken ließen. Einer von ihnen hatte eine Frau mit zimtfarbener Haut und blitzenden Augen geheiratet; sie trug farbenfrohe Kleider, ein Kontrast zum monotonen Schwarz, in das sich die Frauen des Städtchens im Alter hüllten. Sogar zur Kirmes kamen sie mit ihrem Personal und ließen sich bedienen; doch La Mulata, so wurde sie im Ort genannt, nahm dann persönlich die Flasche von der Farbe durchsichtigen Goldes aus einem Behälter, in dem der Wein in Eis getaucht abkühlte, und lächelnd kredenzte sie ihn den Männern in hauchdünnen Kristallkelchen mit feinem Schliff. Das Gold der Kelche leuchtete in der Sonne wie eine Versuchung, und Manuel war unwiderstehlich angezogen von diesen Ritualen, die sich vor aller Welt, aber leicht abseits von der zur Kirmes gekommenen Menge vollzogen und den geheimnisvollen Regeln einer Kongregation zu gehorchen schienen. Manuel hatte die Warnung in diesem unheilversprechenden Schauer vor dem Unbekannten – den der Anblick der Indianos in ihm auslöste und der Schuldgefühle in ihm weckte – zum ersten Mal deutlich vernommen, als er mit seinem Vater nach La Coruña gefahren war und sie bei Einbruch der Nacht in einem bescheidenen Gasthof hinter der Calle Real einkehrten. Den ganzen Tag über hatte er in endlosen Gängen mit fahlgrün gestrichenen Wänden gesessen und gewartet, wäh rend sein Vater Militärs aufsuchte, die Verwandte von Verwandten oder von Nachbarn und Bekannten aus Fiz waren, und als es Abend wurde, war er mit seinem Vater die Kais am Hafen abgelaufen; er hatte die Schönheit des Meeres von den hochgelegenen Gärten aus bewundern können, wo ein Engländer begraben lag, der – auch er – gekommen war, um fern seiner Heimat zu sterben; er hatte die schreckliche, weiße Vollkommenheit jener riesigen Schiffe gesehen, die mit Amerika ihr Geschäft machten, in ihren Bäuchen eine Fracht von Elend, Verzweiflung, aber auch von Hoffnung. Als es dunkel wurde, hatte er die Schatten derjenigen gesehen, die sich am nächsten Tag einschiffen sollten und nun zwischen Bergen von Frachtstücken und den Kränen am Kai einen Schlupfwinkel für die Nacht suchten; und, als sie schon in der Pension waren, hatte ihn die Traurigkeit der Esser am Tisch angesteckt, die von Amerika mit eben dem Grauen sprachen, das auch sein Bruder empfunden haben musste, als er den Tod unter der sengenden Sonne nahen sah, die er in seinen Briefen beschrieben hatte. In jener Nacht hatten sein Vater und er in einem Zimmer mit nur einem etwas breiteren Bett geschlafen, und er war, während er die Wärme seines Vaters spürte und das Gewicht seines Armes, der sich im Morgengrauen um ihn legte, und das mühselige Atmen des Rauchers hörte, erleichtert gewesen, weil er sich nun, nach Carmelos Tod, nicht mehr auf diese Reise ins Unbekannte machen musste; er wusste, dass sein Leben sich auf einer vertrauten Landkarte einschreiben würde: der Weg durch den Eichenwald, der dunkle Stein der Wallfahrtskapelle und die Festabende zwischen den dampfenden Ständen der Schankfrauen aus Ribadeo, der Pferch mit den Kühen, die Weide, die sich bis zum Wildbach senkte, der silbrige Glanz der Forellen und die kalte Flamme des Lachses zwischen den Steinen. Daheim wurde in der Schrankschublade das von seinem Bruder geschickte Foto verwahrt, aufgenommen im Studio eines Fotografen aus Melilla, wie die gepunzte Signatur in der unteren linken Ecke zeigte. Auf die Hintergrundkulisse waren eine Palme, einige Basarbuden und ein Kamelpaar gemalt. In seinem ersten Brief hatte Carmelo die Überfahrt so beschrieben, als sei er der erste Seefahrer der Geschichte: die endlose Wasserfläche, das Unwetter, das sie am Kap San Vicente einholte, das dräuende Profil von Gibraltar und, hinter Kap Espartel, das weiße Häusermeer von Tanger, wie eine Ankündigung des Landes, das ihn erwartete, eingehüllt in einen Schleier von Geheimnissen und gespickt mit Drohungen; er schrieb, wie trostlos ihn die Küste von Almería, die unter der Sonne glühenden Hafenanlagen und die Hütten von La Chanca gestimmt hatten, die zwischen ein paar Pflanzen mit stacheligen Blättern den kahlen Berghang hinaufkletterten, davor das unheimliche Gemäuer der Burg. »Hier trocknet ein Galicier wie Dörrfleisch«, schrieb er im ersten Brief an seine Mutter, »ich versichere Dir, an dem Tag, an dem ich zu Hause durch die Tür komme, werdet ihr glauben, ein echter Mohr kommt, und dabei habe ich Afrika noch nicht betreten. Ich bin schwarz wie Schuhleder.« Er hatte Afrika noch gar nicht betreten. Er hatte nur sein Soldatenkleid angelegt, seinen Rucksack geschultert und sich den Befehlen unterworfen, die, auf Spanisch gegeben, für ihn schwierig zu verstehen waren; er verstand auch nicht, aus welchem Grund die Offiziere sie erst antreten, dann aus dem Glied treten ließen, warum sie gestikulieren, auf der Stelle treten und alle gleichzeitig das Gewehr heben und senken sollten. Aus den Augenwinkeln hatte er die Augen der Frauen von Almería gesehen, die sich hinter den Rollläden versteckten, wenn sie die Soldatentrupps durch die Gassen der Oberstadt heraufkommen sahen. »Am Tag, an dem ich zu Hause durch die Tür komme, werdet ihr meinen, ein echter Mohr tritt ein.« Doch Carmelo Amado kam niemals mehr durch die Haustür, noch setzte er sich in den Schatten der Kastanie zum Mundharmonikaspielen (Hohner: Die Marke war in das Etui geprägt und auch auf den glänzenden Rücken des Instruments). Ob die Mundharmonika, die mit ihm verschwunden war, noch irgendwo erklang? Wer blies auf ihr? Welche Hände hielten sie? Welche Musik tönte aus ihr? Und Carmelo belebte auch nie mehr mit seinen Gesprächen die Winterabende am Kamin. Nicht einmal in Form von Nachrichten kehrte die Erinnerung an ihn zurück. Nichts als ein mit Amtsstempeln verschmiertes Dokument, auf dem die Wendung »im Gefecht vermisst« zu lesen war. Das war alles, was die Rückflut des fernen Krieges von ihm zurückbrachte. Ein paar traurige Tintenkleckse. Ein Name und ein paar dunkle Sätze. Nicht mehr. Sie warteten noch Monate auf ihn, doch auch als der Krieg vorbei war, kam er nicht zurück. Die Jahre vergingen, Manuel wurde ein Mann, und Carmelo löste sich allmählich in Dunst auf: Er war nur noch ein kodifiziertes System von Gesten und Worten, an die sich jemand erinnerte, ein konditionales Wenn (»wenn er das gesehen hätte«, »wenn er hier gewesen wäre«, »wenn ihm das passiert wäre«), das gegenwärtigen Ereignissen Möglichkeitsformen entgegenstellte, ein paar Fotos, die dazu beitrugen, dass der Dunst sich nicht ganz auflöste, die Schrift in seinen Briefen, unregelmäßig, ungelenk, sie hob den Gott der Erinnerungen von seinem Sockel und verwies ihn in den beschränkten Raum eines ungebildeten Bauern zurück, der allzuoft die Regeln des Satzbaus und der Rechtschreibung verletzt hatte. Niemand konnte über ihn Auskunft geben. Der Umschlag, in einer Schublade der Anrichte, die Stempel, die Tintenflecken. Schatten auf einem Papier. Nachts kam nichts als ein schwarzer Schemen zurück und ließ Sand zwischen den unwirklichen Zähnen in den Alpträumen des Heranwachsenden knirschen, der seine Schuldgefühle ausschwitzte. Und als der Vater Jahre später Manuel zum nahen Bahnhof begleitete, von wo aus dieser zum Militärdienst aufbrechen sollte, den er dank Empfehlungen in La Coruña ableisten durfte, legte er dem Sohn die Hand auf die Schulter, sah ihm besorgt in die Augen und sagte: »Mit dir kann mir nichts passieren. Es hat mich viel gekostet, aber du kommst mir zurück«, und mit dieser gewaltsamen grammatikalischen Konstruktion und der verbalen Form, die mehr als eine Ankündigung von Zukünftigem ein unabweisbarer Imperativ war, ließ er den Sohn deutlich wissen, dass er ein Teil von ihm war, wie einst die Kinder, die Manuel bekommen würde, und die Kinder seiner Kinder ein Teil von ihm sein würden, sofern ihm Gott die Gnade gewährte, sie noch zu erleben, aber auch wenn er sie nicht mehr erlebte, denn die Familie war der Fluss, durch den das Leben strömte, und es war ein einziger Fluss, der sich rückwärts im Dunst der Vergangenheit verlor und vorwärts im Nebel dessen, was da kommen würde. Die Wiese, die Kastanie vor dem Haus und die Steine, die das Haus ausmachten, und der Wald und das Gehege, das alles war Teil des Mannes, der an jenem Morgen auf dem Bahnsteig zurückblieb, und musste auch ein Teil dessen sein, der im Zug fortfuhr und für dessen Sicherheit die Familie ein Gutteil ihres Geldes eingesetzt hatte. Manuel begriff an jenem Morgen, dass sein Vater in ihn investiert hatte, genau wie er investierte, wenn er die Dächer reparierte oder einen neuen Stall baute. Er hatte sein Geld in ihn gesteckt, wie man es jahrelang in einen Betrieb steckt und darauf wartet, dass er eines Tages etwas abwirft. Und der Rekrut wusste, dass es seine Pflicht war zurückzukehren, weil der Körper des Vaters keine weitere Verstümmelung vertrug. Jahre später, während des Krieges, als man ihn einige Monate lang als Soldat der Nationalen an die Aragón-Front schickte, musste er erneut daran denken. Wieder gelang es dem Vater über einen Freund, ihm nach kurzer Zeit einen sicheren Platz in der Intendantur zu verschaffen. Das Haus, der kleine Weinberg am Hang, die Tiere im Stall, sie bedurften seiner Rückkehr. Ein Haus konnte sich nicht auf einen Schwiegersohn oder einen Schwager stützen, auf neu gewonnene Verwandte, die mit Gier auf das blickten, was der Himmel, der Zufall oder – schlimmer noch – kühle Berechnung ihnen in den Schoß hatte fallen lassen. All das ging ihm durch den Kopf, während er den Vater anschaute, der nun, so viele Jahre später, neben ihm saß, und im Labyrinth der Falten sah Manuel jene Augen, die ihn auf dem Bahnhof angesehen hatten und ihn unabweisbar zur Rückkehr verurteilt hatten, und er dachte, dass der Vater die Nachtwache durchhielt wie ein Eigentümer, der sich weigerte, seine Eigentumsrechte aufzugeben. Es war ein Entschluss, der nicht nur in dem Glanz der Augen abzulesen war, sondern auch in den stark ausgeprägten Furchen zu beiden Seiten des Mundes, in der breiten Hand, in der Art und Weise, wie er die Zigarette zwischen die Kuppen von zwei Fingern nahm. Züge und Gebärden waren eine Einheit, die sich mit dem Begriff Eigentümer bestimmen ließ: Eigentümer des Hauses und der Möbel, der Tiere und Felder, all dessen, was sich in einem geografischen Raum bewegte, der strikt der seine war, der, wie der Same, der seinen Kindern das Leben gegeben hatte, aus ihm hervorgekommen war und sich bis zu einer genauen Grenze hin ausgebreitet hatte, die durch Kaufverträge und Geburtsurkunden festgelegt war und auch durch etwas Diffuses, so etwas wie eine Hülle, die alles umgab, die um alles und über allem lag, die mehr als alles und zugleich nichts war, nur eine Art zu begreifen und zu schauen, die Hand zu bewegen, um das Bein einer verletzten Kuh zu heben, mit kreisendem Arm auf Grenzmauern und Erhebungen des Geländes zu weisen, sich auf die Bank zu setzen und die Wärme zu genießen, die von den Holzscheiten in der steinernen Höhlung seines solide gebauten Kamins ausging. Eloísa kam herein, um einen neuen Topf mit heißem Wasser zu holen, und unterbrach Manuels Gedanken. Sie wechselten ein paar Worte – »es kommt schon, es liegt richtig«, sagte die Unverheiratete, die noch einmal die schmerzhaften Mysterien der Mutterschaft erlebte, ohne an ihren Wonnen teilzuhaben –, und dann, ein paar Augenblicke später, hallten Schritte im Obergeschoss, eine Tür wurde geschlossen, ein halbes Dutzend von zerrissenen Schreien war zu hören und danach eine Stille, die das Tosen des Wasserfalls aufsog und die nach und nach von einem fernen Wimmern gestört wurde, das anwuchs, in deutlich erkennbares Säuglingsschreien überging und die Tiefe der Nacht ausfüllte. Die beiden Männer sahen sich an und standen auf, der Jüngere mit einer einzigen Bewegung, langsam der Ältere, der die Geste, mit der er Schwung genommen hatte, um sich von der Bank zu lösen, nutzte, um den Zigarettenstummel auf die Glut im Kamin zu werfen. Carmelo Amado, der Neffe jenes Carmelo Amado, den die Sandwüsten Afrikas verschluckt hatten, und der letzte Erbe all dessen, was jenem zugestanden hätte, und auch – als Entschädigung oder Anmaßung, wer konnte das mit Sicherheit sagen? – seines Namens, war geboren. Die Uhr auf der Konsole im Gang zeigte sechs Uhr früh an. Es war der 16. Februar 1948. Als die beiden Männer das obere Stockwerk erreichten, wurden sie vor der Tür der Wöchnerin von der Hebamme empfangen, die das Neugeborene in den Händen hielt und es nun den beiden Männern zur Ansicht entgegenstreckte, die es aus einer wie zuvor vereinbarten vorsichtigen Distanz betrachteten, bevor sie es, einer nach dem anderen, in den Arm nahmen. Als diesem Ritual genügt war und sie flüsternd ihrer Zufriedenheit Ausdruck gegeben hatten, blieb der Ältere vor der Tür stehen, während der Jüngere in das Zimmer hineinging und das Neugeborene mitnahm, das nicht aufhörte zu schreien.
RAÚL VIDAL wusch sich erst die Hände an dem Hahn neben dem Wasserbecken, aus dem ein Schlauch die großen schwarzen Bäuche der Dampflokomotiven füllte. Er machte das jeden Abend, egal ob Winter oder Sommer. Zuvor rieb er Schmierfett und Kohleflecken mit einem Strohwisch ab, und wenn dann die Hände sauber waren, ging er in das Lager, zur Dusche am einen Ende des Raumes, zog sich aus und stellte sich unter den Wasserstrahl, um den ganzen Körper mit kaltem Wasser zu waschen. Es gefiel ihm, in sauberer Kleidung nach Hause zu kommen und die verschmutzte Kluft, die er am nächsten Tag wieder anziehen würde, auf den Bügeln im Magazin zurückzulassen, obwohl daheim seine Frau den Eimer mit heißem Wasser für ihn bereithielt und ihm zuweilen noch den Rücken schrubbte und damit die tägliche Hygiene vervollständigte. Ihm erschien es nicht richtig, in der lumpigen Arbeitskleidung der Bahnarbeiter über die Felder um den Bahnhof und durch die kleinen Gassen zu laufen. Manche Kumpel machten ihre Witze, wenn sie seinen weißen muskulösen Körper unter der Dusche sahen, aber das störte ihn nicht. Er setzte sich zum Abtrocknen auf die Bank vor der schmutzigen Kachelwand, zog die dunkle Hose und das weiße Hemd über, zündete sich eine Zigarette an und machte sich auf den Heimweg. Im Winter färbte sich seine Gesichtshaut nach der Berührung mit dem kalten Wasser rot, besonders wenn er sich dann dem frischen Wind aussetzte, der auf dem weiten Bahnhofsgelände zwischen den abgestellten Waggons pfiff. An solchen kalten Tagen war es schon Nacht, wenn er das Lagergebäude verließ, und er sah auf seinem Weg das Licht der Kneipe, das ihn manchmal für ein paar Augenblicke anzog. Er trank dort ein Gläschen und ging dann weiter heimwärts. Seit der Geburt seines Sohnes machte er noch kürzer bei der Kneipe halt. Er hatte seine Freude daran, diesen späten und unerwarteten Sohn heranwachsen zu sehen, den Adela empfangen hatte, als sie schon über vierzig war und er sich den Fünfzig näherte. In den ersten Monaten erfreute er sich daran, wie das gierige Mäulchen sich dem großen, dunklen Hof ihrer Brustwarze näherte und Milchtropfen die Lippenränder netzten. Manchmal streckte er unter ihrem empörten Blick den Finger aus, tauchte ihn in die Milch und führte ihn dann zum Mund: Sie war süß und hatte die Wärme jener verborgenen Orte, die er regelmäßig behorchte, nachts oder in den drückenden Stunden der sommerlichen Siesta, wenn das Sonnenlicht durch die Spalten zwischen den Holzblättern der Jalousien unregelmäßige Streifen auf die Wand warf. Manchmal kam er auch näher, um gleichzeitig ihre Brust und das Gesichtchen des Kindes zu küssen. Nach dem Abendessen blieb er am Esstisch sitzen und las unter der Lampe die Zeitungsseiten, die Fahrgäste auf ihren Sitzen oder in den Gepäcknetzen vergessen hatten und die er sich, wenn er heimging, in die Jackentasche steckte. Bevor die Putzfrauen kamen, machte er einen Gang durch die Waggons und sammelte die drei oder vier liegengebliebenen Zeitungen ein, die niemand mehr wollte, nicht einmal, um irgendeine Ware einzuwickeln. Abends daheim las er sie, murmelnd und mit dem Zeigefinger dem Lauf der gedruckten Zeilen folgend, als habe er Angst, sich zwischen ihnen zu verlieren. Adela, seine Frau, und Ana, die Tochter, nähten auf niedrigen Stühlen nah bei ihm, und er las, mit begieriger Aufmerksamkeit über die bedruckte Fläche der Zeitung gebeugt. An manchen Abenden las die Tochter ihm vor. Raúl schloss die Augen halb, hörte sich die Nachrichten an und bat ab und zu, sie möge einen Absatz, dessen Sinn ihm entgangen war, wiederholen. Er hatte ihr die ersten Buchstaben beigebracht, aber das Mädchen hatte bald gelernt, sie sorgfältig und sicher auszusprechen, zu Worten aneinderzureihen, einige Wörter hervorzuheben und andere auf unauffällige Weise fließen zu lassen. Sie konnte auch bemerkenswert zeichnen, und sie stickte, erledigte als Zwölfjährige schon Arbeiten für die Nachbarschaft und brachte etwas Geld heim, führte auch für die Mutter Buch über die Haushaltsausgaben. Raúl vertrieb sich die Zeit damit, die karierten Hefte durchzublättern, die sie mit Buntstiften bemalte, bis die Figuren entworfen waren, die sie dann auf Stoff stickte: gelbe Entlein und Blumenkörbe, Häuschen mit rotem Ziegeldach und blauen Türen, mit denen sie Bettücher, Kissen, Kittel und Lätzchen für Neugeborene verzierte; verschlungene Initialen zur Auszeichnung der Aussteuer der Bräute oder als Schmuck an manchen Kleiderausschnitten, an den Taschen von Hemden und Pyjamas oder Taschentuchecken. Im Sommer arbeitete Raúl nach Feierabend im Gemüsegarten – er hatte ein Stückchen Land unweit des Hauses gepachtet –, und das Mädchen und die Frau brachten ihm die Vesper und halfen ihm dabei, die Furchen zu ziehen und zu schließen, durch die das Wasser fließen sollte. Zuweilen, wenn er keinen Dienst hatte und das Wetter gut war, verbrachten sie den ganzen Tag im Garten. Eben dort, im Gemüsegarten, hatte er an einem Abend im Frühsommer von der Geburt des Jungen erfahren. Ana war gekommen und hatte gesagt, die Mutter sei plötzlich krank geworden; er war zum Haus gerannt, doch als er ankam, lag das Kind schon sauber und kuschelig auf Adelas Brust. Dieser Junge würde ihm nachschlagen, dachte Raúl, auch er mochte sich nicht verschmutzt den Blicken anderer aussetzen. Am Abend hatte er die Freunde in die Taverne eingeladen, und er war leicht angeheitert und mit einer Zigarre zwischen den Lippen heimgekommen. Das war die Nacht, in der er seinen Bruder am meisten vermisst hatte. Angeregt vom Alkohol, war er an dem Haus, in dem der Bruder wohnte, unter den Balkons entlanggegangen. Beinahe hätte er nach ihm gerufen, um ihn auf ein Glas einzuladen. Er hatte sich nicht getraut. Die Geburt des Sohnes wäre vielleicht ein guter Grund gewesen, sie nach zwei Jahren, in denen sie nicht miteinander geredet hatten, wieder zusammenzubringen. Sorgsam waren sie sich aus dem Weg gegangen, tatsächlich gab es aber kaum noch einen Ort in Bovra, wo sie hätten aufeinandertreffen können, da sie sich inzwischen in unterschiedlichen Kreisen bewegten. Sein Bruder ging zu den Bällen im Kasino, zu den Ausflugsfahrten, die regelmäßig die gute Gesellschaft der Stadt zu Orten wie Fátima, Lourdes, Ávila oder Santiago de Compostela und auch zu mehr oder weniger entfernten Stränden brachte, er dagegen bewegte sich weiterhin in dem beschränkten Raum zwischen Bahnhof, Kneipe und seinem Haus und ging nur ab und zu in die Bars an der Plaza, um sich dort ein paar Stunden lang mit Hermenegildo zu treffen, seinem Freund aus Kindertagen, der nach seiner Heirat vor ein paar Jahren in die kürzlich an der Landstraße erbaute Siedlung gezogen war. Manchmal ging er mit Hermenegildo auch sonntagnachmittags zum Fußball; damit führten sie eine Jugendgewohnheit fort, die sie über Jahre mit Antonio geteilt hatten. Jetzt konnten sie diesen auf der anderen Seite des Feldes, auf der Tribüne, beobachten, wo er umgeben war von all diesen Krawattenträgern, die sich langsam bewegten, so als schauten sie nur in sich hinein. Es war der einzige Ort, an dem er Antonio hin und wieder sah, und manchmal dachte er, dass er vielleicht gerade deshalb mit immer weniger Lust zu den Spielen ging, denn die Tatsache, dort von fern den Bruder zu sehen, wie er sich mit der frisch erworbenen Sicherheit bewegte, brachte sein Blut in Wallung, was dazu führte, dass er an solchen Abenden übermäßig trank. Er kam mit schlechter Laune nach Hause und ließ sie an Frau und Tochter aus. Sie waren nicht schuld an seinen Schwierigkeiten. Nach Kriegsende war er weiter Hilfsarbeiter bei Vías y Obras geblieben, während er diejenigen rasch aufsteigen sah, die von außen kamen, ausgestattet mit Empfehlungen, die stets das patriotische Verhalten im nationalen Lager hervorhoben. Selbst jene kamen voran, die vor dem Krieg mit ihm zusammengearbeitet hatten, aber bei der Bahn als Kollaborateure aufgetreten waren: die aus der fünften Kolonne, wie man im Krieg jene nannte, die den Dienst behinderten, mit verräterischer Unlust arbeiteten oder sogar kleine Sabotageakte am Material der Eisenbahn verübten. Er selbst hatte sich nie politisch hervorgetan. Wie fast alle war er Mitglied in der UGT, der sozialistischen Gewerkschaft, gewesen; er hatte in Teruel und in Gandesa im republikanischen Heer gedient, da Bovra republikanisches Gebiet gewesen war und auch weil es seinen Vorstellungen als Arbeiter entsprach, als Proletarier, wie es in jenen Jahren hieß; er hatte seinen Bruder – der bei der Vereinigten Sozialistischen Jugend aktiv gewesen war und darum eingesperrt und zum Tode verurteilt wurde – die drei Jahre lang unterstützt, die dieser im Gefängnis von Alcoy saß. Und für all das zahlte er jetzt bei der Arbeit. Besonders für letzteres. Denn sein Bruder hatte sogleich begonnen, zu eben jenen, die ihn verraten und eingesperrt hatten, Beziehungen zu knüpfen, er hingegen hatte Distanz bewahrt, und diese distanzierte Haltung erst hatte ihm die Aura eines Roten verschafft. Es war unfasslich, dass einer, der ein militanter Roter gewesen war, zu Versammlungen gegangen und Fahnen geschwenkt hatte, bei der Beschlagnahmung der Güter von Bürgerlichen und Kollaborateuren geholfen und sogar mit einem Benzinkanister die Kirchenfassade besprengt hatte, so dass die Steinreliefs am Portal vom Feuer rußgeschwärzt waren, dass so einer heute etwas zu sagen hatte und sich auf die Freundschaft von Eduardo Alemany, des Besitzers der Weizenmühle und einer Exportfirma für Früchte, stützen konnte. Antonio war aus dem Gefängnis gekommen und hatte es eilig gehabt, die Jahre aufzuholen, die er darin verloren hatte. An dem Tag, als er entlassen worden war, sagte er, während Adela ihm den Kopf mit Petroleum abrieb, um die Läuse zu entfernen: »Weißt du, Raúl, ich habe bereits genug getan. Du weißt nicht, was ich durchgemacht habe.« Raúl meinte ausreichend Bescheid zu wissen. Obwohl er bei Kriegsende nur ein paar Monate im Gefängnis gewesen war, da nichts Belastendes außer der Tatsache, dass er im republikanischen Heer gedient hatte, gegen ihn vorlag, wusste er sehr wohl, was es hieß, Hunger zu leiden, denn in den drei Jahren von Antonios Haft war das wenige Geld, das sie verdienten, bei Fahrten zum Gefängnis draufgegangen, wohin sie ihm das Essen brachten, das sie sich vom Mund abgespart hatten. Im Grunde war Raúl davon überzeugt, dass von ihnen beiden er selbst derjenige war, der mehr Hunger gelitten hatte. Wenn Antonio wüsste, wie oft er nach Hause gekommen war und behauptet hatte, nicht hungrig zu sein, um Adela und dem Mädchen das Nötigste zu lassen und dem Bruder ein paar gebackene Süßkartoffeln bringen zu können, ein Brot, Eier (in jenen Jahren war ein Ei so weiß wie ein Wunder) oder ein paar Orangen. Deshalb, und weil die Angst oder der Groll und die Rachegefühle nie gewisse Grenzen überschreiten sollen, da sie sonst den Menschen klein und zum Nichtsnutz werden lassen, hatte er die Hast nicht verstanden, mit der sein Bruder dem ganzen Ort die Abkehr von seinen alten Ideen vorführte. Als man ihm erzählte, dass am Sonntagnachmittag im Kino nach Ende der Vorstellung – und gemäß den von den Siegern erlassenen Normen – die Zuschauer aufgestanden waren, um mit hochgestrecktem Arm ›Cara al sol‹ anzustimmen, und dass Antonio, der zwischen ihnen stand, das gleiche getan hatte, und ein alter Franquist ihn vor aller Welt geohrfeigt und gesagt hatte, ein rotes Arschloch habe nicht das Recht, die Hymne des Falangegründers zu beschmutzen, da hatte Raúl gedacht, dass sein Bruder die Grenze überschritten hatte, die für einen Mann die Schande von der Würde trennt, und dass von nun an irgendjemand ihm ein Stück Brot hinwerfen könnte und er es aufschnappen würde, dass man ihm einen Tritt geben könnte und er, wie ein Hund, aufjaulen und davonlaufen würde. Doch sein Bruder ließ sich nicht beirren. Am folgenden Sonntag ging er wieder ins Kino und sang erneut mit halbgeschlossenen Augen ›Cara al sol‹. Und da sagte schon keiner mehr etwas. Und nach wenigen Wochen lud er die Schwester von Alemany mit ihren Freundinnen zu einem Kaffee ein und scherzte auf dem Paseo mit ihnen, vor den Augen eines Städtchens, das noch nicht zum Scherzen aufgelegt war, vor Männern, die noch ihre Brüder, Verwandten und Freunde im Gefängnis hatten und nur deshalb am Sonntag zu dieser Zeit auf den Paseo kamen, weil hier die Tagelöhner für die kommende Woche angeheuert wurden. Raúl wusste nicht, ob Antonio zuerst Partner von Alemany oder Verlobter von dessen Schwester gewesen war, wusste auch nichts von den Demütigungen, die der Bruder hatte ertragen müssen, bevor er in jenem Haus, das sich durch stolze und militante rechte Gesinnung ausgezeichnet hatte, akzeptiert wurde. Tatsache war, dass er nach kurzer Zeit die einzige Tochter der Familie heiratete und dass er, ganz folgerichtig, nicht einmal daran dachte, Adela und ihn einzuladen, die ihn doch während seiner Haftzeit durchgefüttert und, als er zurückkam, aufgenommen, gewaschen, eingekleidet und ernährt hatten. Raúl empfand Bitterkeit und Verachtung, aber wenn er sah, wie Adela oft bis spät in die Nacht nähte, um das Haushaltsgeld aufzubessern, und wie seine Kollegen bei der Bahn sich auf höher angesehene und bezahlte Posten davonmachten, dann sah er sich selbst auch als armen Mann und fand, dass der Hund, der sich niederkauerte, um das hingeworfene Stück Brot aufzuschnappen, nicht sein Bruder war, der in Alpakaanzüge gekleidet Havannas rauchte und das Lederetui auf der Tribüne am Fußballplatz herumgehen ließ oder den Hut beim Verlassen der Kirche aufsetzte, nein, er selbst war das, der mit Schmieröl und Kohle verschmutzt eine Draisine von Vías y Obras lenkte und anschob oder im Schlamm stand und die Tomaten goss, die seine Frau am nächsten Tag unter sengender Sonne zum Markt brachte; ölverschmutzt machte er am Bahnhof die von anderen verachtete Arbeit und sah, wie seine Frau bis zum Morgengrauen sorgfältig Kleider bügelte, die sie nicht einmal im Traum je würde anziehen können. Dann hätte er sich am liebsten einen Strick um den Hals gebunden, wie man ihn den Hunden umbindet (was war er?); aber dann, einige Zeit später, war außer seinen beiden Frauen auch noch der Junge da. Raúl fing schon an, die Dinge mit ihrem Namen zu verlangen, und schmierte mit Buntstiften in die Hefte, die Ana ihm vorlegte, und zeigte mit dem Finger auf die Dinge und sagte Haus, Baum, Wasser und Hund: mit einem noch halbverschluckten H konnte er schon das Wort für Hund sagen.
AN REGENTAGEN GING DER VERDIENST ZURÜCK. Die Leute suchten unter dem Bogengang an der Plaza Schutz und brachten den Nachmittag damit zu, unter den Arkaden herumzuspazieren, und dann war es, als bliebe kein Platz für die Kunden oder als ertrügen diese nicht, vor den Augen so vieler Menschen auf dem Stuhl des Schuhputzers sitzen zu müssen, zu dem man über zwei Holzkisten hochstieg. Außerdem, wozu sich die Schuhe wienern lassen, wenn sie gleich darauf in Matsch und Regen wieder schmutzig würden. Nur ein paar Viehzüchter, einige Vertreter und Händler aus der Provinz ließen sich die soeben gekauften Schaftstiefel mit Talg einschmieren, damit das Leder nicht vom Wasser brüchig würde. Pedro del Moral, der Schuhputzer, der sich immer neben den Tischen des Novelty postierte, hasste Regentage. Sofort nach Einbruch der Dunkelheit verstaute er Schuhwichse und Bürsten und packte Kiste und Schemel zusammen, die er für ein paar Gefälligkeiten, Botendienste und ähnliches im Keller des Cafés unterstellen durfte. Er wusch sich vorsichtig die Hände, damit keine Flecken von der Schuhcreme im weißen Waschbecken zurückblieben, kettete die Stühle zusammen und sicherte sie mit einem Schloss und ging die Rúa entlang Richtung Tejares. Bevor er nach Hause kam, machte er drei oder viermal in Tavernen, die auf seinem Weg lagen, halt, und an solchen Regentagen trank er, da er vorzeitig Schluss gemacht hatte, immer etwas zuviel. Seine Frau war vor sieben Jahren an den Komplikationen nach der Entbindung von José Luis gestorben. Dem Ältesten hatten sie den Namen Ángel gegeben; allerdings stellte sich bald heraus, dass er nicht einem Engel, sondern einem Teufel glich, nun aber war er glücklicherweise auf dem Weg, seine zerstörerischen Instinkte in Bahnen zu lenken: Dank Don Ramiro bekam er mit siebzehn allmählich seinen heftigen Charakter in den Griff. Der ehemalige Boxer sammelte die Jugendlichen ein und trainierte sie in einem verlassenen Schuppen am Rande des Stadtviertels. Auf dem Heimweg, schon im Dunkeln, sah Pedro die Lichter im Lager brennen und hörte die kurzen Schreie, die der Veteran und die Aspiranten ausstießen, und sie erinnerten ihn an die Befehle, die ihnen der Feldwebel beim Militärdienst entgegengeschleudert hatte. Die Schreie verloren sich in der Nacht oder schwebten über den Häusern des Viertels, in deren Fenstern man nur das unstete Licht der brennenden Karbidlampen sah: längliche, seltsame Schatten, als kämen sie von unförmigen Wesen aus einer anderen Welt – enorme Buckel, verzerrte Köpfe, riesige Hände. Den Namen des zweiten Sohnes, José Luis, hatten seine Frau und er ein paar Monate vor der Geburt gemeinsam beschlossen. Sie fanden diesen Doppelnamen elegant. Pedro hatte immer an Namen geglaubt, er meinte, sie prägten in gewisser Weise den Menschen, und dass selbst wenn dem nicht so war, es immer noch leichter sei, mit einem klangvollen Namen wie José Manuel, Juan Francisco, José Pablo oder José Antonio – ein Name, der damals Mode war und vielen Kindern als Erinnerung an den Gründer der Falange gegeben wurde – etwas zu erreichen, als mit einem dieser gewöhnlichen Namen, die zu Witzen herausforderten und denen, schon wenn man sie aussprach, ein trüber Hauch von Elend anhaftete. Bei Ángel hatte sich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Namenswahl nicht gerade als vorausschauend erwiesen, aber wer konnte schon wissen, ob das Schicksal des jungen Mannes nicht eines Tages einen anderen Verlauf nahm. Er stellte sich seinen Namen auf einem Plakat vor: »Der Engel von Tejares«, oder einfach: »Ángel del Moral. Kastilischer Meister im Mittelgewicht«. Oder »Spanischer Meister«. Und die Stimme von Matías Prats oder eines der berühmten Rundfunksprecher würde diesen Namen voller Bewunderung aussprechen, während sie einen siegreichen Kampf aus dem Campo del Gas in Madrid oder vielleicht aus einer Stadt im Ausland kommentierte. In Fuentes de Esteban, dem Dorf, aus dem er bei Kriegsende nach Salamanca gekommen war, hatte er schlicht Pedro Moral geheißen, erst während seiner Zeit im Nationalen Heer hatte er gelernt, wie wichtig es war, ein »del« vor den Nachnamen zu setzen. Diese jungen, überaus sauberen Leutnants, die ihre Studien an der Universität abgebrochen hatten, um dem Vaterland zu dienen, hießen nie einfach Castillo oder Gutiérrez Montes, sondern Del Castillo oder Gutiérrez de los Montes. Also hatte er, als er im blauen Hemd und mit einem Orden auf der linken Tasche (der Seite des Herzens) in Salamanca das Schild malte, das er von nun an jeden Morgen auf den Arbeitssitz stellen sollte, nicht, wie es logisch gewesen wäre, »Pedro Moral. Schuhputzer« geschrieben, sondern »Pedro del Moral. Hygiene und Glanz für das Schuhwerk«. Anfangs lachten die Leute, nicht so sehr wegen des Namens Del Moral, sondern wegen Hygiene und Glanz, was nach Apotheke klang oder nach einem jener Häuser hinter der Clerecía, die, wie man es damals nannte, Hygienegummis verkauften, um bei den Dienstleistungen der Mädchen Ansteckungen zu vermeiden. Im Krieg war man im einen wie im anderen Lager davon überzeugt gewesen, dass der Feind die Huren ansteckte, um die Moral der Truppe zu untergraben. Nach dem Tod seiner Frau war er gelegentlich ins Chinesenviertel gegangen, hatte drei oder vier Gläser getrunken und war mit einer der Frauen hinaufgegangen, um die überschüssige Energie des Witwers loszuwerden. Wenn er wieder herauskam, war er nicht glücklich. Das war nicht die Zukunft, die er sich in seiner Jugend, damals in Fuentes de San Esteban, vorgestellt hatte. Vom fernen Ausguck seiner Armut aus hatte er von schönen Dingen geträumt, die er schon mit den Fingerspitzen zu berühren glaubte, als er aus einem Krieg als Sieger zurückkehrte (»Sieger«, so hatte man sie genannt). Der Krieg hatte ihm zwar gezeigt, dass die Menschen, sogar die besten, zum Bösen fähig waren, dennoch glaubte er, die Nachkriegszeit werde wundervoll sein und ihnen, die der spanischen Flagge gegen die Horden der Republik gedient hatten, gehören. Das versprachen ihnen die hohen Offiziere, wenn sie die Schützengräben besuchten, sie antreten ließen und dann zu ihnen sprachen (»Sieger über die gottlosen Horden des internationalen Kommunismus«), auch jene, die im Radio Reden hielten und deren Stimmen man zu jeder Tageszeit in den Kantinen hören konnte. José Luis del Moral war ein schöner Name für seinen Sohn, so wie dieses Spanien, das, wie er dachte, im Kommen war, schön sein musste. Es war der Name eines Kaufmanns, eines Viehzüchters, eines Rechtsanwalts, eines Sportlers, Bischofs, Arztes oder eines Gelehrten. Seine Frau und er malten sich die Zukunft dieses Kindes vor seiner Geburt aus, mit Illusionen, die für Asunción nicht lange währen sollten, da sie wenige Tage nach der Entbindung am Kindbettfieber starb. So schmerzlich der Tod der Mutter war, er hätte den Strom der Hoffnung nicht eintrüben müssen, der von jenem unschuldigen Kind ausging, das von Anfang an Ziegenmilch aus dem Fläschchen trinken musste, von Pedro dreimal aufgekocht, damit der Kleine sich nicht das Maltafieber holte. Er verdünnte die Milch mit Wasser, damit sie für den Säuglingsmagen nicht zu schwer war. Die Ziege hatte Pedro einer Zigeunerfamilie abgekauft, um die Mutter in der Schwangerschaft zu ernähren, und das Tier hatte dann weiter vor dem Häuschen geweidet und ihnen Milch gegeben, bis es im letzten Winter gestorben war. Ángel hatte den Tierkörper in die Müllgrube hinter den letzten Hütten des Viertels geworfen, und die Hunde hatten eine ganze Nacht lang um die Reste gekämpft. José Luis hatte den Vater mit tonloser Stimme gefragt, warum sie nicht selbst die Ziege gegessen hätten, und Pedro musste ihm erklären, das Tier sei an einer Krankheit gestorben, und man esse die Tiere, die man töte, aber nicht diejenigen, die stürben, obwohl er sich, als er Ángel mit dem Tier auf der Schulter hinter der Rodung verschwinden sah, dieselbe Frage wie sein kleiner Sohn gestellt hatte. Während er die kahlen Erlenstämme der Quinta und die über den Wassern des Tormes schwebenden Kirchtürme betrachtete, dachte er an den Geschmack jenes gebratenen Fleisches, und es war ihm, als gäbe es in seinem Leben jemanden, der Nacht für Nacht das zerstörte, was er den Tag über aufbaute. Er dachte an seine Frau, an den Tag, an dem sie beschlossen hatten, Fuentes de San Esteban zu verlassen und nach Salamanca zu ziehen, weil das für alle das beste schien: für seine Frau, für ihn, für das gemeinsame Kind und für diejenigen, die, so Gott wollte, noch kommen würden. Jene Fahrt im Autobus: Sie trug ein graues Kostüm, selbstgeschneidert aus einem Stück Stoff, das Pedro ihr bei seinem letzten Urlaub von der Aragón-Front mitgebracht hatte, er trug das blaue Hemd und den Orden auf der Brust und war davon überzeugt, dass sich ihm mit diesem Passierschein jede Tür öffnen würde. Er erinnerte sich an die vielen Eichenwälder, die er durchs Fenster gesehen hatte, an die Plätze der Städtchen, in denen der Bus gehalten hatte, um neue Passagiere aufzunehmen. Und vor allem an die entmutigende Ankunft in einer Stadt, auf die ein Regen von Blau und Blech gefallen zu sein schien, denn alle Männer waren angezogen wie er selbst: blaues Falange-Hemd mit Orden. Er meinte, die Welt bräche zusammen, als er die Adressen aufsuchte, die man ihm vor seiner Abreise aus dem Dorf gegeben hatte, und als er vor den Türen die uniformierten Männer (die meisten hatten mehr als einen Orden) in endlosen Schlangen darauf warten sah, dass sie in geheimnisvollen und schlechtgelüfteten Büros empfangen wurden. All diese Leute, so dachte er, hatten bestimmt mehr Empfehlungsschreiben dabei als er, und die waren zweifellos von bedeutenderen Händen unterschrieben als der des lokalen Sekretärs und Führers der Bewegung in Fuentes de San Esteban. Im übrigen hatte der Krieg ihn zwar daran gewöhnt, mit schwachen, kranken und verwundeten Körpern zusammenzuleben, doch hier atmete die Stadt selbst eine Schwäche aus, die ihn verletzte. Dort, in den langen Schlangen, fielen seine aus den blauen Ärmeln ragenden bäuerlichen Hände übermäßig auf. Diese kurzen und kräftigen Finger und die harten, verhornten Handflächen wirkten gewöhnlich neben den bleichen Händen derer, die neben ihm standen, die manchmal um einen Bleistift baten und ihn anmutig nahmen und ebenfalls anmutig die Zigarette zum Mund führten. Wenn das Gefühl zu ersticken unerträglich wurde, musste er aus dem Stadtzentrum flüchten, all diese alten, in Stein gehauenen Fassaden, die Säulen und Statuen hinter sich lassen, die ihm zu sagen schienen, dass dort seit jeher mit Bleistift und Papier hantiert worden war, schon immer Federn in klebrige Tintenfässer getaucht, Briefe, Hunderte, Millionen von Empfehlungen, wie die in seiner Tasche, geschrieben worden waren. Er beugte sich über die Brücke und sah in den Fluss, sah das Wasser gegen die Dämme schlagen, sah die stillen Pappeln am Ufer und den Flug der Vögel zwischen den Bäumen und die riesigen Türme und Kuppeln der Kathedralen und Kirchen, und ihm ging durch den Kopf, dass er die Rückfahrkarte verpfändet hatte, um hierher zu kommen, ja, er dachte, dass er nicht mehr den Autobus nehmen konnte, der ihn in ein paar Stunden in sein Dorf zurückbrächte, denn er hatte in seinem Dorf nichts zurückgelassen: Rauken und Steineichen, die anderen gehörten, Erinnerungen, die nicht zu kaufen oder zu verkaufen waren und unter denen man keinen Schutz fand bei Regen oder Kälte oder wenn im Winter sanft und grausam der Schnee fiel. Niemand kann ermessen, was Pedro del Moral beim Tod seiner Frau gefühlt hat, als er dieses eben geborene Kind in seinen Händen anschaute und sah, es war nur von ihm: Nur von ihm hing ab, ob das Kind, das noch nicht getauft und noch nicht im Standesamt registriert, daher noch ohne Namen und ohne offizielle Existenz war, einst eine Toga oder eine Mitra tragen oder im Radio perfektes Spanisch sprechen würde (es hieß, das beste Spanisch sei das von Valladolid, aber er war sicher, in Salamanca, mit seiner Jahrhunderte alten Universität, sprach man ein besseres), und ob einst jemand seine Büste in irgendeine Fassade schlagen oder in einem Innenhof oder auf einem Platz aufstellen würde und damit ein neuer Steinbrocken in dieser Stadt der Statuen und der Steine erstünde und so den vielen von Kampf und auch Mutlosigkeit erfüllten Jahren einen Sinn gäbe, oder ob das Kind, winzig wie es war, sich in Staub auflösen würde, um nichts als Staub zu sein, Pedros Träume in namenlosen Staub verwandelnd, wie auch seine tote Frau und zuletzt ihn selbst. Nachts wachte er auf, wenn er es weinen hörte, und bemerkte, dass der Schatten seines Daumens die Wange des Kindes bedeckte. Das machte ihm angst. Soviel Zerbrechlichkeit. Es war, als hätte man ihm mitten in der Schlacht befohlen, einen zerbrechlichen Glaskrug zwischen explodierenden Granaten durch die Schützengräben zu tragen. Wie weit würde er kommen? In welchem Augenblick würde das Glas in tausend Stücke zerspringen? Würde die Explosion ihn verschonen? Beim zweiten Glas Wein dachte er, dass ihn nun zwei Kräfte vorantrieben. Und es erschien ihm merkwürdig, dass die beiden Kräfte so unterschiedlich waren. Die eine Kraft ging von Ángel aus, wenn er frisch geduscht vom Training zurückkam oder ihm den Umschlag mit Geld brachte, den er jede Woche in der Autowerkstatt bekam, wo er als Lehrling angefangen hatte. Ángels Kraft lag in seinen Armen, die immer fester wurden, in seinem Hals, der immer breiter geriet, in seinen harten und behaarten Beinen. Ángel war eine starke Kraft, auf die man sich stützen konnte, die einen aufheben oder umwerfen konnte – sie hatten manchmal gestritten, und er hatte gesehen, wie der Sohn wütend die Fäuste schloss, wie er diese Kraft bändigte, um sie seinen Vater nur im Guten spüren zu lassen –, aber da war dann auch die andere Kraft, die ihm José Luis übermittelte. Das war die Kraft der Zerbrechlichkeit, die in ihm eine unerhörte Energie freisetzte, ihn dazu brachte, jenen Körper zu schützen, der sich allmählich streckte, der sich erst auf allen vieren voranschleppte und sich dann auf zwei Füße stellte, tapsig zu gehen begann und dann zu laufen, und der dennoch zart blieb: schmale Schultern, eingesunkene Brust, kleine, unruhige Augen, Beine wie schwaches Schilfrohr. Und all diese Zerbrechlichkeit war wie ein Gefäß, das an einem langen Strick in ihn hinabgelassen wurde und Kraft aus dem Brunnen zog, der er war, aus seinem schattigen Inneren. Im ersten Jahr hatte er, wenn er nachts den Kopf des Kindes in der Handfläche hielt, manchmal gedacht, dass er die offene Hand nur zu schließen bräuchte. Er hatte gemeint, dass der schattige Brunnen in ihm versiegt wäre. Asunción Capilla. 1917-1948. Das stand auf der kleinen Steinplatte, die er eigenhändig auf den Haufen Erde gesetzt hatte, dem man ansah, dass er erst kürzlich aufgeworfen worden war. Den Stein hatte Andrés bearbeitet, einer der Nachbarn in den Hütten, der als Steinmetz arbeitete und ihm seine Arbeit und auch das heimlich aus der Werkstatt geschaffte Material geschenkt hatte. Am Anfang war er fast täglich zum Friedhof gegangen, um das Grab seiner Frau zu besuchen. Jetzt war er schon seit längerem nicht da gewesen. Wozu auch. Die Toten sehen nicht, hören nicht und verstehen nicht. Und die Lebenden schmerzt, was sie dort sehen. Nun ja, nicht das, was sie dort sehen, sondern das, was sie dort wissen und das an einem anderen Ort sein müsste. Asunción, an einem anderen Ort: an einem sonnigen Nachmittag vor der Haustür nähend, in der Küche über den Eintopf gebeugt, ihm die Hemdbrust für einen Spaziergang zurechtzupfend, an einem Tag, wo er nicht zu seinem Schuhputzerstand gegangen ist, an seiner Seite liegend, das Mondlicht scheint durchs Fenster auf ihr Nachthemd, das ihre weiße Brüste sehen lässt. Gott. Was für ein Scheißgott. Die Erinnerung an ihre weiße Weichheit verfolgt Pedro. Er hat sie in den ungelüfteten Zimmern des Chinesenviertels gesucht. Er sucht sie in dem flüchtigen Anblick von Waden und Armen, wenn die Frauen auf der Plaza Mayor hastig an ihm vorübergehen. Er schaut auf diese Waden von seinem Bänkchen aus, auf dem er, eine Handbreit vom Boden, mit einer Kippe zwischen den Lippen sitzt. Manchmal war es ihm, als erkenne er es. Dieses Fleisch. Aber näher überprüfen konnte er das nie. Dunkle Strümpfe, die das weiße Leuchten des Fleisches umhüllen, Schuhe mit hohen Absätzen, auf denen sich die Muskeln anspannen, die, bei nacktem Fuß, wieder einladend weich werden. Flüchtige Figuren, die einen Augenblick vor ihm aufscheinen, während er auf dem Bürgersteig vor dem Novelty sitzt und auf Kundschaft wartet. Zuweilen denkt er, dass, obwohl es auf der Welt Millionen von Menschen gibt, jedes Fleisch anders ist, eine eigene Farbe, einen eigenen Geruch hat, sich anders anfasst und nicht zu kopieren ist. Er hat die halbgeöffneten Schenkel von Asunción verloren. Und er hat sie so verloren, wie andere ein Körperglied an der Front verloren haben, das, lange nachdem es abgetrennt und begraben worden ist, immer noch schmerzt. Der Wein ist eine Medizin, die diesen Schmerz erst lindert und dann verstärkt. In manchen Nächten, spät, gibt ihm der Wein das amputierte Glied zurück, und Asunción schmerzt ihn, als würde sie an irgendeinem frostigen Ort erneut von ihm abgetrennt. Eine Winternacht auf den kahlen Bergen von Alcañiz. Er denkt: »Sieger in einem Krieg«, wenn er trinkt, und der Wein bringt ihm das Eis der Sierras von Teruel und auch ihre fiebrige Blässe während der Krankheit zurück, das Bett, ihre Reglosigkeit, den Geruch des ungewaschen und verschwitzt daliegenden Körpers: ein niederträchtiger Geruch, der den der glücklichen Nächte ersetzen will, ihn überdeckt und beschmutzt, bis er ihn ganz zum Verschwinden bringt. In jenen Nächten weiß er, er muss sich im Haus einschließen, denn würde er Trost im Chinesenviertel suchen, könnte er den Schmerz nicht ertragen und begänne vor allen Leuten zu schreien. Dann meint er, dass Asunción, obgleich sie nicht zart war, in der Zerbrechlichkeit von José Luis weiterlebt, und morgens sieht er ihm beim Ankleiden zu, sieht, wie er die kurzen Hosen anzieht, die Hosenträger über die Schultern führt, den von Ángel geerbten Wollpullover überzieht, den dieser ungefähr in seinem Alter getragen hat, der José Luis aber noch zu groß ist. Ihm beim Ankleiden zuzuschauen ist, als sähe er ihr beim Entkleiden zu. Und während der Junge sein Glas Milch trinkt, sagt er zu ihm: »Onkel Andrés hat mir gesagt, du sollst am Sonntag ins Kino kommen.« Andrés ist, auch wenn er ihn so nennt, nicht der Onkel des Jungen. Er ist ein Freund des Vaters, der die Woche über als Steinmetz und samstags und sonntags als Portier im Alamedilla-Kino arbeitet und José Luis an einigen Sonntagen erlaubt, umsonst in der letzten Reihe zu sitzen. Der Junge verlässt frühzeitig das Haus, geht über die Brücke und vertreibt sich die Zeit damit, den Vögeln nachzuschauen, die über das Flussbett des Tormes fliegen, er durchquert die ganze Stadt, erreicht das Kino, bevor die Türen geöffnet werden, und wartet ungeduldig, bis all die Menschen hineingehen, die dort Schlange stehen; er wartet neben der Metalljalousie, bis der Film beginnt, und schleicht, wenn die Lichter gelöscht werden, von Andrés’ Hand geschoben, auf Zehenspitzen in die letzte Reihe. José Luis geht gerne ins Kino. Er sieht den Film von ganz hinten und kann den gesamten Kegel leuchtenden Staubs verfolgen, der aus dem kleinen Fenster der Kabine strömt, aber er wäre gern einmal wie die anderen hereingegangen, wie die Jungen, die von klein auf eine Krawatte tragen und, obwohl sie so alt sind wie er, Pluderhosen und eine feine Strickweste unter der Jacke, die den Krawattenknoten hervorhebt: den Sitz wählen, auf den man Lust hat, die numerierte Eintrittskarte am Schalter verlangen, die Gesichter, die Gesten der Schauspieler gut sehen, nicht wie von dort oben, wo man auch kaum etwas hört, weil Kinder, die so angezogen sind wie er, durch die Gänge laufen und spielen, nach unten gehen und sich eine Limonade und eine Tüte Kartoffelchips oder eine Waffel bestellen, dort zu stehen, bis die Wochenschau beginnt, und auf das Klingelzeichen und das Verlöschen der Lichter zu warten und darauf, dass die Neonlichter wie leuchtende Fäden um die Leinwand und die Ränge und um die Stukkaturen der Decke aufscheinen, in Formen, die manchmal an eine Blume und manchmal an einen Fisch erinnern. Er denkt, dass er das einmal schaffen wird, in einer Stadt, wo ihn keiner kennt, wo keiner ihn »Putzer« nennt, weil er der Sohn seines Vaters ist; er denkt, wenn er groß ist, wird er sich in eine der ersten Reihen setzen; von dort aus müssen, streckt man die Hand aus, fast die Gesichter und Haare jener schönen Frauen zu berühren sein, die da lachen, singen und weinen, und man muss die Hitze der rauchenden Pistolen nach einem Schusswechsel spüren. Er wirkt zwar jünger, ist aber schon sieben Jahre alt und kann sehr gut lesen. Nach der Heimkehr vom Kino wartet er unruhig auf seinen Vater, um ihm den Film von vorne bis hinten zu erzählen. Es ist erstaunlich, wie er auf jede Einzelheit achtet, die er auf der Leinwand gesehen hat. Sorgfältig schildert er sie dem Vater und fügt manchmal sogar etwas hinzu, das der Filmregisseur vergessen hat. Der Vater hört ihm erst erfreut zu, hat es aber dann später eilig,