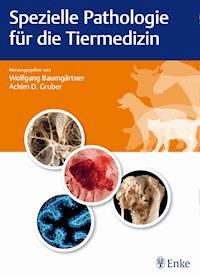
Spezielle Pathologie für die Tiermedizin E-Book
99,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Enke
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kann ein Pferd von der Blauzungenkrankheit befallen werden? Kriegen auch andere Hunderassen eine Boxerkolitis? Die Pathologie hat nicht nur auf diese Fragen eine Antwort: Detektivisch geht sie der Ursache und den Auswirkungen jeder Erkrankung auf den Grund. - Systematisch werden die einzelnen Organsysteme aufgeführt und ihre speziellen Erkrankungen nach ihrer Ätiologie gegliedert. - Einprägsame Beispielbilder helfen beim Wiedererkennen von alltäglichen wie auch seltenen Erkrankungen. - 25 organübergreifende Krankheiten (wie FIP oder Staupe) sind in übersichtlichen Steckbriefen beschrieben. - Neue und bald bei uns zu erwartende Infektionskrankheiten (Schmallenberg-Virus, West-Nil-Virus, Bocavirus und viele andere) sind lückenlos berücksichtigt. - Praxisrelevante Zusammenhänge sind jeweils besonders hervorgehoben und bleiben so im Gedächtnis. Die Pathologie hat alle Antworten und mit diesem Buch wissen auch Sie alles (besser).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1261
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Spezielle Pathologie für die Tiermedizin
Wolfgang Baumgärtner, Ph.D., Dipl. ECVP, DACVP (hon.), Achim D. Gruber, Ph.D., Dipl. ECVP
Wolfgang Baumgärtner, Ph.D., Dipl. ECVP, DACVP (hon.), Achim D. Gruber, Ph.D., Dipl. ECVP, Andreas Beineke, Dipl. ECVP, Christiane Herden, Dipl. ECVP, Marion Hewicker-Trautwein, Dipl. ECVP, Robert Klopfleisch, Dipl. ACVP, Lars Mundhenk, Dipl. ECVP, Christina Puff, Dipl. ECVP, Peter Schmidt, Dipl. ECVP, Reiner Georg Ulrich, Ph.D., Peter Wohlsein, Dipl. ECVP,
430 Abbildungen
Widmung
Unseren geliebten Familien in großem Dank und unendlicher Zuneigung gewidmet: Für Angelika und Lars sowie Barbara, Lukas, Luise und Ben
Vorwort
Der rasante Wissenszuwachs in der Medizin und Tiermedizin betrifft besonders auch die spezielle Krankheitslehre der Tiere. In erster Linie zählen hierzu wesentlich erweiterte Erkenntnisse über die Krankheitsentstehung (Pathogenese) und Diagnostik, besonders auch auf molekularer Ebene. Eine zentrale Bedeutung in der Tiermedizin nehmen darüber hinaus neu auftretende, teils seuchenhaft verlaufende Infektionskrankheiten ein, die bisher in Zentraleuropa keine Rolle spielten. Das Spektrum letzterer („emerging diseases“) hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dazu gehören nicht nur reine Tierseuchen, sondern auch Infektionen, die vom Tier auf den Menschen (Zoonosen) übertragen werden. Diese Entwicklungen hängen u.a. mit der zunehmenden Globalisierung, der damit verbundenen verstärkten Reiseaktivität auch von Tieren, dem Import von exotischen Tierarten, dem Ländergrenzen überschreitenden Warenaustausch und der globalen Erwärmung zusammen. So kann Letztere Lebensbedingungen für bestimmte Infektionsüberträger begünstigen. Als Folge kann es innerhalb von Stunden zur Verschleppung von Infektionserregern von einem Kontinent zum anderen kommen und damit zum erstmaligen Ausbruch von Einzeltiererkrankungen oder zu schweren Seuchen. Ohne professionelle tiermedizinische Kompetenz in der frühen Erkennung und Bekämpfung drohen dramatische gesundheitliche Folgen und wirtschaftliche Verluste. In diesem Zusammenhang sind die bei uns neuen Infektionskrankheiten wie Blauzungenkrankheit und die Schmallenbergvirus-Infektion beispielhaft zu nennen. Das West-Nil-Virus sowie Grippeviren der Tiere bedrohen darüber hinaus als Zoonoseerreger zusätzlich zu ihrer Bedeutung bei Haus-, Wild- und Nutztieren auch die Gesundheit und das Leben von Menschen. Ferner ist ein Wiederauftreten von fast vergessenen Krankheiten („re-emerging diseases“) wie z.B. Rotz und Tuberkulose zu beobachten.
Um diesen Entwicklungen adäquat zu begegnen, wurde ein relevantes Spektrum an etablierten und neuen Krankheiten in dieses Lehrbuch aufgenommen, auch mit Berücksichtigung ihres zoonotischen Potenzials.
Das Grundkonzept dieses Lehrbuches umfasst eine übersichtlich gegliederte Darstellung der speziellen Tierkrankheiten für Studierende, die auch als Nachschlagewerk für praktisch tätige Kollegen sowie Wissenschaftler angrenzender Gebiete gedacht ist. Bei aller nötigen Kürze sollte gleichzeitig die gebotene Vollständigkeit und Aktualität für alte, neue und auch seltene Erkrankungen gewährleistet bleiben. Zum grundlegenden Verständnis der anatomischen und physiologischen Grundlagen wird auf die entsprechenden Standardwerke verwiesen. Gleiches gilt für allgemeine Aspekte der Krankheitsentstehung einschließlich der Benennung krankhafter Veränderungen. Diese finden sich in den Lehrbüchern der „Allgemeinen Pathologie" und „Histopathologie für die Tiermedizin“. Auch muss in Anbetracht der überwältigenden Vielzahl von Krankheiten bei Tieren wie Reptilien, Fischen, anderen Nicht-Säugern und Wildtieren sowie exotischen Spezies auf die jeweils spezifische Fachliteratur verwiesen werden. Im Anhang findet sich zudem eine Auflistung von Standardwerken unterschiedlicher Spezialgebiete der Tierkrankheiten, auf die in diesem übergreifenden Standardlehrbuch nur ansatzweise eingegangen werden kann.
Bei der Konzipierung des Buches finden die jahrelangen Erfahrungen der Herausgeber als Hochschullehrer und diagnostisch tätige sowie wissenschaftlich engagierte Pathologen ihren Niederschlag. Wie in früheren Lehrbüchern der speziellen Pathologie wird in bewährter Weise eine primäre Systematik nach Organveränderungen gewählt. Allerdings erschwert diese Darstellung aus Organperspektive einen übergreifenden Blick für solche Krankheiten, die gleichzeitig oder zeitversetzt verschiedene Organsysteme betreffen können. Dies bedeutet, dass beim Nachschlagen von Systemkrankheiten zum Gesamtverständnis des Krankheitsbildes auf eine Vielzahl von Seiten und Kapiteln zurückgegriffen werden muss. Zur deutlichen Vereinfachung bietet dieses Buch erstmals einen kombinierten Ansatz aus organbezogener Systematik und ergänzenden organübergreifenden „Synopsen“ für typische Systemkrankheiten. Hierbei wird der Krankheitsverlauf in seiner organübergreifenden Komplexität abgebildet. Darüber hinaus werden jeweils Ätiologie, Epidemiologie, ggf. zoonotisches Potenzial, Pathogenese, wesentliche pathologisch-anatomische und histologische Merkmale sowie spezifische Diagnoseverfahren für die Kranheiten dargestellt.
Zusätzlich zu diesem neuen kombinierten Konzept finden relevante Praxisbezüge und aktuelle Entwicklungen in Form von textlich abgesetzten Einschüben („Wissenswertes“) Einzug in das Buch, nachdem diese sich in unserem Lehrbuch „Allgemeinen Pathologie für die Tiermedizin“ bewährt haben. Zusammen mit neuen Pathogeneseschemata sollen diese neuen Elemente LeserInnen in die Lage versetzen, die zugegeben sehr zahlreichen und komplexen Tierkrankheiten schnell und nachhaltig in allen relevanten Aspekten zu erfassen. Außerdem wird in Hinblick auf eine konsequente Umsetzung der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen auf die Anzeigepflicht bestimmter Infektionserkrankungen in Deutschland hingewiesen.
Unser Dank gilt allen Koautoren und zahlreichen Mitarbeitern der beteiligten Institute für ihre engagierten Beiträge und nicht zuletzt den vielen wertvollen und konstruktiven Diskussionen. Ein besonderer Dank der Herausgeber gebührt Frau Dr. Dorothea Hartmann und Frau Dr. Frauke Seehusen, Institut für Pathologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, für die äußerst engagierte und professionelle Mitarbeit insbesondere bei der Zusammenstellung der Synopsen. Dem Enke Verlag, vertreten durch Frau Dr. Maren Warhonowicz, Frau Carolin Frotscher und Frau Anna Mus, gilt unsere besondere Anerkennung für die angenehme, professionelle und äußerst engagierte Betreuung bei der Konzeption und Fertigstellung dieses Buches.
Hannover und Berlin, Herbst 2014
Wolfgang Baumgärtner und Achim D. Gruber
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
Teil I Spezielle Pathologie
1 Große Körperhöhlen
1.1 Postmortale Veränderungen
1.2 Missbildungen
1.3 Fremdinhalte
1.3.1 Luft oder Gas
1.3.2 Flüssigkeit
1.3.3 Feste Körper
1.4 Kreislaufstörungen
1.5 Stoffwechselstörungen und degenerative Veränderungen
1.6 Entzündungen
1.6.1 Übersicht
1.6.2 Exsudative Körperhöhlenentzündungen
1.6.3 Proliferative Körperhöhlenentzündungen
1.6.4 Parasitär bedingte Entzündungen
1.7 Tumoren
1.7.1 Primäre Tumoren
1.7.2 Sekundäre Tumoren
2 Verdauungsorgane
2.1 Einleitung
2.1.1 Besonderheiten des Verdauungstrakts
2.1.2 Typische Reaktionsmuster des Darmes auf Schädigungen
2.1.3 Postmortale Veränderungen
2.2 Maul- und Rachenhöhle
2.2.1 Missbildungen
2.2.2 Farbveränderungen, Kreislauf- und Stoffwechselstörungen
2.2.3 Entzündungen
2.2.4 Tumoren und tumorähnliche Veränderungen
2.3 Speicheldrüsen
2.3.1 Zysten
2.3.2 Entzündungen
2.3.3 Tumoren
2.4 Zähne
2.4.1 Missbildungen und Entwicklungsstörungen
2.4.2 Anomalien der Zahnabnutzung
2.4.3 Plaque, Zahnstein und Karies
2.4.4 Feline und Kanine odontoklastische resorptive Läsionen
2.4.5 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
2.5 Ösophagus
2.5.1 Form- und Lageveränderungen
2.5.2 Entzündungen
2.5.3 Tumoren
2.6 Vormägen der Wiederkäuer
2.6.1 Stoffwechselstörungen
2.6.2 Fremdkörper-assoziierte Erkrankungen
2.6.3 Entzündung der Vormägen
2.7 Magen und Labmagen
2.7.1 Form- und Lageveränderungen
2.7.2 Entzündung
2.7.3 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
2.8 Darm
2.8.1 Missbildungen
2.8.2 Lageveränderungen
2.8.3 Obturation und Obstruktion
2.8.4 Kreislaufstörungen
2.8.5 Stoffwechselstörungen
2.8.6 Entzündungen
2.8.7 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
3 Leber, Gallesystem und exokrines Pankreas
3.1 Leber und galleabführende Wege
3.1.1 Postmortale Veränderungen
3.1.2 Missbildungen
3.1.3 Form- und Lageveränderungen sowie Zusammenhangstrennungen
3.1.4 Kreislaufstörungen der Leber
3.1.5 Kreislaufstörungen der Gallenwege
3.1.6 Hepatosen: Stoffwechselstörungen der Leber und reaktive Veränderungen
3.1.7 Entzündungen der Leber
3.1.8 Entzündungen des galleabführenden Systems
3.1.9 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren der Leber und des Gallesystems
3.2 Exokrines Pankreas
3.2.1 Postmortale Veränderungen
3.2.2 Missbildungen
3.2.3 Lageveränderungen und Kreislaufstörungen
3.2.4 Stoffwechselstörungen und degenerative Veränderungen
3.2.5 Entzündungen
3.2.6 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
4 Hämatopoetisches System
4.1 Einleitung
4.2 Knochenmark
4.2.1 Genetisch bedingte Entwicklungsstörungen
4.2.2 Stoffwechselstörungen
4.2.3 Reaktive Veränderungen des Knochenmarks
4.2.4 Tumoren
4.3 Thymus
4.3.1 Missbildungen
4.3.2 Stoffwechselstörungen
4.3.3 Kreislaufstörungen
4.3.4 Reaktive Veränderungen
4.3.5 Tumoren
4.4 Milz
4.4.1 Missbildungen
4.4.2 Lageveränderungen und Zusammenhangstrennungen
4.4.3 Kreislaufstörungen
4.4.4 Stoffwechselstörungen
4.4.5 Reaktive Veränderungen
4.4.6 Entzündungen
4.4.7 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
4.5 Lymphknoten
4.5.1 Missbildungen
4.5.2 Kreislaufstörungen
4.5.3 Stoffwechselstörungen und Fremdinhalte
4.5.4 Reaktive Veränderungen
4.5.5 Entzündungen
4.5.6 Tumoren
4.6 Hämatopoetische Tumoren
4.6.1 Lymphozytäre Tumoren
4.6.2 Myeloische Tumoren
4.6.3 Histiozytäre proliferative Veränderungen
5 Kreislauforgane
5.1 Herz und Herzbeutel
5.1.1 Postmortale Veränderungen
5.1.2 Missbildungen
5.1.3 Epi- und Perikard
5.1.4 Myokard
5.1.5 Endokard
5.1.6 Tumoren am Herzen
5.2 Blutgefäße
5.2.1 Gefäßmissbildungen
5.2.2 Arterien
5.2.3 Venen
5.2.4 Vaskulitiden mit spezifischer Ätiologie
5.2.5 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
5.3 Lymphgefäße
5.3.1 Zusammenhangstrennungen
5.3.2 Obstruktionen und Lymphangiektasie
5.3.3 Entzündungen
5.3.4 Lymphgefäßthrombosen
5.3.5 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
6 Atmungsorgane
6.1 Nase, Nebenhöhlen und Luftsäcke
6.1.1 Postmortale Veränderungen
6.1.2 Missbildungen
6.1.3 Kreislaufstörungen
6.1.4 Stoffwechselstörungen und degenerative Veränderungen
6.1.5 Entzündungen
6.1.6 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
6.2 Kehlkopf
6.2.1 Missbildungen
6.2.2 Kreislaufstörungen
6.2.3 Degenerative Veränderungen
6.2.4 Entzündungen
6.2.5 Tumoren
6.3 Luftröhre
6.3.1 Missbildungen
6.3.2 Formveränderungen
6.3.3 Degenerative Veränderungen
6.3.4 Entzündungen
6.3.5 Tumoren
6.4 Lunge mit Bronchien
6.4.1 Postmortale und agononale Veränderungen
6.4.2 Entwicklungsstörungen und Missbildungen
6.4.3 Struktur- und Lageveränderungen
6.4.4 Kreislaufstörungen
6.4.5 Stoffwechselstörungen und degenerative Veränderungen
6.4.6 Entzündungen
6.4.7 Tumoren
7 Harnorgane
7.1 Niere
7.1.1 Postmortale Veränderungen
7.1.2 Missbildungen
7.1.3 Kreislaufstörungen
7.1.4 Degenerative Veränderungen
7.1.5 Entzündungen
7.1.6 Hydronephrose
7.1.7 Tumoren
7.2 Harnleiter, Harnblase und Harnröhre
7.2.1 Missbildungen
7.2.2 Form- und Lageveränderungen
7.2.3 Kreislaufstörungen
7.2.4 Entzündungen
7.2.5 Urolithiasis
7.2.6 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
8 Reproduktionsorgane
8.1 Störungen der Geschlechtsdifferenzierung und Intersexualität
8.1.1 Physiologische Entwicklung
8.1.2 Missbildungen
8.2 Weibliche Geschlechtsorgane
8.2.1 Ovarien
8.2.2 Salpinx
8.2.3 Uterus
8.2.4 Vagina und Vulva
8.2.5 Pathologie der Trächtigkeit
8.3 Milchdrüse
8.3.1 Missbildungen
8.3.2 Kreislaufstörungen
8.3.3 Entzündungen
8.3.4 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
8.4 Männliche Geschlechtsorgane
8.4.1 Hoden und Nebenhoden
8.4.2 Akzessorische Geschlechtsdrüsen
8.4.3 Penis und Präputium
8.4.4 Skrotum
9 Nervensystem
9.1 Einleitung
9.2 Zentrales Nervensystem
9.2.1 Missbildungen
9.2.2 Viral bedingte Entwicklungsstörungen im ZNS
9.2.3 Speicherkrankheiten
9.2.4 Kreislaufstörungen
9.2.5 Traumatische Schädigungen
9.2.6 Degenerative Veränderungen
9.2.7 Axonopathien
9.2.8 Myelinopathien
9.2.9 Spongiforme Enzephalopathien
9.2.10 Entzündungen
9.3 Peripheres Nervensystem
9.3.1 Hereditäre Neuropathien
9.3.2 Kreislaufstörungen (vaskuläre Neuropathien)
9.3.3 Toxische Neuropathien
9.3.4 Stoffwechselstörungen
9.3.5 Idiopathische und paraneoplastischen Neuropathien
9.3.6 Endokrin bedingte Neuropathien
9.3.7 Mechanisch-traumatische Neuropathien
9.3.8 Entzündungen
9.3.9 Neuropathien der Pars motorica des Nervus vagus
9.3.10 Idiopathische Gesichtslähmung
9.4 Vegetatives Nervensystem
9.4.1 Missbildungen
9.4.2 Funktionelle Magenstenose des Rindes
9.4.3 Dysautonomien
9.5 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren des Nervensystems und seiner Hüllen
9.5.1 Tumorähnliche Veränderungen
9.5.2 Tumoren des ZNS
9.5.3 Tumoren des PNS
9.5.4 Tumoren des VNS
10 Stütz- und Bewegungsapparat
10.1 Knochen
10.1.1 Missbildungen
10.1.2 Knochenveränderungen infolge eines Traumas
10.1.3 Kreislaufstörungen und Nekrose
10.1.4 Stoffwechselstörungen
10.1.5 Entzündungen
10.1.6 Hyperostosen
10.1.7 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
10.2 Gelenke
10.2.1 Entwicklungsbedingte Störungen
10.2.2 Traumatisch bedingte Veränderungen
10.2.3 Degenerative Veränderungen
10.2.4 Entzündungen
10.2.5 Tumorähnliche Verändungen und Tumoren
10.3 Muskulatur und Sehnen
10.3.1 Missbildungen
10.3.2 Traumatische und kreislaufbedingte Störungen
10.3.3 Degenerative Myopathien
10.3.4 Entzündungen
10.3.5 Tumorähnliche Verändungen und Tumoren
10.4 Sehnen und Sehnenscheiden
11 Haut
11.1 Postmortale Veränderungen
11.2 Effloreszenzen
11.3 Missbildungen
11.3.1 Defekte der Epidermis
11.3.2 Defekte der Haare und Hautanhangsdrüsen
11.3.3 Pigmentierungsstörungen
11.3.4 Bindegewebsdefekte
11.3.5 Defekte komplexer Strukturen
11.3.6 Dermatomyositis
11.4 Stoffwechselstörungen
11.4.1 Atrophie und Alopezie
11.4.2 Störungen der Verhornung
11.4.3 Störungen der Pigmentierung
11.4.4 Störungen der Bindegewebsbildung
11.4.5 Diätetisch bedingte Hautveränderungen
11.4.6 Nekrose
11.4.7 Funktionsstörungen der Talg- und Schweißdrüsen
11.4.8 Endokrin bedingte Hautveränderungen
11.4.9 Einlagerungen in Dermis und Subkutis
11.5 Kreislaufstörungen
11.6 Immunpathologische Hauterkrankungen
11.6.1 Kutane Überempfindlichkeitsreaktionen
11.6.2 Autoimmune Hautkrankheiten
11.6.3 Weitere immunvermittelte Hautkrankheiten
11.7 Physikalisch oder chemisch verursachte Hautkrankheiten
11.7.1 Mechanische Ursachen
11.7.2 Thermische Ursachen
11.7.3 Aktinische Ursachen
11.7.4 Elektrizität
11.7.5 Chemische Ursachen
11.8 Belebte Ursachen
11.8.1 Virale Hauterkrankungen
11.8.2 Bakterielle Hauterkrankungen
11.8.3 Mykotische Hauterkrankungen
11.8.4 Kutane Algeninfektionen
11.8.5 Parasitäre Hauterkrankungen
11.9 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
11.9.1 Tumorähnliche und tumoröse epitheliale Umfangsvermehrungen
11.9.2 Tumorähnliche und tumoröse mesenchymale Umfangsvermehrungen
11.9.3 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren der pigmentbildenden Zellen
11.9.4 Sekundäre Tumoren
12 Endokrine Organe
12.1 Einleitung
12.2 Hypophyse und Hypothalamus
12.2.1 Missbildungen
12.2.2 Kreislaufstörungen
12.2.3 Degenerative Veränderungen und Stoffwechselstörungen
12.2.4 Entzündungen
12.2.5 Hyperplasien
12.2.6 Tumoren
12.3 Schilddrüse
12.3.1 Missbildungen
12.3.2 Kreislaufstörungen
12.3.3 Degenerative Veränderungen und Stoffwechselstörungen
12.3.4 Funktionsstörungen
12.3.5 Entzündungen
12.3.6 Hyperplasien
12.3.7 Tumoren
12.4 Nebenschilddrüse (Epithelkörperchen)
12.4.1 Missbildungen
12.4.2 Degenerative Veränderungen und Stoffwechselstörungen
12.4.3 Hyperplasien
12.4.4 Tumoren
12.5 Nebenniere
12.5.1 Postmortale Veränderungen
12.5.2 Missbildungen
12.5.3 Kreislaufstörungen
12.5.4 Entzündungen
12.5.5 Degenerative Veränderungen und Stoffwechselstörungen
12.5.6 Hyperplasien
12.5.7 Tumoren
12.6 Endokrines Pankreas (Inselorgan)
12.6.1 Missbildungen
12.6.2 Degenerationen und Funktionsstörungen
12.6.3 Hyperplasien
12.6.4 Tumoren
12.7 Diffuses neuroendokrines System und Paraganglien
12.7.1 Tumoren
12.8 Multiples endokrines Neoplasie-Syndrom
12.9 Endokrine Gewebe der Gonaden
13 Augen
13.1 Postmortale Veränderungen
13.2 Missbildungen
13.2.1 Störungen der Organogenese
13.2.2 Differenzierungsstörungen
13.3 Augenlider
13.3.1 Missbildungen
13.3.2 Entzündungen
13.4 Tränendrüsen
13.4.1 Entzündungen
13.4.2 Weitere Veränderungen
13.5 Konjunktiva
13.5.1 Entzündungen
13.6 Hornhaut
13.6.1 Degenerative Veränderungen und Nekrosen
13.6.2 Entzündungen
13.7 Sklera
13.8 Linse
13.8.1 Katarakt
13.8.2 Lageveränderungen
13.9 Glaskörper
13.9.1 Degenerative Veränderungen
13.10 Uvea
13.10.1 Entzündungen
13.10.2 Glaukom
13.11 Retina
13.11.1 Degenerationen
13.11.2 Ablösung der Netzhaut
13.11.3 Entzündungen
13.12 Papille und Sehnerv
13.12.1 Degenerative Veränderungen
13.12.2 Papillenödem
13.12.3 Entzündungen
13.12.4 Proliferative Optikusneuropathie des Pferdes
13.13 Orbita
13.14 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren des Auges und seiner Adnexe
13.14.1 Augenlider
13.14.2 Konjunktiven
13.14.3 Primäre intraokulare tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
13.14.4 Sekundäre intraokulare Tumoren
13.14.5 Extraokulare intraorbitale Tumoren
14 Ohren
14.1 Äußeres Ohr
14.1.1 Missbildungen
14.1.2 Kreislaufstörungen
14.1.3 Degenerationen
14.1.4 Entzündungen
14.2 Innen- und Mittelohr
14.2.1 Missbildungen
14.2.2 Degenerationen
14.2.3 Entzündungen
14.2.4 Weitere Veränderungen
14.2.5 Tumorähnliche Veränderungen und Tumoren
Teil II Anhang
15 Abkürzungsverzeichnis
16 Glossar
17 Literatur
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
Teil I Spezielle Pathologie
1 Große Körperhöhlen
2 Verdauungsorgane
3 Leber, Gallesystem und exokrines Pankreas
4 Hämatopoetisches System
5 Kreislauforgane
6 Atmungsorgane
7 Harnorgane
8 Reproduktionsorgane
9 Nervensystem
10 Stütz- und Bewegungsapparat
11 Haut
12 Endokrine Organe
13 Augen
14 Ohren
1 Große Körperhöhlen
Peter Wohlsein, Lars Mundhenk
1.1 Postmortale Veränderungen
Durch die oft bereits agonal nachlassende Herztätigkeit und die postmortal stagnierende Resorptionsleistung des Mesothels tritt vermehrt seröse Flüssigkeit aus. Diese färbt sich infolge Hämolyse rot (Imbibitionsröte) und wird durch desquamierte Mesothelzellen trübe. Weiterhin finden sich Hypostase, gallige Imbibition im Peritoneum und infolge Austrocknung stumpfe und raue Serosen. Neben der Autolyse führen Bakterien aus dem Darm zur Heterolyse mit schmierigen, abstreifbaren Belägen, Gewebsverflüssigung, Emphysem und Farbveränderungen (z.B. Pseudomelanose infolge Sulfmethämoglobin- und Eisensulfidbildung). Nach Applikation von Tötungsmitteln in die Körperhöhlen sind weiße, kristalloide Ablagerungen auf den Serosen nachweisbar. Postmortale Zerreißungen von Zwerchfell und Magen-Darm-Trakt kommen vor allem bei Pferden und Kaninchen infolge abdominaler Druckerhöhung durch gastrointestinale bakterielle Gasbildung vor.
1.2 Missbildungen
Spaltbildung Bei angeborenen Spaltbildungen treten die Organe der betroffenen Körperhöhlen ohne parietale Serosaabdeckung aus (Eventratio simplex), z.B. Schistosoma reflexum, Fissura sternalis, Fissura abdominalis (▶ Abb. 1.1), Eventratio simplex diaphragmatica. Die Eventratio hernialis (Hernie, Bruch) stellt eine Verlagerung abdominaler Organe dar, die angeboren oder erworben sein kann. Sie ist charakterisiert durch:
einen Bruchsack, gebildet vom Bauchfell und evtl. akzessorischen Bruchhüllen
eine Bruchpforte (proximale Engstelle des Bruchsacks)
einen Bruchinhalt (z.B. Darmschlingen)
Abb. 1.1 Fissura abdominalis mit Eventratio simplex des Darmkonvoluts als Missbildung bei einer Katze.
Es werden äußere und innere Hernienunterschieden (▶ Tab. 2.3):
Äußere Hernien:
Hernia abdominalis (Bauchhernie)
Hernia inguinalis (Leistenhernie)
Hernia perinealis (Dammhernie)
Hernia femoralis (Schenkelhernie)
Hernia umbilicalis (Nabelhernie)
Hernia scrotalis (Hodensackhernie)
Hernia pericardioperitonealis (Herzbeutelhernie)
Hernia diaphragmatica (Zwerchfellhernie; ▶ Abb. 1.2)
Innere Hernien:
Hernia foraminis epiploici (Netzbeutelhernie)
Hernia spatii renolienalis (Milznierenraumhernie)
Hernia mesenterialis (Mesenterialhernie)
Hernia omentalis (Netzhernie)
Hernia plica ductus deferentis (Samenleiterfaltenhernie)
Bruchpforten infolge von Missbildungen sind glatt und reaktionslos, während die erworbenen Bruchpforten (z.B. nach Trauma) im akuten Stadium Blutungen und Entzündungen aufweisen.
Abb. 1.2 Hernia diaphragmatica bei einer Katze mit Vorfall von Dünn- und Dickdarm (*) in die Brusthöhle.
Verlagerte Organe können frei reponierbar oder eingeklemmt sein (Inkarzeration) und infolge der Kreislaufstörung eine hämorrhagische Infarzierung zeigen. Obstipationen, Verwachsungen sowie Toxinämien können die Folge sein. Die pleuroperitoneale Zwerchfellhernie tritt infolge eines Schließungsdefekts im linken dorsalen Zwerchfellquadranten oft bei Hunden auf. Die Verlagerung von Bauchhöhlenorganen in den Herzbeutel (peritoneoperikardiale Zwerchfellhernie) entsteht aufgrund eines genetischen Schließungsdefekts im ventralen Teil des Septum transversum (vor allem Perserkatzen).
Persistierende embryonale Strukturen In der Bauchhöhle können Reste embryonaler Strukturen als fibröse Stränge zwischen Organen verlaufen (Differenzialdiagnose: erworbene Verwachsungen). Sie können zu Inkarzerationen von Darmschlingen führen, z.B. persistierender Dottergang zwischen Darm und Nabel oder linke persistierende Vittelinarterie zwischen kranialer Mesenterialarterie und Darm. In einem lückenhaften Ligamentum falciforme können sich ebenfalls Darmteile einklemmen.
Zysten Gelegentlich werden angeborene serosale Zysten in der Brusthöhle gefunden. Im Mediastinum sind Zysten der Kiementaschen bei brachyzephalen Hunden und bronchogenen Zysten bekannt. Beim Pferd treten gelegentlich pleurale Zysten mit Plattenepithel auf.
1.3 Fremdinhalte
Fremdinhalte können generell zu Blutzirkulationsstörungen, im Thorax zur Kompressionsatelektase der Lunge, in der Bauchhöhle zu intestinalen Passagestörungen und Koliken sowie vielen anderen Funktionsstörungen von Organen führen.
1.3.1 Luft oder Gas
Luft oder Gas im Pleuralspalt wird als Pneumothorax und in der Bauchhöhle als Pneumoperitoneum (Pneumaskos oder Gasperitoneum) bezeichnet.
Pneumothorax Dieser führt zur Atelektase der Lunge (Entspannungskollaps). Bei Eröffnung des Pneumothorax fehlt der sonst hörbare Lufteinstrom. Eine Eröffnung unter Wasser lässt Luftblasen aufsteigen.
Ursachen sind Thoraxperforationen (z.B. Stich, offene Rippenbrüche), Verletzungen der Pleura pulmonalis oder der tiefen Atemwege (z.B. gedeckte Rippenfraktur, flächiges stumpfes Trauma, Emphysemriss, durchbrechende Entzündung oder Neoplasie, Lungenriss nach extremer Druckeinwirkung, gasbildende Anaerobierinfektion, Ruptur von Parasitenzysten, wandernde Parasitenlarven, Ösophagusperforation, Zwerchfellruptur oder durch Weiterleitung ausgehend von einem Pneumoperitoneum). Infolge kommunizierender Pleuralhöhlen tritt beim Pferd der Pneumothorax bilateral auf. Ein Pleuraemphysem kann mit einem Pneumothorax assoziiert sein oder sich bei einem Lungenemphysem oder einer Anaerobierinfektion entwickeln. Ein Pneumomediastinum ist durch Luft- oder Gasansammlung im Mediastinalspalt (Mediastinalemphysem) gekennzeichnet und kann sich speziell beim Rind bis in die Sukutis fortsetzen.
Pneumoperitoneum Das deutlich seltenere Pneumoperitoneum entsteht durch traumatische Perforationen der Bauchwand, Weiterleitung eines Pneumothorax, Rupturen des Gastrointestinaltrakts, der Harnblase oder des Reproduktionstrakts sowie durch Infektion mit gasbildenden Bakterien. Es tritt typischerweise auch nach Bauchhöhlenoperationen auf, meist ohne pathologische Folgen, und wird resorbiert.
Beim Pneumoperitoneum kommt es zu einem Absinken der Bauchhöhlenorgane, was jedoch zumeist folgenlos für die betroffenen Organe bleibt, im Gegensatz zum Pneumothorax.
Sowohl nach einem Pneumothorax als auch nach einem Pneumoperitoneum kann es zum Übertritt der Luft in die Unterhaut kommen, meist dorsal am Tierkörper.
1.3.2 Flüssigkeit
Hydrothorax/Hydroperitoneum Eine nicht-entzündliche Ansammlung von klarer, wässriger Flüssigkeit mit geringem Proteingehalt und wenig Zellen (Transsudat; spezifisches Gewicht: < 1018 [nach einigen Literaturstellen: 1012]; Proteingehalt < 30 g/l) kann in der Brusthöhle (Hydrothorax, Brustwassersucht) und der Bauchhöhle (Aszites, Hydroperitoneum, Bauchwassersucht) auftreten.
Ursachen sind erhöhter hydrostatischer Druck bei Herzinsuffizienz (z.B. Kardiomyopathie), onkotische Druckverschiebungen bei mangelnder Albuminsynthese (Lebererkrankungen, Kachexie), Proteinverlust über Niere (nephrotisches Syndrom) oder Darm, Lymphabflussstörung und Tumoren. Eine portale Hypertonie führt zum Aszites, z.B. bei Leberzirrhose, Portalvenenthrombose, Venenmissbildungen in der Leber. Konsekutiv entwickelt sich beim chronischen Erguss eine resorptive Entzündung mit Mesothelzellhyperplasie, subserosaler Fibrose, Organkapselfibrosen und -hyalinosen (z.B. Zuckergussmilz) sowie Verwachsungen der Serosablätter.
Chylothorax Dieser ist durch milchig-trübe Lymphe mit hohem Triglyzeridgehalt und zahlreichen Lymphozyten gekennzeichnet.
Ein Chylothorax tritt bei Katzen meist idiopathisch auf (▶ Abb. 1.3). Weitere mögliche Ursachen sind:
Rechtsherzinsuffizienz oder Kardiomyopathien, bei denen ein erhöhter Zentralvenendruck den Lympheinstrom vom Ductus thoracicus in die V. cava verhindert
Ruptur (Trauma)
Arrosion des Ductus thoracicus
Obstruktion des Lymphsammelgangs durch Missbildungen (z.B. Afghanischer Windhund), Entzündungen, Neoplasien (z.B. Lymphom, Thymom)
Lungenlappentorsion
Hernien
Wiederholte Drainagen eines Chylothorax können zu Dehydratation, Hypoproteinämien, Lymphopenien sowie Verlust an Fetten und fettlöslichen Vitaminen führen.
Chyloperitoneum Es wird auch als Chylaskos oder Ascites chylosus bezeichnet und tritt selten auf. Ursache ist meist eine Ruptur oder Obstruktion abdominaler Lymphgefäße, besonders der Cisterna chyli.
Abb. 1.3 Chylothorax mit milchig-trübem Brusthöhlenerguss und pulmonaler Atelektase bei einer Katze.
Hämothorax/Hämoperitoneum Ursachen eines Hämothorax oder Hämaskos (Hämoperitoneum) sind Rupturen von Blutgefäßen (z.B. idiopathische Ruptur der Aorta beim Pferd; postoperative Komplikation nach Kastration bei der Hündin) oder Organen (z.B. Leber). Auch entzündliche oder neoplastische Gefäßarrosionen, Lungenlappentorsionen, Rupturen von Tumoren (z.B. Hämangiosarkom, Granulosa-Thekazelltumor) sowie hämorrhagische Diathesen sind mögliche Ursachen.
Pyothorax/Pyoperitoneum Eiteransammlungen werden als Pyothorax (Empyema pleurale, Thoraxempyem), Netzbeutelempyem (Empyema omentale) bzw. Pyoperitoneum (Empyema peritoneale, Peritonealempyem) bezeichnet. Sie treten gemeinsam mit einer eitrigen Serositis bei bakterieller Infektion auf.
Uroperitoneum/Cholaskos Nach Zusammenhangstrennung der Harnblase durch Trauma (Dehnungsruptur z.B. als Geburtskomplikation beim männlichen Fohlen) oder infolge von Entzündung, Neoplasie, Nekrose oder Harnsteinen gelangt Urin in das Abdomen (Uroperitoneum; postrenale Urämie). Eine Ansammlung von Galle in der Bauchhöhle (Cholaskos) entsteht nach Ruptur der Gallenblase (Trauma) und ist meist letal.
Selten kommen gemischte Ergüssevor, z.B. Hydrohämothorax oder Chylopyoperitoneum.
1.3.3 Feste Körper
1.4 Kreislaufstörungen
Eine aktive arterielle Hyperämie ist durch injizierte hellrote serosale Gefäße charakterisiert. Sie tritt vor allem bei akuten Entzündungen auf. Die passive venöse Hyperämieist durch dunkelrote serosale Gefäße gekennzeichnet, deren Ursache meist eine lokale oder systemische Abflussbehinderung (z.B. Herzinsuffizienz) ist.
Rhexisblutungen (z.B. Trauma) haben je nach Kaliber des alterierten Gefäßes hämorrhagische Höhlenergüsse (Hämothorax, Hämaskos), Sugillationen oder Hämatome zur Folge. Petechien und Ekchymosen treten als Diapedesisblutungen im Rahmen einer hämorrhagischen Diathese bei Virämie, Septikämie, systemischer Protozoonose und Vergiftung (z.B. Cumarinderivate) sowie im Schock, aber auch agonal (asphyktisch) auf. Ein subserosaler Lymphstau lässt serosale Lymphgefäße hellgrau linienartig hervortreten und wird durch Rechtsherzinsuffizienz oder Lymphabflussbehinderungen verursacht. Er kann zum Austritt von Chyle führen.
1.5 Stoffwechselstörungen und degenerative Veränderungen
Atrophie Kachektische Tiere zeigen eine seröse Atrophie subseröser Fettdepots (Herzkranzfurche, Nierenlager).
Nekrosen Ein Untergang des retroperitonealen Fettgewebes (▶ Abb. 1.4) stellt sich als kalkartiger, weiß-gelber, fester, umschriebener Bereich dar, der akut einen hyperämischen Randsaum zeigt. Die freigesetzten Fettsäuren können als nadelförmige Kristalle ausfallen oder mit Kalzium Kalkseifen bilden. Nekrotisches Fettgewebe kann eine granulomatöse Entzündung (Steatitis) und bindegewebige Demarkation provozieren. Die Ursache bleibt oft unklar.
Abb. 1.4 Multifokale gelblich-weiße Fettgewebsnekrosen (→) im Netzbeutel bei einer Katze.
Bei Fleischfressern wird durch freigesetztes Pankreassekret (z.B. Trauma, Pankreatitis, Pankreasnekrose, Gangobstruktionen) eine autodigestive enzymatische fokale Nekrose des peripankreatischen Fetts beobachtet. Massive, möglicherweise ernährungsbedingte Nekrosen des omentalen, mesenterialen und retroperitonealen Fettgewebes (Lipogranulomatose) können beim Rind zu einer Obstruktion von Darm oder Ureteren führen. Vor allem bei Schafen werden fokale Nekrosen des abdominalen Fetts unklarer Genese gefunden. Bei der „yellow fat disease“ (Schwein, Katze, Nerz) bestehen ein nutritives Überangebot an ungesättigten Fettsäuren und ein Vitamin-E-Mangel, die zur Peroxidation von Fettsäuren und konsekutiver diffuser Steatitis mit Cholesterol- und Zeroidbildung führen.
Verkalkungen Eine Hyperkalzämie verursacht metastatische Verkalkungen der Elastin- und Kollagenfasern meist der Pleura costalis in Form feiner grauer Streifen. Ursächlich kommen die enzootische Kalzinose der Wiederkäuer, Hypervitaminose D, primärer und sekundärer (osteorenales Syndrom) Hyperparathyreoidismus oder paraneoplastische Hyperkalzämie in Betracht. Fokale dystrophische Verkalkungen sind hingegen selten. Chronisches Narbengewebe (z.B. Kastration, Laparotomie) oder Bruchsackinhalt kann subseröse metaplastische Verknöcherungen aufweisen.
Pigmente Hämoglobinogene Pigmente (Hämosiderin, Hämatoidin) deuten auf abgebaute Blutungen hin. Anthrakose wird an der Pleura pulmonalis und eine Melanose im Rahmen eines Atavismus (Melanosis maculosa) beobachtet. Gelbe Futterpigmente (Pflanzenfresser) können in der intestinalen Serosa visceralis vorkommen.
1.6 Entzündungen
1.6.1 Übersicht
Eine Entzündung seröser Häute kann fokal, multifokal oder diffus als akute, subakute oder chronische Schädigung auftreten. In der Brusthöhle wird sie als Pleuritis (parietalis, visceralis bzw. pulmonalis, pericardialis, mediastinalis, costalis, sternalis, diaphragmatica) und in der Bauch- und Beckenhöhle als Peritonitis (parietalis, visceralis, mesenterialis, omentalis) sowie bei generalisierter Ausbreitung als Polyserositis bezeichnet. Organbezogene Entzündungen werden Epikarditis, Perikarditis, Perihepatitis, Perisplenitis, Perireticulitis, Perimetritis (Serositis des Uterus) oder Parametritis (Serositis der Gebärmutterbänder) genannt.
Der Entzündungscharakter variiert entsprechend der Noxe und Erkrankungsdauer. Es werden exsudative (feuchte; Serositis exsudativa; meist akut), proliferative (trockene; Serositis sicca oder proliferativa; subakut bis chronisch) und gemischte Formen unterschieden. Als exsudativ gelten serös, fibrinös, eitrig (purulent), hämorrhagisch, nekrotisierend und gangräneszierend. Trockene Formen besitzen einen granulomatösen oder proliferativen Charakter. Im chronischen Stadium einer exsudativen Entzündung können durch Granulationsgewebe zwischen benachbarten Serosablättern flächige (Synechien; Adhäsionen) oder spangenförmige Verwachsungen (sog. Briden) entstehen. Außerdem können chronische serosale Entzündungen zottige Proliferationen (Serositis villosa) und flächige narbenähnliche Veränderungen (Schwielen) aufweisen oder vollständig ausheilen. Eine chronische Pleuritis kann eine mechanische Behinderung der Lungen- und Herzfunktion (Panzerherz) sowie Induration und Atelektase der Lunge durch Kompression verursachen. Bei einer chronischen Peritonitis sind eine eingeschränkte Motilität des Magen-Darm-Trakts, Invaginationen, Lageveränderungen und Ileus des Darmes möglich.
Ätiologisch können diese Entzündungen durch infektiöse oder sterile Noxen verursacht werden:
Infektionen können auf lymphohämatogenem Weg (z.B. Septikämie) entstehen. Durch Penetrationen (z.B. transmurale Darmentzündung), Perforationen (z.B. Haubenfremdkörper) oder Rupturen (z.B. Magen, Labmagen) können Entzündungen von angrenzenden Organen oder Geweben auf die Serosa übergreifen.
Primär nicht-infektiöse, resorptive Entzündungen werden durch Ergüsse, Hämatome, Neoplasien, Nekrosen, Kalzium- und Uratablagerungen (Gicht), Lageveränderungen sowie nach chirurgischen Eingriffen beobachtet. Gelegentlich kann eine sekundäre Erregerbeteiligung festgestellt werden.Pathogenetisch steht der direkten (z.B. posttraumatisch) die indirekte Entzündung der Serosa (z.B. nach Pneumonie) gegenüber.
Durch Flüssigkeitsergüsse, Verklebungen (subakut) oder Verwachsungen (chronisch) kann es zu Bewegungs- und Funktionsstörungen der Organe kommen, evtl. auch mit Todesfolge.
1.6.2 Exsudative Körperhöhlenentzündungen
1.6.2.1 Akute seröse Serositis
Die akute seröse Serositis zeichnet sich durch ein klares, meist koagulierendes Exsudat, eine aktive Hyperämie serosaler Gefäße und eine glanzlose, fleckige oder streifige und trübe Oberfläche aus. Der seröse Charakter geht meist in eine andere Entzündungsqualität über oder tritt mit dieser gemeinsam auf, z.B. serofibrinöse oder serohämorrhagische Serositis.
Ursache seröser Körperhöhlenentzündungen können infektiöser (z.B. Viren, Mykoplasmen, Bakterien) oder nicht-infektiöser Natur (z.B. postoperativ, Harn, Galle, Neoplasie, Urämie) sein. Durch Resorption von Toxinen kann eine letale Toxinämie eintreten. Aufgrund der eingeschränkten serosalen Resorptionskapazität bei einer exsudativen Entzündung ist ein hypovolämischer Schock möglich.
1.6.2.2 Fibrinöse Serositis
Die fibrinöse Serositis ist durch gelblich-graue, fädige, schleierförmige oder netz- bis membranartige Beläge von elastischer Konsistenz charakterisiert. Sie lassen sich ohne Substanzverlust von den trüben, glanzlosen und geröteten Oberflächen ablösen und können zu Verklebungen von Organen oder mit dem parietalen Serosablatt führen. In der akuten Phase finden sich eine aktive Hyperämie serosaler Gefäße sowie ein qualitativ variabler, teils auch geronnener, trüber Körperhöhlenerguss. Aufgrund tierartlicher Unterschiede im Fibrinogengehalt des Plasmas (hoher Gehalt beim Rind!) und im fibrinolytischen Potenzial kann die Menge polymerisierten Fibrins variieren. Die Organisation des Fibrins durch Granulationsgewebe geht vom fibrovaskulären Stroma der Serosa mit proliferierenden Schlingenkapillaren und Fibroblasten aus. Es finden sich graue bis grau-rote, derbe, unelastische, teils auch fädige oder zottige Strukturen, die zu Verwachsungen (fibröse Serositis) führen können (Serositis fibrosa diffusa, circumscripta, maculosa, villosa oder filamentosa; Synechie, Bride).
Ursachen fibrinöser Serositiden sind vor allem bakterielle Infektionen, z.B. mit Pasteurellen, Mannheimia sp. und Mykoplasmen (fibrinöse Pleuropneumonie), selten Virusinfektionen (z.B. feuchte Form der FIP) oder Parasitenwanderungen (Strongylus sp., Fasciola sp.). Transmural ausgehend vom Magen-Darm-Trakt, Uterus, Harnblase, Haut oder Nabel können sekundär fibrinöse Entzündungen der Serosen entstehen.
Auch nicht-infektiöse Noxen, z.B. chirurgischer Eingriff, hämorrhagisch infarzierte Darmverlagerung oder Harnblasenruptur, können zur fibrinösen Serositis führen. Beim Rind ist bei einer fremdkörperbedingten Retikuloperitonitis eine fibrinöse Pleuritis und Perikarditis als initiale Konsekutivläsion möglich.
Polyserositiden finden sich z.B. bei Koliseptikämie (Kalb, Schwein), FIP, Glässer‘scher Erkrankung (Haemophilus parasuis) und der Mycoplasma-hyorhinis-Infektion (Schwein).
Die unmittelbaren Folgen akuter fibrinöser Serositiden sind Protein- und Flüssigkeitsverluste, Kreislaufbelastungen und Schock. Bei massiven Fibrinexsudationen können auch Funktionseinschränkungen der Organe resultieren. Durch Verwachsungen entstehen Strikturen, Kompressionen, Obstipationen, Atonien, Ileus, Kolik, Lageveränderungen und Bewegungsbeeinträchtigungen von Organen (z.B. Herz, Zwerchfell, Lunge).
Die Veränderungen bei einer Serositis lassen oft auf ihr Alter schließen: Nach wenigen Stunden bis Tagen dominieren seröse Exsudation, in Verbindung mit leicht abstreifbaren Fibrinauflagerungen (fibrinöse Serositis; akut). Nach mehreren Tagen sprossen erste Fibroblasten aus der Serosa (fibroblastische Serositis; subakut), wodurch nach Abstreifen des Fibrins eine samtige Serosaoberfläche erkennbar wird. Die durch Fibroblasten gebildeten Kollagenfasern können zur Verwachsung von parietaler und viszeraler Serosa führen, sodass benachbarte Organe nur noch unter Substanzverlust zu trennen sind (fibröse Serositis; chronisch).
1.6.2.3 Eitrige Serositis
Die eitrige Serositis kann mit Entzündungen anderen Charakters (z.B. fibrinös, hämorrhagisch oder nekrotisierend) gemischt auftreten. Sie kann aber auch als Folge oder als primär eitrige (purulente) Entzündung vorkommen. Ansammlungen von Eiter in einer Körperhöhle werden als Empyem bezeichnet. Umschriebene Eiterprozesse werden bindegewebig abgekapselt (abszedierendeoder apostematöse Serositis). Die Farbe des Eiters wechselt in Abhängigkeit von den beteiligten Bakterien (z.B. bei E. coli braun, bei Trueperella [T.] pyogenes grünlich) sowie der Art und Menge von Beimengungen (Fibrin, Blut, Fett, Zelldetritus). Die Konsistenz hängt von den Inhaltsstoffen und vom Wassergehalt ab (rahmig, flüssig, fest).
Bakterielle Infektionen sind Ursache eitriger Serositiden, die entweder lokal oder im Rahmen von Septikämien auftreten. Die purulente Pleuritis kann bei eitriger Pneumonie, Fremdkörperperforation des Ösophagus, transmuraler Ösophagitis, perforierenden Wunden (z.B. Pfählungen) sowie tiefer Hautfistel entstehen. Eine purulente Peritonitis entwickelt sich durch Übergreifen von benachbarten eitrigen Entzündungen (z.B. eitrige Omphalitis, septische Metritis, Haubenperforation durch Fremdkörper, ulzerierende Abomaso-Enteritis, infizierte Laparotomiewunde, Pfählung, Bissverletzung, abdominale Fistelung von Abszessen).
Beim Rind kann bei perforiertem Labmagenulkus durch den anatomisch gut begrenzten Netzbeutel eine lokalisierte, empyemartige, eitrig-jauchige Entzündung (Bursitis omentalis purulenta et ichorosa) auftreten.
Beim Schwein ist die durch T. pyogenes verursachte Pyobazillose durch eine (Poly-)Serositis apostematosa multiplex in Bauch- und Brusthöhle gekennzeichnet. Sie entsteht nach hämatogener Erregerausbreitung oder fortgeleitet nach Wundinfektionen (z.B. Kastration).
Fistelungen von abszedierten Lymphknoten bei der Druse des Pferdes (Streptococcus equi ssp. equi) führen zur eitrigen bis apostematösen Serositis.
1.6.2.4 Eitrig-jauchige Serositis
Die eitrig-jauchige Serositis (Pyothorax; ▶ Abb. 1.5) ist durch grau-rotes, meist flüssiges Exsudat mit flockigen bis granulären Agglomeraten aus Bakterien, Fibrin und Zelldetritus (Drusen, „sulfur granules“) gekennzeichnet. Gefäßarrosionen oder Diapedesisblutungen führen zu einem Hämopyothorax. Die Serosa zeigt diffus eine grau-rote Farbe und durch das im chronischen Stadium auftretende Granulationsgewebe eine feingranuläre bis filamentöse Beschaffenheit.
Abb. 1.5 Nocardiose mit Ausbildung eines Hämopyothorax bei einer Katze.
Die Nocardiose (sog. Streptotrichose der Fleischfresser) entsteht durch Mischinfektionen mit Actinomycesspp., Nocardiaspp., Bacteroidesspp., T. pyogenes oder Mannheimia multocida. Sie führt zu einer meist in der Brust-, seltener in der Bauchhöhle lokalisierten eitrigen bis jauchigen Serositis. Der Erregereintritt erfolgt:
hämatogen bzw. lymphogen
direkt über traumatische Penetrationen von außen, z.B. Bissverletzung
direkt über perforierende Läsionen in benachbarten Organen (Lunge, Ösophagus oder Magen)
In der Brusthöhle liegen meist bilaterale Veränderungen vor.
1.6.2.5 Hämorrhagische Serositis
Die hämorrhagische Serositis ist oft ein Teilphänomen einer anderen exsudativen Entzündung. Ursächlich liegen z.B. Clostridieninfektionen, Milzbrand oder eine Koliseptikämie vor. Der hämorrhagische Charakter wird durch Permeabilitätserhöhung der Kapillaren und/oder eine beeinträchtigte Blutgerinnung verursacht. Eine hämorrhagische Serositis kann zu hypovolämischem Schock und generalisierter Hypoxidose führen.
1.6.2.6 Ichoröse Serositis
Die ichoröse oder gangräneszierende Serositis entsteht infolge bakterieller Mischinfektionen unter Beteiligung von Saprophyten (Fäulnisbakterien). Ihr liegt entweder eine fortgeleitete Entzündung (z.B. Lungengangrän nach Aspiration von Fremdmaterial) oder die Perforation eines Hohlorgans (Ösophagus, Vormagen, Magen, Uterus) zugrunde. Sie zeichnet sich durch übel riechendes grau-rotes Exsudat mit Fibrin, Zelltrümmern, Blut, Bakterienkolonien und evtl. Fremdmaterialien (z.B. Ingesta) aus.
1.6.3 Proliferative Körperhöhlenentzündungen
Das chronische Stadium einer Serositis ist durch Granulationsgewebsbildung und Verwachsungen (Serositis fibrosa) gekennzeichnet.
Eine granulomatöse Serositiswird durch schwer verdauliche Noxen verursacht. Die Serosa zeigt fein- bis grobgranuläre, knotige oder beetförmige sowie konfluierende bis diffuse Proliferate. Zusätzlich sind Nekrosen, Granulationsgewebe und Höhlenergüsse unterschiedlichen Charakters zu beobachten. Infiltrationen von Makrophagen, Epitheloidzellen, Riesenzellen, Lymphozyten, Plasmazellen (granulomatös) und neutrophilen Granulozyten (pyogranulomatös) treten auf. Sie können in Abhängigkeit von der Noxe auch konzentrisch angeordnet sein. Ätiologisch kommen belebte und selten auch unbelebte Noxen (z.B. Talkumstaub, Baumwolltupfer, inhalierte Asbestkristalle) in Betracht.
1.6.3.1 Nischenserositis
Die vor allem beim Rind auftretende Nischenserositis hat keine nosologische Bedeutung. Die Proliferate kommen bereits fetal vor und ihre Inzidenz steigt mit zunehmendem Alter. Vor allem in den Interkostalräumen, am Margo acutus der Lunge (Nischenpleuritis) sowie am Perikard im dorsalen Umschlagsbereich (Nischenperikarditis) finden sich filamentöse oder kleinflächige, grau-rote Zotten. Diese bestehen aus gut vaskularisiertem Bindegewebe mit einzelnen Makrophagen und Lymphozyten sowie hyperplastischem Mesothel. Sie besitzen möglicherweise eine „clearance“-Funktion, jedoch können infektiöse Ursachen (Viren, Mykoplasmen) nicht ausgeschlossen werden.
1.6.3.2 Feline Infektiöse Peritonitis
Die Feline Infektiöse Peritonitis (▶ Synopse Feline Infektiöse Peritonitis) wird durch feline Coronaviren hervorgerufen. Meist treten Veränderungen in der Bauchhöhle und anderen Körperhöhlen gleichzeitig auf. Alter, Zeitpunkt der Infektion, genetische Disposition, gleichzeitige andere Infektionen (z.B. FeLV, FIV), Stress und die zelluläre Immunantwort sind pathogenetisch bedeutsam. Ebenso nehmen Virusstamm und die Infektionsdosis Einfluss auf den Verlauf. Als Extremformen lassen sich die feuchte (exsudative) und die trockene Form gegenüberstellen. In der Praxis werden allerdings meist Mischformen mit variablen, inkonstanten Beteiligungen der einzelnen Organsysteme beobachtet:
Die exsudative Form ist durch ein proteinreiches, bei Luftzutritt gelierendes, bernsteinfarbenes, fadenziehendes Exsudat in den Körperhöhlen mit Fibrinbelägen auf den Serosen und Ikterus gekennzeichnet. Die Meningen sind trübe (Exsudation) und in der vorderen Augenkammer ist ein fibrinreiches Exsudat (Uveitis) nachweisbar.
Die trockene Form führt zu multiplen pyogranulomatösen gefäßassoziierten Herdveränderungen (1 mm bis 2 cm Durchmesser) in den parietalen Serosen sowie in Leber, Niere, Milz, großem Netz, Darm, Lunge, Herz, Herzbeutel, Uvea des Auges und ZNS. In den Körperhöhlen ist bei dieser Form kein oder nur wenig Exsudat nachweisbar.
Mischformen weisen sowohl exsudative als auch pyogranulomatöse Komponenten auf.
Synopse: Feline Infektiöse Peritonitis (FIP)
Wolfgang Baumgärtner
Organübergreifende Darstellung der verschiedenen Manifestationsformen bei der Felinen Infektiösen Peritonitis
Abb. 1.6 Bei der trockenen Form der Felinen Infektiösen Peritonitis (FIP) finden sich Granulome in verschiedenen Organen. Häufig sind gefäßassoziierte Granulome z.B. in der Niere (a) und im Gehirn (b) oder noduläre bis disseminierte Granulome z.B. in den Lymphknoten (c) und den Augen (d) zu finden. Bei der feuchten Form lässt sich ein bernsteinfarbener fadenziehender Erguss in Brust- (e) und Bauchhöhle einhergehend mit einer fibrinösen Perihepatitis (f) und -splenitis (g) feststellen. Infolge einer massiven Leberschädigung kann es zum Ikterus kommen (h). Histologisch werden die Veränderungen in Abhängigkeit von der Form von einer fibrinös-nekrotisierenden oder pyogranulomatösen Entzündung dominiert (i, HE-Färbung). Immunhistologisch findet sich Virusantigen vorwiegend in den Makrophagen (braunes Präzipität, j).
Epidemiologie und Bedeutung
Die Feline Infektiöse Peritonitis stellt eine multisystemische, letal verlaufende, weltweit vorkommende Erkrankung dar. Das heute als Felines Coronavirus (FCV) bezeichnete Virus wurde historisch einmal als 2 verschiedene Viren angesehen: das wenig pathogene Feline Enterale Coronavirus (FECV), das durch eine milde transiente Gastroenteritis gekennzeichnet ist, und das FIP-Virus (FIPV). Nachfolgende Studien zeigten, dass das FIPV aus einer Mutation des FECV hervorgegangen ist. Das FCoV kommt weltweit vor. Virusspezifische Antikörper finden sich bei ca. 80 % der Zuchtkatzen und nur bei 10–50 % der frei laufenden Tiere. Grundsätzlich kann jede FCoV-Infektion zur FIP führen.
Betroffene Spezies
Haus-, Wild- und Großkatzen sowie Frettchen.
Ätiologie
Das FCoV, Familie Coronaviridae, kommt als Serotyp I und II vor. Beide können über bestimmte Mutationen zur FIP führen. Beim Frettchen existiert ein für diese Tierart eigenes Coronavirus, das Ferret Systemic Coronavirus (FRSCV).
Inkubationszeit
Die Zeitspanne zwischen experimenteller Infektion und Klinik beträgt bei der feuchten FIP 2–14 Tage und bei der trockenen Form mehrere Wochen. Dagegen ist die Inkubationszeit bei der Spontanerkrankung nicht bekannt. Hier liegt vermutlich ein wochen- bis monatelanges subklinisches Stadium vor. Im Gegensatz zum FECV, das durch Fäzes und Speichel ausgeschieden werden kann, wird das FIPV infolge des durch Mutation veränderten Zelltropismus (Makrophagen) nicht mehr in relevanter Menge ausgeschieden.
Klinik
Die Mehrzahl der Infektionen mit FCoV verlaufen subklinisch oder verursachen respiratorische bzw. enterale Symptome. Bei ca. 7 % der FCoV-infizierten Tiere entwickelt sich die FIP.
Die FIP manifestiert sich in Abhängigkeit von den betroffenen Organen und verläuft in der Regel tödlich (▶ Abb. 1.6). Es erkranken vorwiegend Tiere im Alter zwischen 6 Monaten und 2 Jahren. Diese zeigen Fieber, Störungen des Allgemeinbefindens und Ikterus. Es werden eine feuchte, trockene und eine gemischte Form unterschieden. Bei der feuchten Form der FIP findet sich ein bernsteingelber fadenziehender, fibrinöser Erguss in Brust- und Bauchraum oder Herzbeutel. Bei der trockenen Form kommt es zu einer häufig gefäßassoziierten (pyo-)granulomatösen Entzündung in Lymphknoten und zahlreichen Organen. Darüber hinaus findet sich oft eine Entzündung im Auge in Form einer Uveitis.
Pathogenese und pathologische Befunde
Nach oronasaler FCoV-Aufnahme kommt es zur Virusreplikation im Pharynx und Infektion von Enterozyten. Das virulente FCoV, der Erreger der FIP, entsteht in der Katze de novo durch Mutation aus einem schwach virulenten Erreger (früher als FECV bezeichnet). Das FIPV wird nicht oder nur in geringen Mengen ausgeschieden. Die Virulenz des FIPV entsteht in erster Linie durch einen geänderten Zelltropismus im Vergleich zum FECV. Im Gegensatz zu schwach virulenten Erregern, die sich vorwiegend in Enterozyten replizieren, infizieren FIPV besonders Makrophagen. Damit einhergehend kommt es auch zu einer systemischen Erregerausbreitung. Allerdings liegt der Unterschied zwischen beiden Virusstämmen nicht nur im Zelltropismus begründet, sondern auch in der höheren Replikationseffizienz der virulenten Variante in Makrophagen.
Bei der Entstehung der FIP spielt aber auch eine gestörte mukosale Immunantwort eine Rolle. Infolge der Makrophagen-Infektion und -Aktivierung kommt es zu einer granulomatösen Phlebitis und Periphlebitis. Ob dabei auch Ablagerungen von Immunkomplexen im Sinne einer Arthus-Reaktion eine Rolle spielen, wird kontrovers diskutiert. Während eine intakte zelluläre Immunantwort vor der FIP schützt, muss die Rolle der humoralen Immunantwort differenzierter beurteilt werden. Einerseits sind Welpen durch maternale Antikörper geschützt und andererseits kann es durch die humorale Immunantwort zu einer Verstärkung des Krankheitsprozesses kommen. Dieses Phänomen wird als „antibody dependent enhancement“ bezeichnet.
Pathogenetisch spielt die zelluläre Immunantwort bei der Entstehung der verschiedenen Formen der FIP eine dominante Rolle. Bei der trockenen Form, einer (pyo-)granulomatösen Entzündung, liegt eine geringe Störung der zellulären Immunantwort vor. Bei der feuchten Form (fibrinöse Entzündung) ist sie hingegen hochgradig beeinträchtigt. Koinfektionen mit anderen felinen Pathogenen wie dem FeLV gehen vermutlich, wie auch Stress und zu hohe Besatzdichte, mit einer Resistenzminderung einher und begünstigen somit die FIP-Entstehung.
Trotz der teils charakteristischen histologischen Veränderungen sind differenzialdiagnostisch zahlreiche andere, auch bakterielle Erkrankungen, z.B. die Tuberkulose, zu berücksichtigen und entsprechend ätiologisch auszuschließen. Makroskopisch können die FIP-Granulome oft leicht als Neoplasien, besonders als Metastasen, fehlinterpretiert werden.
Diagnostik
Hierbei muss zwischen der enteralen FCoV-Infektion, die mittels RT-PCR nachweisbar ist, und der FIP unterschieden werden. Bei der FIP können virusspezifische Proteine bzw. RNS in Makrophagen mittels Immunhistologie oder In-situ-Hybridisierung insbesondere innerhalb der Läsionen lichtmikroskopisch detektiert werden. Ein positives RT-PCR-Ergebnis bei gesunden Katzen spricht nicht für das Vorliegen einer FIP, sondern nur für eine FCoV-Infektion. Allerdings ist bei erkrankten Tieren mit negativem Ergebnis das Vorliegen einer entsprechenden Manifestation unwahrscheinlich. Auch der Nachweis von FCoV-Antikörpern erlaubt nur eine Aussage über eine entsprechende Virusinfektion, nicht aber über das Vorliegen von FIP. Ein negativer Antikörpernachweis schließt eine FIP auch nicht aus, da insbesondere bei der feuchten Form im Endstadium ein dramatischer Abfall der Antikörpertiter nachweisbar ist. Es gibt gegenwärtig keinen zuverlässigen intravitalen FIP-Test. Serologische und virologische Ergebnisse sind immer im Kontext mit der Klinik und Pathologie zu interpretieren. Dagegen gestaltet sich die postmortale Diagnostik unter Einbeziehung ätiologischer Nachweismethoden eher unproblematisch. Dies gilt auch mit Einschränkungen für die Biopsiediagnostik.
1.6.3.3 Tuberkulose
Die Tuberkulose (▶ Synopse Tuberkulose) kann zur granulomatösen Serositis führen. Hund und Katze sind meist mit Mycobacterium (M.) tuberculosis (Anthropozoonose) infiziert. Seltener liegen Infektionen mit anderen Mykobakterien, z.B. M. avium ssp. hominissuis (Zooanthroponose), vor. Durch aufbrechende Lymphknoten kann eine exsudativ-nekrotisierende Serositis entstehen.
Beim Rind liegt meist eine Infektion mit M. bovis oder M. caprae vor (für beide Anzeigepflicht), die zu nodulären Proliferaten (sog. Perlsucht) führt (Differenzialdiagnose: Mesotheliom). Die Infektion der Serosa entsteht hämatogen (Früh- und Spätgeneralisation), lymphogen oder durch direktes Einbrechen tuberkulöser Organläsionen.
Makroskopische Veränderungen sind oft nicht hinreichend diagnostisch und können Besonderheiten der Tierart oder der Umstände widerspiegeln. So lassen weiße knötchenförmige Veränderungen der Serosa beim Rind in erster Linie an eine Perlsucht-Manifestation der Tuberkulose denken. Beim Hund dagegen sollte zuerst an eine metastatische Tumorausbreitung gedacht werden, z.B. eines Pankreas- oder Gallengangsadenokarzinoms. Erst die Histologie kann die Diagnose sichern.
Die Tuberkulose beim Pferd (M. bovis oder M. tuberculosis) betrifft nur selten die Serosen. Es treten grobnoduläre oder diffuse (infiltrative) Verdickungen der Serosa und seröse bis serofibrinöse Ergüsse (auch bei Hund, Katze) auf. Eine Beteiligung der Serosen bei Aktinomykose, Botryomykose, Rotz und Systemmykosen ist generell selten.
1.6.4 Parasitär bedingte Entzündungen
1.6.4.1 Trematoden
Bei allen Haustieren kommen transitorische Körperhöhlenparasiten vor. Bei Rindern, seltener Schafen, können die Metazerkarien von Fasciola hepatica transsomatisch in die Leber einwandern und bei starkem Befall eine serofibrinöse Peritonitis mit Verwachsungen verursachen. Die Mesozerkarien von Alaria alata (Hauptwirt Wildkaniden, selten Hund) wandern vom Darm über die Peritoneal- und Pleurahöhle bis in die Lunge. Dabei hinterlassen sie auch bei einem Massenbefall kaum Schäden.
1.6.4.2 Zestoden
Serosophile Bandwurmfinnen sind obligate Körperhöhlenparasiten:
Cysticercus tenuicollis (Taenia hydatigena des Hundes) bei Schwein und kleinen Wiederkäuern
Cysticercus pisiformis (Taenia pisiformis des Hundes) bei Hase und Kaninchen
Die mit klarer Flüssigkeit gefüllten Zysten liegen reaktionslos in der Subserosa. Abgestorbene Zysten von Cysticercus tenuicollis können beim Schaf pergamentartige und verkalkte Herde verursachen.
Bei Hund, Katze und Fuchs ist das Vorkommen von Metazestoden (Tetrathyridien) verschiedener Mesocestoides spp. in den Körperhöhlen möglich. Diese können zu einer chronischen Serositis mit seröser Exsudation führen können.
1.6.4.3 Nematoden
Zu den obligaten Parasiten, vor allem der Bauchhöhle, zählen Filarien. Bei der Setariose leben die adulten Individuen nahezu reaktionslos als spiralig aufgerollte Individuen in der Bauchhöhle (▶ Abb. 1.7). Nur selten entstehen Entzündungen mit Blutungen und Hämosiderose. Bei den verschiedenen Tierarten kommen folgende Filarien vor:
Beim Schwein wird die Setariose durch Setaria (S.) bernardi (Südostasien) und durch S. congolensis (Afrika) verursacht.
Beim Pferd kommt weltweit S. equina vor.
Beim Rind tritt S. digitata und seltener S. labiatopapillosa (syn. S. cervi) auf. Zudem können Wiederkäuer S. cervi, S. marshalli und S. africana beherbergen.
Durch die Larven III von S. digitata in nicht-adäquaten Wirten (Schaf, Pferd) kann eine Augensetariose verursacht werden. Diese Larven können bei Pferd, Schaf und Ziege auch eine zerebrospinale Nematodiasis in Form einer granulomatös-nekrotisierenden Entzündung provozieren.
Abb. 1.7Setaria sp. in der Leberserosa (formalinfixiertes Präparat) bei einem Reh.
(Quelle: Dr. Martin Peters, Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen, Standort Arnsberg)
Durch transitorische Nematoden kann vor allem bei jungen Hunden (Toxocara canis), aber auch bei anderen Spezies (z.B. Katze: Toxascaris leonina; Schwein: Ascaris suum, Pferd: Parascaris equorum) bei massiver Einwanderung eine eitrig-jauchige Peritonitis entstehen. Bei starkem Befall mit Oesophagostomum sp. (besonders Schafe) können Larven in die Bauchhöhle wandern und durch mitgeführte Bakterien eine eitrige Peritonitis verursachen. Wandernde Larven von Strongylus (St.) equinus und St. edentatus führen bei Equiden häufig zu villösen chronischen Serositiden mit zottigen Serosaanhängen, besonders auf Leber und Zwerchfell, Wurmnestern, verkalkten Knötchen und subserösen Nekrosen. Weiterhin sind Bohrgänge mit Blutungen vorhanden, die als fibröse adhäsive Peritonitis mit Verwachsungen (z.B. Leber-Zwerchfell, Darm-Mesenterium) ausheilen.
1.7 Tumoren
1.7.1 Primäre Tumoren
Mesotheliom Der wichtigste Primärtumor der Serosa ist das Mesotheliom, das meist maligne verläuft. Es tritt vor allem bei Rindern, Hunden, Katzen, Ziegen und Pferden auf. Innerhalb der Körperhöhlen breitet sich der Tumor per continuitatem rasch aus; Fernmetastasen sind selten. Grobknotige, konfluierende, weiße bis grau-rote, erhabene Umfangsvermehrungen (▶ Abb. 1.8) können infolge eines variablen Stromas eine weiche bis derbe Konsistenz aufweisen. Häufig sind seröse bis serosanguinöse Ergüsse durch die sekretorische Aktivität der Tumorzellen vorhanden. Histologisch kommen epitheloide, fibroblastische (spindelzellige) oder biphasische (gemischte) Varianten vor. Beim Mesotheliom kann eine Abgrenzung zu serosalen Metastasen von Adenokarzinomen (z.B. Lunge, Ovar, Pankreas) und granulomatösen Entzündungen makroskopisch schwierig sein.
Abb. 1.8 Mesotheliom mit grobnodulärem Tumorkonglomerat (*) in der Bauchhöhle bei einem Hund.
Im Gegensatz zum Menschen, bei dem Asbestfasern eine Ursache des Mesothelioms darstellen, ist die Tumorigenese beim Haustier nicht geklärt. Beim Rind wurde jedoch häufig auch ein Zusammenhang mit Asbest beim Stallbau beobachtet.
Weitere Primärtumoren Weitere serosale Primärtumoren können von den subserösen Gewebskomponenten ausgehen. Beispiele sind:
Fibrome/Fibrosarkome
Myxome/Myxosarkome
Lipome/Liposarkome
Hämangiome/Hämangiosarkome
Lymphangiome/Lymphangiosarkome
Neurofibrome
Die pendelnden Lipome (Lipoma pendulans) beim Pferd können durch Einschnürung von Darmteilen zu deren hämorrhagischer Infarzierung führen. Teratome, Rhabdomyosarkome, Chondrome und Osteome sind selten.
1.7.2 Sekundäre Tumoren
Die sekundären Tumoren gelangen lymphohämatogen oder durch Übergreifen bzw. Implantation maligner Neoplasien aus der Umgebung in die Körperhöhlen und können mit Entzündungen einhergehen. Die lymphogene Ausbreitung kann zu folgenden Veränderungen führen:
perlschnurartige Anordnung der Metastasen (Serositis carcinomatosaoder sarcomatosa)
Drainagestörungen
Ergüsse
Blutungen
passive Hyperämie
vermehrte sekretorische Aktivität
Kolliquationsnekrosen
Sekundäre Tumoren werden vor allem bei Hund und Katze beobachtet. In der Brusthöhle handelt es sich meist um Lungenkarzinome und pulmonale Metastasen von Mammakarzinomen, in der Bauchhöhle um Adenokarzinome von Leber, Gallenwegen, Pankreas, Magen, Darm, Ovar oder Prostata. Weiterhin treten maligne Melanome (▶ Abb. 1.9), Hämangiosarkome, Seminome und maligne Lymphome auf.
Differenzialdiagnostisch sind granulomatöse Entzündungen wie z.B. die Tuberkulose, akzessorisches Milzgewebe und bei Rindern Hämalknoten sowie die Endometriose bei Primaten zu berücksichtigen.
Abb. 1.9 Multiple Metastasen eines malignen Melanoms am Zwerchfell (→) bei einem Hund.
2 Verdauungsorgane
Robert Klopfleisch, Achim D. Gruber
2.1 Einleitung
2.1.1 Besonderheiten des Verdauungstrakts
Der Verdauungstrakt dient der Nahrungsaufnahme und stellt gleichzeitig eine Barriere zur Umwelt dar. Er zeigt von allen Organsystemen die größten tierartlichen Unterschiede.
Die wichtigsten Aufgaben des Verdauungstrakts sind
Inkorporation,
Prozessierung,
Resorption von Nährstoffen und Flüssigkeit,
Ausscheidung und
Entgiftung.
Funktionsstörungen können zu Mangelkrankheiten oder Vergiftungen sowie vielen anderen Problemen für den Gesamtorganismus führen.
Die Darmoberfläche stellt eine Grenzfläche zur äußeren Umwelt dar und hat innigen Kontakt mit einer Vielzahl von unbelebten und belebten, pathogenen und apathogenen Faktoren. Die Schleimhaut des Verdauungstrakts ist deshalb mit komplexen Schutz- und Detoxifikationsmechanismen sowie einem sehr komplexen und dabei hoch spezialisierten Immunsystem ausgestattet. Zu den wesentlichen Leistungen des Immunsystems zählt die Unterscheidung zwischen potenziell gefährlichen Stoffen und Erregern sowie unschädlichen Nahrungsbestandteilen, Bakterien und anderen Organismen. Das Ausbleiben einer immunologischen Reaktion – trotz einer Erkennung durch das Immunsystem – wird als Toleranzbezeichnet. Störungen der Toleranz können zu autoimmunen Erkrankungen führen wie den idiopathischen chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED; auch „inflammatory bowel disease“, IBD).
Tierartspezifische Unterschiede sind für die Krankheiten des Verdauungstrakts von so großer Bedeutung wie für kaum ein anderes Organsystem. Die Komplexität und Spezialisierung auf bestimmte Nahrungsarten und Ernährungsweisen und der daran angepassten, jeweils hoch spezialisierten Anatomie und Physiologie des Gastrointestinaltrakts führen zu spezifischen, bei anderen Tierarten nicht oder nur selten auftretenden Erkrankungen. Als Beispiel seien die Koliken beim Pferd genannt, die durch Verlagerungen der hier besonders komplex strukturierten Darmsegmente entstehen. Für das tierärztliche Management der speziesspezifischen Krankheitsdispositionen ist ein Verständnis der jeweiligen anatomischen und physiologischen Besonderheiten infolge evolutionärer Anpassungen deshalb unverzichtbar.
2.1.2 Typische Reaktionsmuster des Darmes auf Schädigungen
Die Entzündung stellt ein besonders häufiges und universelles Reaktionsmuster der Schleimhaut des Gastrointestinaltrakts dar. Die Entzündungsreaktionen des Verdauungstrakts auf Reizungen, Schädigungen oder Infektionen können dabei sehr vielgestaltig sein. Sie hängen sowohl von der Art und Dosis der Noxe, von der individuellen Abwehrlage und der genetischen Ausstattung des Wirtes ab. Allgemein lassen sich 6 prototypische Reaktionsmuster des Darms unterscheiden:
katarrhalische Entzündung
fibrinöse Entzündung
hämorrhagisch-nekrotisierende Entzündung
vesikuläre Entzündung
erosiv-ulzerative Entzündung
granulomatöse, noduläre bis diffuse (histiozytäre) Entzündung
Katarrhalische Entzündung Sie () stellt oft die 1. Phase der Entzündung dar und ist durch eine Hypersekretion, Hyperämie und Ödematisierung gekennzeichnet. Treten im Laufe der Entzündung vermehrt neutrophile Granulozyten aus den Gefäßen in die entzündlichen Sekrete ein, so spricht man von einer katarrhalisch-eitrigen Entzündung.
Fibrinöse Entzündung Kommt es im Rahmen der Entzündung zu einer Schädigung der Gefäße, so kann hochmolekulares Fibrinogen austreten und gerinnen. Es kommt zu einer fibrinösen Entzündung(). Finden sich membranartige Fibrinauflagerungen, so bezeichnet man dies als pseudomembranöse Entzündung. Sind die Fibrinbeläge fest mit der darunterliegenden nekrotischen Schleimhaut verbunden, bezeichnet man dies als diphtheroide Entzündung. Je nach Dominanz und Tiefe der Nekrosen der Schleimhaut wird auch der Begriff diphtheroid-nekrotisierende Entzündung verwendet.
Hämorrhagisch-nekrotisierende Entzündung Eine Schädigung der Blutgefäße der Darmwand kann zu einer hämorrhagisch-nekrotisierenden Entzündung() führen. Sie wird meist durch toxinbildende Bakterien oder endotheliotrope Viren hervorgerufen und ist durch den Austritt von Erythrozyten und anderen Blutzellen in die Darmwandstrukturen und das Darmlumen charakterisiert.
Vesikuläre Entzündung Bei vesikulären Entzündungen () führen z.B. Virusinfektionen oder thermische und chemische Noxen zu einer Nekrose der basalen und mittleren Schichten eines mehrschichtigen Epithels. Diese Räume füllen sich im weiteren Verlauf mit Gewebsflüssigkeit und einzelnen neutrophilen Granulozyten. Sie werden als Vesikel bezeichnet.
Erosiv-ulzerative Entzündung Im Rahmen einer erosiv-ulzerativen Entzündung führen nicht-lebende Noxen oder Infektionserreger zu einem partiellen bis kompletten Verlust des nekrotischen Epithels (). Bei einschichtigen Epithelien gilt die Verletzung der Tunica muscularis mucosae als Kriterium der Unterscheidung zwischen oberflächlich erosiver und tiefer ulzerativer Entzündung. Bei mehrschichtigen Epithelien stellt die Zerstörung der Basalmembran hingegen den Übergang zwischen erosiver und ulzerativer Entzündung dar.
Granulomatöse, noduläre bis diffuse (histiozytäre) Entzündung Schwer eliminierbare Erreger wie Mykobakterien oder Pilze führen zu granulomatösen, nodulären bis diffusen (histiozytären) Entzündungen. Die nodulären Entzündungen zeichnen sich durch mehr oder weniger typisch strukturierte sphärische Granulome (tuberkuloide Form) aus. Diffuse granulomatöse bzw. histiozytäre Entzündungen stellen hingegen diffuse Infiltrationen mit Makrophagen dar. Sie nehmen nicht die typische Schichtung eines Granuloms an (z.B. Paratuberkulose des Rindes, leproide Form).
Proliferative Entzündungen Chronische Entzündungen können bei nur geringgradig zytolytischem Charakter des verursachenden Erregers zu proliferativen Entzündungen führen. Bei diesen Erkrankungsformen stellen die Infektion sowie die Entzündung einen Proliferationsanreiz für die Epithelzellen, Entzündungszellen und ggf. auch weitere Gewebekomponenten dar. Sie führen zu einer Verdickung der Schleimhaut, die dadurch im Darm möglicherweise ihre Absorptionsfunktion verlieren kann.
Folgeveränderungen Die Zottenatrophie ist ein häufiger Folgebefund von persistierenden entzündlichen Veränderungen des Dünndarms. Die Zotten sind dabei stark verkürzt. Teilweise sind mehrere benachbarte Zotten miteinander verwachsen (Zottenfusion, ). Es kann eine Reduktion der absorptiven Oberfläche mit reduzierter Nahrungsaufnahme daraus resultieren (Malabsorption). Die Zottenatrophie ist die Folge eines erhöhten Verlusts von Epithelzellen an der Zottenspitze durch Zellnekrose, z.B. bei Rota- oder Coronavirusinfektionen. Sie kann aber auch die Folge eines Verlusts der teilungsfähigen Kryptepithelzellen sein wie bei Parvovirusinfektionen (▶ Synopse Parvovirus) oder der sog. Strahlenkrankheit. Ein nicht-nekrotischer entzündlicher Stimulus im tiefen Kryptenbereich von Dünn- und Dickdarm kann jedoch auch zu einer Krypthyperplasie führen. Dabei verbreitert sich die Kryptenbasis, die mehr und dicht gedrängte Epithelzellen mit reduzierter Becherzellzahl beinhaltet. Es kann zu einer L-förmigen Abknickung der Kryptenbasis kommen.
Abb. 2.1 Bei der katarrhalischen Entzündung der Epithelien des Gastrointestinaltrakts kommt es infolge einer Weitstellung der subepithelialen Gefäße zu einer Hyperämie der Darmwand. Die erhöhte Gefäßpermeabilität führt zu einem erhöhten Austritt von Transsudat. Mit zunehmender Dauer der katarrhalischen Entzündung können ebenfalls neutrophile Granulozyten aus den Gefäßen austreten. Es kann zu einer katarrhalisch-eitrigen Entzündung kommen.
Bei einer stärkeren Schädigung der Gefäße durch die auslösende Noxe können höhermolekulare Substanzen des Blutplasmas wie Fibrinogen aus den Blutgefäßen austreten. Sie polymerisieren auf der Schleimhaut und führen zu einer fibrinösen Entzündung. Treten zusätzlich auch Nekrosen des Epithels auf, wird die Entzündung als diphtheroid-nekrotisierend bezeichnet.
Bei hochvirulenten Erregern oder infolge von bakteriellen Toxinen kann es zu einer so starken Schädigung der Gefäßwand kommen, dass auch zelluläre Bestandteile aus dem Blut austreten. Hauptsächlich treten dabei Erythrozyten aus. Eine hämorrhagische Entzündung ist die Folge. Diese ist nicht zu verwechseln mit der entzündungsbedingten Hyperämie. Bei dieser finden sich die Erythrozyten vermehrt intravaskulär.
Virusinfektionen oder chemisch-physikalische Noxen wie Verbrennungen können zu einer Nekrose vor allem der mittleren Epithelzellschichten führen. Der sich bildende Hohlraum füllt sich schnell mit Gewebsflüssigkeit und wenigen neutrophilen Granulozyten. Ein Vesikel entsteht im Rahmen einer vesikulären Entzündung.
Bei mehrschichtigen Epithelien werden Nekrosen des Epithels bei Intaktheit der Basalmembran als Erosionen bezeichnet. Nekrosen des gesamten Epithels inklusive der Basalmembran werden hingegen als Ulzeration bezeichnet (z.B. Mundhöhle und Ösophagus). Im Gegensatz dazu wird bei einschichtigem Epithel eine Nekrose des Epithels bei Intaktheit der Lamina muscularis mucosae als Erosion bezeichnet. Bei einer Schädigung der Lamina muscularis mucosae liegt eine Ulzeration vor (Darm). Grau schraffiert: die minimale Ausdehnung der Schädigung zur Definition eines Ulkus.
Zottenatrophie mit Verkürzung der Zottenlänge. Die häufig damit verbundene Fusion von Zotten ist ein typischer Befund des subakut bis chronisch entzündlich geschädigten Dünndarms. Sie entsteht unabhängig davon, welche Epithelien initial geschädigt sind. So führen sowohl die initiale Infektion der Krypteptihelzellen bei der Infektion mit Parvoviren als auch die Infektion von Epithelzellen der Zottenspitze bei Rota- oder Coronavirusinfektionen zur Zottenatrophie und -fusion.
Typische Reaktionsmuster des Darms.
2.1.3 Postmortale Veränderungen
Der Verdauungstrakt ist hochempfänglich für eine postmortale Auto- und Heterolyse. Grund dafür ist die starke, physiologische oder pathologische bakterielle Besiedelung großer Abschnitte des Verdauungstrakts sowie des feuchten und nährstoffreichen Milieus. Ein weiterer Grund ist der streckenweise hohe Gehalt an Verdauungsenzymen. Dies kann zum Zeitpunkt der Sektion, bereits wenige Stunden nach dem Verenden, zu erheblichen Veränderungen der anatomischen Strukturen und intravital entstandenen krankhaften Veränderungen führen. Eine aussagekräftige Diagnosestellung kann daher beeinträchtigt werden. Aufgrund der Häufigkeit und ihres raschen Voranschreitens sind Kenntnisse über postmortale Veränderungen im Verdauungstrakt von großer Bedeutung. Auch eine zeitnahe Sektion von Kadavern ist für die Qualität der Sektionsbefunde entscheidend.
Maulhöhle und Ösophagus Typische postmortale Veränderungen in der Maulhöhle sind:
Austrocknung
areaktive Zahneindrücke in der Zunge
agonal erbrochener oder postmortal entleerter Mageninhalt
Weiterhin ist nach dem Einfrieren von Kadavern häufig ein trockener, eingesunkener, oft weißer Gefrierbrand der aus dem Maul herausstehenden Zungenspitze zu beobachten.
Postmortale Veränderungen am Ösophagus umfassen Schleimhautablösungen in den kaudalen Abschnitten. Diese entstehen durch zersetzenden Magensaft. Selten finden sich aktiv auswandernde oder agonal erbrochene Askariden.
Vormägen und Magen Die Vormägen der Wiederkäuer, insbesondere der Pansen, zeigen bereits wenige Stunden nach dem Tod eine meist hochgradige postmortale Tympanie. Diese kann in einem Teil der Fälle durch das Fehlen einer Tympanielinie im Bereich des Ösophagus von ▶ intravitalen Tympanien differenziert werden. Der enzym-, bakterien- und protozoenreiche Pansensaft führt weiterhin rasch zu einer Mazeration und Ablösung der Vormagenepithelien. Ähnliche Veränderungen finden sich im Dickdarm des Pferdes.
Im Rahmen der Autolyse des Magens kommt es rasch zu einem Selbstverdau der Schleimhaut. Diese löst sich besonders bei Pferd und Kaninchen in teils recht großen Fetzen ab oder wird in eine schmierig-graue Substanz zersetzt. Im Extremfall kommt es zu einer Auflösung von Anteilen der Magenwand und einer postmortalen Magenruptur. Dies wird recht häufig bei der relativ dünnen Magenwand von Kaninchen und Meerschweinchen, aber auch beim Pferd beobachtet. Die postmortalen Magenrupturen sind in der Regel jedoch recht gut von den intravitalen ▶ Magenrupturen zu unterscheiden, da sie keine Hämorrhagie am Rupturrand und keinen treppenartigen Aufbau der Rupturränder zeigen und nicht mit fibrinösen Verklebungen der Futterbestandteile mit dem Peritoneum assoziiert sind.
Hypostaseund blutige Imbibition der Mägen bzw. des Drüsenmagens der Wiederkäuer können zu einer ausgeprägten Rötung der Magenschleimhaut führen. Diese kann einer entzündlichen Hyperämie im Rahmen einer akuten Gastritis ähneln. Dieses postmortal akkumulierte, aber auch physiologisch vorhandene Hämoglobin kann durch Reaktion mit fäulnisassoziiertem Schwefelwasserstoff zu Sulfmethämoglobin umgewandelt werden. Dieses kann im weiteren Verwesungsverlauf zu einer grünlich-braunen bis grau-schwarzen Verfärbung der Magen- und Darmwand führen (Pseudomelanose).
Eine gelbgrün-bräunliche Verfärbung kann besonders im Bereich des Pylorus und Duodenums entstehen. Ebenfalls sind Verfärbungen im Bereich des Kontakts der Magenaußenwand oder anderer peritonealer Strukturen mit der Gallenblase sind möglich. Diese erst postmortal erfolgende passive Diffusion von Gallepigment durch das Gewebe wird als gallige Imbibition bezeichnet.
Darm Die postmortalen Veränderungen des Darms ähneln prinzipiell denen des Magens. Folgende Veränderungen treten auf:
postmortale Tympanie
blutige und gallige Imbibition
schmierige oder fetzenartige Autolyse der Schleimhäute
Schwierigkeiten bereitet häufig die Abgrenzung eines hyperämischen bis hämorrhagischen, intravital/agonal entstandenen Schockdarms von einer postmortalen Hypostase. Beide zeigen eine ähnliche Rotfärbung der Darmwand und teilweise einen Übertritt von Erythrozyten aus der Darmwand in das Darmlumen.
Zusätzlich kann in nahezu allen Darmabschnitten eine postmortale Darminvagination auftreten. Sie ist Folge der asynchron und ungleichmäßig auftretenden Totenstarre der Darmsegmente. Sie darf nicht mit einer intravitalen Invagination verwechselt werden:
intravitale Invagination
fibrinöse Verklebung der serösen Oberflächen
dunkelrote Verfärbung infolge einer hämorrhagischen Infarzierung
postmortale Invagination
fehlende fibrinöse Verklebung
fehlende dunkelrote Verfärbung
Der Dünndarm der Katze zeigt postmortal generell einen etwas höheren Grundtonus als bei anderen Tierarten. Dieser wird durch die Autokontraktion bei Kontakt mit dem kalten Sektionstisch verstärkt und führt nach Längseröffnung auch bei gesundem Katzendarm zu einer regenrinnenartigen Aufwölbung. Bei anderen Tierarten kann dieses Phänomen auf ein Darmwandödem hinweisen. Beim Rind kann eine postmortale Kontraktion des Dünndarms den Eindruck einer granulomatösen Entzündung vortäuschen, wie sie im Zusammenhang mit einer Paratuberkulose festzustellen ist.
2.2 Maul- und Rachenhöhle
2.2.1 Missbildungen
Spaltbildungen Sie stellen infolge sog. Hemmungsmissbildung die häufigsten Missbildungen des Gesichtsschädels und der Maulhöhle dar. Eine Fusion der meist bilateral symmetrischen fetalen Strukturen, insbesondere der Processus frontonasales und der Processus maxillares, unterbleibt. Die Ursache bleibt im Einzelfall meist unbekannt. Eine Aufnahme verschiedener teratogener pflanzlicher Inhaltstoffe über das Muttertier während der Trächtigkeit wurde jedoch vereinzelt identifiziert.
So führt die Aufnahme von Piperidinalkaloid-produzierenden Lupinen oder Schierling durch Mutterkühe zwischen dem 40. und 50. Trächtigkeitstag zur Gaumenspaltenbildung und Arthrogryposebei Kälbern.
Die Behandlung mit Griseofulvin, einem Antimykotikum, kann bei Katzenwelpen zur Spaltenbildung führen.
Insbesondere bei Hereford-Rindern, Boxerhunden, aber auch bei Siamkatzen und Abessinierkatzen wird jedoch auch aufgrund des familiär gehäuften Auftretens von Gaumenspalten von einer erblichen Disposition ausgegangen. Die genauen genetischen Defekte sind jedoch noch unbekannt.
Die Nomenklatur der Spaltenbildung (griechisch -schisis, Spaltung) erfolgt nach der betroffenen anatomischen Struktur (▶ Tab. 2.1). Zumeist treten die Spaltbildungen als Komplex auf. Die Bezeichnung erfolgt dann je nach Zusammensetzung.
Tab. 2.1
Nomenklatur der Spaltenbildung.
deutsche Bezeichnung
Fachterminus
Operlippenspalte
Cheiloschisis
Kieferspalte
Gnathoschisis
Gaumenspalte
Palatoschisis
Lippenkieferspalte
Cheilognathoschisis
Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
Cheilognathopalatoschisis
Verkürzungen oder Verlängerungen Verkürzungen oder Verlängerungen von Unter- oder Oberkiefer sind ebenfalls häufige Missbildungen bei Haus- und Nutztieren. Sie stellen jedoch bei brachyzephalen Hunde- und Katzenrassen ein erwünschtes Rassemerkmal und Zuchtziel dar. Eine Verkürzung des Oberkiefers wird als Brachygnathia superior bezeichnet. Als Folge kann diese jedoch zu einer Beeinträchtigung des Kauvorgangs sowie zu Zahnfehlstellungen und sekundären Entzündungen führen. Bei veränderter Nasenanatomie kann sie zur Beeinträchtigung der nasalen Atmung führen.
Eine Verkürzung des Unterkiefers wird als Brachygnathia inferior bezeichnet. Sie tritt am häufigsten bei Rindern und Schafen auf und kann zur Beeinträchtigung des Saugvorgangs bei Kälbern und Lämmern führen. Aus diesem Grund ist sie, in Abhängigkeit vom Ausmaß der Veränderung, oft nicht mit dem Überleben der Tiere vereinbar. Prognathie, eine Überlänge der Unterkiefer, oder Agnathie, das vollständige Fehlen eines oder beider Kieferäste, sind seltene Missbildungen bei Tieren. Sie sind ebenfalls zumeist nicht mit einem Überleben vereinbar.
Wissenswertes
Abnorme Entwicklungen des Angesichtsschädels (z.B. die Brachyzephalie) stellen besonders bei Hunden (z.B. Boxer, Mops), Katzen (z.B. Perserkatze) und Kaninchen (z.B. Löwenkopfkaninchen) oft ein Rasseziel dar, auf das über viele Jahrzehnte selektiv gezüchtet wurde. Je stärker die Merkmale ausgeprägt sind, desto schwerer sind oft auch dadurch induzierte Folgeerkrankungen, z.B. Zahnfehlstellungen, Verlegung des Tränennasengangs oder relativ zu langes Gaumensegel. Das damit einhergehende Leiden der Tiere erfordert oft tierärztliche Maßnahmen.
Epitheliogenesis imperfecta Sie stellt eine vererbbare, mechanobullöse Anomalie der kutanen Epithelien und somit auch der kutanen Schleimhaut des Maules dar. Die Anomalie tritt bei Fohlen, Kälbern, Ferkeln und Lämmern auf. Sie führt in der Maulhöhle zu multifokalem bis großflächigem Fehlen von scharf begrenzten Epithelanteilen. Teilweise treten höckerige Zahnoberflächen auf.
Epidermolysis bullosa Ist eine weitere, sehr seltene Erbkrankheit. Sie tritt beim Schwarzkopfschaf, Hereford-, Simmentaler-, Angus- und Brangus-Rind sowie Collies und Shelties auft. Es kommt zu vesikulären und ulzerativen Veränderungen in der Maulhöhle und der Haut. Differenzialdiagnostisch muss daher die Maul- und Klauenseuche ausgeschlossen werden. Ursache ist ein Laminin-5-Defekt in den Keratinozyten.
Missbildungen der Zunge Die wichtigsten Missbildungen der Zungestelleneine Aglossie(vollständiges Fehlen der Zunge), eine Mikroglossie(stark verkleinerte Zunge), eine Makroglossie (stark vergrößerte Zunge) und eine Glossoschisis (Spaltbildung der Zunge) dar.
2.2.2 Farbveränderungen, Kreislauf- und Stoffwechselstörungen
Wie für die klinische Diagnose intra vitam können Farbveränderungen der Maulschleimhaut auch postmortal wichtige Hinweise auf eine systemische Erkrankung geben.
Eine blassrosa bis weiße Maulschleimhaut kann hinweisend auf eine Anämie sein. Diese ist jedoch nicht immer sicher von der Leichenblässe abzugrenzen. Multifokale, mehr oder wenig scharf abgegrenzte weiße, pigmentlose Flecken werden als Leukoplakien bezeichnet. Sie sind oft die Folge von ausgeheilten Erosionen und Ulzerationen und stellen somit narbenähnliche, reepithelialisierte Strukturen dar.
Eine dunkelrote bis -blaue Zyanose der Maulschleimhaut kann durch einen allgemein gestörten venösen Blutabfluss im Kopf- und Halsbereich verursacht werden wie z.B. nach Strangulationen. Es ist jedoch auch ein möglicher und namensgebender Befund der anzeigepflichtigen Blauzungenkrankheit des Schafes (▶ Synopse Blauzungenkrankheit).
Multifokale rote bis dunkelrote Verfärbungen können die Folge einer ungleichmäßigen postmortalen Blutverteilung sein. Es kann sich auch um petechiale bis ekchymatöse, meist subepitheliale Hämorrhagien infolge von Septikämien handeln. Bei größeren Blutungen treten sie auch infolge eines Traumas auf. Ist die dunkelrote Verfärbung mit einem Verlust der typischen glatt-glänzenden Oberflächenstruktur des Epithels assoziiert, sind diese hinweisend auf eine erosiv-ulzerative Stomatitis.
Eine gelbliche Verfärbung der Maulschleimhaut steht zumeist mit einem Ikterusin Zusammenhang. In weniger ausgeprägten Fällen sind die Sklera und die Aorta besser geeignet, um ikterische Veränderungen zu erkennen.
Im Rahmen einer Bleivergiftung kann es zu einer Ablagerung von blau-grauem bis schwarzem Bleisulfid am Zahnfleischrand kommen. Hierbei handelt es sich um den sog. Bleisaum.
Eine senile Atrophie der Gingiva mit nachfolgendem Zahnausfall wird bei alten Hunden und Katzen beobachtet. Weiterhin kommt eine Calcinosis circumscripta im Bereich der Zunge beim Hund vor. Wie in der Haut führen auch hier die Mineralisierungen zu einer Fremdkörperreaktion mit granulomatöser Entzündung. Ein Vitamin-A-Mangel führt beim Ferkel zu papillomatösen Proliferationen und Hyperkeratose im Bereich des Zungenrands.
2.2.3 Entzündungen
Eine Entzündung der Maulhöhle ohne besondere Zentrierung auf eine einzelne anatomische Struktur im Maul wird als Stomatitisbezeichnet. Findet sich die Entzündung jedoch an speziellen Lokalisationen, kann die Nomenklatur differenziert werden:
Glossitis: Entzündung der Zunge
Cheilitis: Entzündung der Lippen
Gingivitis: Entzündung des Zahnfleischs
Pharyngitis: Rachenentzündung
Tonsillitis: Mandelentzündung
Palatitis: Entzündung des harten Gaumens
Angina: Entzündung des weichen Gaumens
2.2.3.1 Stomatitis und Pharyngitis
Katarrhalische Stomatitis und Pharyngitis
Die katarrhalische Stomatitis und Pharyngitis ist durch eine multifokale bis diffuse Hyperämie und Schwellung der Schleimhaut gekennzeichnet. Meist ist sie mit einer Schwellung der Tonsillen und einer erhöhten Speichelbildung verbunden. Sie ist als pathologisch-anatomischer Befund als recht unspezifisch einzustufen, da eine Reihe von chemischen, physikalischen, aber auch mikrobiellen Noxen zumindest initial eine katarrhalische Stomatitis und Pharyngitis hervorrufen können. Die katarrhalische Stomatitis und Pharyngitis stellt vor allem die akute Phase mikrobiell induzierter Entzündungen der Maulschleimhaut dar. Diese kann sich im weiteren Verlauf, je nach Erreger, weiterentwickeln. Es können eine vesikuläre, erosiv-ulzerative oder diphtheroid-nekrotisierende Stomatitis





























