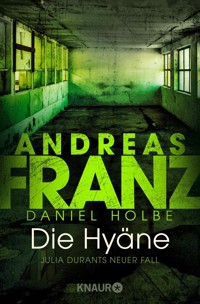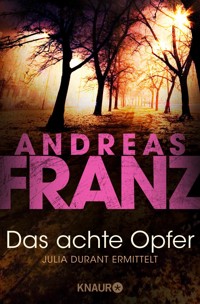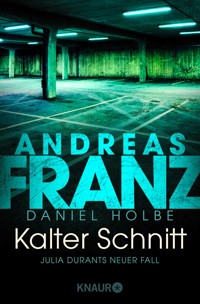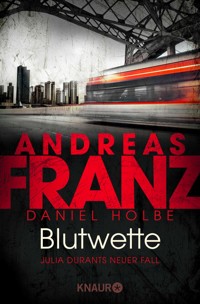9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nicht jede Organspende ist freiwillig … In einem Kieler Vorort wird die Leiche von Oberkommissar Gerd Wegner in seinem Auto gefunden. Die Fenster sind abgedichtet, ein Schlauch führt vom Auspuff ins Wageninnere, das Garagentor ist geschlossen, der Motor läuft. Kommissar Sören Henning und seine Kollegin Lisa Santos sind fassungslos: Kann es sein, dass sich ihr langjähriger Freund und Kollege umgebracht hat? Die schöne Witwe Nina glaubt jedoch nicht an den Selbstmord ihres Mannes, und Sören und Lisa beginnen zu ermitteln. Die Spur führt in eine Schönheitsklinik, in der nicht nur kosmetische Operationen vorgenommen werden…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Andreas Franz
Spiel der Teufel
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Dienstag, 17. April 2007
Dienstag, 14.35 Uhr
Dienstag, 16.20 Uhr
Dienstag, 17.10 Uhr
Dienstag, 20.45 Uhr
Dienstag, 23.35 Uhr
Dienstag, 19.15 Uhr
Mittwoch, 1.50 Uhr
Mittwoch, 3.20 Uhr
Mittwoch, 8.45 Uhr
Mittwoch, 7.15 Uhr
Mittwoch, 8.15 Uhr
Mittwoch, 10.20 Uhr
Mittwoch, 11.15 Uhr
Mittwoch, 11.30 Uhr
Mittwoch, 14.20 Uhr
Mittwoch, 16.30 Uhr
Mittwoch, 22.10 Uhr
Mittwoch, 23.15 Uhr
Donnerstag, 2.10 Uhr
Donnerstag, 7.35 Uhr
Donnerstag, 9.55 Uhr
Donnerstag, 11.25 Uhr
Donnerstag, 11.50 Uhr
Donnerstag, 13.00 Uhr
Donnerstag, 13.40 Uhr
Donnerstag, 14.35 Uhr
Donnerstag, 14.40 Uhr
Donnerstag, 16.05 Uhr
Donnerstag, 17.25 Uhr
Donnerstag, 20.00 Uhr
Donnerstag, 23.00 Uhr
Freitag, 9.00 Uhr
Freitag, 9.10 Uhr
Freitag, 12.30 Uhr
Freitag, 15.35 Uhr
Freitag, 17.55 Uhr
Freitag, 18.20 Uhr
Freitag, 19.57 Uhr
Freitag, 19.33 bis 23.17 Uhr
Epilog
Für
Helen Maria und Carsten Themba.
Ihr seid die neuen Sonnen in unserm
Familien-Universum. Lasst euer Licht leuchten
und geht den Weg, der für euch bestimmt ist.
Ihr könnt immer auf uns zählen.
Glaub mir, ich kenne alle, sogar den Teufel. Und soll ich dir sagen, wie er aussieht? … Wie du und ich.
Prolog
St. Petersburg, November 2001
Es war kalt, als Larissa ihre Sachen packte. Kalt in der Stadt, wo bereits im Oktober der erste Schnee gefallen war, kalt in ihrem kärglich eingerichteten Zimmer, weil wieder einmal die Heizung nicht funktionierte und sich seit vorgestern am Fenster winzige Eisblumen gebildet hatten. Sie fror, obwohl sie über der Unterwäsche eine dicke Wollstrumpfhose, Wollsocken, eine Jeans und einen Wollpullover trug, wovon bis auf die Jeans alles von ihrer Mutter gestrickt worden war. Ihre Hände und ihre Nase waren von der Kälte rot. Sie hatte, als sie ihr Elternhaus verließ, gewusst, dass es in St. Petersburg nicht einfach werden würde, und sie hatte auch gewusst, dass sie sich als eine junge Frau vom Lande in der Großstadt erst einmal würde zurechtfinden müssen.
Anfangs schien es zu klappen. Sie kam mit dem Geld recht gut über die Runden, doch bereits nach vier Monaten waren ihre wenigen Ersparnisse aufgebraucht, und sie hatte überlegt, ob es nicht besser wäre, das Studium abzubrechen und wieder nach Hause zu fahren. Aber sie wollte unbedingt ein besseres Leben führen, ein besseres als ihre Eltern, und vielleicht würde sie es sogar schaffen, ihnen eines Tages hin und wieder etwas Geld zukommen zu lassen.
Doch jeder Tag wurde zu einem Kampf ums Überleben. Sie musste die Miete zahlen, die ihre herrische Vermieterin pünktlich an jedem Ersten des Monats einforderte, sie musste essen, was oft nicht mehr als trocken Brot und ein paar Kartoffeln waren. Seit sie in der großen Stadt lebte, hatte sie sich nichts Neues zum Anziehen zugelegt. Sie ging sehr sorgsam mit ihrer Kleidung um, die ihre Eltern ihr zum Abschied gekauft hatten, wofür sie ihr letztes Geld zusammengekratzt hatten. Aber sie waren stolz auf Larissa und ihren Ehrgeiz und hofften, sie würde es irgendwann besser haben.
Es dauerte nicht lange, bis Larissa einen Aushilfsjob in einem Restaurant fand, wo sie als Spülerin ein paar Rubel hinzuverdiente, und später in einem Sexshop, bis sie von dem Besitzer gefragt wurde, ob sie nicht lieber mehr Geld hätte. So hübsch und attraktiv, wie sie sei, wäre es ein Leichtes, in dieser teuren Stadt angenehm und ohne Sorgen zu leben. Sie wusste, was er damit meinte, bat jedoch um Bedenkzeit. Nach ein paar Tagen hatte sie sich entschieden, ihren Körper niemals zu verkaufen, lieber würde sie sterben. Doch bereits am Abend nach ihrem Entschluss, den sie dem Sexshopbesitzer mitteilte, standen, als sie sich bereits fürs Bett fertigmachen wollte, drei Polizisten vor ihrer Tür, zerrten sie wortlos die Treppe hinunter und in einen Streifenwagen und vergewaltigten sie mehrfach an einer dunklen Stelle am Ufer der Newa. Die Männer hatten die ganze Zeit über kaum ein Wort gesprochen, sie hatten nur ein paarmal hämisch gelacht, und als sie fertig waren, hatten sie Larissa einfach im Dreck liegenlassen und waren davongefahren, nicht ohne ihr vorher deutlich zu verstehen zu geben, dass sie ab sofort jeden Abend zwischen zwanzig Uhr und zwei Uhr an einer bestimmten Stelle zu stehen und so viele Freier zu bedienen habe, wie nach ihr verlangten. Sie hatten ihren Körper misshandelt und missbraucht, aber sie hatten nicht Larissas Willen und Stolz gebrochen, obwohl sie viele Tage benötigte, um sich physisch von dem Geschehenen zu erholen.
Seit jener verhängnisvollen Nacht stand sie selbst in der größten Kälte allabendlich an der Straße und erfüllte Freiern die ausgefallensten und perversesten Wünsche, doch das Geld, das sie dabei verdiente, gehörte nicht ihr, nein, sie musste es bis auf ein paar wenige Rubel an die drei Polizisten abführen. Und wenn sie einmal keinen Freier hatte, was durchaus passierte, kamen die drei und vergingen sich wieder an ihr als Strafe dafür, nicht genug Einsatz zu zeigen.
Larissa wusste von einigen Studienkolleginnen, dass sie das gleiche Schicksal erlitten wie sie, und man munkelte, dass fast die Hälfte der Studentinnen Dinge tun musste, die sie eigentlich nicht tun wollten. Doch dies war nur ein Gerücht. Sie wusste aber auch, dass etliche von ihnen drogenabhängig waren oder an der Flasche hingen, weil sie dem Druck nicht mehr gewachsen waren. Und zwei dieser jungen Frauen hatten sich innerhalb weniger Tage das Leben genommen.
Knapp drei Wochen waren seit der ersten Vergewaltigung vergangen, als sie an einem Freitagmittag von ihrer Professorin in deren Büro bestellt und ihr Tee und Gebäck angeboten wurde. Die kleine, leicht gedrungene, aber nicht unattraktive Frau sah Larissa mit mütterlich-gütigem Blick an und sagte lächelnd und mit der gewohnt sanften Stimme, die sie nur manchmal leicht erhob: »Sie werden sich fragen, warum ich Sie in mein Büro gebeten habe. Nun, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich Sie für eine weit überdurchschnittlich talentierte Malerin halte, für ein Ausnahmetalent, um genau zu sein. Sie können sicher sein, dass ich das gewiss nicht jedem sage.«
Danach machte sie eine kurze Pause, die braunen Augen auf Larissa gerichtet, deren Gesicht sich gerötet hatte, denn solche Worte hatte sie bislang nur einmal gehört, von ihrem Lehrer in der Schule. »Geh weg von hier«, hatte er gesagt, »hier ist nicht der rechte Platz für eine junge und so talentierte Frau wie dich. Du hast so viel Ausdruck in deinen Bildern, so viel Gefühl, so viele Emotionen, du würdest dein Leben wegwerfen, wenn du hierbleiben würdest. Geh und folge deiner Bestimmung.« Nicht lange danach hatte sie sich auf den Weg nach St. Petersburg gemacht, mehr als zweitausend Kilometer von zu Hause entfernt, wo kaum jemand ein Telefon besaß, wo die meisten Häuser noch aus Holz gebaut und die Straßen, wenn es überhaupt welche gab, kaum als solche zu bezeichnen waren.
Aber die Illusion der schönen großen Stadt war spätestens vor drei Wochen wie eine Seifenblase zerplatzt. Und nun saß sie vor ihrer Professorin, die sie mit noch immer gütigem Blick ansah.
»Und ich möchte Ihnen auch sagen, dass ich St. Petersburg nicht für den geeigneten Ort halte. Ich meine, Sie sind hier nicht gut aufgehoben. Die Bedingungen hier sind für Sie, wenn ich mir Ihre Akte und Ihre Herkunft anschaue, alles andere als ideal. Aber lassen Sie mich auf den Punkt kommen, denn ich habe gleich noch einen Termin. Was ich sagen will, ist, dass ich Sie an einer anderen Universität unterbringen könnte, wo alles für Sie leichter wäre.«
»An einer anderen Universität? Was meinen Sie damit?«, fragte Larissa, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Erst hatte ihr Lehrer in ihrem Dorf gesagt, sie solle nach St. Petersburg gehen, weil es keine Universität auf der ganzen Welt gebe, wo man die Feinheiten des Malens besser erlernen könne. Und nun sagte ihre Professorin, sie solle an einer anderen Universität studieren.
»Schauen Sie, in St. Petersburg gibt es nicht viele Studenten, die ein unbeschwertes Leben führen können. Sie sind nicht allein mit Ihrem Problem, ich kenne eine Menge anderer Studentinnen, die sich ihren Lebensunterhalt auf geradezu menschenunwürdige Weise verdienen müssen …« Larissa wollte gerade etwas einwerfen, doch ihre Professorin hinderte sie mit einer Handbewegung daran. »Lassen Sie mich bitte ausreden. Ich möchte nicht, dass Sie in dieser Stadt kaputtgehen. Ich habe sehr gute Beziehungen ins Ausland, besonders nach Deutschland. Ich weiß, dass Sie recht gut Deutsch sprechen, weil ihre Vorfahren aus Deutschland stammen und Sie zu Hause viel Deutsch gesprochen haben und … Nun, um es kurz zu machen, ich kann Sie an eine Universität in Berlin vermitteln, wo Sie in Ruhe studieren können, vorausgesetzt, Sie wollen das. Außerdem hätten Sie dort immer genug zu essen, ein schönes Zimmer und eine nette Familie, bei der Sie wohnen würden. Es ist eine Vorzugsbehandlung, ich weiß, aber ich weiß auch, dass Ihr Leben zurzeit nicht gerade ein Zuckerschlecken ist …«
»Was wissen Sie von mir?«
Larissas Professorin lächelte milde und gleichzeitig geheimnisvoll und erwiderte: »Genug. Man zwingt Sie zu Dingen, die Sie nicht tun wollen. Keine Frau will das, doch viele können sich nicht entziehen. Viele Studentinnen sind hier gezwungen, sich ihren Lebensunterhalt wie Sie zu verdienen. Nur leider kann ich nicht jeder helfen«, fügte sie bedauernd hinzu. »Was halten Sie von meinem Angebot? Ich habe erst vorhin die Anfrage dieser Familie auf meinen Tisch bekommen«, sagte sie und legte ein Foto und einen Brief vor Larissa, »und dabei habe ich sofort an Sie gedacht. Sie müssen sich aber schnell entscheiden, denn diese Familie braucht dringend Unterstützung im Haushalt.«
»Berlin? Was muss ich dafür tun?«, fragte Larissa misstrauisch.
»Das sagte ich bereits, Sie sollen im Haushalt helfen. Die Deutschen sind reich und großzügig. Sie werden es dort gut haben.«
»Und das geht einfach so?«
»Sie brauchen nur ja zu sagen, und ich werde alles Weitere in die Wege leiten. Schon in wenigen Tagen können Sie in Berlin sein, vorausgesetzt, Sie wollen das.«
»So schnell? Natürlich würde ich gerne, aber …«
»Was aber? Wahrscheinlich möchten Sie wissen, worin Ihre Gegenleistung besteht. Nun, es gibt keine. Sie müssen sich lediglich einer medizinischen Untersuchung unterziehen, das ist alles. Ich brauche nur anzurufen, und Sie können gleich zum Arzt gehen.«
Larissa fühlte sich etwas überrumpelt und sah ihre Professorin noch einen Tick misstrauischer an. Bisher war alles, was sie in St. Petersburg gemacht hatte, mit Bedingungen verbunden, nur ausgerechnet diesmal nicht? Aber die ihr gegenübersitzende Frau, die sie seit nunmehr gut zwei Semestern kannte und vor allem schätzte, lächelte sie nur an, aufmunternd und Hoffnung gebend.
»Überlegen Sie nicht zu lange, denn die Familie, die sich an mich gewandt hat, sucht wirklich sehr dringend eine Haushaltshilfe und jemanden, der die Kinder beaufsichtigt, wenn die Eltern einmal weggehen wollen. Es sind Arbeiten, die Sie sehr gut mit Ihrem Studium verbinden können. Sie wohnen umsonst, bekommen ein großzügiges Taschengeld und Kleidung und vielleicht noch die eine oder andere Zuwendung. Aber ich will Sie zu nichts drängen. Nehmen Sie ein paar Minuten auf dem Gang Platz und überlegen Sie es sich, ich muss dringend ein Telefonat führen. Lassen Sie sich das Angebot durch den Kopf gehen, und glauben Sie mir, ich verliere Sie nur sehr ungern, aber ich will wirklich nur Ihr Bestes. Sie werden es zu etwas ganz Großem bringen, das verspreche ich Ihnen. Ihre Bilder werden eines Tages in den größten und berühmtesten Galerien hängen. Bei Ihrem Talent.«
Larissa nickte, erhob sich und ging nach draußen. In ihrem Kopf drehte sich ein Karussell. Sie war mit einem Mal mit etwas konfrontiert worden, das sie in ihren kühnsten und verwegensten Träumen nicht geträumt hätte. Deutschland, ein Land, über das sie immer nur Gutes gehört hatte. Aber Deutschland war weit weg, noch viel weiter weg von ihren Eltern, als sie jetzt schon war. Doch wenn sie nach Deutschland ging, würde sie nicht mehr mit fremden Männern schlafen müssen, sie würde keine Gewalt mehr erleben, sie würde ihr Studium beenden und es eines Tages geschafft haben, wie ihr Lehrer schon vor Jahren prophezeit hatte.
Nach etwa zehn Minuten wurde sie wieder in das Büro der Professorin gebeten.
»Und, sind Sie zu einem Entschluss gekommen?«
»Ich würde Ihr Angebot gerne annehmen«, antwortete Larissa leise, obwohl sie lieber noch etwas mehr Bedenkzeit gehabt hätte.
»Höre ich da einen kleinen Zweifel in Ihrer Stimme?«
»Nein, es ist nur, dass ich überhaupt keine Gelegenheit habe, mich von meinen Eltern zu verabschieden. Sie haben kein Telefon, und ein Brief dauert lang …«
»Wenn Sie in Berlin sind, schreiben Sie ihnen von dort. Ich wollte Sie sowieso dringend darum bitten, mit niemandem über unser Gespräch zu reden. Sie wissen ja, die Neider sind überall. Und Ihre Eltern würden sich auch nur unnötige Sorgen machen, wenn sie schon jetzt von Ihrer Entscheidung erführen. Glauben Sie mir, es ist besser, wenn Sie fahren und ihnen schreiben, sobald Sie in Berlin angekommen sind.«
»Und wie komme ich dorthin?«
»Sie fahren mit dem Schiff und dann weiter mit dem Auto. Aber das wird man Ihnen alles noch erklären. Vertrauen Sie mir einfach.«
»Und was ist mit Papieren?«
»Auch das wird ganz unbürokratisch geregelt. Wir haben ein Abkommen mit den deutschen Behörden. Wir leben schließlich nicht mehr in der Sowjetunion, sondern in einem freien Land, das in der ganzen Welt angesehen ist«, antwortete sie mit einem warmen und weichen Lachen. »Wie gesagt, vertrauen Sie mir einfach. Soll ich den Arzt anrufen?«
Larissa nickte. Das Telefonat war nach kaum einer Minute beendet.
»Hier ist die Adresse, es sind nur ein paar Minuten zu Fuß. Die Untersuchung wird ein wenig dauern, aber Sie haben ja Zeit. Alles Gute und viel Glück.«
Larissa nahm den Zettel, verabschiedete sich von ihrer Professorin und ging zu der angegebenen Adresse. Die Untersuchung dauerte über vier Stunden, bis der Arzt ihr mitteilte, dass sie kerngesund sei und bedenkenlos nach Deutschland fahren könne. Zum Abschluss sagte er, dass in zwei Stunden eine Frau bei ihr vorbeikomme, um ihr letzte Instruktionen zu erteilen.
Die Frau, die sich nur mit »Marina« vorstellte und groß und schlank und kaum älter als Larissa war, kam gegen zweiundzwanzig Uhr in das kleine Zimmer, in dem Larissa hauste. Sie unterhielten sich etwa eine halbe Stunde, wobei die meiste Zeit die junge Frau sprach. Larissa solle ihre Sachen am Samstagnachmittag gepackt haben, am Abend um Punkt einundzwanzig Uhr stehe ein Wagen vor dem Haus, um sie abzuholen. Samstag, das war bereits morgen, also viel schneller, als ihre Professorin ihr gesagt hatte.
Als Larissa ihre wenigen Habseligkeiten gepackt hatte, sah sie sich noch einmal in dem kleinen Zimmer um, dachte an ihre Eltern, die beiden jüngeren Geschwister und an ihre ältere Schwester, die als Polizistin in Moskau arbeitete. Sie hätte gerne noch einmal mit ihr gesprochen, denn es gab niemanden, zu dem sie einen engeren Kontakt hatte, auch wenn sie ihr von der Vergewaltigung und Misshandlung und den vielen Demütigungen nichts erzählt hatte, zu sehr schämte sie sich dafür, und Larissa wollte auch nicht, dass sie sich Sorgen machte oder gar nach St. Petersburg kam. Sie liebte ihre Schwester, doch sie würde sich an die Anweisungen halten und ihr erst schreiben, wenn sie in Berlin war. Und wenn die Familie so nett wie auf dem Foto war, würde sie vielleicht sogar mit ihr telefonieren dürfen.
Larissa wartete ungeduldig, bis es einundzwanzig Uhr war. Sie hatte Hunger und Durst und fror erbärmlich, ging mehr als zwei Stunden im Zimmer auf und ab, rieb sich immer wieder die mit dicken Handschuhen bedeckten Hände oder wärmte ihr Gesicht mit ihrem Atem, den sie in die Handflächen blies, die sie dicht vors Gesicht hielt.
Ein paar Minuten vor neun ging sie nach unten, wo bereits das Auto stand, das sie zum Hafen bringen würde. Und schon in zwei Tagen würde sie in Berlin sein, bei einer Familie, die sie nur von einem Foto kannte. Nette Menschen, mit zwei kleinen Kindern. Und doch beschlich sie ein mulmiges Gefühl, als sie in das Auto stieg, wo noch zwei andere junge Frauen außer dem Fahrer saßen. Auf dem Weg zum Hafen wurde kein Wort gewechselt, es herrschte eine beinahe beängstigende Stille. Larissa war nervös und aufgeregt, wollte sich dies aber nicht anmerken lassen, denn sie redete sich immer und immer wieder ein, es habe schon alles seine Richtigkeit, auch wenn ihr Bauch ihr etwas anderes sagte. Doch sie wollte nicht darauf hören. Ihre Gedanken waren bei ihrer Familie, ihrem Vater, der als Lehrer an einer kleinen Dorfschule gerade so viel verdiente, dass sie immer genug zu essen hatten, und bei ihrer Schwester, die es als Erste geschafft hatte, aus den ärmlichen Verhältnissen auszubrechen und eine einigermaßen gutbezahlte Anstellung bei der Polizei in Moskau hatte. In zwei, spätestens drei Tagen würde Larissa mit ihr Kontakt aufnehmen und ihr eine Menge mitzuteilen haben.
Am Hafen angelangt, standen dort bereits fünf weitere Fahrzeuge, zwei Lieferwagen, ein Mercedes und zwei Polizeiwagen. Die Türen der Lieferwagen wurden geöffnet, und etwa dreißig Personen stiegen aus, die jüngste vielleicht fünf Jahre alt, die älteste höchstens fünfundzwanzig. Nur die Fahrer waren älter.
Sie wurden zu einem Frachter geführt. Das mulmige Gefühl wurde immer intensiver und wandelte sich schlagartig in Angst. Am liebsten wäre Larissa davongerannt, doch um die Gruppe herum hatten sich mehrere Männer geschart, die wie Bluthunde aufzupassen schienen, dass auch jeder auf direktem Weg auf den Frachter ging. Unter diesen Männern befanden sich auch sechs Polizisten, und drei von ihnen waren ebenjene, die Larissa in den letzten Wochen mehrfach vergewaltigt hatten. Einer von ihnen grinste und zwinkerte ihr hämisch zu, während er sich eine Zigarette anzündete. Zwei kleine Kinder weinten und hielten sich bei den Händen, eine junge Frau begann plötzlich hysterisch zu schreien, bis einer der Männer sie kräftig am Arm packte, kurz schüttelte und ihr etwas ins Ohr flüsterte, das Larissa jedoch nicht verstand, weil sie zu weit weg war. Die Frau hatte vor Angst geweitete Augen und verstummte. Vier weitere Polizisten tauchten wie aus dem Nichts auf, unterhielten sich mit einem der Männer, und ein dicker Umschlag wechselte die Besitzer.
Es war ein riesiges Schiff mit vielen Containern. Zu einem davon wurden sie gebracht, wie eine Herde Schweine, die zur Schlachtbank geführt wurde. In dem riesigen Container, der von einer matten Glühbirne nur spärlich erhellt wurde, standen zwei Männer und zwei Frauen, von denen eine Larissa nur zu gut kannte – ihre Professorin, in deren Augen jetzt aber nichts Gütiges und Mütterliches mehr war. Sie runzelte lediglich die Stirn, als Larissa sie hilflos und fragend ansah. Rund um die Wände waren Liegen aufgestellt, in der Mitte des kalten Stahlwürfels war ein Tisch mit gefüllten Gläsern darauf. Die andere Frau sagte, dass jeder ein Glas mit der klaren Flüssigkeit trinken solle, es erleichtere die Reise. Als eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, sich weigerte und fragte, was das für ein Getränk sei, wurde sie nur angeherrscht, dies sei nicht der geeignete Ort, um Fragen zu stellen. Nachdem jeder sein Glas leergetrunken hatte, wurden sie in unmissverständlichem Befehlston gebeten, sich auf eine der Liegen zu legen. Larissa wurde wie allen andern auch erst etwas schwindlig, schließlich drehte sich alles um sie. Sie bekam kaum noch mit, wie die Frauen den Container verließen, die Männer jedoch blieben. Die Stahltür wurde mit einem lauten Knall zugeschoben und von innen verriegelt. Larissa spürte nur noch, wie ihr etwas in die Armvene injiziert wurde. Sie schlief ein.
Dienstag, 17. April 2007
Sören Henning und Lisa Santos waren seit dem frühen Morgen in ihrem Büro und würden nicht nur heute, sondern auch die folgenden Tage damit zubringen, den Aktenstapel schrumpfen zu lassen, eine Tätigkeit, die keiner von ihnen gerne erledigte. Erschwerend kam hinzu, dass sie seit gestern Bereitschaft hatten und keiner von beiden in diesen Nächten wirklich schlafen konnte, da ständig damit gerechnet werden musste, dass sie aus dem Bett geklingelt wurden. Aber es war ruhig geblieben.
Seit Jahresbeginn war es beim K 1 relativ normal zugegangen. Sechs Vermisstenfälle, von denen vier schnell geklärt werden konnten, zwei Personen jedoch blieben weiterhin verschwunden, eine junge Frau von vierundzwanzig Jahren, die seit Mitte Januar mit ihrer zwei Jahre alten Tochter wie vom Erdboden verschluckt schien. Entweder war sie untergetaucht oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen, denn man hatte herausgefunden, dass sie in ständiger Angst vor ihrem Ehemann lebte, der sie laut Aussage der Mutter täglich verprügelte und vergewaltigte und auch vor dem Kind nicht haltmachte. Der Ehemann wies diese Vorwürfe jedoch vehement zurück. Er behauptete, sie hätten eine normale Ehe geführt, seine Frau sei jedoch in letzter Zeit immer depressiver geworden, habe sich aber geweigert, einen Arzt zu konsultieren. Es gab auch einen Abschiedsbrief, der die Beamten allerdings stutzig machte, war er doch maschinengeschrieben und ohne Unterschrift, und es kam nur äußerst selten vor, dass jemand, der den Freitod wählte, sich auf diese Weise verabschiedete.
Der Mann, fast zwanzig Jahre älter und Direktor an einem Gymnasium, war mehrfach vernommen worden, doch bislang war ihm kein Verbrechen nachzuweisen, es gab nicht einmal Indizien dafür. Das Haus war von oben bis unten durch- und untersucht worden, ebenso das Grundstück, die Garage und das Auto. So blieb den Beamten zumindest die Hoffnung, dass die Frau einfach nur einen Schlussstrich gezogen hatte, um ihrem Martyrium zu entfliehen.
Wesentlich gravierender für die Polizei war ein scheinbar sinnloses Tötungsdelikt, das jedem Kollegen an die Nieren gegangen war. Am 1. Januar (die rechtsmedizinische Untersuchung hatte ergeben, dass es in den frühen Morgenstunden geschehen sein musste) hatte ein Mann aus bisher ungeklärten Beweggründen erst seine Frau und anschließend seine beiden Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren mit einer hohen Dosis Zyankali getötet, bevor er seinem Leben auf dieselbe Weise ein Ende setzte. Es fand sich kein einziger Hinweis auf ein Motiv für die schreckliche Tat, kein Abschiedsbrief, lediglich eine dahingekritzelte Notiz mit den Worten: »Ich halte es nicht mehr aus. Es ist die Hölle, nichts als die Hölle.« Doch was hielt er nicht mehr aus? Durch welche Hölle war er in seinem Leben gegangen, die ihn schließlich zu dieser Verzweiflungstat getrieben hatte?
Er war ein renommierter Hepatologe und erfahrener Chirurg in einer großen Klinik, besaß ein Haus in der besten Lage von Kiel, hatte keinerlei Schulden oder andere finanzielle Probleme (im Gegenteil, auf seinen beiden Konten befanden sich über drei Millionen Euro), sein Privatleben schien in Ordnung gewesen zu sein, es hatte bislang nicht einmal einen Kratzer in der heilen Welt dieser Familie gegeben. Keine bekannte Affäre, keine Ehekrise. Seit sieben Jahren war er mit seiner zehn Jahre jüngeren Frau, die aus einer angesehenen estnischen Unternehmerfamilie stammte, verheiratet, und jeder, der die beiden kannte, bewunderte sie für deren vorbildliche Ehe. Alle, die man in den folgenden Tagen und Wochen zum Teil mehrfach befragte, zuckten nur resignierend mit den Schultern, denn niemand hatte eine Antwort auf diese unfassbare Tat. »Erweiterter Selbstmord«, so der Fachjargon, lautete der Vermerk in den Akten, die noch längst nicht geschlossen waren und auch noch lange geöffnet bleiben würden. Erweiterter Selbstmord, da man davon ausging, dass er seinen eigenen Tod lange geplant hatte, seine Frau und die Kinder aber nicht alleinlassen wollte oder konnte.
Und noch immer rätselten die Beamten, was diesen erfolgreichen und angesehenen Mann veranlasst haben könnte, sich und seine Familie zu töten. Die einzige vage und kaum haltbare Vermutung war, dass er eventuell unter Depressionen litt, die jedoch von keinem bemerkt wurden (was sowohl zwei zu Rate gezogene Kriminalpsychologen und alle mit ihm in der Klinik zusammenarbeitenden und befragten Ärzte und Chirurgen für sehr unwahrscheinlich hielten).
Von der Klinikleitung wurde er aufgrund seiner Fähigkeiten als Chirurg geschätzt, von den Nachbarn als freundlich und hilfsbereit geschildert. Was also hatte diesen Mann dazu gebracht, sich und seine Familie zu töten? Keine Schulden, keine Ehekrise, beruflicher Erfolg, fast ein Leben wie im Bilderbuch, und doch musste es etwas gegeben haben, das ihn zu diesem letzten und endgültigen Schritt bewogen hatte. Doch was? Was konnte einen Menschen so verzweifeln lassen, dass er seine ganze Familie auslöschte? Es war ein Rätsel, das vielleicht nie gelöst werden würde, und wenn, dann höchstens durch einen Zufall, durch etwas, das man fand, wenn man zum zehnten oder zwanzigsten Mal den noch immer versiegelten großen Bungalow durchsuchte, oder, was noch besser wäre, wenn sich jemand melden würde, um womöglich den entscheidenden Hinweis zu liefern oder wenigstens einen Ansatzpunkt, was die für vier Menschen so tragische Nacht betraf.
Als Henning und Santos zu dem Ort des Geschehens gerufen wurden, lagen alle vier in ihren Betten, die Kinder schienen zu schlafen, ihre Gesichter hatten etwas Friedliches, der Mann hatte sich zu seiner Frau gelegt und hielt sie umarmt, als würden sie ebenfalls nur schlafen. Nach Rekonstruktion des Tathergangs wurde definitiv ausgeschlossen, dass es sich um eine Affekttat handelte, denn der Arzt hatte alles akribisch vorbereitet.
Es war ein tragischer und vor allem mysteriöser Fall, ein Fall, wie man ihn so in Kiel und Umgebung noch nie erlebt hatte und an den man sich noch lange erinnern würde. Aber vielleicht gab es ja doch irgendwann eine Lösung des Rätsels, auch wenn es erst in ein oder zwei oder zehn Jahren war.
»Wollen wir heute Abend was unternehmen?«, fragte Henning gegen vierzehn Uhr, nachdem sie eine Weile schweigend in ihre Akten vertieft waren. Seit beinahe zwei Jahren waren er und Lisa Santos ein Paar, aber nur inoffiziell. Jeder hatte eine eigene Wohnung, obwohl Henning meistens bei Lisa übernachtete, weil er es in seinem Verschlag, wie er seine kleine Wohnung nannte, nicht aushielt. Eine Wohnung in einem heruntergekommenen Viertel, ein Haus, in dem der Aufzug fast jeden Tag kaputt war, ein Haus, in dem viele Menschen wohnten, die von der Gesellschaft ausgespuckt worden waren oder die sich selbst ins Abseits gestellt hatten. Er wollte dort nicht mehr leben, aber es würde noch gut zwei Monate dauern, bis er eine Wohnung in unmittelbarer Nähe von Lisa beziehen würde.
Sie hatten schon einige Male von Heirat gesprochen, doch dies würde sie zumindest beruflich auseinanderbringen, was nichts anderes bedeutete, als dass sie in getrennten Abteilungen arbeiten müssten. Aber weder Santos noch Henning wollten vom K 1 weg, zu lange waren sie schon hier und zu gut verstanden sie sich mit ihren Kollegen, besonders mit Volker Harms, ihrem Chef. Lisa hatte zwar schon mehrfach angedeutet, dass sie gerne Kinder hätte, doch dafür müsste sie ihre gerade begonnene Laufbahn für eine Weile auf Eis legen, denn es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie in den Rang einer Hauptkommissarin aufsteigen würde. Ihr ging es finanziell einigermaßen gut, ganz im Gegensatz zu Henning, der noch immer Monat für Monat mehr als die Hälfte seines Nettogehalts an seine geschiedene Frau und die beiden Kinder überwies, die bei ihr lebten und für die sie das alleinige Sorgerecht hatte. Nur noch einmal im Monat durfte er sie sehen, wobei Markus ihn schon längst nicht mehr als seinen Vater anerkannte und nie da war, wenn Henning zu Besuch nach Elmshorn fuhr. Dafür liebte Elisabeth ihren Vater umso mehr, und sie kam sogar hin und wieder nach Kiel, um ihn zu besuchen. Sie war mittlerweile vierzehn Jahre alt und zu einer ernsthaften und introvertierten jungen Dame herangereift, was wohl nicht zuletzt an einem traumatischen Erlebnis lag, das sie vor zwei Jahren beinahe das Leben gekostet hätte. Aber genau dieses Erlebnis war es, durch das Hennings Exfrau das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekommen hatte. Dennoch äußerte Elisabeth immer öfter den Wunsch, zu ihrem Vater zu ziehen, weil das Verhältnis zu ihrer Mutter sich zunehmend verschlechterte.
»Gerne. Und wohin willst du mich ausführen?«, fragte Santos, ohne aufzuschauen.
»Lass dich überraschen«, entgegnete Henning nur und wollte noch etwas hinzufügen, als Harms mit einem Mal in der Tür stand. Seine Miene verhieß nichts Gutes, als er näher trat, sich einen Stuhl heranzog, sich verkehrt herum daraufsetzte und die Ellbogen auf die Rückenlehne stützte. Er kaute einen Moment lang auf der Unterlippe und hielt den Blick gesenkt.
»Was ist los?«, fragte Henning, der sich zurückgelehnt hatte, in die Stille hinein.
»Ich habe eben eine sehr traurige Nachricht erhalten«, sagte Harms leise und in einem Ton, den Henning und Santos von ihm nicht gewohnt waren. »Gerd ist tot.«
Henning starrte seinen Vorgesetzten entgeistert an. »Gerd? Was ist passiert?«
»Wie es aussieht, hat er sich das Leben genommen. Mehr weiß ich leider auch nicht. Ein paar Kollegen sind bereits auf dem Weg.«
»Wer?«
»Ziese und Hamann.«
»Wer hat ihn gefunden und wo?«, fragte Henning mit zusammengekniffenen Augen, die Hände gefaltet, wobei er so fest zudrückte, dass die Knöchel weiß hervortraten. Die Anspannung war im ganzen Raum zu spüren.
»Seine Frau, aber wie gesagt, nähere Einzelheiten sind mir nicht bekannt.«
Santos sagte mit leiser, monotoner Stimme: »Er hat erst vor ein paar Wochen seine Tochter verloren. Er hat zwar immer so getan, als hätte er es verkraftet, aber ich konnte mir das nie vorstellen. So einen Schicksalsschlag steckt man nicht einfach so weg.«
»Er hätte doch aber nie im Leben seine Frau zurückgelassen«, warf Henning ein. »Sie …«
»Tut mir leid«, sagte Harms schnell, »aber es ist unmöglich, in einen Menschen hineinzusehen. Nimm’s einfach als die Tragik des Lebens hin. Wir alle haben doch in unserer Laufbahn schon die unmöglichsten Dinge erlebt.«
Henning sprang auf und tigerte durch das kleine Büro. Seine Kiefer mahlten aufeinander, er zog die Stirn in Falten, und sein Blick war düster, als er Harms ansah.
»Gerd und Selbstmord! Das passt einfach nicht. Ich will hinfahren. Wir kannten uns, seit er hier im Präsidium angefangen hat. Und ich kenne auch seine Frau Nina sehr gut.«
»Das weiß ich doch«, sagte Harms verständnisvoll und fast väterlich nickend. »Die Akten können warten.«
»Was ist mit dir, Lisa?«, fragte Henning.
Sie schlug wortlos die eben angefangene Akte zu und erhob sich, als Hennings Telefon klingelte.
»Henning«, meldete er sich.
»Nina hier. Gerd ist tot«, schluchzte sie in den Hörer. »Kannst du vorbeikommen, ich muss mit dir reden.«
»Ich hab’s eben gehört und wollte schon losfahren. Lisa kommt auch mit. Sind schon Kollegen von uns da?«
»Nein, aber sie müssten jeden Moment da sein. Es sind bis jetzt nur zwei Streifenbeamte hier.«
»Wir sind schon unterwegs«, sagte er und legte auf. »Das war Nina. Auf geht’s.«
Gemeinsam gingen sie nach draußen und machten sich auf den Weg zu dem Einfamilienhaus mit der Doppelgarage und dem großen Garten in Strande, das Wegner erst vor wenigen Jahren gebaut hatte und das noch längst nicht abbezahlt war. Wie auch, war er doch erst neununddreißig und bezog das nicht gerade üppige Gehalt eines Hauptkommissars, zu dem er vor etwas mehr als zwei Jahren ernannt worden war.
»Kannst du dir vorstellen, warum er das gemacht hat?«, fragte Henning nach einer Weile des Schweigens.
»Wie Volker schon so treffend sagte, keiner kann in einen andern hineinschauen«, erwiderte sie nur.
»Was denkst du gerade?«
»Keine Ahnung.«
»Dann geht’s dir wie mir. Jeder, aber nicht Gerd.«
»Es ist das erste Mal, dass ein Kollege, den ich nicht nur vom Sehen kannte, sich das Leben nimmt. Das ist alles«, sagte Santos und überspielte damit ihre Gefühle.
»Als ich noch ganz am Anfang bei der Truppe war, hat sich mein damaliger Chef im Keller erhängt. Er hatte rausgekriegt, dass seine Frau mit einem andern rumvögelte, während er sich den Buckel krumm schuftete. Und seine Frau hatte nicht etwa einen x-beliebigen Lover, nee, sie hat sich ausgerechnet mit seinem besten Freund eingelassen, und da hat er durchgedreht. Er kam mit sich und der Welt nicht mehr zurecht. Und eines Nachts ist er in den Keller gegangen, hat sich einen Strick genommen, noch eine Flasche Bier getrunken und … Seine Frau hat ihn am nächsten Morgen gefunden, hat die Beerdigung abgewartet und ist kurz darauf verschwunden. Kein Mensch weiß, wo sie heute lebt. Sie ist untergetaucht. Das hat uns damals alle sehr mitgenommen. Und jetzt das mit Gerd.«
»Hm«, murmelte Santos, die das Gesagte nur am Rande mitbekam, und sah aus dem Seitenfenster auf die Ostsee, die im sanften Licht der Frühlingssonne glänzte. Es war warm, wärmer als gewöhnlich um diese Jahreszeit. Aber seit Monaten schon war es zu warm, der Herbst war kein Herbst gewesen, sondern ein lang anhaltender Spätsommer, und der Winter ein langer Herbst. Und jetzt begann der Sommer – viel früher als üblich. Alle sprachen vom großen Klimawandel, und wie es aussah, war er bereits in vollem Gange. Sie interessierte das nicht, nicht in diesem Augenblick, schon gar nicht nach dieser Nachricht. Sie fragte sich, wie die nächsten Minuten und vielleicht sogar Stunden verlaufen würden. Es war schönes Wetter, aber es war ein trauriger Tag.
Dienstag, 14.35 Uhr
Vor dem Haus standen ein Streifen- und ein Zivilfahrzeug aus dem Fuhrpark des Präsidiums sowie der Wagen der Kriminaltechnik, deren Beamte in der Garage zugange waren, und ein Notarztwagen. Ein uniformierter Beamter, vermutlich einer von denen, die als Erste vor Ort waren, kam ihnen entgegen. Henning hielt ihm wortlos seinen Ausweis hin, und er und Santos wurden durchgelassen. Auf der Straße hatten sich ein paar Schaulustige aus der Nachbarschaft versammelt und beobachteten das ungewöhnliche Treiben neugierig. Henning und Santos hatten so etwas schon öfter erlebt und registrierten es nur nebenbei, als sie ins Haus gingen, dessen Vordertür offen stand.
Sie betraten das sehr geschmackvoll und gemütlich eingerichtete Wohnzimmer, wo Nina Wegner mit verweintem Gesicht auf dem Sofa saß, neben ihr Kurt Ziese, Kommissariatsleiter und Chef von Wegner. Mitten in dem lichtdurchfluteten Zimmer, in dem Henning schon so viele Male war, stand eher unschlüssig Werner Hamann, ebenfalls ein direkter, aber noch junger Kollege von Wegner, kaum dreißig Jahre alt, der mit der Situation sichtlich überfordert war. Es war ein Unterschied, ob man es mit einem fremden Toten zu tun hatte oder mit jemandem, den man nicht nur näher kannte, sondern den man zudem noch schätzte. Henning wusste, dass Wegner ein beliebter Kollege war, auch wenn er hin und wieder Alleingänge startete, die ihm aber nicht übelgenommen wurden.
Nina sah Henning mit vom Weinen geröteten Augen an und sagte mit stockender Stimme: »Sören, warum? Warum, warum, warum?!«
Henning ging zu ihr und nahm sie in den Arm. Sie schluchzte wieder, ihr ganzer Körper wurde durchgeschüttelt, als er sie hielt. Nina war eine außergewöhnliche Frau, in Russland geboren, seit etwas über fünf Jahren in Deutschland. Sie war achtundzwanzig Jahre alt und gehörte zu jener Generation junger Russinnen, die für ihre Schönheit berühmt und auch begehrt waren. Etwa eins siebzig groß, blondes und feingelocktes Haar, das bis auf die Schultern fiel, feinporige Haut, markant geschwungene Lippen, strahlend weiße Zähne, das Hervorstechendste aber waren ihre großen braunen Augen, die einen aparten Kontrast zu ihren Haaren bildeten. Sie war eine Frau, nach der sich die Männer umdrehten, eine Frau, bei der kaum ein Mann nein gesagt hätte. Eine Frau, von der viele träumten, für die es aber nur einen Mann gab – ihren Mann. Als Henning sie hielt, wirkte sie so unendlich traurig und zerbrechlich. Sie zitterte leicht, obwohl es warm in dem Zimmer war.
Ziese sah ihn beinahe hilflos an und erhob sich. »Frau Wegner«, sagte er mit seiner tiefen, sonoren Stimme, »wenn irgendetwas ist, Sie können sich jederzeit an mich wenden.« Und zu Henning mit einem kaum merklichen Schulterzucken: »Wir gehen dann mal. Bleibt ihr noch einen Moment? Gerds Mutter müsste eigentlich bald eintreffen. Lasst Frau Wegner nicht allein, okay?«
»Keine Sorge«, erwiderte Henning leise, »wir kümmern uns um sie. Wir treffen uns nachher im Präsidium.«
»Kann ich dich vorher noch kurz unter vier Augen sprechen?«, fragte Ziese.
»Natürlich. Ich bin gleich wieder da«, sagte Henning zu Nina, die sich aus seiner Umarmung löste und nickte und sich die Tränen mit einem Taschentuch aus dem Gesicht wischte.
Sie gingen nach draußen. Ziese, der über eins neunzig und damit gut zehn Zentimeter größer als Henning war, sah diesen an und meinte leise: »Das war ein klassischer Suizid. Weiß der Geier, warum er sich auf diese Weise davongeschlichen hat.« Er sprach langsam und bedächtig, die Hände in den Taschen seiner Cordhose vergraben. Über dem blauen Hemd trug er ein kariertes Sakko, und irgendwie erinnerte er Henning immer ein wenig an Sherlock Holmes. Nur die Pfeife fehlte und die berühmte Mütze. Und Knickerbocker trug er natürlich auch nicht.
»Was meinst du mit klassisch?«
»Ein Schlauch vom Auspuff ins Wageninnere, der Motor lief, als er gefunden wurde, und das Garagentor war verschlossen. Das meine ich mit klassisch.«
»Höre ich da einen Zweifel in deiner Stimme?«, fragte Henning.
Ziese schüttelte den Kopf. »Nein, ich wollte es dir nur sagen.«
»Und dafür willst du unter vier Augen mit mir sprechen? Nur, um mir das mitzuteilen? Komm, spuck’s aus, da ist doch noch irgendwas.«
Ziese verzog den Mund und meinte, ohne dass ein anderer es hören konnte: »Keine Ahnung, ich weiß selber nicht, was ich von der Sache halten soll. Gerd war nicht der Typ für so was. Abgesehen von den zwei Jahren in Russland war er seit über zwölf Jahren in meiner Abteilung.« Er zuckte mit den Schultern: »Was ich damit sagen will, ist, ich glaube ihn ziemlich gut gekannt zu haben.«
»Davon gehe ich aus. Hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen?«
»Nein, zumindest haben wir noch keinen gefunden. Abschiedsbriefe liegen ja in der Regel sehr sichtbar auf dem Tisch oder dem Regal. Auch das wäre nicht seine Art gewesen. Und außerdem hat er Nina doch über alles geliebt, sie war die Frau seines Lebens. Für sie hätte er alles getan, wenn du verstehst.«
Für einen Moment entstand eine Pause, dann sagte Henning: »Ich weiß. Willst du damit andeuten, dass wir uns etwas näher mit der Sache beschäftigen sollen?«
»Ich will nur sichergehen, dass es wirklich Selbstmord war. Ich will, dass alle Fakten stimmen.«
»Also doch Zweifel. Wann hast du Gerd das letzte Mal gesehen?«
»Am Freitag, weil ich gestern den ganzen Tag unterwegs war. Er machte auf mich nicht gerade den Eindruck, als würde er vorhaben … Ach was«, winkte Ziese ab, »manche faseln die ganze Zeit davon, dass sie sich umbringen, und tun’s dann doch nicht, aber die, die alles in sich reinfressen, die tun’s. Und Gerd hat immer alles in sich reingefressen. Nicht mal, als das mit Rosanna passiert ist, hat er sich groß was anmerken lassen. Tut mir leid, ich begreif’s einfach nicht. Na ja, es wird schon alles seine Richtigkeit haben«, sagte er in einem Ton, als würde er seinen Worten selbst nicht glauben.
»Nee, richtig ist da gar nichts, aber womöglich werden wir die Wahrheit nie erfahren. Wie bei diesem Arzt.«
»Was meinst du damit?«
»Na ja, warum er’s getan hat. Ich geh wieder rein, schau aber nachher noch mal bei dir im Büro vorbei.«
»Bis dann«, verabschiedete sich Ziese, ein alter, erfahrener Polizist, den nichts so leicht aus der Ruhe bringen konnte, der auf alles eine Antwort zu haben schien und der von seinen Mitarbeitern den liebevollen Beinamen Paps bekommen hatte. Doch hier schien auch er keine Antwort zu haben. Noch ein paar läppische Monate, und er würde in Pension gehen und einen gutgeführten und vor allem sauberen Laden hinterlassen. Er war ein aufrechter, integrer Kriminalist, den alle schätzten. Immer sehr auf sein Äußeres bedacht, meist mit Anzug oder wie heute einer Kombination und stets mit Krawatte, selbst an Tagen, an denen das Thermometer über dreißig Grad stieg, was in Kiel jedoch nur sehr selten vorkam. Henning konnte sich nur zu gut vorstellen, wie es in Ziese rumorte, denn Wegner war nicht nur ein Mitarbeiter, sondern auch ein Freund gewesen. Einer, auf den jederzeit Verlass war, auch wenn er bisweilen sehr eigenwillige Ermittlungsmethoden anwandte.
Bevor Henning zurück ins Haus ging, schaute er bei der Spurensicherung vorbei. Er betrat die Garage, wo sich drei Beamte in weißen faserfreien Anzügen aufhielten und einen recht neuen schwarzen BMW525 untersuchten. Wegner war längst in den inzwischen eingetroffenen Leichenwagen gebracht worden, mit dem er auch gleich in die Rechtsmedizin gefahren werden würde. Tönnies, der Leiter der Spurensicherung, kam zu Henning.
»Schöner Schiet, was? Bringt sich so mir nichts, dir nichts um.«
»Was genau ist passiert?«
»Den Schlauch vom Auspuff durchs Seitenfenster, alles luftdicht abgeklebt und den Motor laufenlassen. Die Maschine ist total heißgelaufen, wahrscheinlich hat er’s irgendwann heute Nacht gemacht. Na ja, ist ja auch egal, wann.«
»Ist das mit den neuen Autos nicht ziemlich schwer, ich meine, durch den Kat?«
Tönnies sah Henning beinahe mitleidig an, zog die Stirn in Falten und antwortete: »Ich bitte dich, du kannst den modernsten Kat haben, wenn du den Motor nur lange genug laufenlässt, bist du irgendwann weg. Wie gesagt, es war alles luftdicht abgeklebt, da geht dir recht schnell der Sauerstoff aus.«
»Trotzdem, untersucht das hier, als würde es sich um den Bundespräsidenten handeln.«
»Warum?«
»Weil ich es so will.«
»Glaubst du vielleicht, wir sind zum Spaß hier?«, wurde Henning ziemlich brüsk angefahren. »Die gleiche Order haben wir schon von Ziese bekommen. Alles klar?«
»Dann lasst euch nicht aufhalten. Aber untersucht das Klebeband auf Fingerabdrücke. Ich will wissen, ob nur seine oder auch noch andere drauf sind. Und legt mir die Fotos so bald wie möglich auf den Tisch. Ich will alles haben, und wenn ich alles sage, dann meine ich auch alles. Wann kann ich damit rechnen?«
»Wenn wir hier fertig sind und alles ausgewertet haben«, entgegnete Tönnies kühl. »Was willst du eigentlich? Hast du etwa Zweifel, dass es Selbstmord war?«, fragte er mit gerunzelter Stirn.
»Ich habe immer Zweifel, liegt wohl im Blut.«
»Warte, ich hab da was, das du dir anschauen solltest. Hier«, sagte Tönnies und deutete auf den Beifahrersitz, »zwei Flaschen russischer Wodka vom Feinsten. Er scheint sich vorher noch mal so richtig die Kante gegeben zu haben.«
»Wodka? Mir war nicht bekannt, dass Gerd trinkt«, meinte Henning nachdenklich.
»Die meisten Alkoholiker verstehen es hervorragend, ihre Sucht zu verbergen. Das solltest du eigentlich wissen.«
»Woher denn, ich habe nie getrunken.«
»Hab ich auch nicht gemeint.«
»Dann ist’s ja gut.«
Henning begab sich zurück ins Haus, wo Santos neben Nina auf dem Sofa saß, ihre Hand hielt und mit ihr sprach. Die Unterhaltung stoppte abrupt, und beide Frauen blickten auf, als er hereinkam. Er überlegte, ob er das Thema Alkohol ansprechen sollte, beschloss aber, es für den Moment noch zu unterlassen.
»Wie weit sind die da draußen?«, wollte Nina wissen.
»Ich kann dir nicht sagen, wie lange das noch dauern wird. Möchtest du drüber sprechen?«
»Über was denn?«, fragte Nina verzweifelt und wischte sich mit einer Hand eine Strähne aus der Stirn. Seit sie sich kennengelernt hatten, hatte es für sie nur einen Mann gegeben – Gerd. Und nun war er tot. Selbstmord. Ihr noch junges Leben war noch mehr aus den Fugen geraten, als es ohnehin schon war, nachdem vor gut zwei Monaten ihre knapp fünfjährige Tochter Rosanna von einem Raser totgefahren wurde. Es geschah am helllichten Tag, und doch hatte keiner der Anwohner in der Nachbarschaft etwas von dem Unfall mitbekommen, obwohl gerade in solchen Wohngegenden mit vorwiegend Ein- und Zweifamilienhäusern immer irgendjemand am Fenster steht oder sich im Garten aufhält, doch ausgerechnet an jenem Tag hatte niemand etwas gesehen. Die gesamte Nachbarschaft war zum Teil mehrfach befragt worden, aber keiner konnte Angaben zum Unfallhergang machen. Nur der dumpfe Aufprall des Mädchens war zu hören gewesen und das Jaulen eines durchstartenden Motors. Ein paar Stunden später fand man den Wagen in einem Waldstück. Das Fahrzeug war von seinem Besitzer am Tag zuvor als gestohlen gemeldet worden. Im Innern lagen mehrere Flachmänner und zwei leere Wodkaflaschen, was vermuten ließ, dass der Täter, von dem nach wie vor jede Spur fehlte, zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken war. Bei dem Besitzer des Wagens handelte es sich um einen alleinstehenden älteren Mann, der für die Unfallzeit ein absolut wasserdichtes Alibi hatte, denn er war mit Freunden aus seiner Rentnerclique auf einer Bootstour auf der Elbe unterwegs.
Rosanna starb einen Tag vor ihrem fünften Geburtstag. Für Gerd war eine Welt zusammengebrochen, auch wenn er sich das kaum anmerken ließ, doch in einem Gespräch mit Henning gab er zu erkennen, wie sehr ihn der Verlust seiner Tochter schmerzte. »Das Leben geht weiter«, hatte er gesagt, »es muss weitergehen. Ich habe ja Nina, und irgendwie werden wir es schon schaffen. Sie ist das Beste, was mir je passiert ist.« Und dabei hatte er gelächelt, als hätte er bei diesen Worten an ein Liebeslied gedacht, das im Radio seit Monaten hoch- und runtergespielt wurde. Das war vor etwa einer Woche, und Henning konnte und wollte nicht glauben, dass sein Freund innerhalb weniger Tage den fatalen Entschluss gefasst haben sollte, seinem noch recht jungen Leben ein Ende zu setzen. Er hätte es gespürt, Gerd hätte ein Signal ausgesandt, aber sie hatten gelacht, Scherze gemacht und sich wie immer ganz normal unterhalten. Vielleicht wollte Henning es aber auch nur nicht glauben, weil er mit ihm einen echten Freund verloren hatte.
»Du wolltest, dass ich komme. Was kann ich für dich tun, Nina?« Henning nahm in dem Sessel schräg neben der Couch Platz und betrachtete Nina, die so verloren und unendlich hilflos wirkte. Sie war eine liebenswerte Frau, die er vom ersten Moment an gemocht hatte, deren Tür jederzeit offen stand, die eine hervorragende Gastgeberin war und mit der man sich phantastisch unterhalten konnte.
Sie spielte mit ihren Fingern und ließ eine Weile verstreichen, bevor sie mit fester Stimme antwortete: »Finde heraus, was wirklich passiert ist. Gerd hat sich nicht umgebracht.«
»Aber …«
»Nein, kein Aber. Gerd hat sich nicht umgebracht«, wiederholte sie einen Tick energischer. »Er hätte mich nie allein gelassen. Ich habe das Ziese nicht gesagt, weil er mir sowieso nicht geglaubt hätte …«
»Jetzt mal schön der Reihe nach«, versuchte Henning sie zu beschwichtigen. »Was bringt dich zu der Annahme, dass Gerd keinen Selbstmord begangen hat?«
»Weil ich ihn zu gut kannte. Ich kannte ihn besser als irgendjemand sonst. Weißt du, als wir uns damals in St. Petersburg zum ersten Mal sahen, das war etwas ganz Besonderes. Ich habe ihn gesehen und mich in ihn verliebt. Und bei ihm war es genauso. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst«, sagte sie mit einem Lächeln und diesem unvergleichlichen slawischen Akzent, der ihrem perfekten Deutsch beigemischt war, was nicht zuletzt daran lag, dass sie, bevor sie ihren Mann traf, neben Kunst auch Germanistik studiert hatte. Das Lächeln verschwand jedoch sofort wieder, und ihre Miene bekam erneut diesen unendlich traurigen Ausdruck, und da war auch für einen kurzen Moment wieder diese Leere in ihren Augen. »Der Tod von Rosanna war für uns beide ein Schock, und wir haben viel zusammen geweint. Aber es gab etwas, das uns am Leben hielt und uns Hoffnung gab.« Sie seufzte auf, ein paar Tränen stahlen sich aus ihren Augen und tropften auf ihre helle Sommerhose. Sie fing wieder an zu weinen, stand auf, ging ins Bad und kehrte kurz darauf zurück, Stolz im Blick und in der Haltung. Russischer Stolz.
»Was für eine Hoffnung?«, fragte Henning.
»Nur eine Woche nach Rosannas Tod habe ich erfahren, dass ich schwanger bin …«
»Du bist schwanger?«, wurde sie von Henning unterbrochen, den diese Nachricht völlig unerwartet traf. Gerd hatte bisher nichts davon erwähnt, nicht einmal ansatzweise. Keine Andeutung, nichts.
»Ja, verdammt noch mal, ich bin schwanger, Anfang des vierten Monats, auch wenn man das noch nicht sieht. Nur meine Brust ist ein bisschen größer geworden. Und ich werde das Kind bekommen und allein großziehen. So hat Gott es wohl gewollt.« Und nach einem kurzen Innehalten: »Und jetzt ganz ehrlich: Glaubt ihr allen Ernstes, Gerd hätte mich ausgerechnet jetzt allein gelassen? Glaubt ihr das wirklich?«
»Das heißt, Gerd wusste von deiner Schwangerschaft«, sagte Henning mehr rhetorisch und zu sich selbst.
»Ja, natürlich. Oder meinst du, ich würde ihm so etwas Wunderbares verheimlichen? Die Aussicht auf das Baby hat ihm Kraft und Zuversicht gegeben, das versichere ich euch. Er hat sich wie ein kleines Kind auf das Baby gefreut, auch wenn er immer noch getrauert hat, genau wie ich. Und diese Trauer wird auch nie vergehen, denn Rosanna wird immer in meinem Herzen bleiben. Nur dass ich jetzt um zwei Menschen trauere. Ganz ehrlich, würdest du dir das Leben nehmen, wenn du wüsstest, dass deine Frau schwanger ist?«
Henning schüttelte den Kopf und erinnerte sich an die Zeit, als er noch verheiratet gewesen war und die beiden Schwangerschaften seiner Frau miterlebt hatte und irgendwann selbst schwanger wurde, wie er manchmal scherzhaft bemerkte. Und bei Gerd dürfte es nicht anders gewesen sein. Gerd war ein Kämpfer, ein harter Hund, vor allem gegen sich selbst, der aber nie die Grenzen überschritt. Er hatte seinen Vater verloren, als er selbst gerade begann die Karriereleiter bei der Kripo hochzusteigen; ein Verlust, den er nie wirklich verwunden hatte, denn sein Vater war sein großes Vorbild gewesen. Und sich einfach so davonzustehlen war nicht seine Art. Er hätte Signale ausgesendet, da war sich Henning sicher.
»Hat sich eigentlich schon ein Arzt um dich gekümmert?«
»Er wollte mir eine Spritze geben, aber ich brauche nichts, was mich ruhigstellt. Ich schaffe es auch so. In dem Dorf, wo ich herkomme, gehört der Tod zum Alltag, er geht von einer Tür zur nächsten und weiter und weiter und weiter.«
Allmählich begriff Henning, warum Nina so erstaunlich gefasst war, auch wenn er es nicht nachvollziehen konnte. Er selbst wäre zusammengebrochen wie wohl die meisten, er hätte mit Gott und der Welt gehadert, warum ausgerechnet er das erleiden musste, doch Nina war ein anderes Kaliber, stammte aus einem anderen Kulturkreis, besaß eine andere Mentalität, obwohl sie sich sehr gut an die deutschen Verhältnisse und Gegebenheiten angepasst hatte.
»Vielleicht gehe ich auch zurück zu meinen Eltern. Was soll ich hier noch? Hier könnte ich niemals vergessen …«
»Nina, bitte«, unterbrach Henning sie, »ich halte das für keine so gute Idee. Du hast doch Freunde, unter anderem mich und Lisa. Du kannst immer auf uns zählen.«
Nina lächelte gequält und zuckte mit den Schultern. »Das ist nett von euch, aber ich habe doch alles verloren, was in meinem Leben wichtig war. Das ist nicht gegen euch gerichtet, aber erst Rosanna und dann Gerd … Welcher normale Mensch kann so etwas verkraften?« Und nach ein paar Sekunden beinahe unerträglichen Schweigens: »Seht ihr, auch ihr habt keine Antwort darauf. Das tut so unbeschreiblich weh, so weh. Ich habe Gerd mehr geliebt als irgendeinen andern Menschen, das ist eine Liebe für die Ewigkeit. Ich habe ihn geliebt und werde ihn immer lieben. Es gibt keinen Mann, der jemals seinen Platz einnehmen wird, denn Gerd war einfach nur gut zu mir.«
»Das wissen wir«, sagte Santos und legte eine Hand auf Ninas Schulter. »Dürfen wir dir trotzdem ein paar Fragen stellen, oder sollen wir lieber später oder morgen noch mal kommen?«
»Nein, macht ruhig. Es ist doch egal, ob jetzt, morgen oder irgendwann«, antwortete sie und nestelte am Saum ihrer grünen Bluse.
»Wann genau hast du Gerd gefunden?«, fragte Henning.
»Vor ungefähr anderthalb Stunden, als ich heimgekommen bin. Ich war das Wochenende über bei einer alten Freundin aus St. Petersburg, die jetzt in Hamburg als Übersetzerin arbeitet. Gerd hatte es nicht so gern, wenn ich gerade in letzter Zeit viel allein war. Deshalb hat er mich am Freitagabend zu ihr gefahren, weil er das ganze Wochenende Dienst hatte …«
»Warum bist du nicht selbst gefahren, du hast doch ein Auto?«
»Gerd bestand darauf. Er sagte, dass er mich in meinem Zustand nicht gerne allein fahren lässt. Na ja, und außerdem kenne ich mich in Hamburg nicht gerade gut aus. Gerd hat mich bei Maria abgesetzt, ist kurz mit nach oben gekommen und hat noch einen Tee mit uns getrunken, bevor er wieder nach Hause gefahren ist. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Wir haben uns an der Haustür verabschiedet, er hat mir einen Kuss gegeben und mir über die Wange gestreichelt und mich so seltsam angesehen.«
»Was meinst du mit seltsam?«, fragte Santos.
»Ich kann es nicht erklären, aber es war ein Blick, der irgendwie melancholisch war. Ich dachte zuerst, es wäre wegen des verlängerten Wochenendes, das er allein verbringen musste. Vielleicht war es aber … Nein, ich glaube, ich rede Blödsinn.«
Sie stockte wieder, wischte sich ein paar Tränen weg, schneuzte sich die Nase und fuhr fort: »Ich bin um kurz nach halb eins nach Hause gekommen, obwohl Gerd mir versprochen hatte, mich am Bahnhof abzuholen. Ich habe ihn angerufen, erst auf seinem Handy, aber da sprang nur die Mailbox an, dann zu Hause und schließlich im Büro. Ich habe ihn nicht erreicht und dachte mir, er hat vielleicht einen besonderen Auftrag und sein Handy ausgeschaltet.«
»Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber hatte Gerd sein Handy öfter ausgeschaltet?«, fragte Santos, die immer auf ihrem Mobiltelefon erreichbar war.
»Nein, eigentlich nicht«, antwortete Nina und sah Santos an, »aber ich habe ihn auch nur ganz selten angerufen, wenn er im Dienst war. Er hat immer angerufen und … Er wollte immer wissen, wie es mir geht. Er hat sich eben Sorgen um mich gemacht. Aber das ist nicht so wichtig. Ich bin dann schließlich mit dem Bus hergefahren. Als ich ankam, war alles wie immer, die Garage war zu, die Haustür abgeschlossen … Trotzdem hatte ich so ein komisches Gefühl. Irgendwie war alles so kalt. Ich habe dann noch einmal versucht, ihn zu erreichen, und dann ging auch endlich einer aus seiner Abteilung an den Apparat. Er hat mir schließlich gesagt, dass Gerd gestern noch ganz normal Dienst hatte, heute hätte er aber frei. Ich wusste ja, dass Gerd heute und morgen frei gehabt hätte, und deshalb habe ich mich auch so gewundert, dass er mich nicht vom Bahnhof abgeholt hat. Ich bin dann rausgegangen, und als ich an der Garage stand, habe ich ganz leise den Motor laufen hören. Da war mir klar, dass etwas ganz Schreckliches passiert sein musste.«
»Und dann bist du in die Garage rein?«, sagte Henning.
»Natürlich, was glaubst du denn? Ich werde diesen Augenblick nie in meinem Leben vergessen. Er saß hinter dem Steuer, sein Kopf lag auf dem Lenkrad, seine Arme hingen runter. Ich habe die Tür aufgerissen und den Motor abgestellt, aber ich habe sofort gesehen, dass Gerd tot war. Ich bin wie in Trance ins Haus gerannt und habe Ziese angerufen. Was danach war, weiß ich nicht mehr, ich bin einfach nur ziellos durchs Haus gelaufen.«
»Wann habt ihr das letzte Mal miteinander gesprochen?«
»So gegen Mitternacht. Ich wollte ihm nur gute Nacht sagen.«
»Hat er da schon geschlafen, oder hat er auf deinen Anruf gewartet?«
»Nein, er war noch im Dienst und irgendwo unterwegs, frag mich aber nicht, wo. Ich hatte auch gedacht, er wäre schon zu Hause, aber als er hier nicht abgenommen hat, hab ich’s auf seinem Handy probiert.«
»Er hatte gestern den ganzen Tag Dienst und auch noch nachts?«, fragte Henning zweifelnd, der kaum einmal länger als zwölf Stunden am Stück gearbeitet hatte, außer in absoluten Notsituationen oder wenn akuter Personalmangel wegen zum Beispiel Krankheit herrschte.
»Ja, das kam gerade in letzter Zeit öfter vor. Als ich ihn angerufen habe, war er ziemlich kurz angebunden, weil er an einer Observierung teilnahm. Er hat nur gemeint, er würde so gegen drei Schluss machen und sich sofort hinlegen, weil er nach dem langen Tag einfach kaputt war. Ja, und er wollte mich am Mittag vom Bahnhof abholen. Er hat aber noch gesagt, er könne es gar nicht erwarten, mich wiederzusehen. Seine letzten Worte waren: »Ich liebe dich.«
»Und danach gab es keinen Kontakt mehr?«
»Nein, warum auch?«
»Das heißt, du bist nach dem Telefonat zu Bett gegangen und ziemlich bald eingeschlafen«, konstatierte Henning.
Nina zögerte mit der Antwort und sagte schließlich, ohne Henning anzusehen: »Ja und nein. Momentan nehme ich ein Schlafmittel. Es ist zwar rein pflanzlich, hat aber eine starke Wirkung. Der Phytotherapeut hat mir versichert, dass es dem Baby nicht schadet. Letzte Nacht konnte ich aber nicht richtig schlafen, es war nur so ein Hindämmern, und wenn ich mal weggenickt bin, kamen diese bösen Träume, die ich in letzter Zeit schon öfter hatte, obwohl ich das Schlafmittel genommen hatte. Davor habe ich noch einen Tee getrunken und mich so gegen halb eins hingelegt.«
»Und dann bist du ziemlich bald eingeschlafen«, meinte Henning.
»Hast du nicht zugehört? Ich habe nicht richtig geschlafen …«
»Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen durcheinander. Gerd war schließlich mein Freund.«
Nina lächelte wieder und sah erst Santos und dann Henning vergebend an. »Danke, dass du das sagst. Es tut gut. Er war immer für andere da, wenn sie ihn brauchten, das weißt du selbst. Und er hat mich geliebt, er hat es mir jeden Tag gezeigt und auch immer wieder gesagt. So jemand nimmt sich doch nicht das Leben! Sei ehrlich, so jemand bereitet doch nicht in aller Ruhe seinen Selbstmord vor? Oder?!«
»Und wenn es eine Affekthandlung war?«
Nina lachte auf und sagte kopfschüttelnd: »Gerd und Affekthandlung! Gerd hat nie im Affekt gehandelt, das müsstest du am besten wissen.«
»Schon, aber …«
»Du immer mit deinem Aber! Es gibt kein Aber, es gibt nur Fragen, kapierst du das nicht?«, fuhr ihn Nina wütend an. »Gerd hat keinen Selbstmord begangen, okay?«
»Entschuldige, Nina, ich wollte dich nicht aufregen. Ich muss dir aber diese Fragen stellen, denn wenn wir ermitteln, dann müssen wir auch einen Grund beziehungsweise ein Motiv für einen Selbstmord oder ein Gewaltverbrechen haben.«
»Schon gut, meine Nerven liegen einfach blank.«
»Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Wieso bist du so ruhig? Ich hatte erwartet, dass du …«
»Das ist nur äußerlich. Wenn ich erst allein bin …« Sie hielt inne und sah Henning mit zusammengekniffenen Augen an. »Oder zähle ich jetzt vielleicht sogar zu den Verdächtigen, weil ich nicht hysterisch rumschreie?«, fragte Nina ironisch. »Ich neige nun mal nicht zu Hysterie oder Schreianfällen. Auch nicht nachher, wenn ihr weg seid. Ich mache die Dinge eben anders mit mir aus. Das ist meine Mentalität.«
»Gerds Mutter …«
»Sie wird um ihren Sohn trauern«, sagte sie lapidar. »Jede Mutter trauert um ihren Sohn, wenn er das Einzige ist, was ihr noch geblieben ist. Sie hatte doch niemanden mehr außer ihm – und manchmal auch mich.«
»Du verstehst dich nicht sonderlich gut mit ihr?«
»Das ist eine lange Geschichte«, antwortete sie ausweichend.
»Verstehe«, murmelte Henning nachdenklich.
»Nein, das kannst du nicht verstehen. Und ich will’s dir auch gar nicht erklären. Ich bin eben nur eine Russin«, sagte sie mit einer Spur von Sarkasmus in der Stimme.
»Das tut mir leid, wenn da etwas zwischen euch steht. Aber noch mal zu Gerd. Hat er irgendwann einmal erwähnt, dass er bedroht wird oder in Gefahr ist?«
»Nein, hat er nicht«, antwortete sie gedankenverloren. Sie machte eine Pause und fuhr nach einigem Überlegen fort: »Und doch muss da etwas gewesen sein, über das er mit mir nicht reden wollte oder konnte. Ich verstehe das doch auch nicht. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das ist alles ein großes Rätsel für mich.«
»Und du hast keine Ahnung, wo er gestern Nacht war?«
»Nein. Als ich ihn angerufen habe, war er mit dem Dienstwagen unterwegs.«
»Allein?«
»Nein, als ich gestern Nachmittag mit Gerd telefoniert habe, hat er mir gesagt, dass ihn am Abend ein Kollege abholen wollte, und der würde ihn auch wieder nach Hause bringen.«
»Kennst du den Namen des Kollegen?«, fragte Henning mit gerunzelter Stirn.
»Nein, beim KDD kenn ich keinen. Ich weiß nur, es ging um irgendeine Observierung. Gerd hat aber nie detailliert über seine Arbeit mit mir gesprochen, da war er ganz eisern.«
Henning sah Santos kurz von der Seite an, die seinen Blick jedoch bewusst nicht erwiderte und offenbar das Gleiche dachte wie er. Was hatte Gerd mit dem KDD zu tun? Aber diese Frage ließ sich leicht anhand der Dienst- und Einsatzpläne beantworten.
»Moment, Moment, wieso KDD? Die haben doch ihre eigenen Leute.«
Nina zuckte mit den Schultern. »Gerd hat es gesagt. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich verhört habe. Ach, ich weiß doch auch nicht …«
»Was hat Ziese über die Observierung gesagt?«
»Gar nichts, wir haben nicht darüber geredet«, antwortete Nina.
»Und warum nicht?«
»Keine Ahnung, ist doch auch egal.«
»Aber Ziese ist beziehungsweise war sein Vorgesetzter. Er wird dich doch darauf angesprochen haben …«
»Nein, hat er nicht. Und außerdem, was hat das mit Gerds Tod zu tun?«
»Unter Umständen eine ganze Menge. Wir müssen rekonstruieren, wo Gerd in den letzten Stunden vor seinem Tod war, mit wem er zusammen war und was er gemacht hat.« Henning hielt kurz inne und sagte dann, wobei seine Stimme sehr eindringlich klang: »Nina, gibt es irgendwas, was du uns verheimlichst? Hat Gerd sich in letzter Zeit vielleicht auffällig benommen? War er anders als sonst? Mal abgesehen von Rosannas Tod.«