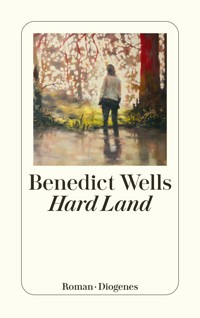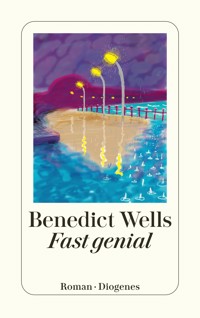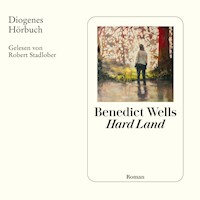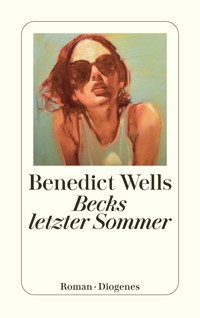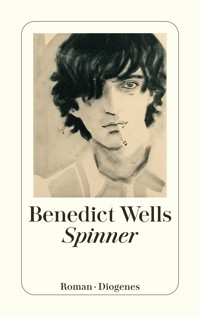
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich habe keine Angst vor der Zukunft, verstehen Sie? Ich hab nur ein kleines bisschen Angst vor der Gegenwart.« Jesper Lier, 20, weiß nur noch eines: Er muss sein Leben ändern, und zwar radikal. Er erlebt eine turbulente Woche und eine wilde Odyssee durch Berlin. Ein tragikomischer Roman über Freundschaft, das Ringen um seine Träume und über die Angst, wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Benedict Wells
Spinner
Roman
Diogenes
Für Dieter Klose, den ehemaligen Leiter
des Grundschulheims Grunertshofen.
Einer der wichtigsten und liebenswürdigsten Menschen
in meinem Leben, ich werde ihm immer dankbar sein.
Ich ist ein anderer.
Arthur Rimbaud
Montag
Gelächter im Dunkeln
Ich habe diese eiskalten Hände. Menschen schrecken immer zurück, wenn sie mir die Hand geben. Und dann starren sie auf meine langen, weißen Finger, die einem gerade verstorbenen Pianisten gehören könnten, und nachdem sie auf meine toten Finger gestarrt haben, schauen sie mir ins Gesicht und wirken für einen Augenblick überrascht, dass ich noch lebe. Deshalb bekam ich schon früh einen Komplex. Immer wieder holte ich meine Hände aus ihrem Lieblingsversteck, den Hosentaschen, hervor und betrachtete sie minutenlang. Vor allem, wenn ich nervös war. Und vor einigen Jahren, als der ganze Wahnsinn geschah, war ich oft nervös.
Ich fuhr damals mit der S5 Richtung Ostbahnhof. Es ruckelte, doch die Frau mir gegenüber hielt die Augen geschlossen. Ich musste gähnen und legte den Kopf in den Nacken. Dann ruckelte es zum zweiten Mal, und mein Koffer fiel auf den Boden. Ich stand auf und stellte ihn wieder hin.
Ein Blick auf die Uhr: kurz nach halb elf abends. Es war wenig los, niemand stieg ein außer einem angetrunkenen Obdachlosen, der vergeblich versuchte, seine Zeitungen und seine Lebensgeschichte loszuwerden. »Alles Wichser!«, rief er in meine Richtung, als er ausstieg.
Ich sagte nichts, betrachtete nur meine Hände mit den dünnen langen Fingern. Dann ruckelte es erneut, und mein Koffer fiel wieder um. Diesmal ließ ich ihn liegen.
Wir hielten am Ostbahnhof. Ich dachte an meine Rückkehr nach München. Meine Mutter zog mit meinem Bruder in eine kleinere Wohnung, und ich hatte versprochen, ihnen zu helfen und meinen Kram auszumisten. Seit der Sache mit meinem Vater und meinem Umzug nach Berlin hatte ich mich zu Hause nicht mehr blicken lassen. Das war über ein Jahr her. Nach München zurückzukehren war das Letzte, was ich wollte. Wahrscheinlich war ich eine Woche früher aufgebrochen als geplant, um es schneller hinter mich zu bringen. Vielleicht vermisste ich aber auch nur das, was von meiner Familie übriggeblieben war. Vielleicht.
Ich betrat die Bahnhofshalle. Während ich meinen schwarzen Samsonite-Trolley hinter mir herzog, kam mir ein blondes Mädchen entgegen, das genau den gleichen Koffer im Schlepptau hatte.
»Schichtwechsel«, sagte ich zu ihr, dann war sie auch schon an mir vorbeigegangen.
Ich musste lächeln, da ich mir einbildete, sie hätte mir einen intensiven Blick zugeworfen. Träumer, dachte ich. Nach ein paar Schritten drehte ich mich noch mal um. Das Mädchen war weg.
Mein Nachtzug traf erst in dreißig Minuten ein. Ich kaufte mir einen Kaffee, nippte daran und verbrannte mir die Zunge. Während ich zum Gleis ging, versuchte ich mir die Wohnung in München vorzustellen, den Geruch, mein altes Zimmer, die gemütliche Küche. Dort hatten wir, als mein Bruder und ich noch Kinder gewesen waren, oft Mensch-ärgere-dich-nicht gespielt. Ich hatte es geliebt, wenn es draußen regnete und wir drinnen im Warmen saßen und würfelten. Lange her. Jetzt kam es mir so vor wie die Erinnerungen eines anderen.
Es war kalt am Bahnhof, ich knöpfte meinen Mantel zu und setzte mich. Eine Familie kam an mir vorbei. Der Vater schob einen Gepäckwagen, auf dem ein kleiner Junge saß. Die Mutter strich ihm liebevoll über den Kopf. Der Kleine murmelte etwas, und dann lachten alle. Deprimierend, wie glücklich die waren. Das passierte mir immer. Wenn ich schlecht drauf war, tauchten auf einmal von irgendwoher so scheißfröhliche Menschen auf. Ich schmiss den Kaffeebecher weg.
Plötzlich fuhr ich hoch. Die Kerze! Ich hatte beim Verlassen der Wohnung bestimmt wieder vergessen, die Kerze auf meinem Schreibtisch auszublasen. Vielleicht brannte schon das ganze Zimmer! Sicher war ich mir zwar nicht, aber besser kein Risiko eingehen. Ich stand auf und umklammerte den Griff des Koffers. München muss erst mal warten, dachte ich. Dann verließ ich den Bahnhof und fuhr wieder zu meiner Wohnung zurück. Immerhin hatte ich es diesmal bis zum Gleis geschafft.
Die letzten dreimal war ich bereits vorher umgekehrt.
Das Schrillen des Telefons riss mich aus dem Schlaf. Auf der Suche nach dem Hörer stießen meine Hände gegen leergetrunkene Bierflaschen. Es musste früher Montagnachmittag sein.
»Ja … bei Lier«, sagte ich. Mit dem »bei Lier« ließ ich mir, obwohl ich allein lebte, immer alle Optionen offen. So konnte ich notfalls die Identität eines fiktiven Mitbewohners annehmen und sagen, dass Jesper nicht da sei, ich ihm aber gern etwas ausrichten könne. »Wer ist da?«
»Jesper, bist du das?«
Die Stimme kam mir vertraut vor. Ich beschloss, mich zu erkennen zu geben. »Ja …«, sagte ich, um dann viel zu laut hinzuzufügen: »Ich bin Jesper Lier!«
Da ich mich im Halbschlaf befand, war ich froh, mich an die Dinge klammern zu können, die ich mit Sicherheit wusste. Ich hätte zwar auch sagen können: Ich heiße Jesper Lier, aber mich beschleicht schon länger das Gefühl, dass ich es auch tatsächlich bin. Obwohl ich mich früher schwer damit tat, denn Jesper klingt irgendwie nach einem scheiß Knusperfrühstück oder einem Biomüsliriegel aus Dänemark.
»Und Sie sind …«, fragte ich.
»Die Andrea natürlich.«
»Ah, ja … toll, dass Sie anrufen!« Ich hatte keinen Schimmer, mit wem ich da sprach.
»Siezt du mich etwa? Jesper, du erinnerst dich doch noch an mich, ich bin’s, deine Tante Andrea.«
Ich wühlte in meinen Erinnerungen herum und sah mich in unscharfen Bildern vor ungefähr drei Millionen Jahren als kleines Kind auf ihrem Schoß sitzen.
»Hab ich dich geweckt, Jesper? Schläfst du um diese Zeit etwa noch?«
»Wieso, welche Zeit haben wir denn?«
Das schien nicht die richtige Antwort gewesen zu sein.
Eine Pause trat ein. Ich überlegte, wie sie eigentlich an meine Nummer gekommen war. Die hatte doch niemand! Dann erinnerte ich mich, wie ich vor ein paar Wochen zufällig ihren Mann auf der Straße getroffen und sie ihm gegeben hatte.
»Tja … sag mal, wie geht’s dir denn so?«, fragte sie mich. »Ich wollte mich schon längst mal bei dir melden, auch wegen deinem Vater. Es tut mir …«
»Mir geht’s gut«, unterbrach ich sofort.
»Schön.« Sie schien nun intensiv nachzudenken, was sie mich noch fragen könnte. »Und sonst? Was machst du, schreibst du eigentlich immer noch an deinem Buch, diesem … Gesellen?«
»Du meinst, Der Leidensgenosse.«
»Ja, richtig. Der Leidensgenosse, wie konnte ich das vergessen.« Sie lachte, was mich doch ein wenig ärgerte. »Und, wie läuft es, bist du fertig, hast du schon einen Verleger? Ich hab ja neulich gelesen, dass es für junge Autoren immer schwieriger wird, etwas zu veröffentlichen.«
»Ach, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Erstens ist das Ding schon lange fertig, und zweitens habe ich auch schon einen Verlag, also alles bestens.«
Das war mehr oder weniger gelogen.
»Na, das ist doch super. Aber mal was anderes. Ich wollte dich, falls du noch nichts vorhast, für heute Abend einladen. Ich hab Geburtstag. Willst du nicht bei uns vorbeischauen?«
Ich wollte natürlich nicht, auf keinen Fall. Doch leider war das nicht meine Entscheidung, da ich an der Langschläfer-Krankheit litt: Ich war fröhlichen Frühaufstehern hilflos ausgesetzt, denn im Halbschlaf versuchte ich es aus mir unverständlichen Gründen immer allen recht zu machen und nickte dann jeden Wunsch oder jede Bitte einfach ab. Und noch bevor ich etwas dagegen unternehmen konnte, hörte ich mich freudig in den Hörer plärren: »Geht klar, Andrea, heute Abend, ja? Natürlich bin ich dabei, das wird sicher lustig … Also, schon mal alles Gute, und bis später, ich freu mich.«
Nachdem ich aufgelegt hatte, schlurfte ich in den Flur. Die Dusche stand, wie bei Arbeiterwohnungen am Prenzlauer Berg damals üblich, in der Küche. Warmes Wasser gab es nur anderthalb Minuten lang. Danach kam der eiskalte Guss, der durch die verkalkten Rohre des Hauses rauschte. Ich hatte mich im vergangenen Jahr, was die Duschgeschwindigkeit anging, sehr gesteigert. Wenn ich gut drauf war, konnte ich in etwa zwei Minuten mit allem fertig sein. Doch da war nichts zu machen. Das Mistding ließ nicht mit sich feilschen und beharrte stur auf exakt anderthalb Minuten.
Vorsichtig schob ich den Plastikvorhang beiseite. Ich nannte ihn »die zweite Haut«, denn das Teil klebte immer sofort an mir. Ich drehte den Hahn auf und rieb mir Shampoo in die Haare. Vielleicht schaff ich’s ja heute rechtzeitig, dachte ich.
Ich war ein Idiot. Der polarkalte Strahl lähmte meinen Verstand und entlockte mir tiefe und dumpfe Laute des Entsetzens. Irgendwie vergaß ich jeden Tag aufs Neue, wie grausam das eigentlich war. Ich schrie auf und musste dabei vor Schreck fast lachen, als auch schon der Duschvorhang angeflogen kam und an mir klebte.
Einige Sekunden hielt ich es noch unter dem eisigen Wasser aus, dann war ich endlich fertig und warf mich wieder ins Bett. Ich wollte nie mehr aufstehen.
Kurze Zeit später stapfte ich mit einem schlechten Gefühl durchs Zimmer. Was sollte das eigentlich heißen, junge Autoren hätten es immer schwerer, etwas zu veröffentlichen? Das ist doch Quatsch, dachte ich.
»Das ist doch Quatsch!«, sagte ich laut. »Das ist doch verdammter Quatsch!«, schrie ich und lachte. Auf einmal war ich gut gelaunt. Ich legte Musik auf, spielte Luftgitarre und sprang im Zimmer umher.
Irgendwann schnappte ich mir beim Rumzappeln einige Blätter meines Romans und las sie durch. Absolut phantastisch. Das Buch hieß, wie schon erwähnt, Der Leidensgenosse, und ich hatte Großes damit vor. Als ich nach Berlin kam, hatte ich erst zweihundert Seiten gehabt, aber danach hatte ich richtig losgelegt. Es sollte schließlich nicht irgendein Roman werden, nein, es sollte der Roman werden. Allein die Verfilmung würde vermutlich mal zehn Oscars gewinnen oder so. Dann konnte ich diese ganze Scheiße hier endlich hinter mir lassen.
Ehrlich gesagt war das vergangene Jahr nämlich ein einziger Alptraum gewesen, bestehend aus dem Drang, bis in den frühen Morgen hinein zu schreiben, Schwindelanfällen, Alkohol und jeder Menge Schlaftabletten. In letzter Zeit hatte ich mich auch immer öfter übergeben müssen.
»Du bist echt krank, du Arsch!«, sagte Gustav immer zu mir. »Ich meine, keine Frauen, keine Kohle, kein Essen. Ständig hockst du allein in deinem Kellerloch und tippst in deinen Computer. Irgendwann wirst du noch durchdrehen, und da brauchst du gar nicht so blöd zu grinsen, das ist nämlich nicht lustig.«
Gustav hatte natürlich recht. Und mir war auch klar, dass die Leute jemanden wie mich für einen Spinner hielten, weil ich noch immer an meine Träume glaubte. Aber lustig fand ich’s irgendwie trotzdem. Ich lachte nämlich oft, auch wenn es in meiner Situation eigentlich nichts zu lachen gab. Manche fanden das seltsam, aber dafür wusste ich, wie man überlebte.
Im Flur schaute ich in den Spiegel. Ein eigenartiger Typ stand mir gegenüber. Er sah ungesund und ausgezehrt aus, als wäre er binnen kürzester Zeit ungewöhnlich schnell gewachsen. Er trug Jeans, T-Shirt und eine dunkle Schiebermütze. Seine braunen Haare glichen einem Vogelnest, und das bleiche Gesicht blickte mir verpennt entgegen …
Eindeutig, so gut hatte ich schon lange nicht mehr ausgesehen, heute war einer meiner besseren Tage. Zufrieden wendete ich mich ab. Im Gehen schnappte ich mir noch meinen Ian-Curtis-Mantel, ein schwarzes und zerknittertes altes Teil, das ich mal zu Hause auf dem Dachboden gefunden hatte, dann verließ ich meine Wohnung, um mich wieder ein wenig zu verlieben.
Das Mädchen mit dem Koffer
Im Hausflur grüßte ich den alten Türken, der einige Stockwerke über mir wohnte und Tüten schleppte. Dann tanzte ich ein wenig, als wär ich irgendein bescheuerter Musicalstar. Keine Ahnung, das machte ich öfter, einfach ein bisschen rumkaspern. Ich drehte mich ein paarmal im Kreis und machte Discobewegungen wie in Saturday Night Fever.
Ich trat ins Freie. Das Tageslicht blendete mich, so was war ich von meinem Kellerloch nicht gewohnt. Meine Wohnung verließ ich normalerweise nur aus zwei Gründen: Der eine war mein Praktikum beim Berliner Merkur, einer kleinen Zeitung. Der andere war: um mir etwas zu essen zu kaufen. Ansonsten blieb ich daheim und schrieb. Mich beschlich das dunkle Gefühl, dass ich mich in den letzten Monaten in meine alte Katze Whiskey verwandelt hatte – ich schlief den ganzen Tag, aß schlechtes Futter aus der Dose und war krankhaft nachtaktiv.
Inzwischen steuerte ich auf die nächste U-Bahn-Station zu, um zur Freien Universität zu fahren. Ehrlich gesagt hatte ich noch nie einen Vorlesungssaal von innen gesehen. Ich studierte nur zum Schein, damit ich jeden Monat Kindergeld bekam und kostenlos U-Bahn fahren konnte. Und jetzt war es Zeit, sich für das nächste Semester einzuschreiben. Da ich das letzte Mal nicht alle Unterlagen dabeigehabt hatte, musste ich persönlich erscheinen. Mein Name auf irgendeiner Immatrikulationsliste – das würde mein einziges Zugeständnis an die Gesellschaft sein, die einzige Spur, die ich da draußen hinterließ. Ich besaß kein Handy, ging nicht wählen und stand nicht im Telefonbuch, ich hatte in meiner Wohnung kein Internet und schrieb keine Mails mehr, und von Facebook hatte damals selbst Mark Zuckerberg noch nichts gehört. Niemand konnte mich mehr finden. Weder diese Idioten aus meiner alten Klasse mit ihren tollen Studienplänen und Lebensentwürfen noch all die Leute, die mir erzählen wollten, was ich machen sollte. Die konnten mich alle mal. Ich war keiner von ihnen. Das sagte ich mir jeden Tag. Ich war keiner von ihnen.
Auf dem Weg zur U-Bahn bog ich in die Schönhauser Allee ein. Überall Menschen, sie redeten, lachten und strömten die Straße entlang, am Obststand neben mir wurde auf Vietnamesisch diskutiert, ich sah dicht an mir vorbeisausende Fahrradfahrer, Bettler, Typen mit Einkaufstüten und eine Horde Kinder mit Schulranzen. Ein paar Sekunden blieb ich stehen und saugte diesen Anblick auf.
Als ich weiterging, fing ich auf offener Straße an, vor mich hin zu singen: »Tried to run, tried to hide, break on through to the other side!«
Ich hörte hinter mir jemanden lachen und drehte mich um. Für einen Moment war ich sprachlos.
»Wart’ mal, das gibt’s nicht!«, sagte ich, als ich mich gefasst hatte. »Du warst doch gestern Nacht am Bahnhof, oder? Wir haben die gleichen Koffer, weißt du noch? Samsonite!«, rief ich, als wäre Samsonite ihr Name oder was.
»Und hast du mir nicht ›Schichtwechsel‹ oder so nachgerufen?«, fragte sie prompt.
Ich nickte, während ich sie mir genauer ansah. Sie war mittelgroß, blond, trug einen beigefarbenen Mantel und eine olivgrüne Strickmütze, die ihr etwas Niedliches verlieh. Ihre Lippen waren blass, ungeschminkt, seltsam verführerisch. Und dann noch diese großen grauen Augen, mit denen sie mich gerade neugierig ansah.
Doch irgendetwas an ihr störte mich. Sie war zu glatt, zu makellos. Vielleicht zu kalt. Ich weiß nicht, ob mich jemand versteht. Wir standen uns noch immer gegenüber. Ich wollte mich schon wieder von ihr verabschieden, da lächelte sie mich an.
»Na, was ist … Krieg ich keine Zugabe?«, fragte sie.
Ihr Lächeln! Die wenigen Buchstaben meiner Tastatur reichen leider nicht aus, um das Gefühl zu beschreiben, das mich in dieser Sekunde erfüllte. Auf einmal schien alle Kälte aus ihrem Gesicht verbannt, und ich spürte, wie ich sofort rot wurde. Armer Jesper. Das passierte mir immer. Wenn mir eine Frau ihr schönstes Lächeln zuwarf, war es um mich geschehen.
»Was?« Ich versuchte mich zusammenzureißen. »Ach so, wegen der Zugabe … Also, tut mir echt leid, aber mein Agent hat mir so was verboten, und er ist ziemlich streng.«
»Wo hast du eigentlich so schief singen gelernt?«
»In der Dusche … Aber ein bisschen angeborenes Talent ist schon auch dabei, sonst hätte ich’s nicht so weit gebracht.« Was redete ich da nur? Ich sah sie flüchtig an. »Aber wie gesagt, eigentlich darf ich gar nicht in der Öffentlichkeit auftreten, nichts zu machen.«
»Schade, ein andermal vielleicht.«
»Gern.«
»Na dann«, sagte sie. »Ich muss jetzt noch raus zur Uni, nach Dahlem.«
Na also. Hatte mein Scheinstudium endlich einen Sinn.
»Ich auch«, sagte ich. »Wir können ja zusammen fahren.«
Wir gingen beide die U-Bahn-Treppen hinauf und setzten uns in die U2. Während wir Richtung Westen fuhren, versuchte ich mir Fragen auszudenken. Fiel mir aber nicht leicht, denn immer, wenn ich an einer Frau interessiert war und ein richtiges Gespräch mit ihr führen musste, verwandelte ich mich in mein pubertierendes fünfzehnjähriges Ich zurück. Das Problem dabei war, dass ich als Fünfzehnjähriger bei den Mädchen ein totaler Versager gewesen war. Nie bekam ich den Mund auf.
»Was studierst du?«, fragte ich nach einer halben Ewigkeit. Nicht zu fassen, selbst so was Einfaches musste ich mir schon krampfhaft abringen.
»Philosophie«, sagte sie. »Na ja, heute ist mein letzter Tag. Ich wechsle mein Hauptfach … Und du?«
»Politikwissenschaft.«
»Und, ist es gut?«
»Keine Ahnung«, sagte ich grinsend, »ich bin noch nie hingegangen.«
Pause. Das schien nicht so gut anzukommen, wie ich gedacht hatte. Ich überlegte, welchen Eindruck ich eigentlich auf sie machen musste: ein komischer Typ, der auf der Straße rumsingt und mit ihr zur Uni fährt, obwohl er gar nicht studiert. Na spitze, dachte ich, auf so was stehen die Frauen.
Wir schwiegen nun beide wieder. Ich betrachtete meine toten Finger und überlegte, was ich ihr sagen konnte. In einem Paralleluniversum, in dem Woody Allen Wimbledon gewann und Hitchcock kleine Pornofilme drehte, wären mir bestimmt tausend Gesprächsthemen in den Sinn gekommen. In dieser Welt dagegen fiel mir ums Verrecken nichts ein … Eine Haltestation nach der anderen zog an uns vorbei, die reinste Folter.
»Kaugummi!«, sagte ich zu mir selbst. Natürlich, ich konnte ihr wenigstens einen Kaugummi anbieten. Ich kramte in der Manteltasche und reichte ihr einen.
»Danke.« Sie griff zu, dann musterte sie mich. »Ich hab noch nie jemanden getroffen, der sich so für einen Kaugummi begeistern kann.«
»Na ja, ich bin eben außergewöhnlich.«
»Das glaub ich dir gern«, sie reichte mir die Hand, »ich bin übrigens die ganz gewöhnliche Miriam. Kannst mich Miri nennen.«
Ich nahm ihre Hand. »Und ich bin der singende Jesper.«
»Freut mich, singender Jesper.«
Für einen kurzen Moment sahen wir uns in die Augen, dann ließen wir voneinander ab. Wir kamen an.
Als wir das Campusgelände betraten, wurde ich beinahe erschlagen. Die letzten beiden Monate hatte ich einsam verbracht, und nun sah ich hier überall junge Menschen, die an mir vorbeidrängten, mit ihren Rucksäcken auf dem Boden hockten und sich unterhielten oder zu ihren Vorlesungen gingen. Dabei wirkten sie alle so sicher und erwachsen, als gehörten sie hierher, als täten sie das Richtige. Ich kam mir vor wie ein Zwölfjähriger, der sich zufällig aufs Unigelände verirrt hatte.
»Miri, hier bin ich!«, rief jemand.
Ich drehte mich um. Ein leicht untersetzter, aber nicht schlecht aussehender Student kam auf uns zugelaufen, er hatte einen Kinnbart und grinste irgendwie dümmlich vor sich hin. Der Typ schien Miri gut zu kennen, sie umarmten sich. Ich wurde natürlich sofort eifersüchtig und trat einen Schritt näher, wollte hören, was dieser Idiot mit Miri redete. Was konnte er ihr denn schon sagen?
»Hey, was machst du nachher noch?«, fragte er sie.
Mist, nicht übel, so etwas wäre mir jedenfalls nie eingefallen.
Dann kam noch eine weitere junge Frau auf uns zugetrabt, die ich aber sofort in die Ökoschublade steckte. Sie trug eine dieser gestrickten Inka-Jacken und schleppte eine bunte Wolltasche mit sich herum, und in ihren roten Locken steckten Perlen und Knöpfe.
»Wer ist denn der nette junge Mann hier?«, fragte sie Miri und deutete auf mich. Nun war sie mir natürlich sofort sympathisch, denn mit diesen Worten hatte sie mich wieder ins Spiel gebracht.
»Das ist Jesper, er ist Sänger.«
Miri stellte mich den anderen vor. Wir sprachen gerade darüber, was wir in den Semesterferien gemacht hatten – ich erfand irgendeine abstruse Geschichte von einem Rucksacktrip durch Norwegen, die ich mir selbst nicht ganz abkaufte –, als der Typ mit dem Bart auf seine Uhr sah. »Wir müssen los, der Kurs fängt gleich an, und ich will nicht schon wieder zu spät kommen.«
Sie wollten aufbrechen, aber das durfte ich nicht zulassen.
»Ach, ich muss mich ja auch noch einschreiben, für Politikwissenschaft«, sagte ich schnell in die Runde.
»Ich dachte, du studierst gar nicht«, sagte Miri.
Erwischt. Hatte ich ganz vergessen. »Tue ich auch nicht.«
Sie sah mich eindringlich an, dann schüttelte sie den Kopf, so dass ihr die hellblonden Haare ins Gesicht schlugen. »Du bist seltsam«, sagte sie, und ich wusste nicht genau, wie sie das meinte. Bei manchen Frauen weiß man wirklich nie genau, wie sie so was meinen.
Ihre Freunde hatten sich in der Zwischenzeit einen kleinen Vorsprung erarbeitet und riefen nach ihr. Die Zeit drängte.
»Miri …«, sagte ich und klaubte das letzte bisschen Mut zusammen. Und für einen Moment schien ich tatsächlich zu wachsen und mich zu wahrer Größe aufzurichten. »Miri, ich, ich wollte dich … nur … es ist nur …«
»Ist nur was?«
»Ist nur …« Ich sah sie lange an.
»Ja?«
»Ach egal«, sagte ich schließlich und schrumpfte wieder zusammen. »Viel Spaß in deinem Kurs!«
Kläglich, absolut kläglich.
»Danke, dir auch bei … was auch immer du hier als Nichtstudent machst.« Sie fuhr sich noch mal durchs Haar. »Also … vielleicht sieht man sich ja mal wieder?«
Ich nickte nur. Einen Moment wartete Miri darauf, ob ich nicht doch noch etwas sagen würde, aber natürlich tat ich das nicht, und sie ging. Jesper sein bedeutet, im entscheidenden Moment zu verstummen.
Das Einschreiben war deprimierend. Ich hielt die Unterlagen und mein lausiges Abiturzeugnis in der Hand und wartete auf einem Plastikstuhl. Auch von meinen Kommilitonen machte keiner den Eindruck, dass er gern hier war. Nur hinten standen ein paar Erstsemester, die sich angeregt unterhielten und sich offenbar noch auf ihr Studium freuten.
Als ich nach einer Stunde fertig war, setzte ich mich draußen auf eine Bank und versuchte, mich an die bisherigen, enttäuschend verlaufenen Akte aus dem Trauerspiel »Jesper und die Frauen« zu erinnern. Meine Feigheit von vorhin nagte an mir. Miri, dachte ich. Je öfter ich mir den Namen vorsagte, desto seltsamer klang er. Miri, Miri, Miri.
Ich fragte mich, wie ich sie einladen konnte – natürlich möglichst gewitzt –, und sprach dabei vor mich hin: »Hey, Miri, ich hab’s mir anders überlegt, ich würde dir doch eine kleine Zugabe meiner Gesangskunst geben, vielleicht im Kino, obwohl, das ist ja totaler Unsinn, da muss man ja eigentlich still sein, hehe …«
Ich drückte auf die Repeat-Taste und war fassungslos.
Noch mal: »Du, Miri, also, na ja, ich wollte dich fragen, wo wir schon mal zusammen U-Bahn gefahren sind, da könnten wir ja auch zusammen essen gehen, oder … haha … wir könnten zusammen …«
So ging das noch einige Minuten. In immer lässigeren Posen sagte ich Sätze wie: »Hallo Miri, ich wollte dir nur etwas Wichtiges sagen, ich äh … ich bin eine ziemliche Niete!«
Ich schüttelte den Kopf, das war ja nicht zum Aushalten. Dann schreckte ich hoch und rannte zur Uni zurück. Ich sah auf den Plan für Philosophie. Doch als ich ankam, war Miri schon weg. Der verlassene Vorlesungsraum erinnerte mich an das Ende meiner Schulzeit. Diese Leere, als alles vorbei war.
Auf dem Rückweg musste ich husten. Kam sicher vom Rennen. Ich war nämlich der totale Antisportler, wenn ihr’s genau wissen wollt. Ich hatte mal einen Lehrer gehabt, Herr Möller-Weiden, der war so ein Ex-Bundeswehr-Sadist und ließ alle dauernd Runden um den Sportplatz laufen. In der Hand hielt er einen Haufen Kieselsteine, und nach jeder Runde ließ er einen fallen, bis keiner mehr da war. Nur ich lief nie mit. Ich hatte ein Attest, dass ich Asthma habe, und lag im Gras und winkte oder so. Herr Möller-Weiden hatte dann immer gesagt, ich sei nur ein Simulant und würde es später noch bereuen, meine »Kameraden« so im Stich gelassen zu haben. Echter Pädagoge, der Typ.
In der S-Bahn nach Hause döste ich dann ein, bis mein Magen knurrte. Mal wieder. Okay, vielleicht hätte ein vernünftiger Mensch mehr auf seinen Schlaf und seine Ernährung geachtet, nur: Ich war eben nicht vernünftig. Ich wühlte in meinen Taschen nach Geld, doch ich fand bloß noch einen Euro. Davon konnte ich mir gerade mal drei Semmeln kaufen. Oder zwei Käsesemmeln. Oder eine Käsestange. Ja, das klang gut. Ich fing sogar an zu grinsen, vor blöder Vorfreude auf die Käsestange, und betrachtete die Bettlerin, die stumm von einem Fahrgast zum nächsten ging. Niemand gab ihr etwas. An ihrer Seite ein kleines Mädchen, mit klugen, hellblauen Augen, die alles in sich aufnahmen. Solche Augen hatte ich überhaupt noch nie gesehen. Immer wieder starrte ich hin, wandte jedoch jedes Mal das Gesicht ab, wenn das Mädchen zurücksah. Dann stand es plötzlich mit seiner Mutter vor mir. Ich versuchte wegzusehen, doch ich spürte, dass das Mädchen mich noch immer ansah, mit diesen ruhigen, wachen Augen, und da hatte ich ihm den Euro schon gegeben.
Ich stieg aus und lief hungrig durch die Straßen. Der Himmel war wie schon seit Tagen grau, richtiges Mistwetter. Miriam … Erst jetzt wurde mir klar, dass ich gar nicht wusste, wie sie mit Nachnamen hieß oder welches ihr neues Fach war. Wie sollte ich sie wiederfinden? Jeden Tag vor der Uni campieren und Zettel aufhängen, dass ich nach ihr suchte?
Während ich die Haustür aufschloss, biss ich mir auf die Unterlippe. Auf einmal war ich wütend auf mich selbst, ich zitterte sogar. Wieso hatte ich den ersten Menschen, den ich seit zwei Monaten kennengelernt hatte, so einfach ziehenlassen? Wie sie mich angesehen hatte … Wieso hatte ich nichts gemacht?
Im Treppenhaus kam mir eine ältere Frau entgegen. Ich grüßte sie und hielt einen kurzen, heiteren Schwatz mit ihr, alles falsch, alles Fassade, denn kaum war ich unten in der Wohnung angekommen, knallte ich die Tür zu. Ich trat mit dem Fuß gegen ein Regal.
»Du scheiß Versager, du bist selbst schuld, dass du einsam bist!«, schrie ich und schmiss mehrere Bücher und einen Stuhl durch den Raum, ehe ich an der Zimmerwand zusammensank.
Nur langsam beruhigte ich mich. Diese plötzlichen Stimmungsschwankungen waren neu, als wäre in meinem Inneren ein defektes, flackerndes Licht. Auf Momente unerklärlicher Euphorie folgten oft lange Phasen von Dunkelheit und Wut.
Ich saß noch ewig so an der Wand, bis mir einfiel, dass mich meine Tante Andrea zu ihrem Geburtstag eingeladen hatte. Als Ausrede würde ich wohl irgendeine Krankheit erfinden müssen, Lepra oder so, aber das war kein Problem. Wenn ich etwas beherrschte, dann war es Schwindeln, immerhin steckt in meinem Nachnamen »Lier« das englische Wort für Lüge.
Inzwischen war mir vor Hunger fast schlecht, doch der Kühlschrank war leer. Und auch der Haufen Orangen und Bananen, den ich mir vor Tagen gekauft hatte, war fast komplett aufgegessen. Die beiden Ausdrucke meines Buchs hatten mich ruiniert. Aber hatte ich nicht irgendwo noch einen Zwanziger?
Ich wühlte in Schubladen, durchsuchte meinen Schrank und die Kommode im Gang. Nichts. In meiner Verzweiflung kroch ich sogar hinter den verdammten Schreibtisch – und fand ihn dort tatsächlich staubbedeckt am Boden. Ich wollte gerade zu einem Freudenschrei ansetzen, da klingelte es an der Tür.
»Hey, du Penner!« Gustav von Wertheim stand im fahlen Licht meines Hausflurs und grinste mich an. »Ich bin wieder da!«
Über den Dächern der Stadt
Ich könnte euch jetzt über fünf Seiten damit langweilen, wie ich Gustav kennengelernt habe, wie seine Kindheit verlief und welche Farbe die Wände in seiner Wohnung haben, oder mit diesem ganzen anderen Mist, der niemanden interessiert. Ihr braucht aber nur zu wissen, dass er zu den Menschen gehört, die sich unbemerkt in dein Leben schleichen und es fortan bestimmen. Gustav war zwei Jahre älter als ich und mein einziger Freund in der Stadt. Ich bewunderte ihn sehr, vor allem, weil es mit ihm nie langweilig war. Ich kannte ihn zwar erst seit einem Jahr, trotzdem hatte ich mit ihm bereits mehr verrückte Dinge erlebt als in den vergangenen neunzehn Jahren davor. Die letzten beiden Monate war er in Spanien gewesen, nun stand er in meiner Tür und wollte umarmt werden.
»Jesp!«, brüllte er mit seiner Bassstimme. Ihr müsst wissen, dass er nie etwas nur sagte, er schrie einen immer gleich an.
Ich umarmte ihn, dann schob ich ihn weg von mir, um ihn anzusehen. Er glich ein wenig diesem amerikanischen Schauspieler, dieser eine mit der gebrochenen Nase, der … ach, egal, ich komm gerade nicht auf den Namen. Gustavs Gestalt begann jedenfalls verheißungsvoll: Mit einem klaren, markanten Gesicht, gerahmt von langen blonden Haaren, und einem gestählten Oberkörper, der in einem Shirt und einer schwarzen Lederjacke steckte; der Rest von ihm endete dann in einer löchrigen Jeans und zwei alten Chucks ohne Schnürsenkel. Gustav ging ziemlich oft ins Fitness-Studio. Er aß auch gesund, Müsli und Obst und so Kram. Obwohl er die Nächte durchmachte, sah er deshalb immer frisch und vital aus, wie so ein verdammter Naturbursche.
»Das hast du ja noch immer nicht ausgewechselt.« Er tippte auf mein Türschild. TUBLUK stand darauf in verblassten Lettern. Das Schild stammte noch von meinem Vormieter, Radoslaw oder Rademir Tubluk, sensationeller Gangstertyp. »Hast du jetzt also doch seine Identität angenommen?«
»Keine schlechte Idee«, sagte ich. »Hin und wieder klingeln Leute bei mir und fragen nach ihm. Deutsche, Russen, Afghanen, Polen … was weiß ich. Dieser Tubluk muss ziemlich wichtig sein.«
»Na, wie auch immer, Jesp, ändere endlich mal das Schild. Wer weiß, was sonst passiert.«
Ich nickte, änderte das Schild aber nicht.
»Und was hast du die letzten Wochen so gemacht?«, fragte Gustav, als er die Wohnung betrat.
Ich dachte nach und versuchte, die spärliche Fackel des Wissens, das ich von meiner Existenz hatte, an ihn weiterzugeben. »Ein wenig geschrieben, ein wenig gelebt, du weißt schon, das Übliche.«
»So, so, das Übliche.«
Wir betraten mein Zimmer. Außer ein paar Postern und den wenigen Möbeln war es leer. Wortlos betrachtete Gustav die unzähligen, überall herumliegenden Seiten von Der Leidensgenosse. Jeder sollte mich für so ein kleines Außenseiter-Genie bei der Arbeit halten, deshalb hatte ich die Wohnung damit übersät. Auf so was achtete ich penibel. Es sollte so aussehen, als wäre ich einfach nur unordentlich, dabei verwendete ich wahnsinnig viel Zeit darauf, bis alle auf dem Boden verstreuten Blätter, Kaffeetassen und das an einer schönen Stelle aufgeschlagene Buch von Nabokov an ihrem richtigen Platz waren. Auch wenn, zugegeben, fast niemand hier unten vorbeischaute.
»Und, wie war’s in Barcelona?«, fragte ich, um von meinem Chaos abzulenken.
Gustav erzählte von ein paar männlichen Urlaubsbekanntschaften. Wiedersehensgequassel. Schließlich hob er ein einzelnes Blatt vom Boden auf und sah es sich an. Seite fünfhundertdreiundsiebzig. »Na, wie geht’s so mit deinem Buch voran?«
Vor dieser Frage hatte ich mich gefürchtet. Ich nahm ihm das Blatt wieder weg.
»Du bist aber inzwischen fertig?«, fragte er, während er mir beim Einsammeln der restlichen Seiten half. »Hast du schon jemanden gefunden, der es liest?«
»Ja, natürlich bin ich fertig. Und ich hab’s vor einigen Tagen Born gegeben.«
»Born? Diesem alten Sack, mit dem du immer Schach spielst?«
»Hey, hör auf, so über ihn zu reden. Er ist wie ein Vater für mich.«
»Er ist wie ein Vater für mich – o Mann.« Gustav stöhnte auf. Er stöhnte sowieso immer auf, wenn jemand nicht über seine Sticheleien und Scherze lachte. »Sorry, ich hab nichts gesagt. Der heilige Born, schon verstanden. Aber erzähl mir jetzt bitte nicht zum hundertsten Mal die Geschichte, wie er sich immer um dich gekümmert hat.«
»Fick dich, okay?«
»Was ist denn los, Jesp? Es war nicht ernst gemeint, das weißt du doch.«
»Schon okay. Es ist nur gerade alles irgendwie … schwierig. Und wenn ich in einer Woche wieder nach Hause fahre, dann …« An dieser Stelle brach ich ab und sagte nichts mehr.
Ja, was ist dann, dachte ich.
Lange war es still, bis Gustav in die Hände klatschte.
»Besaufen!«
Ich blickte ihn ungläubig an.
»Ach komm, schau nicht so doof«, sagte er. »Ich hab recht. Wir gehen was trinken. Und dann brauchst du mal wieder eine Frau, deswegen bist du auch so ätzend. Na los, Jesp, ich weiß, wo jetzt ’ne gute Party steigt.«
Wir traten auf die Straße. Der Osten der Stadt vibrierte, es war, als ob die Menschen erst in der Dunkelheit aus ihren Häusern herausgekrochen kamen. Bars füllten sich, vor den Clubs erste Schlangen, erwartungsvolle Gesichter im Laternenlicht. Jede Sekunde schien etwas Großes passieren zu können.
»Die Nacht ist keine Zeit. Die Nacht ist ein Ort!«
Gustav fasste mich am Arm und warf mir dabei einen gutgelaunten Blick zu, was oft vorkam, denn er zählte, grob geschätzt, zu den fünf fröhlichsten Menschen in Berlin.
»Wo gehen wir eigentlich hin?« Wir standen an einer Kreuzung und sahen einen mit Senioren beladenen Reisebus an uns vorbeifahren.
»Kennst du noch Niko Papadopoulos?«
»Der Architekt?«, fragte ich. »Das meinst du doch nicht ernst, oder? Wir gehen doch jetzt nicht schon wieder auf eine Schwulenparty? Das letzte Mal hat jemand gesagt, ich wäre der verkappteste Homosexuelle, den er je gesehen hat.«
Gustav grinste. »Und, stimmt’s?«
Ich blieb einfach stehen.
»Krieg dich wieder ein«, sagte er. »Ich hab dir doch gesagt, dass da auch Frauen sind. Niko hat Geburtstag. Und eine ziemlich coole Wohnung. Komm schon, es wird dir gefallen.«
Wir zogen weiter durch die Stadt. Eine Gruppe Frauen mit Hidschab kam an uns vorbei, dann eine Schar Jugendlicher, und eine Minute später standen wir auch schon im Treppenhaus eines unverputzten Altbaus. Auf dem Weg nach oben konnten wir bereits laute Musik hören. Kurz darauf klingelte Gustav an einer Tür. Ein Mann mit wirren schwarzen Haaren öffnete, in der linken Hand ein Bier, im Mundwinkel einen Joint. Der Gastgeber persönlich.
»Alles Gute zum Geburtstag!«, sagte ich und reichte ihm die Hand.
Niko ließ sie nicht gleich wieder los und sah mich an. »Jesper, oder?«, fragte er mich. »Du bist doch dieser Schriftsteller.«
Ich machte den Mund auf, wollte etwas Witziges darauf antworten, aber mir fiel genau gar nichts ein.
Gustav trat an mir vorbei. »Nikoletto!«, sagte er laut. Er hatte für all seine Freunde und Kumpels bescheuerte Spitznamen, ich war noch vergleichsweise glimpflich davongekommen.
Er und Niko umarmten sich und küssten sich auf die Wangen, dann ließen sie mich am Eingang stehen. Ich hörte, wie Gustav drinnen sofort von jedem überschwänglich begrüßt und willkommen geheißen wurde.
Zögerlich betrat nun auch ich die Altbauwohnung und gelangte in einen langen Flur mit unzähligen Zimmern. Eine angelehnte Tür gab den Blick auf eine Badewanne frei, in der Hunderte von Kassetten und CDs lagen. Daneben das große Wohnzimmer. Auf dem Sofa am Eingang saßen zwei knutschende Männer, vor mir stand eine Gruppe Frauen, die fröhlich auf Englisch darüber diskutierten, ob sie sich noch Ketamin organisieren sollten.
Ich trat ans Büfett. Bier, Wodka, Käsecracker und Salzstangen. Das bewährte Programm. Ich nahm zwei Flaschen Beck’s und setzte mich auf ein Sofa in der Ecke. Das Bier kippte ich rasch herunter. Ich fuhr mit den Fingern über die Raufasertapete, die sich von der Wand löste, und sah mich um. Die einen tanzten, die anderen redeten, manche standen auch allein rum. Ich hatte das Gefühl, dass man das alles mit ein paar Kniffen deutlich vereinfachen konnte. Fast jeder hier wollte Sex. Sofort und auf der Stelle. Das Ganze musste doch eigentlich recht simpel sein, aber von wegen. Denn wir waren alle Menschen, und da gab’s eben Regeln und Konversation. Und Alkohol, immerhin.
Auch der Typ neben mir, der sich gerade mit einer angetrunkenen Brünetten gesetzt hatte, hatte klare Absichten. Dennoch redete er mit ihr über Michael Jackson. »Kennst du diese Zeichentrickserie von früher, in der sich ein Junge nach einem missglückten wissenschaftlichen Experiment in ein Auto verwandeln konnte?«, fragte er sie.
»Ja, schon.«
»Ich hab gehört, dass Michael Jackson das jetzt mit sich selbst in der Hauptrolle als Menschenauto verfilmen will. Stell dir mal vor, dass dann in dem Film Kinder in ausgerechnet Michael Jackson einsteigen. Das ist doch voll gruselig, oder?«
»Krass!«
»Soll ich dir noch was zu trinken holen?« Er legte seine Hand auf ihr Bein.
Sie nickte.
Ich schüttelte den Kopf. War das Leben tatsächlich so einfach, und ich hatte es nur nicht gemerkt?
Ich stand auf und ließ die beiden allein. Bis jetzt hatte ich, seit ich auf der Party war, noch kein Wort gesagt. Stattdessen trabte ich wieder durch den endlosen Flur von Niko Papadopoulos’ Wohnung.
»Bist du Malte?«, fragte mich eine Frau mit einem raffiniert geschnittenen Undercut. Sie roch nach Parfum und irgendwie auch aufregend nach frischer Anstrengung. Sie musste getanzt haben.
»Nein, ich bin nicht Malte. Ich bin Jesper.«
»Wenn du Malte siehst, sag ihm, dass er ein blödes Arschloch ist!«
»Ist gut, wenn ich einen Malte sehe, sag ich ihm, dass er ein Arschloch ist.«
»Das ist echt lieb von dir, Jens!« Sie umarmte mich.
»Hey, ich heiße …« Doch da war sie längst den Gang entlanggetaumelt und kreischte entzückt, da sie gerade eine Freundin entdeckt hatte.
Als ich in die Küche kam, bot sich mir das übliche Bild. Einige Typen klebten im grellen Licht der Deckenbeleuchtung wie die Schmeißfliegen an aufgerissenen Keks- und Chipstüten und betranken sich hoffnungslos. Es waren Küchenmenschen, Leute, die sich auf jeder Party immer sofort in die Küche hockten, sich dort gemütlich einrichteten, den Kühlschrank leer fraßen und dabei ausschließlich darüber diskutierten, was in den anderen Zimmern geschah.
»Habt ihr Amy gesehen?«, fragte ein Typ mit Dreadlocks seine beiden Freunde. »Hab gehört, die macht gerade mit drei Spaniern auf einmal rum!«
»Woah, das hätte ich der gar nicht zugetraut«, sagten die anderen verblüfft.
Ich fragte mich, wie diese Typen eigentlich an solche Informationen kamen, da sie die Küche wahrscheinlich seit Monaten nicht mehr verlassen hatten. Sie lebten nur von Leuten, die sich zufällig hierher verirrten oder etwas essen wollten und von denen sie in Sekundenbruchteilen wichtige Details aufschnappen konnten. Von Leuten wie mir.
Ich ging zum Kühlschrank. Ein einzelner Joghurt stand inmitten einer großen kalten Leere. Ich griff zu und aß ihn auf. Am Fenster klebten Fotos von Niko Papadopoulos und seiner Mutter oder einer älteren Freundin. Und auch eins mit ihm und Gustav. Wo war der überhaupt?
»Weißt du, wo Gustav ist?«, fragte ich den einen mit den Dreadlocks.
Er sah mich nicht an. »Oben«, nuschelte er gelangweilt. Ich bemerkte, dass er einen großen Pickel an der Nase hatte.
»Wo oben?«, fragte ich.
»Hmf«, grunzte er. Ihm schien sein Pickel jetzt auch aufgefallen zu sein, denn er fing an, ihn ausführlich zu untersuchen, und beachtete mich nicht mehr.
»Hey, ich hab dich was gefragt!«
Diesmal sah er zu mir hoch. »Auf dem Dach natürlich. Mann, nerv nicht!«, murmelte er. Irrsinnig sympathischer Typ.
»Danke!«, sagte ich, froh, diesen traurigen Ort wieder verlassen zu können. Als ich bereits an der Tür stand, drehte ich mich noch mal um. »Heißt du zufällig Malte?«, fragte ich ihn.
»Ja, wieso?«, fragte er, während er gerade eine Packung Russischbrot öffnete.
»Bist ’n Arschloch!«, sagte ich und zog die Tür hinter mir zu.
Ich irrte durch die Wohnung. Das schnell getrunkene Bier führte zu leichten Schwankungen. Ich ging versehentlich in ein falsches Zimmer und musste feststellen, dass Amy und die drei Spanier sowohl das Küssen als auch ihre Kleidung bereits hinter sich gelassen hatten.
»’tschuldigung!«, sagte ich und grinste.
Amy erklärte mir nun in aller Freundlichkeit, dass ich das Zimmer wieder verlassen solle, und ich machte schnell die Tür hinter mir zu. »Verpiss dich, du Wichser!«, schrie sie mir noch nach.
Endlich fand ich die Wohnungstür und ging nach oben. Durch eine Luke im Speicher gelangte ich aufs Dach. Als sich die Öffnung wieder schloss, war aus der lauten Musik von unten nur noch ein dumpfes Pochen geworden.
Nachdem ich einige Schritte auf dem Kies des Dachs gegangen war, entdeckte ich Gustav. Er, Niko Papadopoulos, ein langhaariges männliches Model namens Johnny und Burhan, ein türkischer Fotograf, den ich von früheren Partys her kannte, saßen auf Plastikstühlen und diskutierten lautstark.
Gustav kam auf mich zu. »Wo hast ’n so lange gesteckt?« Er schleifte mich zu den Stühlen. »Setz dich!«
Ich nickte.
Und wie wir so dasaßen und auf Berlin hinuntersahen, fühlte ich ein besonders starkes Gefühl der Nähe zu Gustav von Wertheim. Mir wurde klar, wie sehr ich ihn vermisst hatte, er war wie ein älterer Bruder für mich.
Ich musste an die Anfänge unserer Freundschaft zurückdenken. Als wir uns kennengelernt hatten, hatte ich ihn noch für einen dieser reichen, pseudolinken und überheblichen Hedonisten gehalten, die nur über ihre neuesten Ficks sprachen. Er hingegen hielt mich für einen sarkastischen, ständig rumjammernden Feigling, der sich nie seinen Problemen stellte.
Wir hatten natürlich beide recht.
»Jesp, du siehst echt aus wie eine Leiche«, sagte er nun in seiner gewohnt subtilen Art. »Die ganze Schreiberei hat dich total verkorkst … Ich meine, wann hattest du das letzte Mal Sex?«
»Sex?«, wiederholte ich. »Ist das nicht diese Sache, bei der zwei Menschen miteinander schlafen und ich am Ende immer gewinne und Erster werde?«
»Ich dachte eher an diese Sache, bei der zwei Menschen miteinander schlafen und du es schaffst, für drei Minuten nicht von deinem scheiß Buch zu reden.« Gustav trank einen Schluck Wodka. Ich sah wütend zu ihm hinüber. Er missverstand das und füllte mir auch ein Glas. Wir stießen an und tranken in einem Zug. Ich musste husten.
»Jedenfalls brauchst du endlich mal eine Freundin.« Er dachte nach. »Ich könnte dich Nia vorstellen, wenn du willst. Sie ist unten und steht auf Künstler.«
Der Rauch seiner Zigarette zog an mir vorbei.
»Nia? Ist das ’ne Freundin von dir?« Eine überflüssige Frage. Die halbe Stadt war mit ihm befreundet.
»Ja, sie studiert Mode und ist wirklich klug, auch ziemlich hübsch. Ich glaube, sie würde dir gefallen.«
»Vielleicht, mal schauen«, sagte ich nur. Ich war mir zwar sicher, dass ich diese Nia interessant gefunden hätte, aber es gefiel Gustav einfach zu sehr, seine Umwelt zu manipulieren. Er hatte manchmal etwas Selbstgefälliges und Berechnendes. Außerdem dachte ich lieber an Miriam von der Uni und quälte mich mit einer Endlosschleife ihres Lächelns.
Ich beobachtete die Menschen, die unten auf der Straße