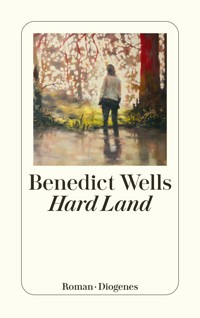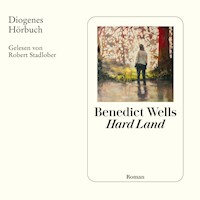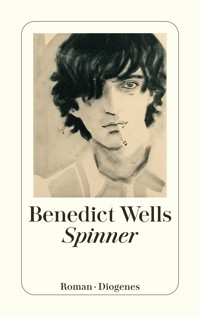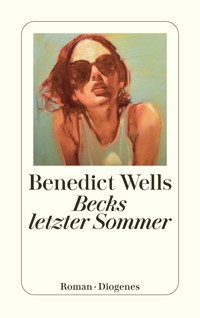22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Buch wie eine persönliche Begegnung. Benedict Wells erzählt von der Faszination des Schreibens und gibt einen tiefen Einblick in sein Leben, von seiner Kindheit bis zu seinen ersten Veröffentlichungen. Anhand eigener und anderer Werke zeigt er anschaulich, wie ein Roman entsteht, was fesselnde Geschichten ausmacht und wie man mit Rückschlägen umgeht. Ein berührendes, lebenskluges und humorvolles Buch – für alle, die Literatur lieben oder selbst schreiben wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Benedict Wells
Die Geschichten in uns
Vom Schreiben und vom Leben
Diogenes
Für meinen Vater, den Geschichtenerzähler
»Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.«
Ludwig Wittgenstein
Vorwort
Dieses Buch ist der gescheiterte Versuch, erst mal kein Buch mehr zu schreiben. Nach zwanzig Jahren, in denen ich durchgehend an Geschichten gearbeitet hatte, sehnte ich mich nach einer Veränderung. »Life moves pretty fast«, sagt der Philosoph Ferris Bueller. »If you don’t stop and look around once in a while, you could miss it.« Statt weiter von einem Roman zum nächsten zu eilen, wollte ich mir eine Auszeit vom Schreiben nehmen, um mein Leben zu reflektieren und etwas Neues auszuprobieren. Ich arbeitete an ein paar Projekten und beschloss, daneben zu studieren; als Autor wollte ich nur weitermachen, wenn ich es vermisste.
Zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben schrieb ich monatelang gar keine Zeile – bis ich als Gastdozent ein Seminar zum Thema »Das Überarbeiten eines Romans« hielt und einen sehr begabten Kurs erwischte. Unsere Diskussionen über das Schreiben beschäftigten mich nachhaltig, durch die Einwürfe der Studierenden begriff ich auf eine tiefere Weise als bisher, wie unterschiedlich man an einen Text herangehen kann.
Im Herbst darauf folgte eine Tour zu meinem Roman Hard Land, auf der mir wie immer viele allgemeine Fragen zum Schreibprozess gestellt wurden, aber auch, wieso meine Figuren sich in manchem ähneln oder warum ich mich so oft an Themen wie Verlust und Einsamkeit abarbeite. Dieser Austausch machte Spaß, er zwang mich allerdings auch, mir Gedanken über Entscheidungen zu machen, die ich intuitiv getroffen hatte. In der Regel führe ich keinen Dialog mit meinem Unterbewusstsein, wieso eine Figur sich auf eine bestimmte Weise verhält oder warum ich mich überhaupt für eine Geschichte interessiere. Schreiben ist etwas anderes, als über das Schreiben zu reden.
Da die Lesetouren während der Coronapandemie begrenzt waren, wollte ich auf meiner Homepage ein Best-of dieser Gedanken für Leser:innen zusammenstellen, die nicht dabei sein konnten. Es sollte ein letzter Werkstattbericht werden und auch ein vorläufiger Schlussstrich. So weit der Plan. Ich wollte bei der Arbeit an diesem Text nur kurz raus, Zigaretten holen – stattdessen begann eine jahrelange literarische Reise.
Wer sich schon am Schreiben eines Buchs versucht hat, kennt vielleicht dieses seltene Glück: Man durchstöbert auf der Suche nach Worten sein Inneres und stößt unverhofft auf eine Quelle. So ging es mir, die Gedanken und Sätze kamen mir fast mühelos. Nachts im Bett hatte ich immer weitere Ideen, die ich im Halbschlaf heruntertippte, bald sprengte der Text jedes Format, selbst für die Homepage. Nach einer Woche hatte ich hundert Seiten, nach drei Wochen dreihundert. In den Jahren danach fing ich zwar ein Studium an und schrieb wie geplant nichts Belletristisches – doch ich arbeitete nebenher an diesem Buch.
Zum ersten Mal überlegte ich, wie ein Roman bei mir und eventuell auch bei anderen entsteht, von der ersten Idee bis zur endgültigen Umsetzung. Welche Prozesse dabei ablaufen und wieso es für mich stets aufs Neue so schwierig ist, eine Geschichte flüssig zu erzählen und Fehler zu vermeiden. Welche Erzählperspektive passt zu welchem Roman, was macht eine gute Figur aus, warum sind Schnitte so wichtig, welchen Ton wählt man für die Sprache?
Im Uniseminar hatte es Fragen gegeben, bei denen ich ins Schwimmen geraten war, nun wollte ich die Werkzeuge zusammenstellen, die mir beim Schreiben oft geholfen haben – und von denen ich einige anderen Autor:innen verdanke.
Wann immer ich in den letzten Jahren nach Tipps für das Schreiben gefragt wurde, habe ich ein Buch empfohlen: Stephen Kings On Writing. Die Bibel für alle, die damit anfangen. Mich hat es gerettet, denn es ist auf gleich zweifache Weise ermutigend.
So erzählt King zunächst sein Leben nach, launig und auch derb. Ein fantasievoller Junge aus schwierigen Verhältnissen, der gern Geschichten erfindet; am liebsten Horror und Science-Fiction. Der später seine Storys bei Verlagen einreicht und Absagen bekommt. Viele Absagen. Die schönsten davon hebt er auf und hängt sie an einen Nagel über seinem Schreibtisch, bis es so viele werden, dass er ihn durch einen Haken ersetzen muss. Da lebt King bereits mit seiner Frau und dem gemeinsamen Baby in einem ärmlichen Trailer. Doch er denkt nicht ans Aufgeben, macht weiter – und wird irgendwann belohnt.
Diese Geschichte hat mich mit Anfang zwanzig sehr getröstet. Ich hängte meine Absagen zwar nicht an einen Nagel, aber es waren ebenfalls viele, und nach jeder einzelnen kam ich mir vor wie ein Versager. Von jemandem, der später eine halbe Milliarde Bücher verkauft hat, zu hören, dass es ihm ähnlich ergangen war, baute mich als jungen Autor auf.
Aber vor allem war Kings Buch eine Offenbarung, weil er darin mit vielen Beispielen seinen Arbeitsprozess veranschaulicht und ich daraus lernen konnte. Dabei bin ich nicht mal ein Leser seiner Romane, weil ich keine Horrorgeschichten mag (okay, weil ich mich vor ihnen fürchte). Doch egal, wie man zu seinen Werken steht: King weiß offensichtlich, wie man eine Geschichte anfängt, weitererzählt und beendet, wie man mit Krisen umgeht, nicht aufgibt und einen Text redigiert. Im Gegensatz zu manchen Ratgebern haftet seinem Buch nichts Manieriertes an. Dafür gibt es viele praktische Ratschläge, die Schreibanfänger:innen den Tag retten können und auch später hilfreich sind. Dieser unverstellte Einblick in seine Werkstatt hat mich inspiriert – nicht zuletzt für das Buch, das Sie gerade in der Hand halten.
Ich habe Geschichten erfunden, weil ich meine eigene lange nicht erzählen konnte. Stattdessen habe ich über vieles in meinem Leben geschwiegen, weil es privat war und ich andere Menschen schützen wollte, mich auch schämte. Doch da mein Aufwachsen stark mit meinen Texten verflochten ist, möchte ich es im biografischen ersten Teil zumindest kurz nachzeichnen: mit den Menschen, die mich unterstützten, mit den Büchern, die mich prägten, mit manchen Rückschlägen. Es gibt Tausende »Wege zum Schreiben«, dieser war meiner.
Genauso werden Sie gleich jemandem begegnen, der als Autor lange nicht wusste, was er tat. Der mit seinen Romanen immer wieder scheiterte oder abgelehnt wurde, schließlich Glück hatte und einen Verlag fand, aber auch danach mit seinen Büchern ins Straucheln kam. Ein Grund, wieso ich davon erzähle, ist, dass ich an der Vorstellung von Autor:innen als Genies im stillen Kämmerchen rütteln möchte. Denn es ist dieses falsche Bild, das viele Menschen davor zurückschrecken lässt, es überhaupt mit dem Schreiben zu versuchen.
Mit welchen Mitteln ich versucht habe, meine gescheiterten Fassungen zu verbessern, und was ich dabei lernte, davon handelt dann der zweite Teil des Buchs, »Über das Schreiben«. Dort geht es um das Handwerk und die Entstehung eines Romans, um Werkzeuge zum Überarbeiten und technische Fragen. Es ist bewusst keine Poetikvorlesung, sondern ein möglichst ehrlicher Blick in die Schreibwerkstatt – und am Ende auf noch unfertige Texte.
Eine alte Frage lautet: Wenn in einem Wald ein Baum umfällt und niemand da ist, der es hört, gibt es dann ein Geräusch? Genauso könnte es heißen: Wenn ich keine Worte für meine tieferen Gefühle habe, empfinde ich sie überhaupt? Weiß ich dann wirklich, wer ich bin, oder bleibe ich mir am Ende ein Schatten? Diese Fragen stelle ich mir seit der Jugend, als mir jahrelang die Worte fehlten. Dass ich sie mir stellte, weiß ich aber erst, seit ich es ausdrücken kann.
Ich wurde einmal gefragt, wieso ich schreibe, und ich habe gesagt, weil ich schief zur Welt stehe. Ich sei nicht ganz mit ihr im Einklang und würde versuchen, diesen Bruch oder mich selbst zu korrigieren. So ein Satz klingt stimmig, ist aber noch immer nicht die Antwort. Denn Erzählen, ob mündlich oder schriftlich, holt uns vielmehr erst in die Welt. Es macht uns greifbar und gibt uns die Möglichkeit, das Erlebte zu teilen. Ich glaube an die »Unschärferelation« in der Literatur: dass Texte sich allein dadurch verändern, dass andere Menschen darauf geblickt haben, obwohl die Worte selbst gleich geblieben sind. Im besten Fall fühlt man sich in der Geschichte von anderen verstanden, so wie diese sich umgekehrt von einem gesehen fühlen. Wir reden von uns und meinen die anderen, wir sehen die anderen und erkennen uns selbst.
Dieses Buch ist eine Einladung zu allem, was mich beim Erzählen von Geschichten fasziniert. Da mich das Schreiben nie aus der Rolle des Schülers entlässt, mache ich auch nach zwanzig Jahren noch viele Fehler und lerne dazu, meist von Autor:innen, die mir talentierter erscheinen als ich. Und so ist dieser Text zugleich mein Echo auf die Werke und klugen Fragen und Gedanken von anderen. Wie bei einem Rundlauf im Tischtennis sprang mir der Ball nun unverhofft entgegen. Dies ist mein Return, und während Sie ihn lesen, bin ich bereits wie Stephen King und viele andere vor mir weitergerannt.
Und wer weiß, vielleicht landet der Ball eines Tages bei Ihnen.
TEIL IDer Weg zum Schreiben
WARUM MAN ANFÄNGT
Es ist das erste Mal, dass ich als Autor an diese Orte zurückkehre. Etwa in das alte Kinderzimmer in München, Ende der Achtzigerjahre. Durch den milchigen Schleier der Erinnerung betrachte ich den Fünfjährigen, der im Stockbett unten schläft. Haare zerzaust, Mund offen, so vieles, was er nicht weiß. Die Welt noch ein winziger Ort, sie reicht vom Hof bis zum Kindergarten, dann franst sie bereits aus. Nächstes Jahr wird er nach der Trennung der Eltern in die Schweiz ziehen, aber nur für wenige Monate. Danach wird er wieder in diesem Bett liegen, zumindest in den Ferien.
Es ist früh am Morgen, das erste Licht der Dämmerung fällt durch das Fenster und bildet in der Mitte des Zimmers ein geheimnisvolles Quadrat. Noch ist es schwach, aber in wenigen Minuten wird es anfangen zu leuchten. Der Fünfjährige hat es geliebt, davon aufzuwachen, doch sonst weiß ich nicht viel über ihn. Er hat mir wenige präzise Erinnerungen hinterlassen, diese ist eine davon: Sanft vom Licht geweckt werden, ein paarmal blinzeln, dann in ein Gefühl von Zuversicht steigen wie in ein Paar warme Hausschuhe …
Aber ich bin hier, weil ich etwas Bestimmtes suche. Gehe an vielen Orten meiner Kindheit und Jugend schnell vorbei, noch immer ein Flüchtling vor der Vergangenheit. Ich möchte für dieses Buch vor allem das mitnehmen, was mir wichtig für mein Schreiben scheint.
Eine Weile blättere ich in den Kinderbüchern im Regal – ein Wiedersehen mit alten Märchen und der Elefantenstadt von König Babar und Celeste –, dann doch wieder ein verstohlener Blick auf den schlafenden Jungen. Er wirkt so winzig. An dem Chaos, das bald zu Hause ausbricht, wird er sich die Schuld geben und glauben, funktionieren zu müssen. Wird nicht auch noch Probleme machen wollen und auf Rückfragen stets mit »schon okay« antworten. Andere haben es schwerer, was sollen die erst sagen? Ein Kind, das im Grunde nicht stattfindet; ein Neverboy, der nur seine Fehler sieht und niemanden mit der eigenen Geschichte behelligen möchte. Der später Romanfiguren als Masken benutzen und seine Gefühle hinter ihren Gefühlen verstecken wird.
Und dennoch muss ich diesen Jungen nun gegen seinen Willen in dieses Buch schubsen, selbst wenn das bedeutet, dass er seine Eltern, seine Schwester und ein paar private Dinge mit hineinreißen wird. Ohne ihn und sein Aufwachsen kann ich nicht von meinem Schreiben erzählen. Es werden nur kurze Bleistiftskizzen, kein farbiges Bild, keine Autobiografie. Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch immer keine Sprache für den Jungen, nur einen distanzierten Ton.
Fast, als wäre er jemand anderes.
Dann sehe ich das Stofftier, das unter seinem Arm klemmt, und greife danach. Fünfunddreißig Jahre später ist es noch immer in meinem Besitz: ein Schneetiger, verschrumpelt und angegraut. Ungläubig sehe ich, wie strahlend weiß er hier noch ist. Ich lege ihn zurück und muss lächeln, dann ziehe ich weiter.
Am nächsten Ort werde ich fündig; das nächtliche Bad eines Heims. Der Junge, er muss jetzt sechs oder sieben Jahre alt sein, blättert im grellen Schein der Deckenlampe durch ein Buch. Pu der Bär von A.A. Milne, die erste Geschichte, die er selbst liest. Eine Weile beobachte ich ihn in seinem Pyjama, dann steigt mir ein vergessener Geruch in die Nase: der Essigreiniger, mit dem die Toiletten des Internats geputzt wurden. Seltsam, wie vertraut er wieder ist.
Ich erinnere mich nun auch an die beklommene Stimmung bei manchen Abendessen. Draußen Dunkelheit, auf dem Tisch Graubrot, Butter, Aufstrich, dazu Tee und Milch in Kannen. Wir sitzen zu sechst am Tisch, ein Freund macht einen Witz über einen Erzieher, lautes Gelächter. Ich lache mit und wirke gelöst, doch woher dann dieses sanfte Ziehen im Magen, das die Szene stört?
Geschützt von der Zeit, die zwischen mir und dem Jungen liegt, gehe ich dem Gefühl nach. Sehe ihn lächeln, sehe aber auch die Angst, die darunter liegt. Das Heimweh und das Suchen im immer etwas zu flüchtigen Blick.
Die Bilder in seinem Kopf.
Es ist die Stimmung dieser Abende, die später wie ein Tintenfass neben mir steht, wenn ich Geschichten erzähle.
Nach der Trennung meiner Eltern war meine Mutter mit mir in ihre Schweizer Heimat gezogen. Als ich sechs Jahre alt war, erlebte ich mit, wie ihre manische Depression ausbrach. Normalerweise war unser Verhältnis innig, nun verbrannte sie im Wahn mein Spielzeug oder drohte mir Gewalt an, etwa, mir die Schulter auszukugeln. Sie setzte ihre Schlaftabletten ab und sprach ständig davon, dass sie sterben würde, was ich ihr ebenso oft auszureden versuchte. Ich war monatelang allein mit ihr, bis sie nach einem Zusammenbruch in die Psychiatrie eingeliefert wurde. Danach kam ich erst zu einem Onkel, dann zu meinem Vater, der damals in die Insolvenz abrutschte, sodass nie sicher war, ob wir die Miete bezahlen konnten oder aus der Wohnung fliegen würden. Da er rund um die Uhr arbeiten musste, landete ich schließlich in einem staatlich-katholischen Grundschulheim in Bayern. Es wurde mir ein Zuhause und bot vor allem Stabilität.
Ich war nun umgeben von Kindern, die alle ihre eigenen Gründe hatten, wieso sie nicht daheim wohnten. Manche waren Waisen oder vor einem Krieg geflohen, während die Verwandten zurückbleiben mussten, andere hatten gewalttätige Alkoholikerväter oder sonstige familiäre Probleme. Die Seile und Auffangnetze waren gerissen, dies war der Boden, doch ohne Eltern aufzuwachsen brachte uns einander nahe. Wir prügelten und versöhnten uns wie Geschwister und schipperten im selben wackligen Boot durch die Kindheit. Über unsere wahren Gefühle oder warum wir hier waren redeten wir nie, weil es uns gar nicht in den Sinn kam. Man sah, wie manche von uns mit Mitarbeitern vom Jugendamt Spielsachen kaufen durften, weil sie nichts hatten, man entdeckte nach den Ferien die blauen Flecken des Jungen neben sich und dachte sich seinen Teil, aber man sprach ihn nie darauf an. Das eher kärgliche Heim war für uns eine Zauberwelt, an deren Schwelle alles von zu Hause vergessen war. Egal, welche Dramen dort wieder passiert waren; auf die Frage, wie es war, sagten wir nur »gut« oder erzählten uns fantastische Lügenmärchen von der Villa mit Pool, in der wir alle angeblich lebten.
Während meine Mitschüler im Schlafsaal gegen neun Uhr einschliefen, blieb ich oft noch stundenlang allein wach. Ich hörte die Kirchturmuhr neben dem Heim schlagen – Viertel nach, halb, Viertel vor oder das gefürchtete lange Geläute um Mitternacht – und lauschte dem gleichmäßigen Atmen der anderen. Manchmal geisterte ich nachts durch die schwach beleuchteten Gänge. Solange unsere Erzieherin noch wach war, fühlte ich mich sicher. »Geh ins Bett«, sagte sie liebevoll, wenn sie mich auf ihrem Rundgang entdeckte.
Trost spendeten mir die Bücher, die ich in diesen Nachtstunden auf der Toilette las. Ich liebte Paul Maars Lippels Traum und William Goldmans Die Brautprinzessin (auch wenn ich den ironischen Schatz darin erst Jahre später heben konnte) und fühlte mich von Astrid Lindgren verstanden, speziell von ihren düstereren Werken wie Die Brüder Löwenherz und Mio, mein Mio, während ich mit ihren Heile-Welt-Geschichten aus Bullerbü wenig anfangen konnte.
Meine Mutter und mein Vater schienen damals kaum greifbar und weit weg. Sie hatten spät Kinder bekommen: meine Schwester mit Mitte dreißig und mich mit über vierzig. Ihre Beziehung war kurz nach meiner Geburt zerbrochen. Manche Trennungskinder sehnen sich danach, dass die Eltern wieder zusammenkommen, ich fragte mich eher, wie sie es nur so lange miteinander ausgehalten hatten. Außer früh erlittener Verletzungen und ihrer Faszination für China und Taiwan schienen sie wenig gemein zu haben.
Meine Mutter war abseits ihrer Krankheit eine unverwüstlich fröhliche, kluge und sehr eigenwillige Schweizerin, die fünf Sprachen sprach und eine unverlierbare Freude an kleinen Dingen hatte. Sie hatte sich nach Verlässlichkeit gesehnt, mein Vater war das Gegenteil davon: ein charmanter und gebildeter Geistesmensch, aber auch ein chaotischer Spielertyp, der sich von überallher Geld lieh, unangenehme Briefe ungeöffnet ließ und Probleme verdrängte oder mit Humor nahm. Nach dem Erfolg der gemeinsamen Übersetzung von Pu Yis Ich war Kaiser von China hatte er eine Sinologie-Professur ausgeschlagen, um stattdessen eine Firma zu gründen. Offiziell ein Dienstleistungsunternehmen für den asiatischen Markt, war sie in Wahrheit ein Vehikel für berufliche Träume aller Art. Noch in den Neunzigern, als die Firma vor der Pleite stand und die Gläubiger sich mehrten, erzählte mein Vater mir unbeschwert von immer neuen Plänen, mit denen wir bald doch noch reich würden; allerdings stellten sie sich stets als so fantastisch heraus wie meine eigenen Märchengeschichten von der Villa mit Pool.[1] Im Grunde waren er und meine Mutter die ersten Romanfiguren in meinem Leben, und als ich später Schloss aus Glas von Jeannette Walls über ihre Eltern und ihr turbulentes Aufwachsen las, fühlte ich mich darin auf eine tiefe Weise verstanden.
Zugleich schimmerte immer wieder das Glück hervor. Vielleicht hatte ich kein richtiges Zuhause, aber ein emotionales, als Hort für Tagträumereien und Heimweh. Kostbar die Ferien, wenn es meiner Mutter besser ging und ich sie besuchen durfte, sie meine Lieblingsgerichte kochte, mich umsorgte und für einen Moment alles normal schien. Oder wenn mein Vater – als Alleinerziehender überfordert, aber auf geniale Weise unorthodox – mit mir nachts die Simpsons schaute und uns beiden dazu Kakao machte. Bei ihm zu wohnen war wie in einer chaotischen Studenten-WG zu leben: Teller wurden nicht abgespült, Zimmer nicht aufgeräumt, Regeln spielten keine Rolle. Dafür gab es immer etwas zu lachen und inspirierende Gespräche. Vor allem versorgten mich meine Eltern mit Literatur. Meine Mutter las mir vor, ließ mich aber auch selbst vorlesen, was ich gern mit verstellten Stimmen tat. Mein Vater erzählte mir Geschichten und sorgte dafür, dass stets genug Bücher um mich herum waren.
Ihre Liebe trotz aller Probleme und der Zugang zu Literatur gehören zu den größten Privilegien meines Lebens. Ich verstand früh, dass Lesen einen in manchen Momenten retten kann. Dieses Gefühl trage ich noch immer in mir.
Eher beiläufig schrieb ich mit sieben Jahren selbst eine Geschichte: über das bewegte Aufwachsen dreier Katzengeschwister. (Wenn man fies wäre, könnte man sagen, dass das schon die Handlung von Vom Ende der Einsamkeit war). Mit acht verkündete ich, dass ich ein Buch zur amerikanischen Serie Das A-Team schreiben wolle. Mein Vater bot direkt an, es mir für ein paar Mark abzukaufen. Begeistert machte ich mich an die Arbeit. Ich schrieb Dialogsätze wie »Kalifornien, die Stadt meiner Träume!«, dachte mir einen Plot um eine Entführung aus, klebte die einzelnen Seiten mit Tesafilm zusammen und gab alles stolz meinem Vater. Es sollte das letzte Mal für lange Zeit sein, dass ich mit einem Text Geld verdiente.
Jetzt könnte man sagen: Das Schreiben war bei diesem Menschen früh angelegt, kein Wunder, dass er später diesen Beruf ergriff. Aber das wäre eine nachträgliche Umdeutung in Kitsch. Denn mit acht wollte ich auch Basketballspieler werden, bis ich bei einem Spiel herausfand, dass ich trotz monatelangem Einzeltraining leider der Schlechteste war, der Kleinste sowieso. Mit neun war mein Berufswunsch Architekt. Damals zeichnete ich oft Skizzen für Häuser, später verschwendete ich nie wieder einen Gedanken daran. Und mit vierzehn interessierte ich mich für gar nichts mehr. Der Horizont war nicht mehr auf die Zukunft geweitet, sondern verengt auf quälende Pubertätsängste und Matheprüfungen.
Die Frage ist für mich nicht, wieso ich mit dem Schreiben anfing, sondern wieso es das einzige von unzähligen kindlichen Hobbys war, zu dem ich als Erwachsener zurückkehrte.
Auf dem Gymnasium schrieb ich bis auf ein Tagebuch jahrelang nichts mehr und las kaum noch. Während ich als Kind draufloserzählt hatte, klar und direkt, versuchte ich nun meine Lehrer:innen zu beeindrucken und kleisterte meine Texte mit pseudokomplexen Sätzen zu. Argwöhnisch wachte ich über Fremdwörter wie »distinguiert« und »utilitaristisch«, die in keinem Aufsatz fehlen durften, und als Stephen King schrieb, man solle nicht »Vergütung« verwenden, wenn auch »Trinkgeld« gehe, meinte er mich.
Da mein zweites Internat ein Fiasko war – ich erhielt nach der Grundschule ein Stipendium für eine private Einrichtung, wurde in dieser elitären Umgebung aber todunglücklich und fing an, schlechte Noten zu schreiben –, wechselte ich schnell die Schule. Diesmal verschlug es mich ins Allgäu: ein staatliches Heim, zwei schlichte graue Gebäudekästen, in denen rund achtzig Kinder und Jugendliche untergebracht waren, daneben die Mensa und das Gymnasium, auf das wir tagsüber mit Hunderten von Externen gingen. Wieder ein neues Zimmer, in dem ich meine paar Sachen verstaute und den Stoffschneetiger unters Kopfkissen legte. Ein weiterer Punkt im Koordinatensystem des Aufwachsens.
Als Teenager war ich ein unsicherer, schüchterner Spätzünder, der das durch eine große Klappe zu kaschieren versuchte – in den Pubertätsjahren im Heim nicht unwichtig. Ein rauer Wind konnte durch diesen elternlosen Ort wehen. Unsere »wunderbaren Jahre« verbrachten wir Tag und Nacht miteinander, auf engstem Raum; man steckte ein, teilte aus und machte den fiesesten Spruch über sich selbst, bevor es jemand anderes tun konnte. Zugleich wurde aus den Freunden aus Mexiko, Bayern und Litauen eine Ersatzfamilie, gab es Nähe und Solidarität. Wir waren albern und ernst, grausam und liebevoll, gelangweilt und wach. Jede Woche konnte nichts und alles passieren, und dazwischen wurden wir ohne es zu bemerken groß.
Oft gingen wir zum See, ich redete und lachte mit meinen Freunden, doch so scharf umrissen mir ihre Persönlichkeiten vorkamen, so wenig hatte ich ein Gefühl dafür, wer ich selbst war. Beziehungsstatus für die nächsten Jahre: unglücklich verliebt. In einem Paralleluniversum hätte ich mich vielleicht in einen schwarzgewandeten, androgynen New-Wave-Goth verwandelt, der The Cure hörte, nonstop rauchte und sein Schweigen nur durch erratische Einzeiler brach. In dieser Welt ging mit der Verpuppung etwas schief. Ich lief zwar tatsächlich in schwarzen Mänteln herum, war ansonsten aber ein kindisch-lärmender, nichtrauchender Fußballfan, der jahrelang wie zwölf aussah und heimlich Robbie Williams hörte. Wie bei den Bildern, bei denen einer die Beine, eine den Oberkörper und die Dritte den Kopf malt, passte bei mir nichts zusammen. Wenigstens fiel es nicht groß auf, da in den Neunzigerjahren auf dem Land ohnehin wenig zusammenzupassen schien.
Mein einziger Coolness-Navigator durch die Pubertät war meine ältere Schwester, die jedoch ihre eigenen Verletzungen abbekommen hatte: Da sie bei der Trennung unserer Eltern schon zur Schule ging, hatte unsere Mutter in ihrem angeschlagenen Zustand nur mich in die Schweiz mitgenommen, sie blieb zurück. Ein Riss zwischen uns, den wir jahrelang nicht kitten konnten. Auch meine Schwester suchte Zuflucht bei Büchern, las als Teenagerin alles, sogar Hegel und Kierkegaard. Während ich mich in mich selbst zurückzog, betäubte sie ihren Schmerz mit Drogen und hüllte sich in einen Panzer aus Glamour und Unnahbarkeit. Sie flog aus zwei Internaten (einmal wegen »Subversion« und »Blasphemie«, was so wohl nur in Bayern möglich war) und starb mit vierzehn fast bei einem Unfall, als sie nachts zu Fuß high über die Autobahn geisterte und angefahren wurde. Ich erfuhr es Tage später, und erst Jahre danach, dass sie damals niemand in der Klinik besucht hatte.
Es gab heiß ersehnte Gespräche, in denen wir uns nahekamen, immer wieder stand sie in entscheidenden Momenten plötzlich neben mir und hielt meine Hand. Aber uns trennten sechs Jahre und damit Welten, und als ich älter war und endlich richtig mit ihr hätte reden können, studierte sie bereits Philosophie in Berlin. In den Stürmen unserer Kindheit und Jugend hatten wir uns aus den Augen verloren.
Lange wusste ich nicht, was ich später machen wollte. Ich war im Fußball nicht talentiert genug, interessierte mich für wenig sonst, auch der Weg zu meiner frühen Liebe Literatur schien versperrt. O-Ton eines Lehrers in der elften Klasse, als ich bei ihm in Deutsch wieder auf einer Vier stand: »Äh, Benedict, haben S’ nix anderes, was Sie als Leistungskurs nehmen können?«
Davon abgesehen war die Konkurrenz einschüchternd. Eine Mitschülerin hörte Bob Dylan, hatte ihr Haar geschoren wie Sinéad O’Connor, las zehnmal mehr als ich und schrieb brillante Essays, für die sie Einser bekam. Offensichtlich verfügte sie über die Worte, die mir damals fehlten.
Denn in Wahrheit war mein Problem fundamentaler: Meine äußere Stimme war auf maximale Lautstärke gedreht, die innere nicht mal an (schon auf die simple Frage »Wie geht’s dir?« hätte ich hundert Antworten geben können, alle wären falsch gewesen). Ich redete viel, hatte aber jahrelang keine Sprache für meine wirklichen Gefühle. Etwa für die Überforderung, mich seit der Kindheit um vieles kümmern zu müssen und ständig Angst um geliebte Menschen zu haben.
Ich hatte auch keine Worte für die Einsamkeit in Gesellschaft anderer, die ich in den dreizehn Jahren im Heim entwickelte. Für die Kluft zwischen dem begüterten Zuhause, das viele Außenstehende bei mir aufgrund meiner Herkunft annahmen, und der Realität mit Psychiatrien, Drogen, leerem Kühlschrank und Verwahrlosung. Für die Scham, wenn ich in den Ferien mal wieder den Gerichtsvollzieher, den ich öfter sah als die meisten Verwandten, durch unsere sagenhaft vermüllte Wohnung führte. Wie ich durch seine Augen begriff, dass wir statt in Betten nur auf versifften Matratzen am Boden schliefen, während er bei all dem Gerümpel nie etwas zum Pfänden fand (meine Sorge galt jedes Mal dem uralten Riesenfernseher).
Keine Sätze für die damals beginnende Auseinandersetzung mit den schrecklichen Taten und Worten meiner deutschen Familie während der NS-Zeit, die später zu meiner Namensänderung von »von Schirach« zu »Wells« führte – und zu einer lebenslangen Abgrenzung.[2] Für die Wut und Scham, die ich angesichts meiner Vorfahren empfand, wie auch für die Trauer und das Mitgefühl mit den Opfern. Und für die Verantwortung und den Willen, mich entschlossen gegen Antisemitismus und Rassismus einzusetzen.
Keine Begriffe dafür, dass ich meine Mutter über anderthalb Jahre gar nicht gesehen hatte – und für den Wahnsinn, dass sie plötzlich wieder aus der Schweiz zurückkehrte und bei uns einzog. Weil sie sich aufgrund ihrer psychischen Krankheit verfolgt fühlte und zugleich unsere Mietschulden in München begleichen konnte. Sie und mein Vater blieben getrennt, bildeten aber jahrelang eine bizarre Wohngemeinschaft (die Frage, wer exzentrischer war, konnte sich je nach Schulden- oder Medikamentenlage ändern). Als wären uns Betten verboten gewesen, schlief auch meine Mutter auf einer Matratze neben der Wohnzimmerheizung.
Keine Stimme für die schönen Momente und die Wärme und Geborgenheit, die es zu Hause genauso geben konnte, weshalb ich nie mit jemandem hätte tauschen wollen. Für die Liebe, an der ich mich festhielt, und die Sehnsucht, auszubrechen und mein Leben selbst zu bestimmen.
Es war alles ein Chaos, nichts passte zusammen, und nichts davon konnte ich artikulieren, eine auf stumm geschaltete Seele. Jahrelang trieb ich in meiner eigenen Wortlosigkeit und hatte keine Ahnung, ob ich mich dabei auf das Ufer zubewegte oder mich von ihm entfernte.
Der literarische Held meiner Jugend war Peter Parker. Wenn mir zu Hause alles über den Kopf wuchs, las ich Spider-Man-Comics. Mit dem Teenager, der sich um seine Tante kümmerte und linkisch von einem Problem zum nächsten hangelte, konnte ich mich identifizieren. Und insgeheim waren später viele meiner Romane in ihrem Wesen »Peter-Parker-Geschichten«.
Meine damalige Vorstellung von Literatur war von den deutschsprachigen Werken geprägt, die wir im Unterricht lesen mussten. Deren ausnahmslos männliche Verfasser mit ihren Tweedsakkos, kantigen Brillen und Pfeifen wie Schauspieler wirkten, die Schriftsteller spielten, und deren Texte ich – bis auf Ulrich Plenzdorf – sperrig oder gekünstelt fand. So erwartete ich auch nicht viel von diesem Buch, das monatelang in meinem Regal stand.
Leider weiß ich nicht mehr genau, wie ich an Das Hotel New Hampshire von John Irving kam. Ob es mir eine Freundin meines Vaters schenkte, er selbst oder – am wahrscheinlichsten – meine Schwester. Ich weiß nur, dass es lange ungelesen in meinem Internatszimmer vor sich hin staubte. Wobei ich zugeben musste, dass der Klappentext um Ringer, Hunde mit Flatulenz, Hotels mit Huren und Anarchisten, Gewichtheber und Freud lustig klang. Trotzdem: Hätte ich damals bereits Internet oder ein Handy gehabt, hätte ich keine Zeile gelesen. So aber schlug ich eines langweiligen Nachmittags das Buch auf, machte mich auf den Weg ins ferne New Hampshire – und kehrte verwandelt zurück.
Irvings Wunderroman zeigte mir, dass Literatur nicht nur das war, was in diesem grauen, vom Mief der alten Bundesrepublik durchzogenen Klassenzimmer unterrichtet und analysiert wurde. Sondern eine ganze Welt voller Tragik, Humor, großartiger Figuren und virtuos erzählten (aus heutiger Sicht erstaunlich progressiven) Geschichten. Ich meine es todernst: Kein Mensch kann von einem Buch mehr umgehauen worden sein als ich mit fünfzehn von Das Hotel New Hampshire. Ich las es wie früher nachts auf der Toilette, tagsüber auf dem Sportplatz, beim Essen in der Mensa und manchmal auch im Unterricht. Ich bekam sogar eine Strafe, weil ich bei einer Szene – als der ausgestopfte Hund Kummer aus dem Schrank springt – so sehr lachen musste, dass der Lehrer es mitbekam.
Durfte man wirklich so schreiben? Offenbar war die Antwort kein schüchternes Nicken, sondern ein irritierend klares, lautes, befreiendes: Ja! Ich las daraufhin alle weiteren Bücher von Irving und dann noch mal und noch mal. Wenn das auch Literatur ist, dachte ich, dieses tiefe und berührende, dieses witzige und überbordende Erzählen: Dann kann ich mir vorstellen, selbst zu schreiben …
»Da geht’s um einen Jungen im Internat, und an einer Stelle wichsen alle auf einen Keks.« So oder so ähnlich erfuhr ich – einige Zeit nach dem Erweckungserlebnis mit Irving – auf dem Pausenhof von Crazy von Benjamin Lebert. Ein Autor, mit dem es eine für mich schreckliche Bewandtnis hatte: Er war nur zwei Jahre älter als ich! Doch während ich im Unterricht meine verquasten Aufsätze auf die Lehrer losließ, hatte er als Jugendlicher mal eben seinen ersten Roman veröffentlicht.
Ich besorgte mir Crazy sofort, und obwohl ich es damals nicht zugegeben hätte, war ich beeindruckt. Bis dahin wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man mit siebzehn schon ein Buch veröffentlichen kann. Und dann auch noch über ein Internat und mit einem jugendlichen Außenseiter als Helden.
Das gefiel mir. Ebenso, dass Lebert durch seinen Erfolg der Schule den Mittelfinger zeigen konnte und sie kurz darauf abbrach. Ich stellte mir nach missratenen Klassenarbeiten Ähnliches vor. »Tut mir leid«, würde ich zu meinem Mathelehrer sagen, »ich kann morgen nicht zur Prüfung … Warum? Da habe ich eine Lesung in Frankfurt. Ach, und bevor ich’s vergesse: Ich komm auch nicht wieder. Adiós!« Dann Abgang mitten in der Stunde, den Rucksack geschultert, verfolgt von den staunenden Blicken der Klasse …
Noch am Abend setzte ich mich an den Heimcomputer und schrieb die ersten Kapitel einer möglichen Geschichte. Es spielt keine Rolle, dass das alles nur eine peinliche Pubertätsvorstellung war. Oder dass dieser mit sechzehn geschriebene Text jeder Beschreibung spottet. Viel wichtiger war, dass ein kurz zuvor noch perspektivloser Teenager mit Begeisterung irgendetwas machte.
Damals wusste ich nicht, wie ich mein Schreiben – wie es die Autorin Deborah Levy nennt – »auf die Welt bringen konnte«, war aber überrascht, wie viel Wut ich beim Tippen in mir gespürt hatte, wie viel Traurigkeit und Sehnsucht. Und noch etwas war trotz meines Scheiterns aufgeblitzt, das mir in fast allen anderen Bereichen fehlte: Selbstbewusstsein. Beim Schreiben war ich plötzlich mutig, beflügelt von einem durch nichts gerechtfertigten Zutrauen, jedes Problem lösen zu können. Es war für mich das, was für den schüchternen Außenseiter Peter Parker das Spider-Man-Kostüm war: die Chance, ein anderer zu sein.
Gefühle, für die man keine Begriffe hat, finden nur selten den Weg ins Bewusstsein. Und etwas, das man sich nicht mal bildlich vorstellen kann, taucht kaum als Berufswunsch auf. Ein Teil von mir hat vermutlich bereits davor geschrieben, hat vielleicht sogar immer in Geschichten gedacht und sich früh in andere Menschen hineinversetzt, schon weil er es bei seinen Eltern musste. Aber diese und andere Neigungen waren irgendwann in der Kindheit verschüttgegangen, begraben unter dem Geröll prägender Erlebnisse, Zweifel und Schulversagen. Und das hätte auch noch lange oder eventuell für immer so bleiben können, je nachdem, wie mein Leben verlaufen wäre.
Leberts Weg als Jugendlicher zum Schriftsteller war der Auslöser, mich zum ersten Mal nach Jahren an einen Text zu setzen. Irvings Bücher waren die tiefere Ursache gewesen, mich überhaupt wieder für Literatur zu begeistern. Doch der wahre Grund für das Schreiben war ein anderer.
In meinen ersten Interviews als Autor behauptete ich, dass ich als Jugendlicher mit dem Schreiben angefangen hätte, um Mädchen zu beeindrucken. Sollte lustig klingen, zeigt aber auch gut den Reifegrad, den ich mit Mitte zwanzig hatte. (Obwohl die Aussage nicht ganz falsch war. Genauer gesagt: ein Mädchen, in das ich damals verliebt war.) Gleichzeitig verdeckten solche Aussagen die Tatsache, dass ich wirklich nicht wusste, wieso ich tat, was ich tat. Dass mir auch als veröffentlichtem Autor noch immer die Worte dafür fehlten und ich nur Ersatzworte hatte, so wie ich statt meiner eigenen nur Ersatzgeschichten schrieb.
Später las ich von der Autorin Yeonmi Park, die unter schwierigsten Bedingungen aus Nordkorea geflohen war.[3] Sie sprach über westliche Filme, die in ihrem Land verboten seien, aber trotzdem oft unter der Hand verliehen würden. Vor allem Titanic habe ihr Leben verändert. Denn in Nordkorea gäbe es zwar ein Wort für die Liebe zu einem politischen Regime, nicht jedoch für die Liebe zwischen Mann und Frau. Was steckte also hinter diesem Begriff, wenn er einen dazu brachte, sein Leben für einen anderen Menschen zu opfern, statt für sein Land? Nachdem sie den Film gesehen hatte, habe sie gespürt, dass es noch eine andere Welt geben müsse – und beschlossen zu fliehen.
Sprache bildet die unsichtbaren Leitplanken für unsere Gedanken und Gefühle; was dahinter ist, bleibt uns oft unvorstellbar. Auch gibt sie dem Unbewussten eine Stimme. Das Schreiben half mir, einen Teil meines Selbst ins Sichtbare zu holen, der zuvor im Verborgenen lag.
Wenn ich heute darauf antworten müsste, wieso ich damit anfing, würde ich eher zu meinem siebzehnjährigen Ich zurückgehen. Es hatte bereits Irving gelesen und erste vage Träume, es als Schriftsteller zu versuchen. Dann holte mich der Heimleiter eines Tages zu sich, ein ernstes Gespräch.
Ich überlegte, ob ich etwas falsch gemacht hatte, bis ich begriff: Zu Hause musste wieder etwas Schlimmes passiert sein. Doch stattdessen teilte er mir mit, dass meine Internatsrechnung über ein Jahr lang nicht bezahlt worden sei. Auch auf die unzähligen Mahnungen und Anrufe habe keiner reagiert, sie hätten keine andere Wahl, als mich aus dem Heim zu werfen.
Es dauerte, bis ich diese Nachricht verstand. Danach sprach ich mit niemandem und machte einen Spaziergang zum See. Ich hing an diesem Internat und stellte mir vor, wie es wäre, meine Freunde verlassen zu müssen und schon wieder an einem anderen Ort neu anzufangen. Vor irgendeiner fremden Klasse zu stehen. Ich spürte, dass ich das nicht mehr tun würde. Nein, in diesem Fall würde ich die Schule vor dem Abitur abbrechen. Ohnehin sah ich mich nicht als jemanden, der im Studium enthusiastisch in Lerngruppen saß. Aber wie ging es weiter?
An diesem Tag am Ufer dachte ich zum ersten Mal ernsthaft über die Zukunft nach und begriff, wie frei ich war. Jahre später las ich in Jean-Paul Sartres autobiografischer Schrift Die Wörter, wie es für ihn war, ohne Vater aufzuwachsen, und dass er diesen Umstand als ein Privileg empfunden habe. So habe es niemanden gegeben, der ihm Vorgaben machte, keinen, auf den er reagieren musste, ob durch Nachahmung oder Ablehnung. Stattdessen habe er die Lücke selbst füllen dürfen, sei frei gewesen.
Ist man das Kind von Menschen mit psychischen Krankheiten oder Traumata, können sich die Rollen vertauschen. Man kuschelt mit derselben Person, die einen später im Wahn beleidigt und immer wieder in der Geschlossenen liegt – und für die man der einzige Vertraute ist, der sich kümmert. Genauso führt man mit einem Menschen die lustigsten, tiefsten Gespräche – und dann lässt dieser Mensch zu, dass man die Schule verlassen muss.
Ich liebte meine Mutter und meinen Vater sehr, und das hat sich auch später niemals geändert. Sie inspirierten mich, sie liebten mich zurück und taten für mich, was sie konnten. Aber sie waren nun mal selbst versehrt, und es waren ihre Lebensbrüche, in denen ich aufwuchs und früh lernen musste, selbstständig zu sein. Mit sieben hatte ich meine Wäsche gewaschen, getrocknet und gebügelt, weil ich sie sonst nass ins Heim mitbekommen hätte. Und anstatt dass sie mir zu Hause Regeln vorgaben, war es bald an mir zu kontrollieren, ob mein Vater die Miete zahlte und Mahnungen öffnete oder meine Mutter ihre Medikamente nahm. Manchmal fühlte es sich an, als hätte ich selbst Kinder, als wüsste ich alles über meine Eltern, aber wenig über mich. Mit welcher Berechtigung hätten sie mir nach der Schule meine Ziele ausreden oder etwas von mir fordern können? Oft sind es die eigenen Eltern und ihre Sorgen, die zwischen einem selbst und waghalsigen Träumen stehen, doch zwischen mir und dem Schreiben würde gar niemand stehen.
An diesem Nachmittag am See – als ich noch nicht wusste, dass ein Schweizer Verwandter, zu dem ich damals keinen Kontakt hatte, von der offenen Heimrechnung erfahren und sie begleichen würde – begannen meine Pläne vom Autorsein konkret zu werden. Damals fühlte ich in mir eine tiefe Entschlossenheit, Trotz und Wut, und all das musste irgendwo hin. Da ich nicht gegen meine Eltern rebellieren konnte, weil sie keine Autoritäten für mich waren, nahm ich diese Gefühle und packte sie in meinen Traum vom Schreiben.
Meine darunterliegenden Verletzungen und Sehnsüchte dagegen schleuderte ich weit von mir, und es dauerte viele Jahre und mehrere Romane, bis sie wie ein Bumerang zu mir zurückkehrten.
Im Sommer 2003 saß ich im vollgepackten Mietauto nach Berlin. Ich hatte keine Ahnung, was mich dort erwarten würde, ich wusste nur: Ich war neunzehn, hatte gerade Abitur gemacht und wollte Autor werden. Meine Schreiberfahrung bestand aus Texten für die Heimzeitung, die gefühlt zwar nur zwanzig Leser:innen hatte (die Redaktion mitgerechnet), durch die regelmäßige Übung und auch sonst aber sehr wichtig für mich gewesen war. Und mit achtzehn hatte ich mich in den Sommerferien an ein erstes richtiges Buch gewagt. Angelehnt an Reiner Kunzes Die wunderbaren Jahre, in denen er in präzisen Szenen und Dialogen die Gesellschaft der DDR porträtierte, hatte ich versucht, das Leben eines Jugendlichen nachzuzeichnen. Jeden Ferientag hatte ich daran geschrieben und auf die weißen Seiten geblickt wie einst als Kind auf das geheimnisvolle Quadrat aus Licht in meinem Zimmer. Nach sieben Wochen war das Manuskript fertig, ich sehe noch, wie ich es damals vom Copyshop abholte; ungläubig und stolz …
Tatsächlich war dieser Text so schlecht und durchzogen von Teenage-Weinerlichkeit, dass man mich heute damit erpressen könnte. Ich bekam zwei klare Absagen von Verlagen und schämte mich bald selbst dafür. Bei diesem ersten ernsthaften Versuch hatte ich aber etwas gelernt, das auch in diesem Buch eine Rolle spielen wird: wie schwierig beim Schreiben das Einfache ist. Wie machten das die guten Autor:innen, dass man nicht aufhören konnte zu lesen? Dass bei ihnen alles so souverän wirkte und im Fluss, als könnte die Geschichte nur so und nicht anders erzählt werden?
In Berlin wollte ich es herausfinden. Die Idee, Kreatives Schreiben zu studieren, verwarf ich. Nach der Schule war ich es leid, von anderen bewertet zu werden. Und was, wenn ich an einen Dozenten geriet, der mir wie damals sagte: »Äh, Benedict, haben S’ nix anderes, was Sie studieren können?«
Nein, ich wollte meinen eigenen Weg gehen und ohne Druck Fehler machen dürfen. Mir selbst die Bücher suchen, die mich inspirierten, meinem Traum vom Schreiben eine faire Chance geben. Und das waren keine zwei Monate vor dem Studium, sondern zwei Jahre ohne Studium. Danach konnte ich zur Not noch immer etwas Solides oder Akademisches machen.
Dieser Entschluss hatte in meinem Umfeld nicht gerade Begeisterung ausgelöst. »Du bist bescheuert, und in drei Monaten bist du wieder zurück«, gab mir ein Kumpel mit auf den Weg. Und der Klassiker der gut gemeinten Ratschläge war: »Willst du nicht lieber erst mal was Sicheres studieren und danach schreiben?« Ein Satz, den ich damals von fast allen Freunden, Bekannten und auch Verwandten hörte und der in den meisten Fällen aus aufrichtiger Sorge geäußert wurde.[4]
Doch für mich war es nicht verrückt oder mutig, sondern eher logisch, sich nach der Schule in seine Träume zu stürzen. Bei meinem Vater – der trotz seiner künstlerischen Neigungen in die vermeintlich lukrativere Wirtschaft gegangen war – hatte ich gesehen, dass es so etwas wie Sicherheit nicht gab. Wenn schon scheitern, dachte ich, dann lieber mit etwas, das ich liebte. Natürlich gab es Ausnahmen: Menschen, die zuerst etwas Handfestes machten und dann mit vierzig ausbrachen, um sich spät doch noch ihre Träume zu erfüllen. Aber das schien mir so unendlich viel schwieriger, als es andersherum anzugehen. Was hatte man mit Anfang zwanzig wirklich zu verlieren? Das Ansehen von Freunden, Verwandtschaft und sich selbst, okay. Doch ein solcher gesellschaftlicher Druck war nichts im Vergleich zu dem, den man später mit Job, Familie und Kindern hätte, wenn man mit vierzig kündigte, um mit seiner ambitionierten Garagenband auf Tour zu gehen. Das wäre verrückt. Das wäre mutig. Es mit neunzehn zu versuchen, schien mir dagegen vernünftig.
Mit einem Haufen Buchideen und hundertzwanzig Euro kam ich in Berlin an – dann sperrte ich mich gleich am ersten Tag aus und hatte nur noch sechzig. Egal, nun mit Schlüssel machte ich mich auf einen Spaziergang durch den Kiez. Selbst die simpelsten Großstadteindrücke euphorisierten mich. Punks quatschten mich an, die gelbe U-Bahn bretterte hoch über mir hinweg. Ich hörte den Lärm von Millionen Menschen und konnte es fast spüren: Jede Sekunde wurde hier irgendwo geliebt und gelitten, wurden hinten alte Träume mit der Schubkarre rausgefahren und vorne schon wieder neue produziert. Das Wetter war schmuddelig, aber manchmal ließ die Sonne die Wolken aufglühen, und die Ideen tanzten durch meinen Kopf. Ich holte mir einen Kaffee, hörte Tangled Up in Blue von Dylan und empfand ein unschlagbares Gefühl von Freiheit.
Damals gab es unzählige leer stehende Mietwohnungen, ich hatte aus einem Katalog die nächstbeste genommen. Sie lag in einer Nebenstraße der Schönhauser Allee, Prenzlauer Berg. Ein Zimmer, Dusche in der Küche, Kohleofen, kein Strom auf der Toilette. Hier hatten zu DDR-Zeiten Arbeiter:innen gewohnt. Aus einer bizarren Laune heraus strich ich drei Wände orange, dann ging die Farbe aus, und die letzte Wand ließ ich weiß-rot. Mit so einer Farbkombination konnte man Menschen nachhaltig verstören, doch es war mir egal, und Besuch hatte ich eh fast nie. Es hätte auch keinen gekümmert, denn das ganze Viertel war Anfang der Nullerjahre noch ziemlich heruntergekommen.
Die Hausfassaden waren mit Graffiti beschmiert oder voller Einschusslöcher. Das Wort »gentrifiziert« kannte damals kaum jemand, dafür hing »Arm, aber sexy« als Slogan über den Dächern der Stadt. Berlin war in jenen Jahren spottbillig und offen wie eine sperrangelweit aufgestoßene Tür.
Wohnungen mit über sechzig Quadratmeter im Zentrum kosteten kaum mehr als zweihundert Euro warm, denn die Stadt hatte genauso wenig Geld wie die Menschen, die nun aus allen Teilen der Welt dorthin zogen. Die einen ließen sich treiben, alles egal, die anderen hatten eine fixe Idee, wollten irgendwas auf die Beine stellen, irgendwas machen, und diese fiebrige Mischung ließ vor allem den Osten der Stadt vibrieren und erfasste mich jedes Mal, wenn ich vor die Haustür trat.
Hart waren die Winter, das werden alle bestätigen, die damals in Ostberlin lebten, mit sibirischen Winden, eisigen Temperaturen und wenig Schönem im graukalten Straßenbild. Nur selten sah man gemütliche Cafés und herausgeputzte Läden, dafür gab es noch viele Videotheken.
In eine davon ging ich in diesen Monaten oft. Ich gab mein Geld für Filme aus und las pausenlos Bücher vom Flohmarkt, wollte die gesamte Weltliteratur nachholen, ob aus Russland, Amerika, Frankreich oder England. Leider war das eine ziemlich kleine Weltkarte. Und leider waren das wie in der Schule – abgesehen von Carson McCullers und Harper Lee[5] – fast ausschließlich Männer; es fiel mir nicht mal auf! Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich zu meinem zwanzigjährigen Ich gehen und ihm kopfschüttelnd die Bücher von Lucia Berlin, Joan Didion, Toni Morrison, Virginia Woolf, Banana Yoshimoto, Olga Tokarczuk, Veza Canetti, Gabriele Tergit, Clarice Lispector, Tove Ditlevsen, Katherine Mansfield und vielen anderen in die Hand drücken.
Nie mehr in meinem Leben hatte ich so viel Zeit und Muße wie damals. Ich besaß zu Hause keinen Internetanschluss, hatte in der neuen Stadt keine Freunde, sah auch meine nachthungrige Schwester nur selten. Die größte Ablenkung waren ein paar Nebenjobs, die ich häufig wechselte. Wie ein streunender Hund, der in die Lobby gelaufen kam, arbeitete ich mal als Nachtportier, dann in einem Kino oder als Kellner – und verschwand genauso schnell wieder.
Um kostenlos U-Bahn fahren zu können und Kindergeld zu kriegen, schrieb ich mich an der Uni ein. Ich wählte Fächer wie Altorientalistik, indische Philologie, Turkulogie oder, mein Favorit, Mathematik, bei denen ich niemandem den Platz wegnahm – und wechselte jedes Mal, wenn meine Professor:innen mich vor der Zwischenprüfung persönlich kennenlernen wollten.
Meine Texte schrieb ich auf einem uralten Computer, der gefühlt den Vormittag brauchte, um hochzufahren. Ich träumte von einem Laptop, doch das war utopisch. Damals haderte ich damit, dass meine Eltern mich nicht finanziell unterstützen konnten, ich hätte alles angenommen und wäre jeden Deal eingegangen. So aber gab es nichts zu erben und nichts zu verlieren. Keine Komfortzone, die man erst verlassen musste. Kein Wechsel in Form einer monatlichen Summe von zu Hause, die einen unter Druck setzte und unausgesprochen zu einer solideren Ausbildung verpflichtete, um diese Unterstützung zu rechtfertigen.
Niemand erwartete etwas von mir, niemand bemerkte mich, wenn ich von meinen stundenlangen Streifzügen durch die Stadt zurückkehrte, den Kopf voller Pläne. Meine Wohnung war ein Loch, die Dusche spendete nur eine Minute lang warmes Wasser, auch sonst ließ ich kein Klischee eines Bohemiens aus.
Vermutlich war ich in meinem Leben nie freier gewesen.
WARUM MAN NICHT AUFHÖRT
Kurzer Einschub: Dieser biografische Teil, von Salinger schön als »David-Copperfield-Mist« bezeichnet, kann einem das Gefühl vermitteln, eine etwas holprige Kindheit im Gepäck wäre beim Schreiben hilfreich. Oder der Erfolg würde sich erst einstellen, wenn man beruflich alles auf diese Karte setzt. Aber so ist es nicht. Okay, ein Frank McCourt – der als Heranwachsender bitterster Armut ausgesetzt war und noch einmal ganz andere existenzielle Nöte durchlebte – hätte seine Werke wohl nicht verfasst, wenn er statt im irischen Limerick auf Long Island aufgewachsen wäre. Doch vielleicht wäre er dann sogar schon früher zum Schreiben gekommen als erst nach seiner Pensionierung.
Jedenfalls hatten unzählige Autor:innen behütete Kindheiten und solide Jobs. Sie arbeiteten als Arzt (Khaled Hosseini) und Pharmazeutin (Agatha Christie), Anwältin (Elizabeth Strout) und Autohändler (Kurt Vonnegut), in einer Bank (T.S. Eliot), für eine Fluglinie (Harper Lee), als Versicherungsjurist (Franz Kafka), Verlagslektorin (Toni Morrison) oder Lehrer (Vladimir Nabokov, Nick Hornby und viele andere; John Irving unterrichtete Schreiben und Ringen), manche eröffneten ein Kino (James Joyce) oder eine Augenklinik (Arthur Conan Doyle). Haruki Murakami bescheinigte sich die durchschnittlichste Jugend, die man nur haben kann, und arbeitete in seiner eigenen Bar, als er mit Ende zwanzig zufällig zum Schreiben kam – das alles hat seinem Erfolg nicht geschadet. Andere dagegen hatten erheblich schwerere Umstände als ich. Und während manche schreiben, um Schmerz oder Traurigkeit zu verarbeiten, tun es viele zu ihrem Vergnügen, »aus Liebe zur Welt« (Natalie Goldberg), als »Auflehnung« gegen die Realität (Mario Vargas Llosa), weil sie davon träumen, die/der Beste zu sein, weil sie nur sie selbst sein wollen – oder alles zusammen.
Ich kann also bloß meinen Weg als Autor schildern und ihn hier auf wacklige Weise interpretieren, aber er lässt sich nicht auf andere übertragen. Dabei stelle ich fest, dass ich über die Zeit von Spinner am besten erzählen kann, wenn ich den saloppen Ton der Hauptfigur übernehme, und über Vom Ende der Einsamkeit, wenn ich dafür wieder die Erzählstimme des Buchs nutze. Die Orte von damals habe ich verlassen, manche gibt es auch nicht mehr. Geblieben ist die Sprache.
Ein Stilmittel in Romanen ist der unzuverlässige Erzähler, und was könnte ich beim Hüten meiner Geschichte anderes sein. Trauen Sie mir nicht. Schon die Frage, wie sehr meine buchaffine Familie meinen Weg prägte, ist bei mir in schlechten Händen, denn natürlich gewichte ich meinen eigenen Anteil gern so hoch wie möglich. Dabei schreiben inzwischen mehrere meiner Verwandten, ob meine Schwester Ariadne von Schirach oder mein Cousin Ferdinand von Schirach, und von dieser Warte aus scheint es nur logisch, dass auch ich damit anfing. Doch zugleich gehört zur Wahrheit, dass mir anfangs ausgerechnet aus der Familie viele das Schreiben ausreden wollten und ich in den ersten Jahren damit allein war.
Später wurde ich oft gefragt: »Dein Cousin ist ein erfolgreicher Autor, konnte der dir bei der Verlagssuche denn keine Türen öffnen?« Die Antwort auf solche Fragen ist jedoch immer: Nein. Im Falle meines Cousins aus dem simplen Grund, dass er damals noch als Anwalt arbeitete und ich bei Erscheinen seines Debüts veröffentlicht war. Aber generell funktioniert der Betrieb so einfach nicht. Diese Erfahrung hat wohl jeder gemacht, der sich schon mal für das Werk eines Freundes eingesetzt hat. Man kann nur an Türen klopfen und dann das Beste hoffen. Denn Verlage bekommen von Bekannten oder Agenturen täglich unzählige Texte angepriesen, deshalb sollte man ihre Begeisterung über den Hinweis, der Sohn oder die Tante habe auch ein »tolles Buch« geschrieben, nicht überschätzen.
Andererseits verdanke ich so vielen Menschen so unendlich viel. Ich glaube zwar nicht an ein in die Wiege gelegtes Talent – dafür war ich anfangs nicht gut genug –, aber ich glaube an Inspiration durch das Umfeld. So hatten sich meine Eltern immer für meine Geschichten interessiert und sogar selbst ein Werk aus dem Chinesischen übersetzt, während im Stockbett über mir einer der wortgewandtesten, intelligentesten Menschen schlief, die ich je traf: Ich hatte nicht nur das Glück, dass meine Schwester mir später sehr half, sondern auch, dass sie mir das Schreiben ein paar Jahre lang »überließ«, bevor sie ihre eigene Autorinnenkarriere startete. Denn wenn ich heute auf meine Entscheidungen zurückblicke, entpuppen sie sich im Nachhinein oft als ein unbewusstes oder trotziges Reagieren auf andere. Alle in meiner Klasse rauchten, also tat ich es nicht. Alle studierten, also machte ich etwas anderes. Immer wieder suchte ich nach einer vermeintlichen Nische.
Daher bin ich froh, dass meine familiäre Herkunft erst nach meinem dritten Roman herauskam und ich meinen öffentlichen Weg bis dahin eigenständig gehen konnte. Ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt als Autor versucht hätte, wenn es damals schon mehrere schreibende Verwandte gegeben hätte. So aber durfte ich im Sommer 2003, als ich damit begann, das flüchtige Gefühl haben, in eine Lücke zu stoßen.
Mein erster Roman in Berlin wurde eine Dreiecksliebesgeschichte. Der Clou: Der Erzähler, ein Ire namens Willy Guest, und sein bester Freund und Nebenbuhler waren dieselbe schizophrene Person, eine Idee, die mir damals originell vorkam (zu meiner Ehrenrettung sei gesagt, dass ich den Film Fight Club erst Jahre später sah).
Je länger ich in meiner monatelangen Einsamkeit an diesem Text saß, desto mehr beschlich mich ein unheimliches Gefühl: dass ich ein verkapptes Genie sein könnte, das endlich zu seiner wahren Größe fand. Ein geradezu ungeheuerlicher Gedanke, der täglich durch immer neue sensationelle Einfälle und Ideen genährt wurde. Kurz vor der Fertigstellung von Ich war Willy Guest bekam ich daher Angst zu verunglücken, denn ich sah schon vor mir, wie mein Buch postum erscheinen und diverse Preise gewinnen würde. Und dann hieß es: »So tragisch: Ein junges Genie, früh aus dem Leben gerissen.«
Doch Glück gehabt, ich blieb unversehrt und schickte das Buch einem ersten Leser: dem Exfreund meiner Schwester, die gerade zum Studieren ins Ausland gegangen war. In ihrer Abwesenheit kümmerte er sich rührend um mich, er war mein einziger Kontakt in der Stadt und zugleich ein kritischer Literaturliebhaber. Also jemand, der sicher zu