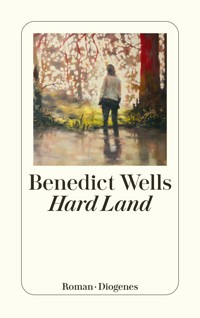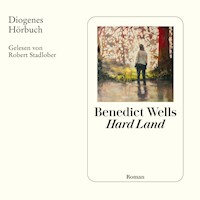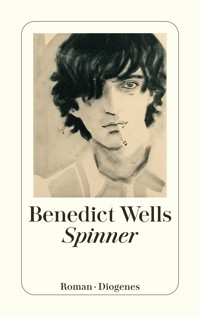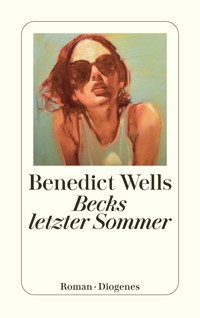
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beck ist nicht zu beneiden. Mit der Musikerkarriere wurde es nichts, sein sicherer Job als Lehrer ödet ihn an, und sein Liebesleben ist ein Desaster. Da entdeckt er in seiner Klasse ein unglaubliches Musiktalent: Rauli Kantas aus Litauen. Als Manager des rätselhaften Jungen will er es noch mal wissen, doch er ahnt nicht, worauf er sich da einlässt ... Ein tragikomischer Roman über verpasste Chancen und alte Träume, über die Liebe, Bob Dylan und einen Road Trip nach Istanbul. Ein magischer Sommer, in dem noch einmal alles möglich scheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Benedict Wells
Becks letzter Sommer
Roman
Diogenes
Für meine Mutter, meinen Vater und meine Schwester,
die ich liebe und denen ich so viel verdanke
»But I was so much older then,
I’m younger than that now.«
Bob Dylan
The Road To Raito
(Intro)
Als er bei Neapel vor einem Lokal parkte, hatte Beck acht Stunden Fahrt und sein ganzes Leben hinter sich. Beim Aussteigen fiel ihm auf, dass sein graues Cordjackett zerknittert war. Nachdem er vergeblich versucht hatte, es glattzustreichen, betrat er das kleine Lokal.
Drinnen setzte er sich an einen Ecktisch und griff nach der Speisekarte. Während er las, kamen wieder die Zweifel. Der Abschied von München, die Kündigung, die leergeräumte Wohnung; jetzt hatte er tatsächlich alles aufgegeben. Kein gutes Gefühl. Sicher, er war endlich frei, aber wenn das diese Freiheit war, von der alle immer sprachen, dann wurde sie gnadenlos überschätzt.
Beck klappte die Karte zu. »Conto?«, rief er vorsichtig. In seinem Italienischwörterbuch hatte gestanden, dass das das passende Wort sei, um etwas zu bestellen. Oder war es das passende Wort gewesen, um die Rechnung zu verlangen? Egal, der Kellner oder Inhaber des schäbigen kleinen Ladens legte mit einem gelangweilten Blick seine Zeitung weg und erhob sich. Er trug ein hellrotes Hemd, dessen Ärmel hochgekrempelt waren, so dass seine behaarten Unterarme freilagen.
»Che cosa desidera? Mangiare?«, fragte er, ohne Beck anzusehen.
Desidera, dachte Beck. Das bedeutete doch »entscheiden«, oder? Wieso hatte er jetzt nicht sein Wörterbuch dabei? Wieso hatte er nie irgendetwas Nützliches dabei?
Er deutete auf die Karte und bestellte Spaghetti Napoli, dazu einen Tee. Der Kellner nickte und nahm ihm die Karte aus der Hand. Dann zog er ab und rief der alten Frau, die am Herd in der Küche stand, etwas zu. Beck schaute sich um. Das Lokal war verlassen, nur ein schwarzer Kater lag zusammengerollt auf einem Kissen unter dem Tresen. An der Wand hingen Bilder von ehemaligen Spielern des AC Milan und ein paar Wimpel. Aus dem Radio an der Theke dudelte ein berühmter Schlager aus den Siebzigern. Draußen spielten ein paar Jungen mit einem Ball.
Als der Kellner wiederkam, stellte er einen Teller vor Becks Nase, in dem ein paar Nudeln in einer roten Brühe schwammen. Daneben stand ein Becher mit heißem Kaffee. Als Beck den Kellner noch mal zu sich rief, um sich zu beschweren, dass er keinen Tee bekommen hatte, entstand ein kurzer Disput. Der Kellner redete auf ihn ein und schien ziemlich genervt zu sein. Beck verstand keine Silbe, aber einmal hörte er das Wort »Familia« raus. Familia? Was war nur los? Großer Gott, er wollte doch nur eine beschissene Tasse Tee, wieso musste er sich jetzt diesen Mist anhören?
Schließlich warf ihm der Kellner einen angewiderten Blick zu und stellte ihm noch eine zweite Tasse Kaffee hin, bevor er einfach wieder hinter der Bar verschwand.
Okay, dachte Beck, dann also Kaffee.
Er fing an, mit der Gabel auf dem Teller rumzustochern. Die Nudeln schmeckten, als wären sie schon vor Tagen zubereitet und seitdem in einem Karton aufbewahrt worden. Als er vor einigen Wochen auf seinem Trip durch Osteuropa in Rumänien gewesen war, hatte er einmal etwas ähnlich Schlechtes gegessen. Aber Rumänien war ein armes Land ohne nennenswerte Pastahistorie, es hatte immerhin eine gute Ausrede. Für diesen Fraß gab es keine Entschuldigung.
Beck stand auf und ging auf die Toilette. Der Raum war warm und schlecht gelüftet, es stank nach Katzenklo, nur das Sirren einer Mücke war zu hören. Er ging zum Waschbecken. Im Spiegel entdeckte er, dass ein Spritzer Tomatensoße an seinem Bart klebte. Beck wusch ihn ab. Dann betrachtete er sein Ebenbild. War dieser bärtige, langhaarige Mann wirklich er selbst?
Er versuchte sich daran zu erinnern, wie vor über einem halben Jahr alles angefangen hatte. Wie sein altes Lehrerleben Stück für Stück auseinandergebrochen war. Im Grunde hatte alles mit Lara angefangen. Er dachte an ihr ausdrucksstarkes, feines Gesicht und das winzige Muttermal unter dem linken Ohr. Ihm fiel ein, wie er sie das erste Mal auf der Straße gesehen hatte. Sie hatte ihn beschimpft. Nicht zu fassen, war das schon mehr als sieben Monate her?
Alles ging so schnell vorbei. Man müsste die Zeit festhalten, dachte er. Sich einfach auf sie drauflegen, sie ersticken, bis sie keine Luft mehr bekommt …
Bis sie keine Luft mehr bekommt? Die Zeit oder was? Beck schüttelte nur den Kopf. Es war verrückt. Er konnte ganz unten sein, aber so ein Schwachsinn wie »erstickte Zeit« fiel ihm immer ein.
Als er wieder zurückgehen und zahlen wollte, bemerkte er, dass er seinen Geldbeutel im Auto liegengelassen hatte. Nach kurzer Überlegung entschied er, sich einfach durch das Fenster der Toilette aus dem Staub zu machen. Er kramte eine Zigarette aus der Jacketttasche und steckte sie sich in den Mundwinkel. Dann wurde ihm klar, dass er es ernst meinte. Das gefiel ihm. Er prellte die Zeche. Er lachte kurz und zündete ein Streichholz an. Nein, für dieses Essen wollte er wirklich nicht bezahlen.
Beck zwängte sich durch die schmale Öffnung nach draußen und suchte nach seinem Auto. Er fühlte sich lebendig. Sein kleines Verbrechen berauschte ihn, und so bemerkte er nicht, dass er auf seinem Weg zum Wagen genau an dem Lokal vorbeiging, aus dem er gerade geflüchtet war.
Er blickte nach rechts und sah mitten in die weit geöffneten Augen des Kellners, der doch ein wenig überrascht war, seinen Gast, der noch nicht gezahlt hatte, draußen auf der Straße herumspazieren zu sehen.
Nach einer Sekunde des Nachdenkens, die beide Seiten gebraucht hatten, um die neue Situation zu begreifen, ging es los. Der Kellner brüllte etwas, ruderte mit den Armen und kam aus dem Lokal gelaufen. Beck begann sofort loszurennen, musste dabei jedoch plötzlich lachen. Sein altes Problem. Schon als Kind hatte er blöd vor sich hin gekichert, wenn er beim Fangen verfolgt oder beim Verstecken gesucht wurde.
Nach zwanzig Metern drehte er sich noch mal um, aber der Kellner war nicht mitgelaufen, sondern stand vor seinem Restaurant. »Cazzo!«, brüllte er noch, dann winkte er einfach ab.
Beck setzte sich hinters Steuer seines Audis und ließ den Motor an. Er warf noch einen letzten Blick auf den Kellner und sah, wie dieser schimpfend in sein Lokal zurückging. Nicht ärgern, dachte Beck. Dann trat er die Kupplung, legte den ersten Gang ein und fuhr los.
TRACKLIST
A-SEITE
Song 1
Song 2
Song 3
Song 4
B-SEITE
Song 5
Song 6
Song 7
A-SEITE
TRACK 1»Things Have Changed«
Der erste Song: Über einen litauischen Wunderschüler, eine Liebesnacht, die keine ist, und über die erste Schießerei.
1
Es war Montag, der 22. Februar, Ende der Neunziger, diesem vergeudeten Jahrzehnt. Wie jeden Morgen stand Robert Beck nackt vor dem Badezimmerspiegel. Meine Güte, bist du fett geworden, dachte er. Für ihn gab es nur eine Erklärung: Gott.
Gott wollte einfach nicht, dass er abnahm.
Die andere Begründung war: Er hasste Bewegung, er aß ungesund, und sein Körper war nicht mehr der jüngste. Man altert einfach zu schnell, dachte Beck. Einmal kurz weggeschaut, schon war man nicht länger ein junger Leadsänger in einer Band, sondern ein siebenunddreißigjähriger Lehrer an einem Münchner Gymnasium. Nicht gerade der erhoffte Lebenslauf.
Er sah wieder in den Spiegel. Jessas, das war ja nicht mehr zum Aushalten, wie fett er war, ständig dieses Baucheinziehen, als ob das was bringen würde. Sport, dachte er. Er müsste mehr Sport treiben. Leichtathletik, oder Yoga. Ja, Yoga war genau das Richtige für ihn. Yoga und gesündere Ernährung. Beck warf sich einen ernsten Blick zu, dann hielt er inne und betrachtete sein entschlossenes Gesicht. Ein bisschen sah er jetzt ja schon wie dieser englische Hollywoodstar Colin Firth aus. Oder war der Ire? Egal. Eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem englischsprachigen Schauspieler war jedenfalls nicht zu übersehen, bis auf die zwanzig Pfund Übergewicht natürlich. Beck strich sich über seinen Bauch und kniff tief hinein, so dass er zwischen Daumen und Zeigefinger sein weißes Fleisch hielt. Er hatte das Unheil längst kommen sehen. Obwohl er früher dünn gewesen war, hatte er doch stets geahnt, dass in ihm schon immer auch ein fetter Robert Beck gesteckt hatte, der herauswollte. Dass es in den vergangenen Monaten geschehen war, war somit furchtbar, aber unvermeidlich gewesen. Wie die letzten Alben von REM.
Nachdem Beck das Haus verlassen hatte – typische Aufmachung: Jeans, dunkles Hemd, schwarze Lederjacke –, sah er kurz vor seinem Wagen eine Frau, die wild gestikulierend auf der Straße stand und brüllte. Im ersten Moment vermutete er in ihr eine Verrückte, dann sah er, dass sie in ein Handy sprach.
»Verpiss dich, du Wichser, verpiss dich einfach … Nein, du hörst mir jetzt zu. Es ist aus, okay?! Ich hab das so satt, du kannst mich mal!«
Beck stand vor ihr und lauschte. Er schätzte sie auf Mitte, Ende zwanzig. Sie hatte eine schlanke Figur, hellbraune Haare und ein zartes, fast elfenhaftes Gesicht. Nur die Nase war etwas groß. Randbeobachtung: Sie trug einen Secondhand-Rock und ein buntes Hippie-Sweatshirt und schien auf irgendeinem »Rettet die Welt«-Ökotrip zu sein. Beck entschied spontan: hübsch, aber nicht sein Typ.
»Du kannst mich mal!«, schrie sie wieder. »Ich hab das so satt mit dir. Du hast dich überhaupt nicht verändert … Ach … Nein, vergiss es. Ich hol nachher mein Zeugs, und dann tschüss, dann kannst du mit dieser Tussi zusammenziehen!«
Als sie aufgelegt hatte, sagte sie noch einmal leise und mit geschlossenen Augen: »Scheiße!« Dann erst bemerkte sie Beck, der noch immer, mit leicht offenem Mund, direkt vor ihr stand. »Was sind Sie denn für einer? Lauschen Sie öfter?«
Beck fiel auf, dass sie eine schwarze Schürze trug, auf der in roten Buchstaben »Macchiato« stand. Sie schien in dem Café, vor dem sie stand, zu arbeiten. »Ich hab nicht gelauscht«, sagte er.
»Natürlich haben Sie gelauscht.«
Beck dachte einen Moment nach. »Na schön, ich hab gelauscht«, gab er zu. »Und wenn schon. Sie haben es mir ja schließlich auch sehr schwer gemacht, nicht zuzuhören.«
»Was?«
»Jessas, Sie stehen hier mitten auf der Straße und brüllen rum: Wichser, Tussi. Soll ich da einfach vorbeigehen, als ob nichts wäre? Wenn Sie Privatsphäre wollen, dann müssen Sie woanders telefonieren. Wahrscheinlich wollten Sie sogar, dass Ihnen jemand zuhört. Also unbewusst.«
Die Frau dachte tatsächlich einen Augenblick lang über diese Unverschämtheit nach, dann sah sie Beck mit zusammengekniffenen Augen an. »Jetzt hören Sie mal zu, Sie kleiner Hobbypsychologe. Wenn Sie nur ein bisschen Anstand hätten, dann wären Sie einfach weitergegangen, weil Sie bemerkt hätten, dass es mir gerade nicht besonders gut geht.«
Erst jetzt begriff Beck, dass sie kurz davor war loszuweinen.
»Tut mir leid«, sagte er schließlich. »Tut mir wirklich leid.«
Sie krauste die Lippen. Ihr Gesicht bekam den Ausdruck eines kleinen, trotzigen Mädchens. »Ja, allen tut es leid. Ihnen tut’s leid, ihm tut’s leid.« Sie deutete auf ihr Handy, als ob ihr vielgescholtener Exfreund als kleiner Geist darin hausen würde. »Tun Sie mir den Gefallen, halten Sie das nächste Mal einfach Ihre Klappe. Und jetzt muss ich arbeiten.«
Mit diesen Worten wandte sie sich ab und ging ins Café zurück. Beck sah durch das Schaufenster, wie sie mit einer Kollegin sprach und sich von ihr in den Arm nehmen ließ. Irgendwie süß, diese Elfenfrau, dachte er. Müsste man vielleicht bald mal vorbeischauen, in diesem Café.
2
Beck war spät dran, er raste zur Schule. Aus den Boxen dröhnte Transmission von Joy Division. Er steckte sich eine Zigarette an und drehte die Lautstärke auf. Kurz darauf hielt er auf dem Lehrerparkplatz.
Als Beck durch die Flure des Georg-Büchner-Gymnasiums ging, spürte er wieder, wie sehr er dieses Gebäude hasste. Hier hatte schon sein Vater unterrichtet, hier hatte er selbst das Abitur gemacht, ehe er nach dem geplatzten Traum von einer Musikerkarriere an genau dieser Schule Lehrer geworden war. Inzwischen kannte er jeden Winkel, jedes Geräusch, jedes Gefühl: Jungs, die heimlich auf den Toiletten rauchten, kichernde Mädchen, ein küssendes Pärchen auf dem Schulhof, hektische Gesichter, Gelächter, Versagensangst, laute Lehrerstimmen. All das wiederholte sich, jeden verdammten Tag. Die Gefühle blieben immer die gleichen, während die Menschen, die sie erlebten, austauschbar waren.
Nachdem er zwei Stunden Deutsch unterrichtet hatte, hatte Beck nun die 11b in Musik. Das Fach teilte er sich mit Norbert Berchthold, einem verklemmten Anfangvierziger, den er aus tiefster Seele hasste. Diese betuliche, unfassbar langweilige Frank-Elstner-Art, diese Hochwasserjeans der Karstadtmarken Le Frog und Barisal, diese weißen Birkenstock-Sandalen mit weißen Socken im Sommer. Norbert Fucking Berchthold.
Das einzig Interessante an ihm war, dass er eine dreizehn Jahre ältere Freundin namens Inge hatte, deren Falten im Gesicht so tief waren, als hätte man mit einem Messer lange Striche in Ton geritzt. Beck nannte sie immer die »grimmige Inge«, weil sie nie lachte. Die grimmige Inge war arbeitslos, und hin und wieder kam sie Berchthold nach dem Unterricht besuchen, dann schlossen sich die beiden im Hinterzimmer des Musikraums ein, rauchten es voll und hörten französische Chansons oder Joe Cocker. Übel nahm Beck seinem Kollegen aber vor allem zwei Dinge. Erstens, dass sich dieser alte Öko-Pazifist vor ein paar Jahren tatsächlich auf die Schienen eines Castor-Transports gelegt hatte. Wie gestört konnte man sein? Und zweitens war da noch die Werner-Tasse, aus der Berchthold jeden Tag seinen Kaffee trank. Abartig. Und mit so was teilt man sich dann noch muntere zwei Jahrzehnte lang den Job, dachte Beck, aber ohne mich. Allerdings: So wie es aussah, kam er aus dieser Lehrersache nicht mehr raus, also würde er Berchthold in den nächsten Jahren wohl irgendwie kunstvoll ermorden müssen. Vielleicht Gift in den Kaffee schütten, dann hätte es sich endlich ausgewernert.
Beck betrat das Musikzimmer. Mit einem Buch in der Hand kam Anna Lind auf ihn zu. Anna war achtzehn und ein wahr gewordener Lehrertraum oder, wie Kollege Ernst Mayer neulich Beck zugeraunt hatte, »fast schon unfair«: Ihr langes Haar war blond, ihre blauen Augen glänzten, als ob sie ständig den Tränen nahe wäre, und ihr Gesicht hatte eine unschuldige Kühle, die schon beinahe wieder durchtrieben wirkte.
»Danke«, sagte sie und gab ihm Das Attentat von Harry Mulisch zurück. Sie hatte es sich für das Literaturcafé ausgeliehen, das Beck hin und wieder veranstaltete. Anna schenkte ihm noch ein kurzes Lächeln, dann setzte sie sich.
Beck hielt nun eine lockere Stunde über berühmte Orchesterwerke. Es war schon kurz vor der Pause, als er ein Merkblatt über Smetana kopieren ging. Kaum betrat er mit den Kopien in der Hand wieder das Klassenzimmer, bemerkte er, wie einige Schüler jemanden kichernd mit Papierkugeln bewarfen. Rauli Kantas, einen Neuen aus Litauen. Beck hatte gestern im Wegfahren gesehen, wie der Junge nach der Schule auf dem Parkplatz geweint hatte. Zu seiner Überraschung schien es Rauli jedoch nicht zu stören, dass er beworfen wurde. Mit stoischer Ruhe und Kopfhörern auf den Ohren schrieb er einen kleinen gelben Zettel voll. Wieder prallte eine Papierkugel gegen seinen Kopf.
»Lasst das!« Beck ging dazwischen. »Jessas, was ist denn los mit euch, seid ihr alle wieder Kleinkinder, oder was?«
Das Werfen wurde maulend eingestellt. Beck schüttelte den Kopf. Da er es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, seinen Schülern die letzten fünf Minuten jeder Musikstunde etwas vorzuspielen, legte er eine CD mit Smetanas Moldau auf. Dann trat er vor Rauli Kantas. »Komm mal mit.«
Der Junge setzte die Kopfhörer ab. Den gelben Zettel ließ er in der Hosentasche verschwinden. Er sah seinen Lehrer fragend an.
»Ja, dich mein ich. Komm mal mit.«
Rauli erhob sich. Er war blass und dünn, seine pechschwarzen Haare hingen ihm ins jungenhafte Gesicht. Unter seinem olivgrünen Bundeswehrparka trug er ein verwaschenes Shirt und eine schwarze Karottenhose. Obwohl er bereits siebzehn Jahre alt war, wirkte er eher wie ein rebellischer Vierzehnjähriger. Wahrscheinlich hatten sie ihn deshalb auch mit den Papierkugeln beworfen.
Beck ging mit ihm ins Hinterzimmer und machte die Tür zu.
»Warum ich? Ist was Schlimmes?«, fragte Rauli. Seine Stimme war sanft und nicht sehr tief.
»Nein, nein«, sagte Beck. »Ich wollte dich nur fragen, ob bei dir alles klar ist. Ich hab dich gestern gesehen.«
Rauli schaute ihn misstrauisch an. »Bei was?«
»Wie du auf dem Parkplatz geweint hast.«
»Ach so … das.« Der Junge schien seltsamerweise erleichtert. »Ist kein Problem, Herr Beck. Ist alles wieder gut. Wirklich!«
»Fein. Sollte noch irgendwas sein, dann …« Beck fuhr herum. Aus dem großen Vorderzimmer des Musikraums drang plötzlich Lärm. »Wart mal«, sagte er zu Rauli und eilte zum Rest der Klasse zurück.
Die 11b war ein Tollhaus. Niemand saß auf seinem Platz, alle grölten oder buhten. Beck sah, wie der Klassenclown Jesper Lier unter dem Gelächter seiner Mitschüler auf einem Tisch stand und eine Stripshow veranstaltete. Er wedelte mit seinem ausgezogenen Hemd herum. Zwei giggelnde Mädchen knisterten mit Geldscheinen und taten so, als würden sie sie ihm zustecken. Dazu dröhnte aus den Boxen You can Leave Your Hat on. Irgendein Schüler musste die CD mit Smetanas Moldau einfach durch eine von Joe Cocker ausgetauscht haben, die Kollege Berchthold hier vergessen hatte.
Mitten im Refrain drückte Beck die Stopptaste. Alle murrten enttäuscht und setzten sich auf ihre Plätze. »Jessas, ihr seid wohl völlig verrückt geworden?« Beck ging auf Jesper Lier zu. »Wir beide reden nachher. Und was euch angeht …«, er wandte sich an die Klasse, »kann man euch nicht mal fünf Minuten allein lassen? Wir können nächste Stunde auch gerne eine Arbeit über Notationen und Partituren schreiben, wenn euch das lieber ist. Oder aber ihr reißt euch ein bisschen zusammen. Verstanden?«
Ein lautes Aufstöhnen ging durch die Klasse. Ja, ja, ihr mich auch, dachte Beck. Er wollte noch etwas sagen, als es zur Pause läutete. Alle packten ihre Sachen und verließen fluchtartig den Raum. Beck seufzte, dann ging er wieder ins Hinterzimmer. Dort traf ihn fast der Schlag. Dieser Rauli Kantas hatte sich einfach eine seiner sündhaft teuren E-Gitarren umgehängt.
»Was machst du da?«, fragte Beck ein wenig ängstlich, wie jemand, dessen Gegenüber gerade eine Waffe gezogen hatte. »Leg die wieder weg.«
»Wow, ein weiße Fender Stratocaster!«, flüsterte der Junge. »Die muss voll teuer sein. Darf ich anschließen?«
Beck wollte eigentlich nein sagen, aber dann dachte er daran, dass dieser Junge gestern noch geweint hatte. Er nickte. »Aber nur kurz.«
Rauli schmiss den Bundeswehrparka achtlos auf den Boden. Beck stöpselte währenddessen die Gitarre an den Verstärker. Der Junge schwang die Stratocaster einmal heftig herum. Was mach ich da nur, dachte Beck, dieses komische Kind haut mir das Teil bestimmt noch zu Schrott.
Und dann spielte das komische Kind. Durchs Zimmer donnerte ein mächtiges Gitarrenriff, vorgetragen in rasender Geschwindigkeit. Raulis lange Finger huschten über die sechs Saiten und entlockten der Gitarre winselnde, schneidende Klänge, die Beck nicht mal im Traum hinbekam. Der Junge griff Akkord um Akkord ab, verrenkte seine teuflisch schnellen Finger und ließ sie hoch- und runtersausen, bis Boden und Decke vibrierten und die Zimmerlampe hin- und herschwang. Ein Orkan tobte durchs Zimmer, Tische und Stühle fielen um, Holz splitterte. Beck musste sich am Türrahmen festhalten, um nicht auch davongeweht zu werden. Das Klavier zerbarst unter dem Getöse, die Scheiben des Fensters sprangen mit einem Klirren in tausend Teile, während die Wände tiefe Risse bekamen, getroffen von dieser Urgewalt. Und im Auge des Taifuns stand, völlig ruhig, ein Junge mit einer Gitarre in der Hand.
Beck musste vor Freude grinsen. »Das reicht!«, sagte er schließlich, als er endlich wieder ein ernstes Gesicht hinbekommen hatte.
»’tschuldigung«, sagte Rauli, dessen Zunge beim Spielen wie eine kleine rote Robbe aus dem Mundwinkel herausgehangen hatte.
Beck starrte ihn fassungslos an. Dieser kindliche Litauer war verdammt noch mal so gut wie Jimi Hendrix, ach was, er war besser als Jimi Hendrix. Und trotzdem lief er hier einfach so durchs Schulgebäude, ohne dass irgendjemand etwas von seiner Begabung mitbekam.
Nachdem Rauli sich bedankt hatte und in die Pause gegangen war, blieb Beck noch allein im Hinterzimmer stehen. Er spürte, wie sich der Wind drehte. Binnen Sekunden reiften in ihm Pläne heran, er sah, wie er mit Rauli spielte und diesen Rohdiamanten zu einem Juwel schliff. Er sah, wie er zur Musik zurückkehrte.
Dann entdeckte er, dass der Junge seinen Parka auf dem Boden liegengelassen hatte. Als er ihn aufhob, fiel etwas heraus. Ein durchsichtiges Tütchen mit verdächtigem Inhalt. Beck roch daran. Das altbekannte Aroma stieg ihm in die Nase, weckte Erinnerungen an stickige Proberäume und herrliche Abende an Seen mit längst verlorenen Freunden. Er betrachtete das Tütchen lange. Erstklassiges Hasch, kein Zweifel.
»Scheiße«, sagte Beck.
3
»Was wollen Sie denn hier?«
Es war Nachmittag, Beck saß an einem Ecktisch im ›Macchiato‹ und wurde von der Elfenfrau bedient, die er am Morgen bei ihrer Trennung belauscht hatte. Sie hieß, wie er von ihrem Namensschild ablas, Lara. Die letzte Viertelstunde hatte sie ihn erfolgreich ignoriert, was bei zwei Gästen nicht einfach war.
Beck räusperte sich. »Ich wollte mich entschuldigen. Das von heute Morgen war blöd von mir. Ich hätte nicht lauschen dürfen.«
»Allerdings.«
»Es tut mir leid, wirklich. Es ist mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen …« Sie sind mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. »Schauen Sie, ich hab was für Sie. Kleine Wiedergutmachung.«
Er griff in seine lederne Aktentasche und holte eine Schachtel Frigor-Pralinen heraus, das waren die besten, die sie im Hertie hatten. Frigor-Pralinen, mehr geht nicht, dachte er. Er hatte auch überlegt, ihr Blumen zu schenken, aber das wäre ja lachhaft gewesen, sie waren ja schließlich nicht in einem Dienstagabend-Hausfrauen-Filmchen, sondern in irgendeinem drittklassigen Café. Er betrachtete Laras lange schlanke Gestalt und ihre spitzen Ohren, von denen immer eines wie eine Antenne unter ihren Haaren hervorschaute.
Zögernd griff sie nach den Pralinen. Sie schien verlegen. »War’s das?«, fragte sie, aber ihre Stimme klang etwas wärmer.
»Nein.«
»Nein? Was wollen Sie denn noch?«
»Einen Kaffee.« Beck lächelte entwaffnend. »Bitte.«
Lara musste ebenfalls lächeln, widerwillig zwar, aber immerhin. Ein Anfang. Es war zwar komisch, sich an eine junge Frau ranzumachen, die eigentlich nicht sein Typ war, aber sie war wirklich süß, das musste er zugeben. Und er hatte ja Zeit. Er würde die nächsten Tage einfach immer wieder im Café vorbeischauen, viel bestellen und den guten alten Robert-Beck-Charme spielen lassen, falls es den je gegeben hatte. Und wenn’s nicht klappte, dann eben nicht, aber einen Versuch war’s wert.
Während sie wegging, griff Beck in seine Hosentasche. Es knisterte. Er hatte das Tütchen mit dem Hasch einfach behalten. Das war für ihn die einzige Lösung gewesen. Hätte er es Rauli zurückgegeben oder ihm heimlich wieder in den Parka gesteckt, wäre das eindeutig kriminell gewesen, wegen so etwas wollte er nicht den Job riskieren. Und hätte er Rauli gemeldet, wäre dieser von der Schule geflogen. Das war auch nicht in seinem Interesse. Denn dieser Junge und seine Begabung waren vielleicht genau das, was er all die letzten Jahre vergeblich gesucht hatte: gottverdammte, wahre Inspiration und der Weg raus aus den miefigen Räumen des Gymnasiums, zurück auf die Bühnen der Welt.
4
Am Nachmittag saß Beck in seinem Arbeitszimmer, dem stillen Zeugen seines gescheiterten Traums. Überall lagen Fotos von seiner alten Band Kopfgeburt herum, auch der Zeitungsartikel über den magischen Abend in der Muffathalle 1987, als sie bei einem Konzert als Vorgruppe von New Order aufgetreten waren. Der Höhepunkt seines Lebens. Kurz darauf hatten sie ihn aus der Band geschmissen.
Obwohl Beck einen Haufen Schularbeiten zu korrigieren hatte, tat er lange nichts. Schließlich nahm er seine Akustikgitarre und zupfte darauf herum. Er musste wieder an diesen Rauli Kantas denken. Wieso hatte der Junge gestern auf dem Parkplatz eigentlich geweint? Aber dann beschloss Beck, dass es ihn nichts anging, und fing mit dem Korrigieren an.
Es war früher Abend, als er endlich fertig wurde. Inzwischen lag er auf dem Bett und schaute fern. Es lief gerade Godzilla gegen Mechagodzilla. Beck stellte auf lautlos und holte aus dem Nachttisch das Jahrbuch seiner Schule heraus. Auf Seite 112 fand sich ein Foto von ihm und Anna Lind, es war für das Literaturcafé gemacht worden. Beck sah sich das Foto lange an. Annas blonde Haare verdeckten das linke Auge, wohingegen das rechte ihn anzustarren schien. Er konnte einfach nicht aufhören, Annas schönes Gesicht und das Auge anzusehen, dieses verführerische rechte Auge, das sich auf ihn heftete …
Er fing an zu onanieren. Das war jetzt seit fast fünfundzwanzig Jahren sein Patentrezept gegen Langeweile. Den Fernseher ließ er einfach laufen. Während im Hintergrund das japanische Militär gegen Godzilla kämpfte, stellte Beck sich vor, wie Anna nach Schulschluss zu ihm ans Pult kam. Sie entschuldigte sich dafür, vorhin so falsche Antworten gegeben zu haben, und revanchierte sich, indem sie sich langsam vor ihm auszog. Obwohl Beck sich bewusst war, was das für eine armselige Pornoheftchenscheiße war, erregte es ihn.
Aber dann war der Film vorbei, und es kamen die 18-Uhr-Nachrichten. Sie zeigten eine Explosion in einem Waisenhaus in Bangkok, überall sah man Krankenwagen und weinende obdachlose Kinder mit blutverschmierten dünnen Oberkörpern. Beck stellte seine Tätigkeit sofort ein. Darauf muss dann schon ein anderer kommen, dachte er, sich bei solchen Bildern einen runterzuholen.
Er räumte die Taschentücher weg und richtete sich auf. Neben ihm auf dem Bett lag das Jahrbuch. Seite 112 war umgeknickt, aber noch immer aufgeschlagen. Annas rechtes Auge starrte ihn vorwurfsvoll an.
5
Wer war Rauli Kantas? Er hatte keine Freunde. Einige Schüler hatten angeblich gesehen, wie er mit einem Revolver gespielt hatte. Er hatte oft eine schwarze Sporttasche dabei. Außerdem beschrieb er andauernd diese gelben Zettel, von denen niemand wusste, was darauf stand. Und neulich hatte Beck von einem Kollegen gehört, dass Rauli die 11. Klasse zum zweiten Mal nicht schaffen würde und damit das Abitur vergessen könne.
Beck tat das zwar leid, aber er interessierte sich nicht wirklich dafür. Ihm ging es nur um die Musik, und Rauli war von dem Vorschlag regelrecht begeistert gewesen, mit ihm nach dem Unterricht zu jammen. Er schien keine Eile damit zu haben, nach Hause zu kommen. Und so lungerten sie nach Schulende oft noch zusammen im Hinterzimmer des Musikraums herum. Beck ließ den Jungen bei diesen Sessions auf seiner weißen Stratocaster spielen, während er selbst am Klavier saß. Meist improvisierten sie, er griff eine Melodie von Rauli auf oder gab selbst eine Idee vor. Ihr Zusammenspiel war teilweise so gut, dass Beck mittlerweile ein Aufnahmegerät mitlaufen ließ.
Ärger gab es nur, als Norbert Berchthold und die grimmige Inge feststellten, dass sie aus dem Musikraum vertrieben werden sollten. Doch die beiden beschlossen schnell, sich eine neue Bleibe zu suchen. Berchthold warf ihm noch einen beleidigten Blick zu. Ja, ja, dachte Beck, während er die Tür hinter ihm schloss, verpiss dich einfach, Berchthold, und nimm deine verdammte Werner-Tasse mit.
Als sie weg waren, schloss Beck das Mikrophon an. Heute wollte er den Jungen endlich einmal singen hören. »Vielleicht fangen wir am besten mit Wonderwall von Oasis an«, sagte er. »Kennst du den Text?«
»Klar, Oasis ist ein Lieblingsband von mir.«
»Es heißt: eine Lieblingsband von mir.«
»Okay, danke.« Mit seiner leicht weinerlichen Miene sah Rauli ständig aus, als ob er sich entschuldigen wollte.
Beck nahm ihm die Stratocaster aus der Hand und stimmte sie kurz. Rauli griff sich das Mikro und kratzte sich damit an der länglichen Narbe auf seiner linken Backe, die seinem knabenhaften Aussehen einen morbiden Anstrich verlieh. Beck hätte gern gewusst, welches dunkle Geheimnis dieses Mal zu erzählen hatte oder wieso Rauli schon seit Tagen zu hinken schien. Er beherrschte sich. »Also, auf drei geht’s los«, sagte er. »Eins, zwei …«
Und dann sang Rauli endlich. Wonderwall.
Beck hatte Mühe, sich auf sein Spiel zu konzentrieren. Raulis Stimme übertraf all seine Erwartungen, das sonst hohe Krächzen wurde zu einem rauchigen, überraschend tiefen Klang, der etwas in seinem Innern sofort berührte. Es war kaum zu glauben, dass dieser stille Kerl, der sonst nie den Mund aufbekam, so viel Energie und Leidenschaft hatte. Sein Gesang war wie Zauberei. Die Zeit stand erst still, dann raste sie rückwärts, die verdorrten Pflanzen am Fensterbrett fingen wieder an zu blühen. Beck spürte, wie auch er selbst jünger wurde, seine Haut straffte sich, und mit einem Mal war er nicht mehr Lehrer, sondern wieder Teenager. Er lag auf dem Bett seines winzigen Kinderzimmers, rockte auf seiner ersten Gitarre und sang dazu, es klang furchtbar und gleichzeitig verdammt noch mal großartig.
Während Rauli den Refrain herausschrie, wanderte Becks Blick durch den Musikraum und blieb an der Zeitleiste mit den Köpfen der berühmtesten Komponisten und Dirigenten der letzten Jahrhunderte hängen. Ob Vivaldi, Mozart, Rossini, Bach und Beethoven: Man konnte die Verzückung in ihren Augen sehen. Sie hatten Jahrzehnte voller untalentierter Musikschüler miterlebt, aber dieses Genie entschädigte sie für alles.
Als Rauli fertiggesungen hatte, öffnete er vorsichtig die Augen, blinzelte herum und sah schließlich zu Beck. »Und?«, fragte er leise. »War es gut?«
6
Zu Hause konnte Beck kaum stillsitzen. Man müsste Songs für den Jungen schreiben, dachte er, aber das war ja das Problem, es fielen ihm schon seit Jahren keine mehr ein. Sein halbes Leben hatte er versucht, einen Hit zu schreiben. Ein paarmal hatte er das Gefühl gehabt, kurz davor zu sein, aber letztlich hatte er es nie geschafft.
Doch erst mal hatte er andere Probleme, er musste ein verdammtes Wichtelgeschenk basteln. Seine 5. Klasse hatte sich das Wichteln von ihm gewünscht, und als ihr Klassenleiter hatte er notgedrungen zugestimmt. Alle, auch Beck, mussten ihren Namen auf einen Zettel schreiben und in einen Topf werfen, dann zog jeder einen Zettel und würde die Person, deren Name darauf stand, zur nächsten Stunde beschenken. Bedingung war: Es sollte etwas Selbstgemachtes sein. Und so musste Beck nun für Nadine Meier, eine elfjährige Schülerin, die er überhaupt nicht kannte, etwas basteln. Er wusste nur, dass sie am Fenster saß und dass Vögel ihre Lieblingstiere waren, aber was nützte es ihm?
Gerade als er beschloss, doch etwas zu kaufen, klingelte das Handy. Es war ein kurzes Gespräch, und als er wieder auflegte, hatte er andere Sorgen als das Wichtelgeschenk. Seine Mutter war gestorben.
7
Beck hatte an seine Mutter, eine Französin, nur verschwommene Erinnerungen. Als sie damals fortging, war er vier Jahre alt gewesen, unehelich gezeugt. Nach der Trennung war sie wieder nach Paris gezogen. Ihn hatte sie zurückgelassen. Eine tiefe, schlecht vernarbte Wunde. Beck wusste von ihr nicht viel, sein Vater hatte nur selten von ihr gesprochen. Offenbar war sie zu jung und überfordert gewesen, das hatte er herausbekommen. Auch, dass sie malte und ihre Ausstellungen schlecht liefen. Und dass sie schwer krank war. Das wusste er von ihrer Schwester, sie hatte es ihm vor Monaten geschrieben. Beck hatte damals überlegt, seine Mutter in Paris zu besuchen, sich aber nicht getraut. Und jetzt war sie tot.
Seine Tante hatte ihn am Telefon gefragt, ob er zur Beerdigung kommen wolle. Er hatte ihr gesagt, dass er es noch nicht wisse. Das war gelogen. Er wollte nicht. Und er würde auch nicht kommen.
Beck war in einer eigenartigen Stimmung. Er fühlte sich nicht traurig, eher erschöpft und angeschlagen. Ihm war nicht klar, was er jetzt machen sollte. Am liebsten wollte er einfach nur still dasitzen, gleichzeitig wartete er auf eine Reaktion von sich. Dann, obwohl er es nicht wollte, erinnerte er sich dunkel an seine Mutter und wie sie ihn als kleines Kind in den Arm genommen hatte. Jessas, es hätte nicht so schlecht laufen müssen.
Eine Weile starrte Beck noch aus dem Fenster, ehe sein Blick auf Raulis Tütchen mit dem Hasch fiel, das er vor ein paar Tagen konfisziert hatte. Schnell sah er wieder weg. Dann wieder hin. Ach, scheiß drauf. Kurz darauf lag Beck in seinem roten Sitzsack und rauchte nach Jahren den ersten Joint.
8
Ein paar Minuten lang geschah nichts. Beck saß bewegungslos da und dachte nach. Dann sprang er plötzlich auf, als hätte ihn jemand von hinten mit einer Speerspitze gepikst. Er wusste, was er zu tun hatte.
Während er langsam high wurde, fing er an, wie blöd ein Wichtelgeschenk für Nadine Meier zu basteln. Aus Pappe und Klebstoff baute er ein kleines Vogelhäuschen, in das er ein kunstvoll gefaltetes, buntbemaltes Papiervögelchen legte. Auf dem Dach des Vogelhäuschens war ein Haken befestigt, so dass sie es gleich an dem Fenstergriff aufhängen konnte, neben dem sie immer saß.
Als er fertig war, lief Beck ein kleiner Schauer über den Rücken. Er sah sich sein Wichtelgeschenk lange an. Dann holte er seine Digitalkamera aus dem Schlafzimmer und fotografierte es mehrere Male voller Begeisterung. Anschließend nahm er das Vogelhäuschen wieder in die Hand, um es minutenlang noch mal ganz genau zu betrachten. Kein Zweifel. Beck war ehrlich über sich gerührt. Er hatte nicht mehr daran geglaubt, etwas so Liebevolles und Schönes erschaffen zu können.
In diesem Moment klingelte es an der Tür.
Beck richtete sich auf und öffnete. Im Hausflur stand ein zwei Meter großer glatzköpfiger Schwarzer. »Hallo, altes Arschloch. Gib mir sofort ’n Zehner, oder ich fick dich!«, sagte er und hob drohend seine Faust.
9
Beck hatte nicht viele Freunde. Früher hatte er jede Menge gehabt, aber das hatte ihn immer irritiert. Er hatte nie gewusst, was diese Menschen an ihm gefunden, wieso sie sich für ihn interessiert hatten. Er war misstrauisch gewesen und hatte nie viel von sich preisgegeben. Jetzt hatte er ein Heer von oberflächlichen Bekannten, mit denen er Billard spielen oder in Clubs gehen konnte, das lag ihm mehr.
Sein einzig verbliebener Freund von früher war Charlie Aguobe. Charlie war siebenundzwanzig, Afrodeutscher und ständig abgebrannt. Ein Hypochonder mit der Ausdrucksweise eines Sechzehnjährigen. Seinen Job als Türsteher hatte er vor kurzem geschmissen, weil er wieder studieren wollte. Wenn man es genau nahm, war Charlie also ein arbeitsloser Assi ohne Kohle, der die Leute mit seinem Angstgerede über Krebs, Aids oder Tumore nervte und seine Konversationen mit einem Vokabular bestritt, das hauptsächlich aus Wörtern wie »Ficken« und »Flachwichsern« bestand. Er war der Schlagzeuger von Becks ehemaliger Band.
»Los, zehn Mäuse her«, sagte er.
»Vergiss es.« Beck ging ins Arbeitszimmer zurück. Er ließ sich auf einen Stuhl fallen und zündete sich eine an. Charlie war ihm einfach gefolgt. Er hatte sich aus der Küche ein Bier und ein Sandwich geholt, plumpste nun auf den roten Sitzsack und fragte, was es so Neues gebe.
Beck tat einen Zug. »Meine Mutter ist tot«, sagte er mit einer bekifften Entspanntheit und in etwa der Tonlage, in der man jemanden auf einen Zeitungsartikel über ein großes Zugunglück im Norden Kasachstans hinwies.
Charlie brauchte einige Zeit, um mit dieser Nachricht fertig zu werden. Im Gegensatz zu Beck hing er sehr an seiner Mutter. Sie hatte ihn und seinen Bruder damals allein aufgezogen, nachdem sich der Vater, ein Ghanaer, aus dem Staub gemacht hatte.
»Ist das wahr?«, vergewisserte er sich noch mal. Er kaute an seinem Sandwich.
»Ja. Sie ist wohl schon gestern gestorben.«
»Woran?«
»Krebs.«
»Welcher Krebs?«
»Ist doch eigentlich egal, oder?«
»Ja, schon.«
Charlie nickte.
»Also, welcher Krebs war es jetzt?«, fragte er.
»Jessas, Charlie.«
»Mir ist so was wichtig, das weißt du. War es ein Hirntumor mit Metastasen, oder war es Lymphdrüsenkrebs? Morbus Hodgkin? Das hat nämlich neulich jemand …«
»Es war ein scheiß Lungenkrebs, glaub ich. Sie hat viel geraucht. Reicht dir das, oder willst du jetzt auch noch irgendwelche Röntgenbilder?«
Charlie entschuldigte sich und wischte sich den Mund mit einer Serviette ab. Wo hat der Typ nur auf einmal die Serviette her, dachte Beck fasziniert. Es entstand eine kurze, ergebnislose Unterhaltung, wie Beck sich nach dem Tod seiner Mutter fühle. Gegen elf Uhr brachen sie schließlich auf, um ins ›Bel Air‹ zu gehen, einen Club in der Nähe des Englischen Gartens. Sie tranken beide viel und redeten wenig, und am Ende ging Charlie mit einer hübschen Frau nach Hause und Beck allein.
10
Eine Woche später saß Beck im ›Macchiato‹ und schrieb zum ersten Mal seit Jahren wieder an einem Song. Er war noch immer bekifft, vorhin hatte er auch noch den Rest von Raulis Hasch geraucht. Beck wusste nicht, ob seine Inspiration vom Joint kam, vom Jammen mit Rauli oder von Laras schönem Gesicht. Er war nur froh, dass er eine vernünftige Melodie und einen ganz passablen Text hatte, er handelte vom Leben eines Musikers. »There was no business like show-business, there was no delusion like self-delusion …«
Der Song hieß Little Doubts, und er war für den Jungen. Instinktiv hatte Beck beschlossen, dass seine Zukunft auf den Namen Rauli Kantas hörte. Er würde ihn unter Vertrag nehmen müssen – ein weiterer Großangriff auf das Erbe seines Vaters. Sicher war das ein finanzielles Risiko, aber schließlich wollte er ja nicht ein zweiter verdammter Mike Smith werden, das Genie, das damals die Beatles abgelehnt hatte. Nur, was konnte er tun, um Rauli für sich zu gewinnen?
»Was schreiben Sie da?«, fragte Lara.
Inzwischen hatte sie sich an Beck gewöhnt. Die ganze letzte Woche war er nun schon im ›Macchiato‹ gewesen, immer am Ecktisch und immer mit einem bestimmten Blick, den er Lara zuwarf. Vor hundert Millionen Jahren, also etwa zu der Zeit, als auf der Erde noch Dinosaurier rumliefen, hatte Beck schließlich mal recht großen Erfolg bei den Frauen gehabt, und dabei hatte dieser Blick immer eine wichtige Rolle gespielt.
Während er über ihre Frage nachdachte, starrte er Lara an. Dafür, dass sie nicht sein Typ war, sah diese Elfenfrau ziemlich gut aus. Sie hatte eine Art, eine Schnute zu ziehen, die ihn an die guten alten Meg-Ryan-Filme erinnerte. Er mochte ihr mädchenhaftes Gesicht. Ihm gefiel, dass sie dezent geschminkt war und dadurch etwas Natürliches hatte. Und ihm gefielen ihre Augen, die so groß waren, dass man öfter hinsehen musste, als man wollte. Er dachte daran, wie sie sich gestern Abend noch lange unterhalten hatten. Sie lachte oft, wenn sie mit ihm sprach …
Dann fiel Beck wieder ein, dass sie ihm ja eine Frage gestellt hatte. Er wusste allerdings beim besten Willen nicht mehr, worum es gegangen war. Verdammtes Hasch.
»Was?«, fragte er schließlich.
Sie deutete auf seine Notenblätter. »Ist das ein Song? Schreiben Sie Musik?«
»Nur zum Spaß. Ist nicht für mich.«
»Nein? Für wen dann?«
»Ach, für einen Freund.« Freund? Wieso hatte er das gesagt?
»So, so. Darf ich mal sehen?«
Beck verdeckte das Notenblatt mit dem Songtext. »Es ist noch nicht fertig.«
»Schade. Und was ist, wenn Sie es fertighaben?«
»Wissen Sie was? Wenn ich das hier jemals fertigkriege, dann spiel ich Ihnen mal was vor. Natürlich nur, wenn Sie wollen.«
Jetzt galt es. Der Köder war ausgelegt.
»Sicher will ich«, sagte sie. »Wie oft lernt man schon jemand kennen, der Songs schreibt? Wissen Sie, als ich ein kleines Mädchen war, hab ich immer für Musiker geschwärmt.«
»Ich war mal Musiker.«
»Ja, und ich war mal ein kleines Mädchen … Außerdem ist es doch gar nicht für Sie. Oder doch?«
»Nein, nein. Sie haben recht. Ich war nur nostalgisch.«
Er sah sie an. Sie sah zurück. Für einen Moment war alles so leicht. Dann mischte sich ein anderer Gast ein und bestellte einen Espresso, und die Stimmung war dahin.
Als Lara später mit der Rechnung zu Beck kam, sah sie ihn länger an als sonst. »Das macht dann sechs siebzig, Mr. Robert Beck Music-Star.«
Beck blickte erstaunt zurück. »Woher kennen Sie meinen Namen?«
Sein Herz tat einen kleinen Sprung bei dem Gedanken, dass sie sich vielleicht heimlich über ihn erkundigt hatte.
Lara deutete auf seine Mappe mit den Notenblättern, auf der groß und fett stand: ROBERT BECK, MUSIK.
»Ach so.« Beck ärgerte sich. Wie lächerlich war das denn, dass sie sich heimlich über ihn erkundigte, sollte sie etwa mit Mantel und Hut in einer finsteren Seitengasse neben dem Gymnasium stehen und das Kuvert eines bestochenen Schülers entgegennehmen, in dem ein Foto mit seinem Namen lag? Das ist doch Bockmist, dachte Beck, ich muss mich zusammenreißen, bevor es noch peinlicher wird.
»Um gleiche Verhältnisse zu schaffen: Ich heiße Lara Zachanowski mit vollem Namen«, sagte sie. »Also falls es dich interessiert.«
»Ein bisschen.«
»Ich nehm dich übrigens beim Wort«, sagte sie, als er sich in Richtung Tür bewegte.
»Ach ja?«, fragte er, während er registrierte, dass sie zum Du übergegangen war.
»Wenn du den Song fertighast, will ich ihn hören.«
»Also gut. Das dauert aber noch ein wenig.«
»Das macht nichts. Solange du ihn hier schreibst.«
Sie drehte sich verschämt weg. Beck blieb erstaunt stehen. Das war doch jetzt gerade ein richtiger Flirt, oder nicht? Wieso lief es auf einmal so gut?
»Mal sehen«, sagte er schließlich und setzte ein verunglücktes, eigentlich richtig dämliches Grinsen auf, ehe er das Café verließ. Draußen haderte er eine Zeitlang mit sich selbst. Mal sehen? Was Besseres hatte er nicht? Eine junge attraktive Frau wollte sich mit ihm verabreden, und er sagte einfach nur: Mal sehen?
Er fing also tatsächlich wieder an, Fehler zu machen. Er hatte sich in einen Jugendlichen zurückverwandelt, der das erste Date nicht auf die Reihe bekam. Er spürte den Reiz der Schwierigkeiten und Hindernisse, er würde diese Nacht nicht schlafen können, sondern sich sein Versagen vorwerfen und am nächsten Tag wieder im Café sitzen und auf die Erfüllung seiner unrealistischen Sehnsüchte warten. Das alles war ein einziges Elend. Es war herrlich.
Vier Gespräche zwischen Beck und seinen Freundinnen, über die Liebe:
Gespräch 1
Beck und Melanie, seine erste Freundin, essen Eis. Er ist vierzehn.
MELANIE,
ihr Eis schleckend: »Ich liebe dich.«
BECK:
»Cool.«
MELANIE,
ungeduldig: »Und, was ist mit dir?«
BECK:
»Wie, mit mir?«
MELANIE:
»Na, liebst du mich auch?«
BECK,
gutmütig: »Weiß nicht, ich glaub nicht, wieso?«
MELANIE:
Wendet sich ab.
Gespräch 2
Beck und Nina, seine dritte Freundin, haben gerade miteinander geschlafen, das Einzige, was sie seit Wochen tun. Er ist siebzehn.
NINA,
sich an ihn kuschelnd, flüstert: »Liebst du mich eigentlich?«
BECK,
rauchend, lange Pause, dann achselzuckend: »Keine Ahnung. Ist das für dich wichtig? Ich dachte, wir schlafen nur miteinander.«
NINA:
Wendet sich ab.
Gespräch 3
Beck und Franca, seine sechste Freundin, sind gerade im Kino gewesen. Er ist dreiundzwanzig.
FRANCA,
ihren Kopf auf seine Schulter legend: »Du?«
BECK:
»Ja?«
FRANCA:
»Ich hab gerade nachgedacht, was das mit uns ist.«
BECK:
»Und?«
FRANCA:
»Mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, was du für mich empfindest.«
BECK:
»Was meinst du damit?«
FRANCA:
»Na ja, ob du mich zum Beispiel liebst?«
BECK,
viel zu überschwenglich lügend und langgedehnt: »Klaaar.«
FRANCA:
Wendet sich ab.
Gespräch 4
Beck und Jasmin, seine neunte Freundin, kommen aus einem Club, sie sind angetrunken. Er ist zweiunddreißig.
JASMIN,
in einem alkoholseligen Zustand: »Ich liebe dich.«
BECK:
Nickt.
JASMIN,
laut, in die Straße hinein: »Ich glaube, ich liebe diesen Kerl.«
BECK,
ängstlich: »Psst, nicht so laut.«
JASMIN,
noch immer leicht lallend: »Und was ist mit dir, liebst du mich?«
BECK,
inzwischen erfahrener und ruhig: »Ja.«
JASMIN:
Küsst ihn.
BECK:
»Ich mein, wie man halt so jemanden liebt, nach vier Monaten.«
JASMIN:
Wendet sich ab.
11
In den nächsten zwei Wochen spielte Beck nach der Schule mit Rauli oder hörte ihm zu, wie er Stücke von Oasis sang. Abends saß er dann zu Hause, kiffte (das Zeug besorgte er sich von einem Bekannten von Charlie) und schrieb Songs für den Jungen. Beck musste sich eingestehen, dass er Rauli Kantas mochte. Dieser kindliche Litauer war eine verhuschte, stille Gestalt, nicht unsympathisch. Sie redeten nur wenig, das war angenehm.
Mit Lara redete er dafür umso mehr, er steckte sein Gehalt in Milchkaffees und Kuchenstücke, sie spazierten nach ihrer Schicht manchmal zusammen bis zu ihrer Wohnung, aber es geschah nichts weiter. Nie ging er mit nach oben. Beck wusste von ihr noch immer kaum etwas, nur, dass sie siebenundzwanzig war, Kunstgeschichte studierte und kein Fleisch aß, ansonsten heulte sie sich bei ihm pausenlos über ihren Exfreund Carsten aus. Er würde ihr noch Geld schulden, und außerdem hätte er die Trennung überhaupt nicht verkraftet, neulich habe er sie nachts besoffen angerufen. Dreißigmal.
Beck fragte sich, wie seine nächsten Schritte bei Lara aussehen sollten. Sie mal zum Essen einladen war sicher richtig. Einfach mal was wagen, dachte er. Dann ärgerte er sich. Was wagst du denn, du Arsch, fragte er sich, sie zum Essen einladen ist doch kein Wagnis. Eine Million im Casino auf Rot setzen, das ist ein Wagnis. Woher kam nur diese Feigheit, das konnte er doch alles besser.
Beck wusste, dass er nicht mehr so gut aussah wie vor ein paar Jahren, sein Doppelkinnansatz war deutlich sichtbar, und tiefschürfende Unterhaltungen hatte er auch nicht drauf. Trotzdem war es ihm nie schwergefallen, Frauen herumzukriegen. Die Leute hatten früher oft seine Freundinnen gesehen und zu ihm gesagt: »Nie im Leben, wieso ist die mit dir zusammen?« Er hatte nur lässig gegrinst und sich nichts dabei gedacht. Vielleicht war das der Grund seines Erfolgs gewesen. Dieses sich nichts dabei denken. Bei Lara war es anders. Er wollte sie ins Bett kriegen, sicher, aber da war noch was anderes. Er dachte sich was dabei.
12
Am Freitagabend saß Beck mit Charlie in einem neueröffneten Club Nähe Theresienstraße. Charlie redete wie immer pausenlos vor sich hin: dass er unerklärliche Kopfschmerzen habe und vermutlich schwer krank sei, dass er gestern eine heiße Frau flachgelegt habe, dass Kylie Minogue den besten Hintern der Welt habe, dass er neulich im HL-Supermarkt um fünf Mark beschissen worden sei. Als schließlich eine Gruppe Studenten den Club betrat, sagte er, dass es richtig gewesen sei, seinen Türsteherjob zu kündigen, um wieder zu studieren. Es sei damals ein Riesenfehler gewesen, das Philosophiestudium abzubrechen. Oder?
»Ja, sicher.« Beck nickte gelangweilt. Seine Gedanken waren bei Lara, aber von ihr wollte er Charlie nichts erzählen, er hatte das Gefühl, dass das nicht zusammenpasse. Stattdessen redete er von Anna Lind, die sich für das nächste Literaturcafé schon wieder ein Buch von ihm geliehen hatte.
Charlie stöhnte auf. »Robert, sag mir bitte nicht, dass du noch immer in diese Schülerin verknallt bist. Ich sag nur Kündigung und zurecht ewiges Höllenfeuer.«
»Und ich sag nur Anna Lind«, gab Beck zurück, der wie aus dem Nichts in alberner Stimmung war und ihn ärgern wollte. »Langes blondes Haar, hinreißende Figur, vielleicht ein bisschen verdorben. Oh, Anna, Anna, Anna.«
»Das ist krank, das muss ich mir echt nicht mehr antun.«
»Das war nur ein Witz, verdammt.«
»Ja, klar.«
Charlie ging auf die Tanzfläche. Sofort wurde er von zwei Frauen angetanzt. Charlie hatte es eben leicht. Er war ein großer parfümierter Athlet, sehr gutaussehend, dazu ein charmantes Lächeln. Auf so einen stehen die Frauen, dachte Beck. Er selbst war dagegen … Na ja, schwieriges Thema. Den Rest des Abends verbrachte er an der Bar.
13
Ende März saß Beck zu Hause und wartete auf Rauli Kantas. Sie wollten zusammen zum Oasis-Konzert gehen. Beck hatte von einem Bekannten, der beim Vorverkauf arbeitete, zwei Karten bekommen und nach langer Überlegung beschlossen, dem Jungen eine davon zu geben. Schließlich hatte er den festen Plan, Rauli unter Vertrag zu nehmen, da konnte so was nicht schaden. »Das ist Herr Beck, der Lehrer, der mich mal zu einem Oasis-Konzert mitgenommen hat«, würde der Junge dann später vielleicht zu seinen Eltern sagen, bevor diese gerührt einwilligten, dass Beck der Manager ihres Sohns wurde. Er war sich sicher, dass die Sache mit Rauli gut laufen würde. Bis auf den Zwischenfall mit dem Hasch konnte man sich keinen höflicheren, ehrlicheren Jungen vorstellen.
Es war sieben Uhr abends. Beim Warten zappte Beck herum und landete schließlich bei der Serie Power Rangers Dino Thunder. In einer Szene kämpften erwachsene Männer und Frauen, als Jugendliche geschminkt, in lächerlichen, grellbunten Kostümen. Sie fuchtelten mit ihren Händen herum und brüllten Dinge wie: »Achtung, Tyrannosaurus-Attacke!« Ihre Gegner, hässliche Stein- oder Dinosaurier-Klumpen, wurden vernichtend geschlagen und traten den Rückzug an.
Es läutete an der Tür. Beck schaltete aus und öffnete.
»Hallo, Herr Beck«, sagte Rauli mit seiner hohen Singsang-Stimme. Es klang, als würden die Worte nacheinander in einen ächzenden Schredder geschmissen. In seinen Händen hielt der Junge eine rosafarbene Schachtel. »Habe ich Ihnen was mitgebracht.«
»Es heißt: Ich habe Ihnen was mitgebracht.«
Rauli nickte und öffnete die Schachtel. Darin lag ein angedatschter Käsekuchen. »Mein Bruder Genadij ist Bäcker. Ist für Sie.«
»Oh … Toll … Danke«, murmelte Beck. Er nahm den Kuchen und stellte ihn irgendwo auf eine Kommode. Dann führte er den Jungen herum. Das Wohnzimmer war riesengroß, so groß wie Frankreich. Eine Filmsammlung eröffnete den Raum, der von dem gewaltigen Fernseher beherrscht wurde, daneben standen zwei Regale mit Tausenden von Platten und CDs, alles aufgebaut mit Becks Gehalt und dem Erbe seines Vaters.
Rauli sah sich um. »Sie haben ein coole Wohnung, Herr Beck. Ich lebe mit Vater und Bruder, aber unser Wohnung ist nur halb so groß.«
»Hm«, sagte Beck, dem dieser Vergleich unangenehm war und der hoffte, dass jetzt kein längeres Klagelied folgte. Es war schon unnatürlich genug, dass er etwas mit einem Schüler unternahm, das reichte ihm. Von seiner Familie wollte er erst gar nichts wissen.
»Wow, so viele Pokale«, sagte Rauli, als sie an Becks Schlafzimmer vorbeikamen. »Sie waren früher bestimmt eine echt gute Sportler.«
Er hatte die Betonung auf »früher« gelegt und musterte nun den fett gewordenen Beck. Der nickte gequält. Die Pokale waren nicht echt, sondern bestellt. Aus Langeweile hatte er sich an einem Wochenende bei eBay eine Tenniskarriere zusammengekauft, die tragischerweise von einer Verletzung gestoppt worden war. Kreuzbandriss oder so.
Beide standen nun im Flur und wussten nicht, was sie miteinander reden sollten. Sie hatten noch zwanzig Minuten, wie Beck mit Schaudern feststellte.
»Ich muss noch ein paar Mails beantworten«, sagte er schnell. »Du kannst fernsehen, wenn du willst.« Er deutete zum Wohnzimmer und war über diese Ausrede ganz froh, denn er hatte keine Lust, sich mit Rauli zu unterhalten.
Als Beck nach zwanzig Minuten wieder aus seinem Schlafzimmer trat, suchte er den Jungen. Komisch, im Arbeitszimmer war er nicht, und auch das Wohnzimmer war leer. Nur ein paar CDs lagen auf dem Fernsehtisch gestapelt. Rauli musste sie aus den Regalen genommen haben. Sie waren alle von Bob Dylan. Ausgerechnet Dylan, dachte Beck. Er hasste diesen alten Zausel mit seinen nölenden Nerv-Songs. Die CDs hatte er von seinem Vater geerbt, der sein Leben lang ein riesiger Dylan-Fan gewesen war. Er war zu jedem seiner Deutschlandkonzerte gefahren und hatte sich dort mit anderen Fans Mitte fünfzig getroffen, um heißen Punsch zu trinken und in irgendwelchen miefigen Hallen in Düsseldorf oder Oldenburg Songs über Freiheit und Protest mitzusingen. Das pure Elend.
Beck ordnete die CDs wieder alphabetisch ins Regal ein und rief nach dem Jungen. Niemand antwortete. Er ging in den Gang und rief noch mal. Wo steckte der kleine Kerl nur? Dann hörte er ein Lachen. Beck folgte dem Geräusch und öffnete die Küchentür einen Spalt weit. Wieder ein Glucksen. Drinnen stand Rauli vor seinem Kühlschrank. Ein zweieinhalbtausend Mark teures Edelstahlgeschoss mit einer integrierten Eismaschine, mit der man die Eiswürfel über einen schwarzen Schlauch direkt ins Glas schießen konnte.
Rauli hatte in der Küche verschiedene Tassen und Gläser aufgestellt und versuchte, die Eiswürfel über eine Entfernung von ein oder zwei Metern hineinzuschießen. Immer wenn er einen Schuss abgefeuert hatte, lachte er.
Beck wusste nicht, wieso, aber es war ihm unheimlich. Er schloss vorsichtig die Tür und stellte sich in den Gang. »Also, wir können losgehen«, sagte er von dort aus überlaut.
Er hörte, wie Rauli in der Küche hastig alles zusammenräumte. Wenige Sekunden später stand der Junge neben ihm und sah so blass und verpennt aus wie immer. »Ah, Herr Beck, habe nur kurz was getrunken.«
Beck nickte nachdenklich, dann sagte er zu dem Jungen, dass man CDs nicht einfach rausnehmen könne, ohne sie auch wieder an ihren Platz zu tun. Rauli druckste jedoch herum. »Kann ich mir CDs vielleicht ausleihen?«, fragte er schüchtern.
Wie bitte? Beck wollte gerade antworten, dass das leider nicht möglich sei, aber Raulis grüne Augen hatten inzwischen einen Grad an Verwässerung erreicht, der es ihm unmöglich machte, diese Hoffnung zu zerstören. Außerdem war es ja nur der bescheuerte Dylan.
»Bringe sie auch sofort zurück, Herr Beck, bitte.«
»Also gut, meinetwegen, aber ich kriege sie wirklich spätestens nächste Woche wieder.«
Rauli rannte zu den Regalen und verstaute mit hastigen Handbewegungen die Bob-Dylan-CDs in seinem Rucksack. »In ein paar Tage kriegen Sie zurück«, sagte er. »Versprochen.«
Beck sah sie nie wieder.
14
Sie waren spät dran, das Olympia-Stadion war bereits gut gefüllt. Beck fand das Konzert ganz okay. Rauli dagegen war begeistert. Obwohl sie ziemlich weit hinten standen, grölte er bei jedem Song mit der Menge mit, und als Wonderwall kam, war er nicht mehr zu halten. »Ist gut!«, schrie er beim Refrain und sah zu Beck. Beck nickte, und Rauli grölte weiter.
Nach dem Konzert saßen sie bei McDonald’s, er hatte den Jungen eingeladen. Während sie aßen, redete Rauli pausenlos von seiner Familie. Was textet der mich auf einmal mit diesem Zeug voll, dachte Beck. Er Er bekam zu hören, dass der Vater mit Rauli und seinem Bruder nach Deutschland gezogen war, um Geld zu verdienen. Seine Mutter und seine beiden Schwestern seien in Litauen geblieben und würden nachkommen, sobald der Vater eine Arbeit gefunden habe und so weiter und so weiter.
Beck hörte nur halb zu, er dachte lieber daran, dass Lara vielleicht noch im Café war, sie hatte diese Woche Spätschicht. Er könnte nachher bei ihr vorbeischauen, einen Espresso trinken und sie wie schon gestern zu ihrer Wohnung bringen. Dann sah er wieder zu Rauli, der stumm zurücksah. Vielleicht sollte ich doch ein wenig Konversation machen, dachte Beck. Er hatte zwar keine Lust, aber als Raulis Lehrer spürte er so etwas wie eine unausgesprochene Verpflichtung. Schließlich fragte er den Jungen nach Mädchen.
Rauli sah erst verschämt weg, aber dann begann er von Anna Lind zu schwärmen. Von ihren blonden Haaren, ihren wunderbaren Augen, ihrem Lächeln. Er taute richtig auf und gab erst Ruhe, als Beck ihm mehrmals versichert hatte, dass Anna wirklich das schönste und liebenswerteste Mädchen der Schule sei. Rauli nickte zufrieden. Beck dachte an die Gerüchte, die an der Schule über den Jungen kursierten, etwa, dass er einen Revolver habe. Absurd.
Sie unterhielten sich noch eine Weile über Tarantino-Filme oder Lehrer, die sie beide nicht leiden konnten, wobei Beck genüsslich Interna ausplauderte, es war ihm egal. Als er dabei einmal lachen musste, dachte er daran, dass er Angst vor diesem Treffen gehabt hatte. Doch wie er jetzt feststellte, kam er ziemlich gut mit Rauli aus, obwohl sie nicht im Musikraum saßen, wo sie hauptsächlich Gitarren- und Klaviersaiten zur Verständigung benutzten. Raulis kindlicher Eifer war einfach ansteckend. Alle Dinge des Lebens beantwortete er mit einer unschuldigen Neugier, er wollte über die Warhol-Bilder an der Restaurantwand Bescheid wissen oder wieso Beck so einen großen Kühlschrank habe, er fragte ständig nach und schien einfach froh, dass sich jemand mit ihm beschäftigte.
Beck war darüber erstaunt, dass ihm ein junges, selbständig denkendes Geschöpf mit eigenen Ideen und Gedanken gegenübersaß, das ein so anderes Leben führte als er selbst und mit dem er sich trotzdem über Reservoir Dogs unterhalten konnte. Das war etwas, was er sich immer wieder bewusstmachen musste, dass die Menschen eigenständig und unabhängig waren und auch dann noch existierten und redeten und vor sich hin träumten, wenn er den Raum verlassen hatte oder nicht an sie dachte.
Gegen halb ein Uhr nachts fuhr er Rauli nach Hause. Beck machte allerdings einen kleinen Umweg und lenkte sein silbernes Cabriolet zuerst in die Clemensstraße. Er wollte schauen, ob das Café noch aufhatte, aber nein, es war zu spät. Hinter den Fenstern war es dunkel, sie war bereits gegangen. Einen Moment war Beck enttäuscht, dann entdeckte er zwei Straßen weiter doch noch Lara. Sie stand vor einem Hauseingang und wurde von einer Gruppe Männer bedroht.
15
Beck hielt einige Meter entfernt. Er sagte zu Rauli, dass er im Wagen warten solle, dann stieg er aus und ging zu Fuß weiter. Als er näher kam, sah er, wie Lara von einem Typ, der ungefähr Mitte zwanzig war, bedrängt wurde. Daneben standen zwei weitere Männer, beide ebenfalls in den Zwanzigern.
»Hey!«, sagte Beck. Alle sahen ihn an. »Hey, hey, hey!«, sagte er noch mal laut, ärgerte sich aber sofort. Das war mindestens ein »Hey« zu viel, dachte er, das hörte sich jetzt so an, als suche man Ärger. Einmal »Hey« ist in Ordnung, dachte er, zweimal »Hey« ist schon hart an der Grenze, dreimal »Hey« bedeutet, dass man Schläge will.
Als Lara ihn sah, riss sie sich los. »Robert!«
Der Mann, der sie eben noch festgehalten hatte, trat auf Beck zu. Gutaussehender Matt-Damon-Verschnitt. Er hatte ein helles Polohemd an und stank nach Alkohol. »Was willst du?«
Beck bemühte sich, so ruhig wie möglich zu sein, spürte aber, dass sein Herz unnatürlich stark klopfte. Die Situation war für ihn nur schwer einzuschätzen. »Darf ich fragen, wer Sie sind?«
»Ich bin ihr Freund«, sagte der Typ mit dem hellen Polohemd.
»Ist das wahr?«
Lara schüttelte energisch den Kopf. Beck sah, dass sie Angst hatte, was ihn vor die Frage stellte, ob er auch Angst haben sollte. Lara hatte ihm ja gestern erzählt, dass ihr Exfreund sie schon wieder nachts angerufen hätte.
»Nun, offensichtlich sind Sie nicht mehr ihr Freund. Wenn Sie also nichts dagegen haben, würden wir jetzt gern gehen.«
Mit diesen Worten fasste Beck Lara an der Schulter und führte sie zu seinem Audi, der auf der anderen Straßenseite stand. Für einen Moment glaubte er tatsächlich, aus dem Gröbsten raus zu sein, als er plötzlich heftig herumgerissen wurde.
Er blickte in das nun deutlich veränderte, wütende Gesicht von Laras Exfreund. Ihm fiel auf, dass er selbst um einiges kleiner war.
»Na fein«, sagte Beck schließlich. Er war halb angepisst, halb ängstlich und griff in seine Hosentasche. »Willst du Geld, ist es das?«
Er war einfach zu alt für diesen Mist. Okay, die Geldmethode war natürlich erbärmlich, und das auch noch vor Lara, aber das war nicht die Zeit, den Helden zu spielen. Was sollte das denn, was waren das überhaupt für überzogene Erwartungen, die man da hatte, dass man diesen Scheißkerl jetzt halb zu Tode prügelte, wo kam das her, diese Bilder, wie er den Exfreund mit einem Schlag niederstreckte, das ist doch unrealistisch, dachte er, das ist ja schließlich nicht Power Rangers Dino Thunder hier, und wenn man ehrlich ist, dann ist man wahrscheinlich auch schwächer als der Typ in dem Polohemd, dann bekommt man was aufs Maul und wird zusammengeschlagen, und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
»Ich scheiß auf dein Geld«, sagte Laras Exfreund. »Ich bin noch nicht fertig mit ihr. Sie hat mir ein paar Fragen zu beantworten.«
»Was für Fragen?«
»Das geht dich nichts an.«
Beck spürte, wie Lara sich so fest an ihn klammerte, dass es ihm weh tat. Er sah sich um, ob ein Passant diese Szene vielleicht mitbekommen und Hilfe gerufen hatte, aber sie waren allein. »Ich denke, das geht mich sehr wohl was an.«
»Du lässt mich jetzt mit ihr allein reden. Sie hat mich beklaut.«
»Also das ist doch lächerlich. Außerdem bist du betrunken. Du wirst jetzt erst mal gar nichts mit ihr allein machen. Aber du kannst sie morgen gerne anrufen, da werde ich nicht stören.«
Laras Exfreund kam näher. Er hatte etwas Wildes, Unberechenbares in den Augen, das Beck nicht gefiel und ihm – das konnte er ruhig zugeben, da ging er ganz gelassen mit um – zum ersten Mal richtig Angst machte.
»Halt!«, sagte Beck jetzt und streckte seinen Arm aus. Er hatte vor kurzem eine Fernsehsendung über Gewalt gegen Frauen gesehen, und eine der Hauptthesen dieser Sendung war gewesen, dass Frauen ihre Angreifer laut und deutlich zurückweisen sollten, am besten mit ausgestrecktem Arm, alles andere würde sie nur zu Opfern machen.