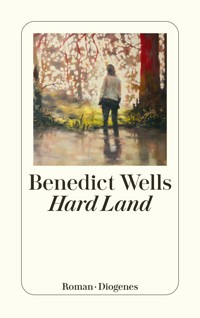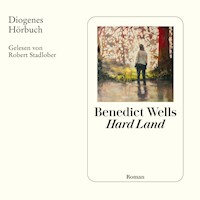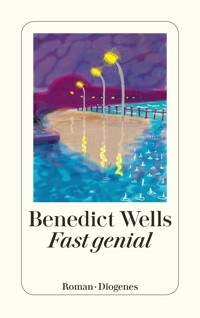
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich hab das Gefühl, ich muss meinen Vater nur einmal anschauen, nur einmal kurz mit ihm sprechen, und schon wird sich mein ganzes Leben verändern.« Die unglaubliche, aber wahre Geschichte über einen mittellosen Jungen aus dem Trailerpark, der eines Tages erfährt, dass sein ihm unbekannter Vater ein Genie ist. Gemeinsam mit seinen Freunden macht er sich in einem alten Chevy auf die Suche nach ihm. Eine Reise quer durch die USA – das Abenteuer seines Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Benedict Wells
Fast genial
Roman
Diogenes
Für Helene und Adrian, die für mich wie Schwester und Bruder sind
Nach einer wahren Geschichte …
»Where I am, I don’t know, I’ll never know,
in the silence you don’t know,
you must go on, I can’t go on,
I’ll go on.«
Samuel Beckett
Irgendwann im Jahr 2005
Claymont
1
»Ich werde abhauen!«
Wie so oft saß Francis in der Psychiatrie, neben ihm seine Mom. Der Stuhl war zu klein für ihn, die Lehne drückte ihm in den Rücken. Er schloss die Augen und stellte sich vor, wie er von einer Klippe sprang und mit dem Kopf voran ins Meer tauchte.
Seine Mutter redete weiter: »Ich werde fliehen oder mir einen Anwalt nehmen. Das ist alles deine Schuld, Francis, du hast mein Leben kaputtgemacht!«
Seit er sie mit Hilfe des psychiatrischen Notdienstes in die Klinik gebracht hatte, war sie nicht besonders gut auf ihn zu sprechen.
Sie warteten auf den Arzt. Francis nahm eine Münze aus der Tasche: Kopf bedeutete, dass alles gut ausging, Zahl das Gegenteil. Gespannt schnippte er das Zehncentstück in die Luft und fing es mit dem Handrücken wieder auf. Jetzt galt’s, Kopf oder Zahl. Er wollte gerade nachsehen, da ging die Tür auf, und Dr. Sheffer kam ins Zimmer, der neue Oberarzt.
Er nickte Francis zu und berührte die Schultern der vierzigjährigen Frau, die auf dem Stuhl saß und nun völlig abwesend wirkte. »Seit wann ist sie in diesem Zustand?«
»Seit ungefähr einer Woche.« Francis rieb sich die Augen. »Seitdem ist sie vollkommen irre, wenn man das so sagen kann.«
Doch, dachte er, das konnte man so sagen.
Der Arzt machte sich Notizen und ging die Akte durch, Katherine Angela Dean war auf dem Deckblatt zu lesen. »Ihre Mutter hat eine schizoaffektive bipolare Störung?«
Francis zuckte mit den Achseln. »So geht das schon seit Jahren. Und wenn sie dann noch ihre Medikamente absetzt, kommt der totale Zusammenbruch.«
»Das habe ich mir gedacht«, sagte seine Mom. Sie schien mit sich selbst zu reden und schüttelte den Kopf. Dr. Sheffer blickte sie an. Die dunklen Haare hingen ihr ins Gesicht, sie hatte Augenringe und konnte trotz ihrer Müdigkeit kaum stillsitzen. Doch selbst in diesem Zustand war ihre Schönheit unverwüstlich.
Francis erzählte von ihrer Krankheit und der Aggressivität ihm gegenüber; dass sie kaum noch schlief und sich von ihren Nachbarn und ihrem Exmann Ryan verfolgt fühlte. »Sie hat sogar unsere Handys weggeworfen, weil sie dachte, dass da irgendwelche Peilsender eingebaut sind.«
Seine Mom erwiderte seinen Blick. Plötzlich drückte sie liebevoll seine Hand. Francis drückte überrascht zurück. Für einen Moment vergaß er den Wahnsinn und fühlte sich ihr nahe, wie früher als Kind, und es brach ihm das Herz, sie nun schon zum dritten Mal hier sitzen zu sehen.
»Wie alt sind Sie?«, fragte ihn der Arzt.
»Fast achtzehn.«
»Sie wirken älter.«
Francis hörte das öfter, er wusste noch immer nicht, was er darauf sagen sollte.
Dr. Sheffer überflog wieder die Unterlagen. »Haben Sie Geschwister?«
»Ja, Nicky, mein Halbbruder. Er lebt jetzt aber in New York bei meinem Stiefvater. Mom und ich wohnen allein.«
»Was ist mit Ihrem leiblichen Vater?«
Francis schaute zu Boden. Das war die große Frage. Er wusste nicht, wer sein Vater war. Seine Mutter hatte es ihm nie sagen wollen. Sie hatte nur einmal erzählt, dass es eine kurze Affäre mit jemandem von weit weg gewesen sei. »Weit weg« konnte vieles bedeuten, vielleicht war sein Vater Australier oder Engländer. Aber wahrscheinlich verbarg sich hinter »weit weg« nur ein Yuppie-Arsch, der sich L.A. ansehen wollte und nach einem Lakers-Spiel seine Mom gevögelt hatte. Als Cheerleaderin hatte sie viele Verehrer gehabt, und wie’s aussah, hatte damals einer von ihnen seine Gene in den Ring geworfen und, ohne es zu wissen, einen Sohn gezeugt.
»Ich kenne meinen Vater nicht. Ich weiß auch nicht, wie er heißt.«
Dr. Sheffer nickte und klappte die Akte zu. »Ihre Mutter ist bei uns in guten Händen«, sagte er. »Das Wichtigste ist, dass sie erst mal zur Ruhe kommt und schläft.« Was nichts anderes bedeutete, als dass sie seine Mom mit Medikamenten vollstopften und auf der Station festhielten.
Es klopfte. Steve, der dicke Pfleger, den Francis schon von früheren Aufenthalten kannte, schlurfte herein. »So, Mrs. Dean, dann bringe ich Sie mal auf Ihr Zimmer.«
Er führte sie geduldig hinaus. Francis stand auf und bedankte sich bei Dr. Sheffer. Sie gaben sich die Hand. Der Arzt sah zu ihm hoch und drückte besonders fest zu, wie die meisten Männer, die nicht groß waren. Francis schnappte sich den Koffer seiner Mom und folgte ihr.
Als sie den Flur entlanggingen, fürchtete er sich schon vor Steves schlechten Witzen. Sie betraten Zimmer 039. Seine Mutter packte ihre Sachen aus, überraschend ruhig und gewissenhaft. Francis lehnte gegen die Tür und schloss die Augen, auch er hatte die letzten Tage kaum geschlafen. Er dachte an seine Mitschüler, die gerade mit ihren Familien zu Mittag aßen oder in der Mall rumhingen.
Steve versuchte ihn aufzumuntern. »Hey«, fragte er grinsend. »Wie viele Blondinen braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben?«
Francis öffnete die Augen und sah den Pfleger stirnrunzelnd an. Als das nicht reichte, zuckte er auch noch mit den Schultern.
»Fünf!« Steve spreizte triumphierend alle Finger. »Eine hält die Glühbirne, und vier drehen die Leiter!«
Um ihn nicht völlig zu blamieren, deutete Francis ein Lächeln an. Seine Mom zog ein gerahmtes Foto aus der Tasche: Ein großer, breitschultriger Junge mit schwarzen Haaren, der eine Sportjacke trug und erschöpft, aber zufrieden wirkte. Damals hatte er einen wichtigen Ringkampf gewonnen. Ziemlich lange her, wie die meisten Bilder, auf denen er zufrieden aussah.
Während seine Mom weiter auspackte, sah er sich auf der Station um. Das Linoleum im Flur quietschte bei jedem Schritt. Die Schwestern hier kannten ihn und warfen ihm mitleidige Blicke zu. Manchmal glaubte er, dass sie es nicht taten, weil er diese Sache mit seiner Mutter hatte, sondern weil er auch noch diese Sache mit seiner Mutter hatte. Die meisten Leute hielten ihn für einen perspektivlosen Versager oder einen dummen Riesen, und es war ein bisschen bitter, dass er ihnen nicht das Gegenteil beweisen konnte. Dabei war er früher richtig gut in der Schule gewesen. Immer wieder war ihm ein Satz herausgerutscht, den die Lehrer für bemerkenswert hielten, als Kind war er bei einem Eignungstest sogar mal einer der Besten gewesen. Ein paar Leute hatten deshalb geglaubt, er sei vielleicht hochbegabt. »Frankie, mein kleines Genie!«, hatte seine Mom damals oft zu ihm gesagt. Doch danach war von ihm nicht mehr viel in diese Richtung gekommen, und inzwischen war er froh, wenn die Schule sein geringstes Problem war.
Das Weiß der Klinikwände war im Laufe der Jahre vergilbt, im Fernsehraum lief eine Doku. Francis sah ein paar Patienten wie Zombies über den Flur schleichen, in Jogginghosen oder Shorts, die Haare ungewaschen und fettig. Einige brabbelten vor sich hin, andere schauten einfach nur stumpf ins Nichts, von Medikamenten sediert. Eigentlich ein gutes Setting für einen Horrorfilm, dachte er.
Die Patientenzimmer waren geschlossen, nur bei einem war die Tür halb geöffnet. Francis blieb ruckartig stehen. Durch den Spalt entdeckte er ein Mädchen, das nichts als eine schwarze Jeans und einen BH trug und sich gerade ein T-Shirt anzog. Ihr Kopf war unter dem Shirt verschwunden, er sah ihre Brüste, dann tauchte ihr Gesicht auf; weiße Haut, schulterlange schwarze Haare, ein feingeschwungener Mund. Dazu große, dunkle Augen – die nun in Richtung Tür blickten.
Francis erschrak, er wusste nicht, was geschehen war. Jemand hatte seinen Kopf gepackt und mehrmals in eisiges Wasser getaucht. Jemand hatte ihn auf ein Katapult gelegt und tausend Meter in die Höhe geschossen. Jemand hatte ihm mit voller Wucht gegen die Brust geschlagen, doch es tat nicht weh. Alles geschah auf einmal. Es war 14:32, als sich für Francis Dean alles änderte.
Er konnte den Blick nicht von dem Mädchen abwenden. Sie hatte Piercings im Ohr und an der Nase, ihre Handgelenke waren bandagiert; wahrscheinlich ihr Ticket für Zimmer 035.
Im ersten Moment schien sie sich zu ärgern, dass sie die Tür offen gelassen hatte, dann kam sie auf ihn zu. »Verpiss dich, du Spanner!«
»Ich wollte nicht … Ich bin nur vorbeigelaufen, und da …«
Sie streckte ihm den Mittelfinger entgegen und knallte die Tür vor seiner Nase zu.
Francis blieb noch einen Augenblick vor dem Zimmer stehen und las, was auf dem Türschild stand: Anne-May Gardener. Den Namen würde er sich merken.
2
Claymont war ein Provinznest an der Ostküste, gerade noch groß genug für die Standardausrüstung einer Kleinstadt: McDonald’s, Papa John’s, Starbucks, Wal-Mart, Subway und Lucky Brand Jeans. Für Festivals oder eine Universität war der Ort drei Ecken zu klein, und wer was im Leben vorhatte, haute gleich nach der Schule ab. Die restlichen Bewohner von Claymont hatten Minderwertigkeitskomplexe, weil sie hier lebten und nicht im dreißig Meilen entfernten Jersey City, so wie die Leute in Jersey City Komplexe hatten, weil sie dort lebten und nicht in New York. Die größten Komplexe aber hatten die Menschen, die im Pine-Tree-Trailerpark draußen am Stadtrand hausten. Es waren Verrückte, Verlierer oder kaputte Familien. Selbst die meisten Kinder wirkten schon verstört, mit raspelkurzen Haaren, schlechten Zähnen und einem debilen Gesichtsausdruck, den man nur bekam, wenn einem das Leben die Unwissenheit ins Gesicht getackert hatte. Hier lebte Francis mit seiner Mutter seit zweieinhalb Jahren. Durch ihre Krankheit hatte sie ihren Job als Sekretärin in einer Immobilienfirma verloren, kurz darauf hatte sich sein Stiefvater an der Börse verspekuliert. Von dem bisschen Geld, das er ihnen gab, hatten sie die Miete für die Wohnung im Zentrum nicht mehr bezahlen können. Danach hatten sie erst in einem Motel 6 gewohnt, ehe sie schließlich in eines der siebzig verfallen wirkenden Mobile Homes am Rand von Claymont gezogen waren.
Anfangs hatte es Francis gestört, aber inzwischen war es ihm egal. Hin und wieder bekam er zwar mit, wie die Polizei jemanden verhaftete, oder er beobachtete eine Schlägerei, bei der jemand halb totgeprügelt wurde. Aber ein Typ wie er, über eins neunzig groß und durchtrainiert, kam hier draußen ganz gut zurecht. Und es gab in der Siedlung auch nette und normale Leute. Seinen Nachbarn Toby Miller zum Beispiel, der mit allerlei Zeugs dealte, damit er und seine Familie über die Runden kamen. Auch Toby träumte davon, hier eines Tages abzuhauen, nach Williamsburg. Dort würde er ein Lokal aufmachen, eine Frau finden und ein neues Leben anfangen. Der Punkt war nur, dass jeder hier draußen irgendwann dieses bestimmte Gefühl bekam. Manche mit zwölf, andere mit sechzehn, einige hatten es auch schon von Geburt an. Dieses Gefühl, dass man niemals von hier wegkommen würde.
Als Francis an diesem Tag die Fliegengittertür zum Trailer aufstieß, war er glücklich wie lange nicht. Anne-May Gardener. Unter anderen Umständen hätte sich der Kontakt zwischen ihr und ihm nur auf das Nötigste beschränkt. Sie wäre ein Model gewesen und er eben er, ein potentieller Mitarbeiter bei Wendy’s in der Spätschicht. Sie wäre zu ihm an die Kasse gekommen und hätte sich einen Salat und einen Cheeseburger bestellt.
Anne-May: »Einen Salat und einen Cheeseburger, bitte!«
Francis: »Hier, macht 2,90. Willst du lieber das Maxi-Sparmenü mit Fritten für 3,80?«
Anne-May: »Nein, danke.«
Das wär’s gewesen, mehr hätte er mit ihr nicht zu reden gehabt. Aber jetzt lag sie in der Klinik, nur ein paar Zimmer von seiner Mom entfernt, und war offenbar verrückt. Falls sie da nicht sofort wieder rauskam, hatte er also jede Menge Zeit, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Morgen, gleich nach der Schule, würde er seine Mutter besuchen und auch bei Anne-May vorbeischauen, um sich fürs Spannen zu entschuldigen, und dann würde er ihr erzählen, dass seine Mom ebenfalls da sei und dass er deshalb ziemlich durch den Wind wäre, dann hätte Anne-May vielleicht Mitleid und würde sich mit ihm unterhalten. Okay, die Mitleidstour war ziemlich billig, ehrlich gesagt, sogar armselig, aber Hauptsache, man kam ins Spiel.
Francis ging in sein Zimmer, eine kleine Kammer mit ein paar Postern und einem alten PC. Das Telefon klingelte. Er ließ es einfach läuten, die meisten Anrufe verhießen eh nichts Gutes. Es hätte die Klinik sein können oder die Schule oder, noch schlimmer, einer der Exfreunde seiner Mom. Nach der Scheidung hatte sie sich immer an reiche Typen gehängt, ihm von ihnen vorgeschwärmt und von einer besseren Zukunft geträumt, bis sie dann doch regelmäßig verlassen worden war. Inzwischen waren ihre Freunde nur noch Loser, von denen einige bei einer Polizeikontrolle wohl eher schlechte Karten gehabt hätten.
Einer, er hieß Derek Blake, war nach der Trennung mal besoffen vorbeigekommen und handgreiflich gegen seine Mom geworden. Zufällig war Francis auch da gewesen und hatte sie verteidigt. Derek war wutentbrannt auf ihn losgegangen, aber Francis war ein geübter Ringer und hatte ihn schnell auf den Boden gedrückt, dann hatte er ihm noch ein paarmal in die Rippen getreten, ihn am Hemd gepackt und aus dem Trailer geworfen.
Das Telefon läutete nun schon über eine Minute. Genervt hob er ab.
»Hi Frankie, hier ist Nicky.«
Jetzt war er doch froh, dass er drangegangen war. »Hey! Was gibt’s?«
»Die Klinik hat Dad angerufen. Er sagt, Mom ist wieder krank.«
Nicky schniefte ein bisschen. Francis versuchte ihn durchs Telefon zu trösten. Er hatte nur noch selten Kontakt zu seinem kleinen Bruder, vor einigen Wochen, an Nickys dreizehntem Geburtstag, hatten sie sich das letzte Mal gesehen.
Francis gab seinem Stiefvater die Schuld; Ryan Wilco. Als er drei Jahre alt gewesen war, hatte seine Mutter in einem Café einen jungen Anwalt aus Newark kennengelernt. Bald darauf hatten sie geheiratet, und seine Mom war noch mal schwanger geworden, mit Nicky. Eine Zeitlang schien alles perfekt zu laufen. In Francis’ Kindheit gab es eine Menge Wochenendausflüge und gemeinsame Abendessen, und ein riesiges Kinderzimmer, in dem er im Stockbett oben schlief und Nicky unten. Damals hatten sie in Jersey City gelebt. Aber vor viereinhalb Jahren hatten sich seine Mutter und Ryan scheiden lassen. Streit, Unterhaltsklagen, das ganze Programm. Nicky war erst mal mit seinem Vater nach New York gezogen, seine Mom und er dagegen in Claymont gelandet. In einer laut Prospekt »unterschätzten und aufstrebenden Stadt im Herzen New Jerseys« oder anders gesagt: am Arsch der Welt. Seine Mutter hatte sich hier etwas »Neues« aufbauen wollen. »Wir zwei schaffen das«, hatte sie zu ihm gesagt, ihr Mantra. Ein halbes Jahr später war sie zum ersten Mal in der Klinik gelandet.
»Dad meint, du kannst zu uns kommen, wenn du willst«, sagte Nicky.
Francis steckte sich eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. Er schüttelte den Kopf. Zwar vermisste er Ryan und hätte nichts lieber getan, als bei ihm zu wohnen. Aber das war vorbei. All die Jahre war Ryan wie ein Vater für ihn gewesen, doch nach der Scheidung hatte er sich einfach abgewandt.
»Schon okay. Ich bleib hier.«
»Schade. Wir hätten Basketball spielen können. Ich kann jetzt den Korbleger. LetzteWochehabichJamiebesiegt:zehnzudrei.« Vor Aufregung redete Nicky zu schnell.
»Jamie Roscoe von nebenan? Aber der hat dich doch immer abgezogen.«
»Ja, früher!«
Bei der Vorstellung, wie sein Bruder jetzt den Hörer in der Hand hielt und strahlte, lächelte Francis. Schließlich war Nicky so klein, dass sich langsam alle Sorgen machten. Sein Bruder tat zwar so, als sei’s ihm egal, aber Francis wusste, dass es ihn störte. »Okay, abgemacht.« Er drückte die Kippe aus. »Ich schau bald mal wieder bei euch vorbei, und dann spielen wir eine Runde. Mich machst du bestimmt auch fertig. Du wirst langsam echt zu gut.«
Nicky gluckste am Telefon.
Nachdem Francis aufgelegt hatte, räumte er auf. Die Sachen, die seine Mutter nach ihm geworfen hatte, die schmale Küche, die verdreckte Toilette. Er reparierte auch noch den Wasserhahn. Fühlte sich gut an, etwas, was kaputtgegangen war, wieder hinzukriegen. Seine Katze kam in die Küche; sein Stiefvater hatte sie ihm damals aus dem Tierheim mitgebracht, als seine Mom das erste Mal krank geworden war. Sie strich ihm um die Beine und miaute, Francis antwortete ihr miauend. Eine Weile redeten sie auf diese Weise miteinander, er hätte gern gewusst, über was. Francis streichelte ihren Kopf und schüttete eine Portion Trockenfutter in die Schüssel. Während sie fraß, holte er seine Lose aus der Tasche und rubbelte die verdeckten Stellen frei. Der spannendste Moment des Tages: Für ein paar Sekunden konnte er hoffen, eine Million zu gewinnen und hier rauszukommen. Aber es waren nur Nieten dabei.
Am Nachmittag steckte Grover seinen Kopf ins Zimmer. »Hier bist du!«, sagte er und ließ sich auf die Matratze fallen. Grover Chedwick war sein alter Nachbar und inzwischen bester Freund, allerdings schien er kein Klischee eines Nerds auslassen zu wollen. Seine dunklen Haare waren zu kurz geschnitten, er war groß, bleich und dünn, hatte eine Hornbrille und sah ständig nach unten, so dass ihn schon Dreizehnjährige verarschten. Aus unerfindlichen Gründen lief Grover auch im Sommer in schwarzen Stiefeln herum, dazu trug er noch immer diese T-Shirts, auf denen vorne pseudolustige Sprüche standen, etwa »FBI – Female Body Inspector«. Sein heutiges war grellrot und hatte den Slogan »SAVE FERRIS«.
»Hier.« Er hielt Francis einen Stoß Papier hin. »Hab dir deine Hausaufgaben mitgebracht, falls du sie machen willst.«
»Danke, schon okay.«
»War auch mehr eine rhetorische Frage.«
Grover sprach oft langsam, als würde seine Stimme mit reduzierter Geschwindigkeit von einem Tonband abgespielt, seine Gedanken liefen jedoch auf der Vorspultaste: Er war ein Informatikgenie mit ausgezeichneten Noten und einem überragenden IQ. Zwei Software-Unternehmen hatten schon angefragt, ob er nach der Highschool für sie arbeiten wollte.
Er streichelte die Katze. »Willst du über deine Mom reden, Francis?«, fragte er vorsichtig. Grover hatte den Tick, einen immer mit Namen anzusprechen. Ihm selbst schien das nicht aufzufallen. Er war auch der Einzige, der ihn Francis nannte, alle anderen nannten ihn Frank oder Frankie.
»Danke, aber geht schon.«
Grover nickte. Er klappte seinen mitgebrachten Laptop auf, und dann spielten sie Unreal Tournament – wie so ziemlich jeden Tag. Francis wusste, dass das armselig war, aber was wäre die Alternative gewesen? Dass ein befreundeter Millionärssohn sie auf eine sommerliche Gartenparty mit hübschen Frauen einlud? So eine Party wie in den Filmen, bei der dauernd von irgendwoher Gelächter und das Ploppen von Korken zu hören waren und man sich was zu trinken holte und mit einem Haufen Idioten redete, und dann stand man auf einmal abseits neben dem süßen Mädchen, mit dem man den ganzen Abend geflirtet hatte, und unterhielt sich ein bisschen, ehe sie einen am Ärmel fasste und sagte: »Du bist irgendwie anders«, und im nächsten Moment sah man sie an, stellte das Glas weg und küsste sie …
Bullshit, dachte Francis. Nicht in tausend Jahren würden sie zu so etwas eingeladen werden, also hieß es eben: Unreal Tournament. Dabei hatte er früher eigentlich nie Probleme mit Mädchen gehabt. Er war vielleicht nicht der smarteste Typ von Claymont und konnte sich auch keine teuren Klamotten leisten. Dafür war er vor seiner Knieverletzung in der Schulmannschaft gewesen, bei den Ringern, und er war auch nicht schüchtern. Im Gegenteil, damals hatte er viele Freundinnen gehabt, ohne dass er groß darüber nachgedacht hätte. Doch bevor es mit dem Sex richtig losgegangen war, hatte seine Pechsträhne begonnen. An den Wochenenden, wenn die meisten Partys waren, musste er fast immer arbeiten. Außerdem hieß es, dass Frauen positive Ausstrahlung wichtig sei. Aber wenn er jetzt vor einer Frau stand, dachte er an die weißgestrichenen Wände im Klinikzimmer seiner Mutter, an das verblichene Gras vor dem Trailer oder an dieses Gefühl des sicheren Untergangs, wenn er in der Schule einen Test schrieb … So viel zu seiner positiven Ausstrahlung.
Er steckte sich eine Kippe an und erwähnte beiläufig, dass er in der Klinik ein Mädchen kennengelernt habe.
»Echt?« Grover tippte konzentriert auf seiner Tastatur. »Du weißt, die ersten vier Sekunden sind die wichtigsten. Da entscheidet eine Frau, ob sie dich will.«
»Na ja, die ersten vier Sekunden waren eher … mittelgut.« Francis hämmerte ebenfalls auf die Tastatur ein; sein virtuelles Ich in der Arena beförderte zwei Gegner ins Jenseits.
»Aber ist sie denn auch krank, Francis?«
Francis zuckte nur mit den Schultern, dann erzählte er von Anne-May. Erst zurückhaltend, aber bald klang es so, als wäre er ganz kurz davor gewesen, mit ihr zu schlafen.
Grover schluckte. Im Gegensatz zu Francis hatte er gar keine Erfahrung mit Frauen. Wenn man in seiner Gegenwart Wörter wie »Titten« oder »feucht« fallenließ, errötete er schlagartig. Fehlte nur noch, dass ihm wie bei einer Comicfigur Dampf zu den Ohren rauskam. Francis amüsierte das. Auf der einen Seite onanierte Grover sicher fünfmal am Tag, auf der anderen Seite hatte er wahrscheinlich Angst vor richtigem Sex. Nicht dass es bei ihm bald so weit gewesen wäre, Gott, in hundert Jahren nicht, aber trotzdem, bestimmt hatte er wahnsinnig große Angst davor, dass er mal vor einer nackten Frau stehen könnte.
Dann doch lieber Unreal Tournament.
3
Da Francis nicht zu Hause übernachten wollte, stiegen sie in den gebrauchten Chevy, den Grover zum Führerschein bekommen hatte. Seine Eltern waren wohlhabend; seinem Dad gehörte Spin Technology, eine Firma, die Virenabwehrprogramme herstellte, seine Mom war Anlageberaterin. Sie wohnten in einem weißen Schindelholzhäuschen in der Innenstadt. Die Straßen in dieser Gegend waren von riesigen Ahornbäumen gesäumt und trugen verheißungsvolle Namen wie Lincoln Lane, Dublin Avenue oder Seahaven Boulevard. Bevor Francis mit seiner Mutter hatte wegziehen müssen, hatten sie schräg gegenüber von den Chedwicks gewohnt.
»Oh, Frank, mein Armer«, sagte Grovers Mom. »Ich hab das mit Katherine gehört!« Sie nahm ihn in den Arm. »Hey, Terry, Frank ist da.«
Es polterte, dann kam Grovers Dad – hundertzwanzig Kilo, Bart und Baseballcap – zur Tür rein. »Ach, Frankie!« Er haute Francis auf die Schulter. »Ist ’ne schlimme Zeit, ich weiß. Aber ich bin sicher, deiner Mutter geht’s bald wieder gut.«
Francis nickte. Sicher würde es seiner Mom bald wieder gutgehen, das Problem war eher, dass es ihr auch irgendwann wieder schlechtgehen würde. Weil sie aus ihrer teuflischen Dreifaltigkeit aus Männern, manischer Depression und Klinikaufenthalten einfach nicht mehr rauszukommen schien.
Zum Abendessen gab es Koteletts, Kartoffeln und – für wen auch immer – Salat. Francis beobachtete, wie die Chedwicks das Fleisch kleinschnitten und es sich genussvoll in den Mund schoben. Beide waren ziemlich übergewichtig, Sex hatten sie bestimmt keinen mehr. Sie hatten das Lustzentrum vom Schlafzimmer in die Küche verlegt. War aber okay, weil es für sie zu funktionieren schien. Ihre Lebenseinstellung lautete ungefähr so: »Wenn du mal nicht weiterweißt, schmeiß ein Steak auf den Grill.« Francis fand das in Ordnung. Das Motto seiner Mom war dagegen offenbar: »Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, schlaf einfach mit dem erstbesten Typen.« Nicht unbedingt zu empfehlen.
Anders als seine Eltern aß Grover nichts, er trank nur Saft. Er schien das Essverhalten einer Boa constrictor zu haben. Er fastete zwei, drei Tage, dann fraß er auf einen Schlag wahnsinnig viel, gleich mehrere Pizzen oder Steaks, und die verdaute er dann wieder tagelang. Vielleicht war er deshalb so dürr.
Den restlichen Abend verbrachten sie in Grovers Zimmer. Die Chedwicks hatten das Souterrain saniert, und dort unten herrschte ihr Sohn nun über ein riesiges Schattenreich mit Doppelbett, Flat Screen und mehreren Rechnern. An den Wänden Poster mit Lara Croft, dem Grand Canyon und berühmten Drummern. Grover hatte selbst ein Schlagzeug, und wenn er nicht am Computer saß, spielte er stundenlang. Früher war er sogar der Drummer in einer Band gewesen, bis sie ihn rausgeworfen hatten. Der Genickschuss für sein Sozialleben, seitdem spielte er nur noch allein.
Sie sahen sich eine Serie an. Nebenbei musste Grover Klamotten anprobieren, die seine Mutter für ihn gekauft hatte: eine sackförmige Jeans und einen Wollpullover.
»Mom, du sollst mir doch nichts mehr mitbringen.« Grover begutachtete sich missmutig im Spiegel. »Damit seh ich aus wie ein pädophiler Lehrer.«
»Ach, Unsinn. Und die Hosen stehen dir ausgezeichnet.«
»Das sind Opa-Jeans, dafür wird man bei uns in der Schule geschlagen.«
Seine Mutter strich ihm als Antwort nur über den Arm und ging aus dem Zimmer. Grover sah ihr seufzend hinterher. »Die treibt mich noch in den Wahnsinn.«
»Ich mag deine Mom«, sagte Francis.
»Ja, dich behandelt sie ja auch nicht wie ein Kind. Gestern hat sie mich ermahnt, weil ich nach acht Uhr abends Cola getrunken habe.«
Es klopfte an der Tür. Mr. Chedwick kam herein, um gute Nacht zu sagen. Als er Grover vor dem Spiegel sah, gab er ihm einen liebevollen Klaps. »Deine Mutter meint’s nur gut, mir hat sie die gleichen Hosen mitgebracht. Morgen leg ich dir Geld raus, und du holst dir einfach neue. Deal?«
»Deal!« Niemand konnte so breit grinsen wie Grover. Sein riesiger Mund ließ zwei perfekte Zahnreihen aufblitzen, seine Augen leuchteten hinter den Brillengläsern.
»Und am Wochenende gehen wir mit meinen Jungs Pool spielen.«
Grover stöhnte auf. »Nur, wenn du versprichst, dass du nicht wieder deinen komischen Siegestanz aufführst.«
Sein Vater lachte. »Den hier?« Er bewegte seinen massigen Körper unrhythmisch im Kreis und schwang dazu die Arme. Es sah komisch aus, auch Francis musste lachen. Er lag abseits auf seiner Matratze und beobachtete, wie sich Grover und sein Dad neckten. In solchen Momenten dachte er oft an seinen eigenen Vater. Wo er wohl war? Hätte er ihm auch so gute Nacht gesagt oder hatte er Kinder, bei denen er’s tat? Ihn störte der Gedanke, dass sein Vater nichts von ihm wusste und vielleicht all die Jahre gern für ihn da gewesen wäre, aber nie von seinem Sohn erfahren hatte. Irgendwo da draußen war er jedenfalls, das konnte Francis spüren.
Als sie sich hingelegt hatten, redeten Grover und er darüber, was sie später machen wollten. Francis erzählte von Dave Larson, der mit ihm früher in der Schulmannschaft gewesen war und vor zwei Jahren den Highschool-Abschluss gemacht hatte. »Damals hat er allen gesagt, dass er aus diesem Nest abhauen und in Berklee Musik machen wird. Und weißt du, wo ich ihn neulich getroffen hab?«
»Wo?«
»Bei Denny’s in der Johnson Road, an der Kasse … Er hat’s echt weit gebracht.«
Francis musste an Daves leere, ernste Augen denken und was für eine Ausstrahlung er früher gehabt hatte. Man hatte ihn immer mit einem Lächeln gesehen, umgeben von ein paar hübschen Mädchen. Doch er hatte den Absprung verpasst, und jetzt war davon nichts mehr übrig geblieben. Er stieß Grover an. »Hey, was glaubst du? Kommen wir irgendwann von hier weg?«
Grover zuckte nur mit den Achseln. Dann begann er von einem Fantasy-Rollenspiel zu erzählen, das er entwickeln wollte, und von Kriegern, Fechtmeistern und Kraft- oder Empathiepunkten. Er wollte das Spiel The Tales of Ashkalan nennen. Wahrscheinlich wusste er selbst, wie albern das alles war, aber es schien ihm eine Menge Spaß zu machen, davon zu erzählen. Francis streute hin und wieder Fragen ein, wie Holzscheite, die man ins Feuer warf.
Nach dem Lichtlöschen dauerte es nicht lange, bis Grover gleichmäßig schnarchte. Francis wälzte sich auf der Matratze und lauschte dem Wind, der ums Haus wirbelte. Früher war er gar nicht der Typ gewesen, der sich über alles den Kopf zerbrach, aber in letzter Zeit lag er oft nachts wach. Er fühlte, wie sein Leben langsam feste Formen annahm. Jahrelang war alles so biegsam gewesen, so offen, jetzt, zum Ende der Schulzeit, schien alles auszuhärten, kalt und fest zu werden. Er dachte an seine Mom. Wie sie als Kind gewesen war, welche Träume und Erwartungen sie wohl gehabt hatte. Und wie sie nun auf der Station lag, krank und einsam in ihrer Verwirrung. Francis starrte an die Decke. Und dann rannte er einfach los. Er rannte aus dem Trailerpark hinaus und aus Claymont, er ließ New Jersey hinter sich, er rannte einfach immer weiter, durch Wälder und Täler, durch Meere und durch Berge hindurch. Nichts konnte ihn aufhalten. Er rannte, bis er frei war und alles vergessen hatte, was hinter ihm lag. Und während er sich vorstellte, wie das sein würde, schlief er ein.
Als Francis am nächsten Tag in der Pause an seinem Spind stand, hörte er ein paar Mitschüler über das kommende Wochenende reden. Einmal schnappte er das Wort »Party« auf. Ein paar Sekunden schaute er zu ihnen rüber, in der Hoffnung, sie würden ihn ansprechen, dann holte er sein Geschichtsbuch und einen Schokoriegel aus dem Spind und machte sich auf zum Unterricht.
Vor dem Kunstraum entdeckte er Grover, umgeben von zwei Jungs aus seinem Matheteam, den Mathletes. Sie diskutierten über ein bevorstehendes Turnier gegen andere Schulen, als Brad Jennings herantrat, ein großer Typ mit Locken und Sommersprossen. Früher war Brad ganz in Ordnung gewesen, selbst ein Nerd und World-of-Warcraft-süchtig, aber dann war er als junior gegen die Franklin High reingekommen und hatte sofort neunzehn Punkte gemacht. In den Spielen darauf sogar noch mehr. Danach hatte man ihm ein paarmal zu oft gesagt, er sei der Größte. Inzwischen war er ekelhaft arrogant.
»Hey, Chedwick«, sagte Brad. Um ihn herum standen seine Kumpels und zwei, drei Mädchen. »Stimmt das? Hab gehört, du treibst es mit Katzen.«
Ein paar der umstehenden Schüler lachten. Grover schien sich eine witzige Antwort zu überlegen, aber ihm fiel nichts ein. Francis sah, dass er ein T-Shirt trug, auf dem in weißen Lettern »ORGASM DONOR« stand. Er fragte sich, in welch abartiger Stimmung Grover sein musste, wenn er sich diese Shirts kaufte, wie er sich damit im Spiegel betrachtete und zufrieden zur Kasse ging.
Brad machte das qualvolle Miauen einer Katze nach, wieder Gelächter. Grover hatte längst aufgegeben. Wieso sich wehren, es war doch alles unvermeidlich, er hatte keine Waffen, er hatte gar nichts. Machte aber nichts, seine Würde und seinen Stolz hatte er eh bereits irgendwann in seinem ersten Highschool-Jahr verloren und seitdem nicht mehr wiedergesehen. Hilfesuchend blickte er umher.
Eigentlich wollte Francis sich raushalten, trotz seiner Statur fühlte er sich in solchen Situationen unsicher. Doch dann fiel ihm ein, wie sie Grover vor Jahren fertiggemacht und seinen Kopf in die Kloschüssel gesteckt hatten, danach hatte er mit tropfenden Haaren seine Mom angerufen. Er selbst war nur wie gelähmt abseitsgestanden und hatte zugesehen, wie Mrs. Chedwick später ihren Sohn abgeholt hatte, beide resigniert und machtlos. Es tat ihm noch immer leid.
Francis stellte sich nun vor, wie er seine Unsicherheit packte und wie ein Blatt Papier zerriss; ein alter Trick von seinem Coach. Er trat vor Brad Jennings und sagte: »Los, hau ab.«
Stille, eine atemberaubende Sekunde lang, dann kam Brad auf ihn zu. Sie standen sich Nase an Nase gegenüber. Francis überlegte, wie er ihn beim Ringen besiegt hätte. Brad war einen Tick kleiner als er und wirkte nicht sonderlich schwer. Mit dem Spaltgriff könnte er ihn ruckartig bei den Beinen packen und hochreißen. Da Brad aber auch ziemlich gehässig sein konnte, wollte er sich nicht um jeden Preis mit ihm anlegen. Er lockerte nur die Schultern und baute sich auf.
Brad schien beeindruckt, konnte vor seinen Kumpels aber nicht klein beigeben. »Hey, Dean, wie geht’s eigentlich deiner Mom?«, fragte er mit besorgter Stimme. »Mal wieder in der Klapse, oder ist sie am Rumhuren? Hab gehört, sie wurde schon öfter bestiegen als dieses Rennpferd Seabiscuit!«
Francis’ Schläfen begannen zu pochen. Er dachte an die Typen seiner Mom und wie sie sich bei ihm hatten einschleimen wollen, ihm Kram von der Tankstelle und sogar Bier mitbrachten und danach mit seiner Mutter nach nebenan gegangen waren, um sie zu ficken. Und wie seine Mom später am Abend lächelnd zu ihm ins Zimmer gekommen war, ihm durchs Haar gestrichen und gemeint hatte, dass jetzt alles gut werden würde. Bis sie dann Wochen später abserviert wurde, heulend auf dem Bett lag und sich irgendetwas einschmiss.
Währenddessen hatte er Brad Jennings an der Gurgel gepackt und ihn so heftig gegen den Spind gedrückt, dass es krachte. Francis hatte bereits mit der Faust ausgeholt, aber im letzten Moment noch gestoppt. Als er nach einigen Sekunden losließ und Brads erschrockenes, gerötetes Gesicht sah, tat ihm sein Ausbruch fast schon wieder leid.
Brad befühlte seinen Hals, die Augen aufgerissen. »Du bist ein Versager«, murmelte er. »Nur ein scheiß Versager, und das wirst du immer bleiben.«
Francis reagierte nicht, doch die Worte sickerten in ihn ein. Er zog sich die Kapuze seines Pullovers über den Kopf und ging nach draußen. Auf dem Pausenhof spielten ein paar Schüler Basketball, dahinter die Turnhalle, in der er seine Ringkämpfe gehabt hatte. Nie würde er den beißenden Geruch der Umkleide kurz vor einem Kampf vergessen. So roch Anspannung, so roch Nervosität. Francis wusste, dass er nicht mehr lange auf dieser Schule sein würde und dass sein Leben danach auf eine Sackgasse zusteuerte. Doch daran wollte er jetzt nicht denken. Das Einzige, woran er denken wollte, war das suizidgefährdete Mädchen in der Klinik seiner Mom.
4
Bevor er zu Anne-May ging, schaute Francis bei seiner Mutter vorbei, auch wenn ein Besuch bei ihr im Moment wenig brachte. Erst musste die Lithiumbehandlung anschlagen, bevor sie langsam wieder normal sein würde; das wusste er aus unzähligen Gesprächen mit Ärzten. Manchmal hatte er das Gefühl, unfreiwillig schon zwei Semester Medizin hinter sich zu haben. Ein Pfleger öffnete ihm die Tür zur Station. Im Flur hingen trostlose Bilder, aus dem Musiktherapieraum hörte er schiefen Gesang. Kaum war er in der Psychiatrie, spürte er wieder diese Beklommenheit, sie wuchs mit jedem Schritt. Vor Zimmer 039 holte Francis noch einmal Luft, dann klopfte er und trat ein.
Seine Mom sah ihn an, als wäre er ein Fremder. Sie saß auf dem Stuhl und klagte, die Vögel draußen auf den Bäumen würden sie beobachten, wären jedoch nicht echt. Francis trat an das vergitterte Fenster und schaute hinaus. Von Vögeln keine Spur. Genauer gesagt waren da noch nicht mal Bäume. Unterdessen behauptete seine Mutter, er sei Mitglied der Verschwörung gegen sie und habe sie zusammen mit seinem Stiefvater Ryan in die Klinik gebracht, um sie wahnsinnig zu machen. Francis hörte schweigend zu und räumte frische Klamotten in ihren Schrank.
Familie kam nie zu Besuch. Geschwister hatte seine Mom keine, und ihre Eltern hatte sie seit vierundzwanzig Jahren nicht mehr gesehen. In ihrer Kindheit musste irgendetwas vorgefallen sein, sie war schon als Teenager von zu Hause weggelaufen. Einmal hatte sie ihm in angetrunkenem Zustand ein paar Andeutungen gemacht, und ihm war ganz schlecht geworden. Danach hatten sie nie mehr davon geredet. Er hatte erst wieder etwas von ihrer Verwandtschaft gehört, als ihm ein Arzt davon erzählte. »In der Familie Ihrer Mutter gab es einige Fälle von Depression«, hatte er gesagt und auf die Akte gedeutet. »Ihre Mutter kann nichts für ihre Krankheit, sie ist vermutlich auch genetisch bedingt.« Francis hatte damals kaum zugehört, erst nach und nach war ihm die Bedeutung dieser Worte bewusst geworden.
Er betrachtete seine Mom. Wie sie da auf dem Stuhl saß, wirkte sie wie der verlorenste Mensch der Welt. Er ging zu ihr und umarmte sie.
»Wir zwei schaffen das«, sagte er leise.
Als er sich verabschieden wollte, hielt sie ihn noch immer fest. »Lass mich hier nicht allein, Frankie.« Ihre Augen schimmerten. »Ohne dich pack ich’s nicht … Hol mich hier raus. Bitte!«
Francis war von ihrem Ausbruch so überrascht, dass es ihm die Kehle zuschnürte. »Aber die helfen dir hier!«
Ein paar Sekunden lang tat er nichts, dann löste er sich aus ihrer Umklammerung. »Ich komm morgen wieder. Ich versprech’s dir!«
Er gab ihr einen Kuss auf die Stirn und verließ das Zimmer. Draußen auf dem Flur lehnte er gegen die Wand und atmete durch.
Als er an Anne-Mays Tür klopfte, reagierte niemand. Er öffnete zögerlich. Das Zimmer war leer, auf dem Bett lag Strickzeug, über dem Stuhl hingen schwarze Klamotten. Auf dem Nachttisch das gerahmte Bild eines kleinen, braunhaarigen Jungen. Francis nahm es in die Hand, dann betrachtete er die Romane, die danebenlagen; einer dicker als der andere. Er selbst las kaum. Ryan hatte ihm früher oft Bücher geschenkt, von Mark Twain und Michael Chabon und auch eins von seinem Lieblingsschriftsteller, diesem Hemingway. In dem Buch war es um einen alten Fischer gegangen, der eine Menge Pech gehabt hatte, aber dann hatte er draußen auf dem Meer doch noch einen riesigen Fisch gefangen und … Francis wusste nicht, wie es ausging, er hatte es nicht zu Ende gelesen.
Er suchte sie auf der Station, doch nirgendwo war sie, weder beim Tischtennis noch im Aufenthaltsraum, auch nicht beim Essen. Gerade wollte er die Klinik verlassen, da hörte er ein Lachen aus dem Fernsehzimmer am Anfang des Flurs. Dort saß Anne-May und schaute Die Simpsons.
Francis setzte sich neben sie, doch sie tat, als wäre es ihr egal. Aus der Nähe fand er sie noch hübscher. Obwohl Anne-May nicht klein war, wirkte sie filigran. Sie war schlank, ihr Haar pechschwarz und ihr Gesicht blass und ebenmäßig. Je genauer er hinsah, desto makelloser fand er es. Er musterte die Verbände an ihren Handgelenken und die Piercings. Francis hatte nie viel geredet, und in den letzten Jahren war es noch weniger geworden. Dennoch fühlte er, dass er jetzt etwas sagen musste.
»Es tut mir leid.«
Keine Reaktion.
»Ich hätte dich gestern nicht so anstarren dürfen.«
Keine Reaktion.
»Ich war nur … Es ging alles so schnell.«
Keine Reaktion. Er gab auf und schaute sich die Folge schweigend neben ihr an.
An den nächsten Tagen wiederholte sich dieses Ritual. Nach den Besuchen bei seiner Mutter setzte er sich wie selbstverständlich zu Anne-May in den Fernsehraum und schaute mit ihr Die Simpsons. Anfangs schien es sie zu stören, doch spätestens nach dem vierten Mal hatte sie sich an ihn gewöhnt.
Nach einer Woche kam es ihm sogar so vor, als ob sie ihn insgeheim erwartete. Diesmal ließ es Francis darauf ankommen und rutschte immer näher an sie heran, bis er mit seinem Knie ganz leicht gegen ihres stieß. Er hatte damit gerechnet, dass sie sich weiter wegsetzen würde, doch sie blieb dicht neben ihm. Sie trug einen schwarzen Rock und schlug ihre nackten Beine übereinander, fasziniert starrte er hin.
Dann bemerkte er, dass Anne-May ihn fragend ansah. »Wieso hängst du eigentlich dauernd hier in der Klinik rum?«
»Wir haben zu Hause keinen Fernseher.«
Sie musste lächeln. Zwar nur ein bisschen, aber er hatte es gesehen. Er holte einen Schokoriegel aus der Tasche, und als er ihre gierigen Blicke bemerkte, hielt er ihn ihr vorsichtig, wie einem Raubtier, hin.
Sie zögerte kurz, dann griff sie zu. Kauend musterte sie Francis. »Du hast aber keinen Dachschaden oder so?«
Er grinste und zuckte nur mit den Achseln.
»Weißt du, was komisch ist?« Anne-May nahm noch einen großen Bissen, dann schaute sie wieder auf den Bildschirm. »Man verliert hier jedes Zeitgefühl. Ich orientier mich nur noch an Fernsehsendungen.«
»Wie lange musst du noch hierbleiben?«
»Weiß nicht. Sie sagen’s mir nicht.«
Als die Folge vorbei war, schaltete Anne-May den Fernseher aus, blieb aber sitzen. Sie schien nachzudenken. »Spielst du gern Mikado?«
Die Frage überraschte ihn. »Wieso? Du?«
»Eigentlich nicht. Aber es ist so langweilig hier, und ich hab gesehen, dass es im Aufenthaltsraum ein Mikado gibt. Also, spielst du so was?« Sie wirkte mit einem Mal unsicher, als hätte sie Angst, er könne sie auslachen.
»Sicher.« Er merkte, dass sie noch immer misstrauisch war. »Sehr gern sogar.«
Anne-May schien erleichtert.
Im Aufenthaltsraum gab es neben Mikado noch das Leiterspiel, Dame und Scrabble. Francis hatte seit Jahren keine Brettspiele angerührt, aber er stellte fest, dass es ihm Spaß machte. Er mochte diese ruhige Art des Zusammenseins, das Gefühl, nicht viel reden zu müssen, und das Geräusch des Würfels oder der Spielfigur, wenn man sie ein paar Felder nach vorne schob.
Anne-May war jedoch in nahezu jedem Spiel unbesiegbar. Gerade legte sie schon wieder ein absurd langes Wort bei Scrabble und notierte zufrieden die Punkte auf ihrem Block. »Sieht nicht gut für dich aus …«, sagte sie mit Blick auf den Vorsprung. »Na ja, wir finden schon was, bei dem du auch mal mithalten kannst.« Sie pustete sich das Haar aus dem Gesicht und schaute ihn mit einem spöttischen Lächeln an. Ihr Mund wie so oft leicht geöffnet, so dass ihre schönen weißen Zähne hervorblitzten.
Er antwortete nichts, aber ihm gefiel es, von ihr aufgezogen zu werden. Er stand auf. »Ich muss dann mal gehen.«
Anne-May rührte sich nicht. »Wie heißt du eigentlich?«
»Francis Dean.«
»Dean«, wiederholte sie. »Bis morgen?«
Als er nach Hause kam, war es schon dunkel. Im Trailer roch es nach Essen, Rauch und kaltem Schweiß. Francis knipste das Licht an und ging in sein Zimmer. Es war so eng, dass darin nur die Matratze und sein Computer Platz hatten, noch nicht einmal ein Schreibtisch oder Schrank. Seine Klamotten bewahrte er in einem Seesack am Eingang auf.
Als sie hierhergezogen waren, hatte er die meisten seiner Sachen aussortieren müssen. »Es ist doch nur für eine kurze Zeit, Schatz«, hatte seine Mutter damals gesagt, als er deshalb geweint hatte. Doch inzwischen machte es ihm nichts aus. Seine Katze kam zu ihm gelaufen, er hob sie in die Luft und rieb seine Nase an ihrer, dann schob er ein TV-Dinner in die Mikrowelle und aß zu Abend. Immer wieder dachte er an Anne-May, und dann musste er lächeln.
5
Francis hätte es nicht zugegeben, aber der Klinikaufenthalt seiner Mom fühlte sich fast wie Urlaub an; für ein, zwei Monate war endlich mal alles geregelt, er musste sich um nichts kümmern, das taten jetzt die Ärzte und Schwestern. Und er mochte es, zu Hause selbst für alles verantwortlich zu sein. Er hatte den Trailer geputzt und aufgeräumt, Wäsche gewaschen und das Scharnier der Küchentür repariert. Abends aß er oft noch vor dem Fernseher, die Katze schnurrend auf dem Schoß.
Mit Anne-May verstand er sich immer besser. Ihr Misstrauen war verschwunden, jetzt unterhielt sie sich gern mit ihm, spielte ihm Musik vor oder lachte, wenn sie ihn in einem Spiel beim Schummeln erwischte. Sie hatte sich angewöhnt, ihn mit seinem Nachnamen anzureden. »Gib’s endlich auf, Dean«, sagte sie, wenn sie ihn mal wieder besiegt hatte.
Allerdings war sie auch ziemlich launenhaft. Es gab Tage, da sprach sie kaum und stritt sich mit den Schwestern, und als er wieder mal bei ihr im Zimmer saß, braute sich hinter ihrem Blick plötzlich etwas zusammen. »Gestern warst du in meinem Traum«, sagte sie. »Aber das war widerlich.«
»Wieso, was hab ich gemacht?«
»Du hast dich von hinten an mich rangeschlichen, dann hast du mich umgedreht, mir mit der Zunge übers Gesicht geleckt und Affenlaute von dir gegeben.«
Er grinste. »Kommt nicht wieder vor, versprochen.«
Anne-May schüttelte sich angeekelt. »Wehe, du machst so was noch mal, Dean. Dann will ich dich hier nie wieder sehen.«
Sie spielte weiter die Wütende und verzog keine Miene; ihre Art, ihn zu necken. Dann fragte sie ihn, was er selbst so träumte.
Francis erzählte ihr, dass er in seiner Kindheit zwei Träume gehabt habe, die anders als alle anderen gewesen seien. Einmal habe er geträumt, dass Ryan Wilco nicht sein richtiger Vater sei, es habe sich einfach wahr angefühlt, und deshalb sei er später auch kaum mehr überrascht gewesen, als er erfahren habe, dass es stimme.
»Und der andere Traum?«