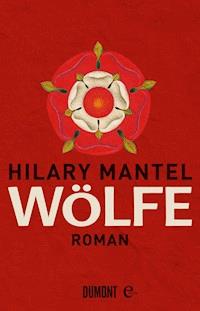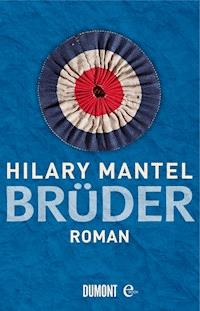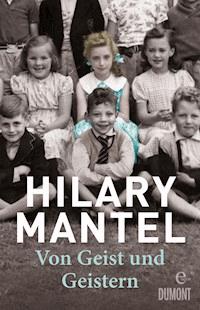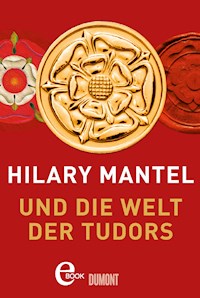18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ›Sprechen lernen‹ folgen wir Hilary Mantels Figuren ins England der Fünfziger- und Sechzigerjahre, betreten abgelegene Dörfer und Schrottplätze, besuchen altmodische Kaufhäuser und Klosterschulen. Es sind diese unscheinbaren, »von rauen Winden und derben Klatschmäulern geplagten Orte«, die zum Schauplatz eben jener Momente werden, die den jungen Protagonisten und Protagonistinnen noch lange in Erinnerung bleiben. Momente, die ihr Leben für immer prägen werden: das Verschwinden des leiblichen Vaters, die neue Identität der Mutter, das plötzliche Verlorengehen und das mühsame Sprechenlernen. Leicht, aber voller Hintersinn und mit gnadenlosem Witz gewährt uns die zweifache Booker-Preisträgerin einen erzählerischen Einblick in die Rätsel ihrer Kindheit und Jugend, ohne sie je in Gänze aufzulösen. »Diese Erzählungen bergen Welten, die so groß sind wie die der längsten Romane Mantels.« THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
In ›Sprechen lernen‹ folgen wir Hilary Mantels Figuren ins England der Fünfziger- und Sechzigerjahre, betreten abgelegene Dörfer und Schrottplätze, besuchen altmodische Kaufhäuser und Klosterschulen. Es sind diese unscheinbaren, »von rauen Winden und derben Klatschmäulern geplagten Orte«, die zum Schauplatz eben jener Momente werden, die den jungen Protagonisten und Protagonistinnen noch lange in Erinnerung bleiben. Momente, die ihr Leben für immer prägen werden: das Verschwinden des leiblichen Vaters, die neue Identität der Mutter, das plötzliche Verlorengehen und das mühsame Sprechenlernen.
Leicht, aber voller Hintersinn und mit gnadenlosem Witz gewährt uns die zweifache Booker-Preisträgerin einen erzählerischen Einblick in die Rätsel ihrer Kindheit und Jugend, ohne sie je in Gänze aufzulösen.
»Diese Erzählungen bergen Welten, die so groß sind wie die der längsten Romane Mantels.«
THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW
© Els Zweerink
Hilary Mantel, geboren 1952 in Glossop, gestorben 2022 in Exeter, England, war nach dem Jurastudium in London als Sozialarbeiterin tätig. Für ihre Romane ›Wölfe‹ (2010) und ›Falken‹ (2013) wurde sie jeweils mit dem Booker-Preis, dem wichtigsten britischen Literaturpreis, ausgezeichnet. Bei DuMont erschien außerdem u.a. die Autobiografie ›Von Geist und Geistern‹ (2015) und zuletzt der dritte Band der Tudor-Trilogie ›Spiegel und Licht‹ (2020).
Werner Löcher-Lawrence war lange als Lektor in verschiedenen Verlagen tätig. Heute ist er literarischer Agent und Übersetzer. Zu den von ihm übersetzten Autor*innen gehören John Boyne, Hisham Matar, Robert Littell, Richard Wright und Meg Wolitzer.
Hilary Mantel
Sprechen lernen
Erzählungen
Aus dem Englischenvon Werner Löcher-Lawrence
Zitatnachweis: William Butler Yeats, ›Die Gedichte‹. Neu übersetzt von Marcel Beyer, Mirko Bonné, Gerhard Falkner, Norbert Hummelt, Christa Schuenke. Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Christa Schuenke liegen beim Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Die englische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel
›Learning to talk‹ bei Fourth Estate, London.
© Hilary Mantel 2003
E-Book 2023
© 2023 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Werner Löcher-Lawrence
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln nach einem Entwurf von Alison Forner
Umschlagabbildung: © Martin Parr / Magnum Photos / Agentur Focus
Satz: Fagott, Ffm
Gesetzt aus der Garamond und der Poetica Chancery
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-6071-5
www.dumont-buchverlag.de
Ein weiteres Mal in Liebe
für Anne Terese
und ihre Tochter
Vorwort
In diesen Geschichten geht es um Kindheit und Jugend. Sie wurden über viele Jahre ausgearbeitet. Ich benutze diese Formulierung, weil das Schreiben kurzer Geschichten für mich voller Spannungen und Widerstände ist. Bei »King Billy ist ein Gentleman« hatte ich innerhalb von Sekunden den ersten und den letzten Satz, brauchte aber zwölf Jahre, um den Raum dazwischen zu füllen. Geschichten verwandeln sich, auch wenn man es beim Schreiben nicht merkt. Sie erweisen sich als Proben, als Zwischenberichte.
All diese Erzählungen sind aus Fragen über meine frühen Jahre entstanden, wobei ich nicht sagen kann, dass ich durch das Übertragen meines Lebens ins Fiktionale Rätsel gelöst hätte – aber zumindest habe ich einzelne Teile hin und her geschoben. Ich bin im Norden Englands aufgewachsen, in einem Dorf am Rand des Peak District in Derbyshire, wo auch mein Roman Der Hilfsprediger spielt. In einer Kleinstadt mit einer Reihe rußgeschwärzter Textilfabriken, deren Straßen von schmalen, kalten Reihenhäusern gesäumt wurden. Wie viele andere dort waren auch meine Vorfahren auf der Suche nach Arbeit aus Irland gekommen, und obwohl es zu meiner Zeit keine tatsächlichen Kämpfe in den Straßen gab, war doch das Erste, was man über die Menschen erfuhr, welcher Religion sie angehörten. Die Moral der römisch-katholischen Minderheit wurde von der Kanzel aus unter die Lupe genommen, und wir alle, Protestanten wie Katholiken, wurden von Klatsch und Gerede kontrolliert.
Trotzdem holte meine Mutter, als ich sieben war, ihren Geliebten zu uns ins Haus, und während der nächsten vier Jahre lebte ich mit zwei Vätern unter einem Dach. Die genauen Umstände waren so bizarr, dass sie, gingen sie unverändert in eine Erzählung ein, alle anderen Elemente verdrängen würden. Deshalb werden in diesen Geschichten Besucher zu Vätern, Väter verblassen im Hintergrund, laufen davon und werden zurückgelassen. Sie existieren in einer Art Dämmerzustand. Keiner von ihnen ist mein wirklicher Vater, und so geben sie anderen Erzählsträngen Raum. Ich möchte diese Geschichten nicht autobiografisch, sondern autoskopisch nennen. Aus einer entfernten, erhöhten Perspektive blickt mein schreibendes Ich auf einen auf seine bloße Hülle reduzierten Körper, der darauf wartet, mit Sätzen gefüllt zu werden. Seine Umrisse nähern sich meinen an, aber es gibt einen verhandelbaren Halbschatten.
Als ich elf war, nahm mir der Umzug in eine andere Stadt einen meiner Väter, und ich bekam einen neuen Namen. Der Schock dieser sozialen Veränderung wird in der titelgebenden Erzählung beschrieben. Es geht um die Klasse, um Aufgeblasenheit und das Recht, gehört zu werden – und das Erzählte hat sich bis auf ein, zwei Details tatsächlich so ereignet. Die Mutter und Tochter der Geschichte am Ende, »Ein reiner Tisch«, sind fiktiv, aber die örtlichen Gegebenheiten entsprechen der Wahrheit. Verwandte meines englischen Großvaters Goerge Foster lebten in einem Ort, der in einem Stausee für die Städte im Nordwesten unterging. Die in meiner Kindheit kursierenden Geschichten über das versunkene Dorf waren meine Einführung in das sumpfige Gebiet zwischen Geschichte und Mythos. Seitdem trete ich dort auf der Stelle.
Hilary Mantel im Dezember 2020
King Billy ist ein Gentleman
Ich bekomme den Ort nicht aus dem Kopf, an dem ich geboren wurde, direkt außerhalb der sich windenden Tentakel der Stadt. Wir waren zu nahe dran, um ein eigenes Leben zu entwickeln. Es gab eine regelmäßige Zugverbindung – keine von denen, wo du auf der Lauer liegen und genaue Gewohnheiten studieren musstest. Aber wir mochten die Leute aus Manchester nicht. »Städter, untersetzt und voller Tücke«, so sahen wir sie wohl. Wir spotteten über ihren Arbeiterakzent und bemitleideten sie für ihren Körperbau. Meine Mutter, eine stramme Lamarckistin, war überzeugt, dass die in Manchester unverhältnismäßig lange Arme hatten, weil sie seit Generationen an Webstühlen arbeiteten. Bis (aber das war später) eine rosa Siedlung aus dem Boden gestampft und sie zu Hunderten dorthin verpflanzt wurden, wie Bäume, die zu Weihnachten ausgemacht und mit den Wurzeln in kochendes Wasser getaucht werden – nun, bis dahin hatten wir nicht viel mit den Leuten aus der Stadt zu tun. Und doch, wenn Sie mich fragen, ob ich ein Junge vom Land war: Nein, war ich nicht. Unsere Ansammlung Stein und Schiefer, gezeichnet von rauen Winden und derben Klatschmäulern, das war nicht das ländliche England mit Morris-Tanz, gegenseitiger Verbundenheit und gutem altem Ale. Es war ein kaputter, steriler Ort ohne Bäume, wie ein Durchgangslager, mit der gleichen hoffnungslosen Dauerhaftigkeit, die solche Lager anzunehmen pflegen. Der Schnee blieb bis April in den Höhenlagen ringsum liegen.
Wir wohnten oben im Ort, in einem Haus, in dem es meiner Meinung nach spukte. Mein Vater war verschwunden, und vielleicht war es seine Gegenwart, schlaksig und bleich, die unter der Tür durchstrich und dem Terrier die Nackenhaare aufstellte. Von Beruf war er Büroangestellter gewesen. Kreuzworträtsel waren sein Hobby, und ein bisschen Angeln. Er mochte einfache Kartenspiele und seine Zigarettenbilder-Sammlung. An einem stürmischen Märzmorgen um zehn ist er gegangen, hat seine Alben mitgenommen und seinen Tweedmantel. Seine Unterwäsche hat er dagelassen. Meine Mutter hat sie gewaschen und einem Wohltätigkeitsbasar vermacht. Wir haben ihn nicht sehr vermisst, nur die kleinen Melodien, die er auf dem Klavier gespielt hat, wieder und wieder. Wie den Pineapple Rag.
Dann kam der Untermieter. Er war von weiter nördlich, ein Mann mit langen, gedehnten Vokalen, die aus Worten eine große Sache machten, die bei uns schnell durch waren. Er war cholerisch, seine Toleranzschwelle niedrig. Sehr, sehr unberechenbar. Wolltest du wissen, was kam, musstest du ihn sorgfältig beobachten, ganz ruhig und die Intuition geschärft. Als ich älter wurde, begann ich mich für Ornithologie zu interessieren und nutzte die Erfahrung, die ich mit ihm gemacht hatte. Aber das kam später. Im Ort gab es keine Vögel, nur Spatzen und Stare, und eine verrufene Truppe Tauben, die durch die engen Straßen stolzierte.
Der Untermieter zeigte Interesse an mir und holte mich aus dem Haus, um einen Fußball hin und her zu kicken. Aber ich war nicht der Typ dafür, und sosehr ich ihm gefallen wollte, mir fehlte das Talent. Der Ball rutschte mir zwischen den Füßen durch, als wäre er ein kleines Tier, und mein atemloses Husten klang beunruhigend. Schlappschwanz, sagte der Untermieter, sagte es aber mit Angst im Gesicht. Bald schon schien er mich abzuschreiben. Ich hatte das Gefühl, ihm lästig zu sein. Ich ging früh ins Bett, lag wach und lauschte dem Gepolter und Geschrei unten, denn der Untermieter brauchte Streit, genauso wie er sein Frühstück brauchte. Der Terrier fing an zu jaulen und zu kläffen, um den Streithähnen Gesellschaft zu leisten, und später hörte ich meine Mutter nach oben laufen und leise vor sich hin schniefen. Sie wollte den Untermieter nicht gehen lassen, ich wusste, sie hatte ihn sich in den Kopf gesetzt. In seinen Lohntüten brachte er mehr Geld ins Haus, als wir je gehabt hatten, und während er erst nur die Miete zahlte, legte er bald schon die ganze Tüte auf den Tisch – meine Mutter öffnete sie mit spitzen Fingern und gab ihm ein paar Shilling für Bier und was immer die Männer ihrer Meinung nach brauchten. Er bekam einen Bonus, erklärte sie mir, er wurde zum Vorarbeiter gemacht, er war unsere Chance im Leben. Wäre ich ein Mädchen gewesen, hätte sie mir mehr anvertraut. Aber ich begriff schon, was da vorging. Still lag ich wach, als keine Schritte mehr zu hören waren, der Hund verstummt war und die Schatten zurück in die Ecken des Zimmers krochen. Ich döste dahin, wünschte, von Geistern frei zu sein und dass die Jahre in einer Nacht vergingen, sodass ich am Morgen als Mann aufwachte. Ich schlummerte ein und träumte, eines Tages würde sich in der Wand eine Tür auftun, und ich träte hindurch und würde im Land dahinter der asthmatische kleine König sein, ein König in einem Land, in dem es ein Gesetz gegen Streit gab. Doch dann, im wirklichen Leben, wurde es hell, ein Samstag vielleicht, und ich musste im Garten spielen.
Die Gärten der Häuser waren lange schmale Streifen, die hinter maroden Zäunen in graue Kuhfladenfelder übergingen. Hinter den Feldern lagen Moore, stiller, stählerner Schlick – und die dunkelgrünen Nadelbäume und das klare Licht der Büros der Forstwirtschaftsbehörde. Wenig wuchs in unseren Gärten: Scheuergras, ein Gewirr aus verkümmertem Gebüsch, eingegrenzt von ameisenzerfressenen Zaunpfählen und einsamen Drahtenden. Ich ging bis ans Ende des Gartens und zog rostige Nägel aus dem verrottenden Holz. Ich riss die Blätter vom Fliederbaum, roch am grünen Blut auf meinen Händen und dachte über meine Situation nach, die sonderbar war.
Bob und seine Familie waren früh schon aus der Stadt ins Haus neben uns gezogen, da waren sie als Aussiedler noch eine Ausnahme. Vielleicht erklärte das Bobs Haltung seinem Garten gegenüber. Während wir misstrauisch die Handvoll wurmstichiger Himbeeren betrachteten, die unser auf sich gestelltes Stück Land hervorbrachte, die erbärmlichen Lupinen, die ihre Samen ausstreuten, während unser wuchernder Rhabarber nie geschnitten und zu Kompott verarbeitet wurde, umzäunte Bob seinen Garten wie das Allerheiligste der menschlichen Seele: als hütete er den Heiligen Gral in seinem Gewächshaus, und auf der Kuhfladenwiese johlten und wüteten die Vandalen. Bobs Garten war militärisches Sperrgebiet, alles korrekt, das Terrain kannte seinen Herrn. Das Leben wuchs in Reihen, gelangte aus Tüten in die Erde, spross punktgenau in die Höhe und erwartete strammstehend Bobbys Inspektion. Unbenutzte Blumentöpfe standen helmgleich in Stapeln, Stöcke reckten sich wie Bajonette. Jeden Quadratzentimeter seines Grundstücks hatte Bob in Besitz genommen und gesichert. Er war ein hagerer Mann mit einem mächtigen Kinn und leeren blauen Augen. Er aß niemals weißen Zucker, nur braunen.
Eines Tages ereiferte sich Myra, seine Frau, vom Zaun aus über das unmoralische Leben, das meine Mutter führe, machte wirr und unzusammenhängend ihrer lange aufgestauten Wut darüber Luft, dass meine Mutter ihren Kindern und denen in den Gärten ringsum ein schlechtes Beispiel gebe. Ich war acht Jahre alt. Ich fixierte sie mit meinem durchdringendsten Blick, in meinem Mund explodierten gewalttätige Worte und wirbelten blutig wie ausgeschlagene Zähne in ihm herum. Ich wollte sagen, dass die Kinder hier – und ihre ganz besonders – sowieso völlig beispiellos waren. Meine Mutter, gegen die sich die Tirade richtete, stand langsam von dem Stuhl auf, auf dem sie sich gesonnt hatte, sah Myra kurz unbeteiligt an und ging schweigend ins Haus, worauf ihrer Nachbarin nichts blieb, als sich wie ein verrückt gewordener Wellensittich gegen Bobs guten Zaun zu werfen. Myra war klein, ein rattengesichtiges, erbärmliches Nichts, nicht mehr als ein namenloses Stück Fleisch im Fenster eines Metzgers in einem Abrissgebiet. So, wie Mutter es sah, hingen ihr die Arme bis tief unter die Knie.
Ich glaube, erst waren sich unsere beiden Haushalte ziemlich freundlich gesonnen. Aber dann wurde Bob mit seinen Manien (hab neun Reihen Bohnen, ein Bienenvolk, das brummt) zunehmend zur Zielscheibe unseres heimlichen Gekichers. Er schlich sich abends in den Garten, um vom seinem Fleischstück Frau wegzukommen, und wenn seine geheimnisvolle Arbeit getan war, sein Bohren und Pflügen, stand er am Zaun, hob den glanzlosen Blick zu den Höhen ringsum, die Hände in den Taschen, und pfiff eine tonlose, schwermütige Melodie. Von unserem Küchenfenster konnte man ihn noch gerade so durch den feuchtkalten Abendnebel erkennen, der in jenen Jahren das Klima bestimmte. Dann zog meine Mutter die Vorhänge zu, stellte den Kessel aufs Gas und beklagte ihr Leben. Und sie lachte über Bobby-Boy und fragte sich, welcher Schaden wohl angerichtet werden würde, bevor er tags darauf wieder dort stand.
Denn Bobs Zaun war nicht sicher. Er war aufwendig, ausgeklügelt, man könnte sagen äußerst angespannt, wenn das auch eine etwas seltsame Charakterisierung eines Zaunes ist. Er war wie Stendhal im Regal der Dorfbibliothek: beeindruckend, taugte aber für nichts, das uns betraf. Die Kühe kamen rein, wir sahen sie, wie sie sich in der Morgen- oder Abenddämmerung leise herantasteten und Bobs schmucke Riegel mit den Köpfen anhoben. Hereingetrampelt kamen sie, schlürften und zerkauten seine wohlschmeckenden Früchte, befriedigten jeden ihrer vier Mägen, die nachdenklichen Augen erfüllt von einer stillen Freude über die Gerechtigkeit des Ganzen.
Aber Bob glaubte nicht an Rinderintelligenz. Er verprügelte seinen Sohn Philip, weil er das Tor offen gelassen hatte. Hinter unseren steinernen Mauern hörten wir, wie sich Bobs wirre Leidenschaft Bahn brach, hörten die wilden Ausbrüche von Trauer und Verzweiflung über den Verlust seiner Gurkengerüste, Wehgeschrei, das sich ihm aus dem Leib riss. Das alles verschaffte mir einige Befriedigung. Ich hatte ein paar Freunde, oder genauer: Es gab Kinder in meinem Alter. Aber weil mich meine Mutter so oft nicht in die Schule ließ – ich war krank, hatte dies, hatte das –, blieb ich ihnen fremd, und mein Name, Liam, sagten sie, sei lächerlich. Es waren wilde Kinder mit aufgeschürften Knien und Herzen voller Überschwang, unerbittlichen Urteilen und unbarmherzigen Blicken. Sie hatten Riten, sie hatten Regeln, und sie hatten mich zu einem Außenseiter ihres Stammes erklärt. Krank zu sein, war fast besser. Es war etwas, das man allein tat.
Immer, wenn ich in die Schule kam, wurde klar, dass ich mit dem Stoff im Rückstand war. MrsBurbage, unsere Lehrerin, war eine vielleicht fünfzigjährige Frau mit spärlichem, rötlichem Haar und nikotingelben Fingern. Sie sagte, ich solle aufstehen und das Sprichwort »Spar nicht am falschen Ende« erklären. So wurden Kinder in jenen Tagen erzogen. Sie trug eine prall gefüllte karierte Tasche mit sich, die sie jeden Morgen mit einem dumpfen Knall auf den Boden neben ihrem Pult stellte, und schon begann das Schreien und Schlagen. Es war eine Tyrannei, unter der wir litten, und während wir von Vergeltung träumten, verging unbemerkt ein Jahr unserer Kindheit. Einige von uns planten, sie zu töten.
In Naturkunde saßen wir mit hinter dem Rücken verschränkten Armen da, während sie uns vom Grünfink vorlas. Im Frühling behandelten wir Weidenkätzchen, von denen angenommen wurde, dass sie alle Kinder interessierten. Aber ich erinnere mich nicht an den Frühling, sondern eher an jene Tage, an denen um elf noch das Licht brannte, an nasse Dächer und hinter Regenvorhängen zitternde Fabrikschlote. Um vier gab es fast kein Tageslicht mehr, der dunkle Himmel hatte es in sich aufgesaugt, unsere Gummistiefel schmatzten im Matsch und modernden Laub, und unser Atem hing wie eine Katastrophe in der nasskalten Luft.
Die Kinder hatten dem Klatsch ihrer Eltern gelauscht. Sie stellten mir, besonders die Mädchen, bohrende Fragen nach den Schlafmodalitäten in unserem Haus. Ich sah nicht, was die Fragen sollten, war aber dennoch nicht so dumm, sie zu beantworten. Es gab Gerangel, Geraufe und Gekratze, nichts Ernstes. »Ich zeige dir, wie man kämpft«, sagte der Untermieter. Als ich seinen Rat in die Tat umsetzte, gab es Tränen und blutige Nasen. Es war der Triumph der Wissenschaft über die Brutalität, aber er hinterließ einen üblen Geschmack in meinem Mund, Angst vor der Zukunft. Ich wollte lieber davonlaufen als kämpfen, doch wenn ich losrannte, vernebelten und verschwammen die steilen Straßen vor meinen Augen, und der Käfig meiner Rippen schloss mein Herz wie einen Hummer in seinem Korb ein.
In meinem Verhältnis zu Bobs Kindern sprach wenig für sie. Wenn ich draußen spielte, kamen Philip und Suzy immer wieder in ihren Garten und warfen Steine nach mir. In Nachhinein weiß ich nicht zu sagen, wie da Steine in Bobs Garten liegen konnten, Steine, die einfach so dalagen und sich als Geschosse verwenden ließen. Ich nehme an, sobald sie welche fanden, dachten sie, sie täten ihrem Vater einen Gefallen damit, sie auf mich niedergehen zu lassen. Und während er immer merkwürdiger wurde, immer gehetzter, während er immer seltsamere Sachen aß, mussten sie zweifellos jede Chance ergreifen, ihm einen Gefallen zu tun.
Suzy war eine fiese kleine Rotznase mit einem Breitmaul wie ein Briefkasten. Sie hing auf dem Tor und höhnte. Philip war älter als ich, vielleicht drei Jahre. Er hatte einen modifizierten Kokosnusskopf, verwirrte schmale graue Augen und so ein Kopfzucken zur Seite hin, als trainierte er ständig, den Schlägen wegen der Kühe auszuweichen. Vielleicht hatte er auch eine Gehirnerschütterung. Was seine Wurfgeschosse anging, hatte ich keine großen Schwierigkeiten, sie kamen so ungenau, dass ich ihnen problemlos ausweichen konnte. Aber wenn ich das einmal zu oft tat, wenn ich sah, dass ich ihn wie einen Trottel aussehen ließ, ging ich lieber zurück nach drinnen, weil auf seinem Gesicht eine leicht zerstörerische Wut aufzog, ganz so, als könnte da ein anderes Wesen durchbrechen, ein wilderes Tier, und es stimmt, seitdem habe ich genau diesen Ausdruck auch schon in den Augen größerer, intelligenter Hunde gesehen, die an der Kette liegen. Und wenn ich das sage, meine ich nicht, dass ich dachte, Philip sei ein Tier, damals oder heute. Was ich dachte, war, dass wir alle ein verborgenes Ich in uns tragen, eine geheime Gewaltbereitschaft, und ich beneidete ihn um die offensichtliche Kraft seiner dünnen, sehnigen Arme voller Adern und Knoten wie die eines erwachsenen Mannes. Ich beneidete ihn, verabscheute seine unterwürfige Natur und hoffte, dass ich nicht auch so war. Einmal klaubte ich Erdklumpen und Stöcke auf, schleuderte sie zurück auf ihn und schrie dabei wie ein Dämon mit all den Schmähungen, die ich aus den Büchern kannte, die ich gelesen hatte: Halunke, Hahnrei, gemeiner Schurke und Hundesohn.