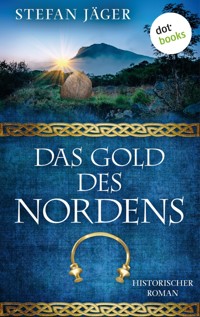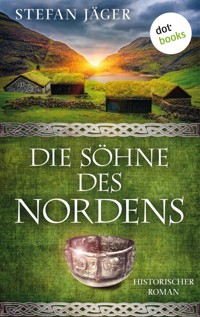Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt im Mittelalter: Historische Kurzgeschichten aus Fritzlar von Bonifatius bis zu den Hexenverfolgungen. Dazwischen ist viel passiert, von Königserhebungen über Kirchenbauten bis hin zu Belagerungen. Die Geschichten sind mal von Ihm erzählt und mal von Ihr, mal aus der Sicht derjenigen, die Geschichte gemacht haben, mal aus der Sicht derer, die sie aushalten mussten. Jede Geschichte wird ergänzt von zwei bis drei Seiten mit Anmerkungen zu den historischen Tatsachen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch:
Kein anderer Ort im alten Niederhessen hat eine so reiche mittelalterliche Vergangenheit wie Fritzlar. Zuerst sind die Missionare in den Ort oberhalb der Eder gekommen, dann waren es Könige und Kaiser. Und schließlich waren es Bischöfe und Erzbischöfe, die das Geschick 'Frideslars' für Jahrhunderte bestimmten. Von ihnen allen ist in diesem Buch die Rede, aber auch von den 'kleinen Leuten', die zwar keine Geschichte machen, ohne die aber kein Ort existieren kann.
Über den Autor:
Stefan Jäger, geb. 1970 inmitten des alten Chattenlandes, hat im Piper-Verlag die historischen Romane 'Der Silberkessel' und 'Das Gold des Nordens' veröffentlicht. Mehrere Theaterstücke liegen bei verschiedenen Verlagen vor. Zuletzt erschienen die historische Kurzgeschichtensammlung 'Von Hessen und Chatten' und der historische Krimi 'Mord in Mattium'.
Geschichte und Geschichten, Theaterstücke und Rätseleien, Bücher und Brettspiele, Stadtführungen und Physiotherapie - das sind die Dinge, mit denen er sich gern beschäftigt.
Inhalt
Baumarbeiten (
723)
Wunderdinge (
um 735)
Hie Franke! – Hie Sachse! (
919)
Die Regel oder die Straße (
um 1005)
Mainz oder deins? (
1066)
Der kranke König (
1066)
Steinarbeiten (
um 1100)
Mauergeschichten (
1232)
Schreibarbeiten (
1355)
Turris magna (
um 1410)
Stadt der Türme (
1427)
Trygophorus (
1525)
Wechseljahre (
1529)
Morgenspaziergang (
1574)
Die Ratte im Stroh (
1603)
Der Chorherr und der Nachtwächter (
1603)
Teufelskind (
1629)
Nachbemerkungen
Urbs turrita wurde Fritzlar im ausgehenden Mittelalter genannt, Stadt der Türme. Kein anderer Ort innerhalb der Landgrafschaft Hessen war so stark befestigt.
Wunderdinge (um 735)
«Paulus! – Paulus, hörst du mich nicht?»
Er schreckte auf. Über der Nasenwurzel des Novizenmeisters stand eine deutliche Falte. Sie verhieß Ärger, und der betraf ihn nicht zum ersten Mal. Dabei lag es gar nicht daran, dass Paulus sich nicht anstrengen wollte, aufmerksam zu sein. Vielmehr hatte er immer noch Mühe, die Verbindung zwischen diesem Namen und ihm selbst herzustellen.
«Entschuldigung, Meister Witta.»
«Um Buße für Deine wiederholte Unaufmerksamkeit zu tun, wirst du an diesem Tag außerhalb des Unterrichts schweigen.»
«Ja, Magister.»
Es gab Schlimmeres, als einen halben Tag nicht zu sprechen. Er musste nur aufpassen, dass es ihm kein zweites Mal passierte. Das würde die Strafe unverhältnismäßig verschärfen.
«Vielleicht», fuhr Witta mit spöttischer Stimme fort, «nutzest du diese Stunden aber, um über die Entscheidung nachzudenken, welche dir bevorsteht.»
«Ja, Magister.»
«Und nun, wenn es dir nichts ausmacht, sag uns bitte, was es bedeuten würde, wenn auf dem Buraberg ein Bischofssitz entstehen würde.»
«Äh, nun, äh ...»
«In verständlicher Sprache bitte. Es muss kein Latein sein. Und wenn es dir keine allzu große Mühe macht, dann würde ich dich bitten, für die Antwort aufzustehen.»
Alle lachten, am lautesten Geppa, der wie ein Ackergaul wieherte.
«Silentium!», rief der Novizenmeister, und die Gruppe verstummte umgehend. Es war schwer, Unbotmäßigkeit zu zeigen, wenn sich auf Wittas Stirn die Falte zeigte.
Paulus erhob sich mit zusammengebissenen Lippen. In seinem Bauch zog es unangenehm. «Wir ... hätten einen eigenen Bischofssitz ...»
«Wer wir? Wir Benediktiner hier in Frideslar?»
«Äh, nun ... nein. Also schon auch, aber vor allem die Hessis hätten dann ...» Unvermittelt sah er, wie ein Papyruskügelchen an der Robe des Lehrers abprallte. Das war sicher wieder Geppa gewesen, der von ihnen allen stets am wenigsten Ehrerbietung zeigte. Zum Glück hatte Witta es nicht bemerkt. «... hätten dann einen Bischofssitz.»
«Aha. Und auf lateinisch würde man das wie ausdrücken?»
«Uh. Pff ...»
«Das scheint mir alles andere als Latein zu sein, Paulus.»
«Oh ... ja. Also, Hessis ... ähm... habent ... suam sedem ...» Er musste passen, was die Übersetzung des ‹Bischofssitzes› anging. Tatsächlich wusste er nicht einmal, wie man den ‹Bischof› richtig wiedergab. Diaconus war sicher nicht ausreichend. Sein Bauch fühlte sich inzwischen an, als habe er einen Fliegenschwarm verschluckt.
«Megingoz!», rief Witta. «Ein Bischof.»
In der ersten Reihe erhob sich ein junger Mann. Paulus sah nur seinen Hinterkopf, aber er wusste, wie hübsch er anzusehen war mit seinem ebenmäßigen Gesicht, der feinen Nase und dem honigblonden Haarkranz. Alle Lehrer und die meisten Schüler mochten oder bewunderten Meingott. «Episcopus, Magister Witta.»
Paulus verabscheute ihn. Hinter seiner freundlichen Miene hielt er ihn für einen Ehrgeizling, der nicht davor zurückscheute, die Fehltritte anderer zu seinen Gunsten zu nutzen.
Trotzdem sank Paulus nun erleichtert auf die Holzbank zurück.
Megingoz hieß eigentlich Meingott, aber die gewieften Lateiner am Ort bevorzugten eben ‹Megingoz› – auch um die Nicht- oder Halb-Lateiner zu düpieren.
Solche wie Paulus.
«Ganz richtig, mein Junge. – Paulus? Und bitte, bitte nicht mehr hessis, sondern ...»
Verflixt! Wie ein Frosch sprang er wieder auf. «Äh, hessi habent suam sedem ... episco-» Wenn der Bischof ein episcopus war, dann war ein Bischofssitz ein... Verdammt. «Pagus episcopus?»
«Der Ort eines Bischofs? Nun, nicht ganz dumm. In der Tat haben wir schon weitaus Dümmeres von dir gehört. – Megingoz!»
«Episcopatus, Magister.»
«Episcopatus, sehr gut, mein Sohn. Das wollen wir für den Augenblick gelten lassen. – Paulus, du sprichst aber, als wenn es den Bischofssitz bereits gäbe. Doch handelt es sich lediglich um ein Gedankenspiel unseres geliebten Oberhirten. Die Hessen hätten dann einen eigenen Bischofssitz, es ist nur eine Möglichkeit.»
«Ha-, habuissent?», stotterte Paulus.
«Dann hätten die armen Hessen es bereits hinter sich, was bedauerlich wäre, wenn auch nicht im Übermaß.»
«Haberent?» Schweiß war ihm auf die Stirn getreten.
Der Novizenmeister verdrehte die Augen. «In ganzen Sätzen, wenn ich bitten darf.»
«Hessis, äh, Hessi haberent ...»
«Dann! Dann hätten die Hessen!»
«Äh ... tum Hessi haberent suam sedem episcopatus?»
«Nun ja. Für den Anfang gar nicht so schlecht. Allerdings bist du kein Anfänger. Sondern bereits im zweiten Jahr deines Noviziats. Im zweiten! Du kannst Dich wieder setzen. – Megingoz! Bitte die richtige Form, und zwar auch betreffend des Bistums. Mitnichten heißt es dann nämlich episcopatus, sondern ... Und bitte, bitte tausche endlich dieses unsägliche, bäurische Hessi aus.»
Paulus plumpste frustriert auf die harte Bank zurück, während Meingott nach oben schoss.
«Hassis esset sedes episcopalis.»
«Ah, Hassis!», rief der Abt. «Vorzüglich, wie immer!»
Paulus spürte noch einmal, wie sehr er diesen hochgelobten Meingott doch hasste und den Novizenmeister dazu, auch wenn dies keine Gedanken waren, die einem Klosterschüler gut zu Gesicht standen. Immerhin war ihm die Rute erspart worden. Anscheinend hatte Witta einen seiner milderen Tage. Die waren selten.
Da die Stunde endlich vorüber war, wollte Paulus soeben den Raum verlassen, als Geppa ihm die Hand auf die Schulter legte. «Lernen wir nachher noch ein wenig Latein zusammen? Ich würde gern an deinen außergewöhnlichen Fähigkeiten teilhaben.»
«Äh, ich ... uh», machte Paulus. Siedendheiß war ihm eingefallen, dass er den restlichen Tag zu schweigen hatte. Er kannte Geppa aber gut genug, um zu wissen, dass dieser ihn mit voller Absicht herausgefordert hatte.
«Äh, ich, uh? Ist das wieder diese seltsame Sprache, die sie hier sprechen? Was macht deine Familie nochmal? Schweine züchten? Das erklärt einiges.» Wiehernd ging er davon, im Gefolge Hunfried und Stirme, die ihm stets auf den Fersen waren.
Am liebsten wäre Paulus ihm ins Kreuz gesprungen, konnte sich aber ausmalen, was das für eine Strafe nach sich ziehen würde. Nicht einmal mit Worten konnte er sich nun wehren, aber so war die Regel der Benediktiner. Man hatte zu beten und zu arbeiten, alles andere war zweitrangig. Vor allem von Gesprächen und Unterredungen hielten sie nicht viel – es sei denn, diese hätten die Gebete oder die Arbeit zum Inhalt.
Geppa, dieser Schweinehund, war groß darin, die Unmengen von Regeln, die diese Mönche kannten, zu unterlaufen, auf eine Weise allerdings, die nur selten Anstoß erregte. Geppa mit dem gemeinen Lächeln und den klebrigen Nissen in seinen fettigen Haaren. Paulus achtete darauf, so wenig wie möglich neben ihm zu sitzen, keinesfalls wollte er sich die Läuse holen. Besser, man würde Geppa möglichst bald eine Tonsur verpassen. Vielleicht würde ihn das sogar lehren, die Regeln einzuhalten, all die Regeln, mit denen auch Paulus zu kämpfen hatte.
Und dabei musste jede Einzelne von ihnen streng befolgt werden.
Tue dies!
Beachte jenes!
Verhalte dich wie folgt!
Allein was das Schweigen als solches anging, so hatten die Benediktiner eine ganze Menge dazu zu sagen. Paulus dünkte das eigentlich wie ein Widerspruch, aber Besserwisserei wurde im Kloster überhaupt nicht gern gesehen.
Der Schweigsamkeit zuliebe soll man bisweilen auf gute Gespräche verzichten. Umso mehr müssen wir wegen der Bestrafung der Sünde von bösen Worten lassen.
Mag es sich also um noch so gute, heilige und aufbauende Gespräche handeln, vollkommenen Jüngern werde nur selten das Reden erlaubt wegen der Bedeutung der Schweigsamkeit.
Albernheiten aber, müßiges und zum Gelächter reizendes Geschwätz verbannen und verbieten wir für immer und überall. Wir gestatten nicht, dass der Jünger zu solchem Gerede den Mund öffne. Bei vielem Reden wirst du der Sünde nicht entgehen.
Denn Reden und Lehren kommen dem Meister zu, Schweigen und Hören dem Jünger.
Wenn sie aus dem Nachtgebet kommen, gebe es für keinen mehr die Erlaubnis, irgendetwas zu reden.
Findet sich einer, der diese Regel des Schweigens übertritt, werde er schwer bestraft.
Und immer so weiter. Es war hoffnungslos.
Wie gern Paulus sich an jene Zeit erinnerte, als er noch Ask geheißen und mit den Eltern und Schwestern zusammengelebt hatte. Was hatten sie da manchmal für einen Unsinn erzählt, wenn sie am Tisch beisammen saßen – zum Gelächter reizendes Geschwätz eben. Ihre Mutter hatte oft verzweifelt den Kopf geschüttelt, sich aber doch daran erfreut und am Ende mit ihnen gelacht.
Diese Zeiten würden nicht wiederkehren. Er war im Kloster und die eine Schwester ... Nein, darüber wollte er nicht nachdenken; es würde diesen Tag nur noch weiter verdunkeln.
Besser, er suchte den Innenhof auf, denn wenn er dort seine Runden drehte, würde ihn das am ehesten davor bewahren, ein Gespräch zu beginnen. Auch kein Mitschüler würde es wagen, ihn dort anzusprechen, wenn er den Kopf gesenkt hielt und den Versunkenen gab, nicht einmal der redefreudige Geppa.
Als Paulus den Hof betrat, der sich der großen Steinkirche auf der Südseite anschloss, stellte er fest, dass er nicht der Einzige war, der dort gemessenen Schrittes ein paar Runden drehen wollte.
Abt Wigbert war sehr oft hier anzutreffen, insbesondere, wenn er ein theologisches Problem zu lösen hatte – oder eines Schülers im stillen Gebet gedenken wollte.
Paulus mutmaßte, dass auch er schon mehr als einmal Anlass solcher Gebete gewesen war.
Um ihm nicht zu begegnen, lenkte er seine Schritte in die gleiche Richtung wie Wigbert und bemühte sich, dessen Geschwindigkeit nicht zu übertreffen, damit er ihm nicht versehentlich auf die Hacken trat. Es fiel ihm schwer, denn Wigbert setzte seine Füße sehr gemächlich voreinander.
Paulus mochte den viereckigen Innenhof mit dem kleinen Kräutergarten in der Mitte, in dessen Zentrum sich eine Zisterne befand.
Im Gegensatz zur Kirche waren die vielen Gebäude rund um den Innenhof aus Holz, Lehm und Flechtwerk, das aber eines Tages überall durch Stein ersetzt werden sollte. Nur der Kapitelsaal, in welchem sie unterrichtet wurden, hatte immerhin schon steinerne Grundmauern. Als Nächstes würde das Refektorium an die Reihe kommen, der Speisesaal, aber über dessen Fertigstellung würde noch eine Weile vergehen, obwohl eine ganze Schar von Laienmönchen bereits fleißig damit zugange war, Steine zu behauen.
Der Innenhof war der Ort des Klosters, an dem die Mönche sich fortwährend über den Weg liefen, doch wer sich offensichtlich auf ‹der Runde› befand, wurde für gewöhnlich in Ruhe gelassen. Diese Runde war gut erkennbar am ausgetretenen Pfad im Erdboden – so viele Mönche waren bereits darüber geschritten, in Gebete oder Gedanken tief versunken.
Manchentags konnte man meinen, eine ganze Schar wandernder Leichen drehe mit gemessenen Schritten ihre Runde um den kleinen Garten.
Noch lieber als durch den Innenhof des Klosters wäre Paulus durch den nahen Wald gestreift, so wie früher, aber das war ihm nicht erlaubt.
Blieb ihm also nur der Hof, zumindest bis zum Mittagsgebet, der Sext.
Paulus setzte Schritt vor Schritt und fragte sich zum hundertsten Male, ob er, da das Ende seiner Probezeit im Kloster nahte, sein Gelübde verlängern sollte oder nicht. Seit annähernd zwei Jahren war er nun im Kloster. Schon nach dem ersten Jahr hatte er seine Probezeit um ein weiteres verlängert, anstatt endgültig das Gelübde abzulegen.
Weil, so hatte er dem Abt zögerlich erklärt, er sich noch nicht bereit fühle, um die Worte zu sprechen: Nimm mich auf, Herr, nach deinem Wort, und ich werde leben; lass mich in meiner Hoffnung nicht scheitern.
Er sei sich nicht restlos sicher, hatte er behauptet, und Wigbert in seiner Güte hatte genickt und ihm lächelnd erlaubt, sich ein weiteres Jahr zu prüfen.
Nur leider war Paulus sich noch immer nicht sicher. Gern hätte er seine Probezeit ein weiteres Mal verlängert, bezweifelte aber, dass ihm das gestattet werden würde.
Und wenn er einfach zum Laienbruder konvertierte? Das würde ihm doch gewiss erlaubt werden, denn das Kloster brauchte immer Leute, die bereit waren, all die anstehenden Arbeiten in den Werkstätten, den Ställen und beim Bauen zu erledigen, all das, wofür die Mönche, die durchaus mit anfassten, keine Zeit oder nicht das nötige Geschick hatten.
Seiner Mutter würde er damit aber das Herz brechen.
Gebet und Gottesdienst und ebenso das Schweigen waren zu ertragen, sogar all der Unterricht, wenn er oft auch kaum verständlich war. Das Fasten, na gut, das fiel ihm schwer, richtig schwer. Er hatte das Gefühl, immerzu essen zu müssen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, was ihm schon mehr als einmal die Rute eingetragen hatte.
Aber auch damit ließ sich zurechtkommen.
Allein der Gedanke an Ida war nicht zu ertragen oder vielmehr der Umstand, dass er sich keine Gedanken um sie machen durfte. Denn ein Mönch hatte in Ehelosigkeit zu leben, und Paulus wusste nicht so recht, wie er damit auf Dauer zurechtkommen würde.
Armut ja, Gehorsam ja, aber Ehelosigkeit?
Wenn sein Vater ihn besuchen kam, ließ Paulus sich nur zu gern von Ida erzählen, wie es ihr erging, wie hübsch sie anzusehen war, und dass sie manchmal nach Paulus fragte.
Es war, als ob sein Vater in voller Absicht diese Hürde vor Paulus errichtete, während seine Mutter nie ein Wort von Emblas bester Freundin verlor.
Es war schwer, ein Mönch zu werden, so schwer.
Dabei wusste Paulus ja, dass viele von den Gedanken, die die Mönche mitgebracht hatten, gut waren, richtig waren, geradezu wunderbar waren. Beinah am meisten sagte Paulus jener Gedanke zu, nach dem man einen Mond noch weiter unterteilen konnte, als die Einheimischen das bislang getan hatten.
Auf einen solchen Gedanken war in der Gegend noch niemand gekommen.
Bei den Mönchen hatte jeder Mondlauf vier Abschnitte, geheißen septimana, und ein jeder dieser Teile bestand wiederum aus sieben Tagen, beginnend mit dem Tag des Herrn. Und das war das Verblüffendste an dieser ganzen Überlegung: Dieser erste Tag des Herrn, der sogenannte dies dominica, sollte frei sein von Arbeit.
Es war dies ein wahrhaftig bemerkenswerter Gedanke, den sogar Paulus´ Vater pries. Und der war im Allgemeinen nicht zimperlich, wenn es darum ging, an den Mönchen und ihrem Tun herumzumäkeln. Als Paulus ihm von den Tagen des Herrn berichtet hatte, da hatte er bereits seinen Mund geöffnet, um seiner Gewohnheit nachzugehen – und hatte ihn sogleich wieder geschlossen.
Jeder siebte Tag frei von Arbeit?
Das gefiel ihm, das gefiel ihm außerordentlich. Das war eine willkommene Abwechslung von der gewohnten Mühsal. Das Jahr hatte zwölf Monde, damit kämen eine ganze Menge freier Tage zusammen.
«Hätte nie gedacht, dass die Mönche mal für etwas zu gebrauchen sind», hatte er gesagt.
Ganz so glücklich war Paulus über diese Tage allerdings nicht.
Ihre Einrichtung, ganz gewiss, war wunderbar, und was hätte man an so einem dies dominica nicht alles tun können!
Nur: Die Mönche hatten diesen Tag den Gebeten und der inneren Einkehr vorbehalten. Und so musste Paulus zweiundfünfzig Tage im Jahr für das Heil seiner Schwester beten, zweiundfünfzig ganze Tage. O ja, er hatte die Rechenkunst erlernt, der Umgang mit den Zahlen fiel ihm zwar nicht leicht, aber es war dennoch nicht unmöglich, sie zu beherrschen, ganz im Gegensatz zum Lateinischen.
Nicht dass er nicht bereit gewesen wäre, für Embla viele Gebete zu sprechen! Ihre schweren Verletzungen machten sie unfähig zu gehen, und es war Mutters ausdrücklicher, inniger Wunsch gewesen, dass ihr Sohn in das Kloster eintreten sollte, das Bonifatius selbst gegründet hatte.
Damit Paulus für seine Schwester betete.
Und lernte, ein Wunder zu wirken.
Denn einmal hatte die Mutter selbst schon ein Wunder gesehen, ein echtes Wunder.
Sie war nämlich dabei gewesen, als der ehrwürdige Abt Wigbert sein Weinwunder gewirkt hatte.
Seitdem war sie wie besessen von dem Christenglauben im Allgemeinen und von Wigbert im Besonderen.
Noch immer sprach sie – das wusste Paulus von seinem Vater – beinah jeden Tag von Wigbert und seinem Wirken und insbesondere von dem Wunder mit den Weintrauben: Der ehrwürdige Abt hatte einstmals, weil es ihm für eine Messe am nötigen Wein mangelte, ein dickes Bündel Trauben in die Hand genommen und über einem leeren Kelch ausgepresst. Als er dann diesen Kelch den Gläubigen zum Abendmahl darreichte, schmeckten diese zu ihrer Überraschung den Messwein, der nun wundersamerweise darin war und das Blut Christi darstellte.
Paulus´ Mutter war die vierte in der Reihe gewesen, und sie habe, so erzählte sie immer wieder, den Wein deutlich geschmeckt, «so deutlich wie einen Schluck Gerstensaft.»
Doch was wusste seine Mutter schon vom Wein?
Soweit Paulus wusste, hatte sie weder vorher noch nachher in ihrem Leben jemals Wein getrunken. Er verstand ohnehin nicht, was so Besonderes am Wein sein sollte. Der, den die Mönche in dieser Gegend zu ziehen versuchten und als Messwein verwendeten, war ein übel schmeckendes Gesöff. Dagegen war der Gerstensaft, den sie brauten, ganz wunderbar, viel besser als derjenige der Dörfler.
Zudem hätte er, Paulus, sich bei dem Gedanken geschüttelt, Wein aus den blanken Händen Wigberts zu sich zu nehmen: Er kannte den alten Mann als jemanden, der stets schmutzige Hände hatte, weil er selbst im hohen Alter noch gern in der Erde des Klostergartens wühlte.
Bereits in jüngeren Jahren sollte Wigbert bereits verschiedene Wunder gewirkt haben, und nun sollte Paulus von ihm lernen, ein solches an seiner Schwester zu wirken. (Dabei konnte Paulus sich nicht einmal vorstellen, dass der steinalte Wigbert überhaupt jemals jung gewesen war; darüber sollte man vielleicht einmal nachdenken, wenn man ihn mit Wundertaten in Verbindung brachte.)
Seine Mutter hielt viel, sehr viel von dem neuen Glauben und den Segnungen, die er hervorbringen konnte.
Dass es sich bei dem Heilsversprechen der Kirche aber mehr um das Seelenheil handelte als um eine körperliche Gesundung, das wollte seine Mutter indes nicht so recht begreifen.
Ihre Tochter musste wieder gehen können, und wenn jemand sie dazu in die Lage versetzen konnte, dann waren es die Mönche!
Und darum hatte Paulus´ Mutter den Vater überredet, seinen eigenen Sohn für das Heil der Tochter herzugeben. Paulus´ Welt veränderte sich damit von einem Tag auf den anderen, beginnend damit, dass er zum Osterfest im eisigem Edderwasser getauft wurde, und dass aus Ask Paulus wurde.
Am Ende hatte die Mutter durchgesetzt, dass Paulus in das Kloster ging, das Bonifatius am Ort errichtet hatte. Das hölzerne Bethaus, einst aus dem Holz der großen Eiche gezimmert, war mittlerweile einem großen, einem gewaltigen Bauwerk aus Stein gewichen, welches die Baumeister der Franken aufgerichtet hatten, als wäre es nicht mehr als ein Vorratsspeicher.
Das war in den Augen von Paulus das größere Wunder: Was für ein prächtiger Bau da entstanden war, weitaus größer noch als die Steinkirche auf dem Buraberg! Dagegen war der Bau, der zuvor am Platz gestanden hatte, gar nichts gewesen, jenes Bethaus aus dem Holz der Eiche, die Embla so gemocht hatte ...
Zwei Jahre zuvor, als Paulus in das Kloster eingetreten war, hatte er den so eindringlichen Worten seiner Mutter noch geglaubt, dass er nämlich berufen wäre, ein Wunder zu wirken, ein ganz bestimmtes Wunder an der eigenen Schwester.
Bei seinem Eintritt war Paulus von einem Mönch befragt worden, ob er wirklich bereit sei, Gott zu dienen, und Paulus, der sich im Grunde gar nichts Rechtes darunter vorstellen konnte, hatte genickt.
Dann war ihm eine längere und recht umständliche Redewendung vorgelesen worden, und Paulus hatte wieder genickt, ohne etwas davon verstanden zu haben. Schließlich hatte er seinerseits geloben müssen, gehorsam und beständig zu sein und dem klösterlichen Lebenswandel zu folgen. Man hatte ihn eingekleidet und seinen Vater mit freundlichen Worten fortgeschickt. Dessen Opfergabe, die halbe Honigernte des Jahres, hatte man gern genommen.
Es hatte sich für Paulus seltsam angefühlt, von einem Tag auf den anderen keine Hose mehr zu tragen, sondern eine Kutte, und für eine geraume Weile hatte er sich sogar geschämt. Andererseits war das Essen – außer in der Fastenzeit – immer vorzüglich gewesen, und das wog für ihn sehr vieles auf, wenn auch nicht alles.
Nach zwei Monden als Klosternovize las man ihm die gesamte, unendlich lange Regel des Benedikt vor, nach weiteren sechs Monden noch einmal und ein drittes Mal nach Ablauf des ersten Jahres.
Jedes Mal hatte Paulus dazu genickt, aber jedes Mal war er auch von einem unguten Gefühl heimgesucht worden, von Zweifeln, von Unverständnis, sogar von Ablehnung.
Neues Leben auf die Welt zu bringen, hatte Wigbert einmal gesagt, bereite noch stets Schmerzen, große Schmerzen.
Paulus verstand zwar nicht vollends, was der Abt damit sagen wollte, doch er war geblieben, seiner Mutter und seiner Schwester zuliebe.
Nach Emblas Unglück war die Mutter richtiggehend fromm geworden – fromm ganz im Sinne der römisch-katholischen Kirche. Andere hätten den Gott von Bonifatius verflucht, nicht so seine Mutter, die das große Unglück für ein letztes schändliches Aufbäumen des nun machtlosen Donar gehalten hatte.
Inbrünstig begann sie zu dem neuen Gott und besonders zu dessen Sohn Jesus Christus zu beten, so sehr, dass die Familie um ihre Knie fürchtete, auf denen sie nun fortwährend zu finden war.
Doch wer, wenn nicht Abt Wigbert oder auch einer seiner Schüler wären sonst dazu in der Lage, um ein Wunder an Embla zu wirken? Wahrsagerei und Zauberei, das konnte man doch lernen, denn so war es in diesem Land immer gewesen, alle wussten das: Ein Weiser hatte sich beizeiten einen Schüler genommen und diesen gelehrt, wie bestimmte Zeichen zu deuten, bestimmte Lieder zu singen oder bestimmte Zauber zu wirken waren.
Was lag also in den Augen der Mutter näher, als dass Wigbert eines Tages seine Fähigkeit Wunder zu wirken an einen seiner Schüler weitergab?
Paulus Erwiderungen fruchteten da wenig. Sie glaubte einfach nicht, dass der Alltag der Mönche nicht darin bestand, Wunder zu erlernen und zu wirken, sondern im Gegenteil: dem Bemühen, den Einheimischen ihren heidnischen Wunderglauben auszutreiben.
Hatte denn nicht, so erklärte Paulus´ Mutter abwehrend, Jesus Christus die Blinden wieder sehend und die Lahmen gehend gemacht? War er nicht selbst über Wasser geschritten? Hatte er nicht Tausende gespeist mit nichts als einer Handvoll Brotlaiben?
Waren das nicht Wunder gewesen?
Wozu sonst waren die Mönche also da?
Gewiss, das gab seine Mutter gern zu (ganz im Gegensatz zu seinem Vater), viel Gutes war außerdem entstanden in den vergangenen Jahren, untadelige Gedanken hatten die Mönche, edle Ansichten vertraten sie. Rastlos waren sie tätig, bauten und werkten, vergrößerten und verbesserten. Und was hatte ihr Sohn nicht alles gelernt in diesen Jahren!
Aber es waren doch die Wunder, auf die es ankam. Und da war Wigbert eben der, dem sie ein neues Wunder am ehesten zutraute, denn eines hatte sie durch ihn ja bereits am eigenen Leibe erfahren dürfen.
Ganz bestimmt, pflegte sie zu betonen, wäre auch Bonifatius jederzeit zu einem Wunder in der Lage, doch sah man diesen selten in Frideslar. Zwar war er der Herr des Klosters, soweit Paulus das verstand, doch reiste er lieber durch alle Ecken und Winkel des Landes, um noch mehr Heiden zu dem einen wahren Glauben zu bekehren und die Arglist des Widersachers aufzudecken und zu unterbinden. Und beinah jeden Tag, so hieß es, nahm er durch seine Predigten neue Völker in den unendlich weiten Schoß der heiligen Mutter Kirche auf.
Bonifatius war also mit Größerem beschäftigt, das verstand sogar Paulus´ Mutter, die darum mehr auf Wigbert denn auf Bonifatius setzte.
Und Paulus wusste nun, dass Bonifatius alles daransetze, den Hessen einen eigenen Bischofssitz zu verschaffen, und zwar vorzugsweise auf dem Buraberg, wo sich die große Festung der Franken befand.
Bonifatius habe also keine Zeit, sich um Embla zu kümmern, argumentierte Paulus´ Mutter, obwohl er natürlich wundertätig sei, überaus wundertätig. Schließlich sei es bereits ein Wunder gewesen, wie schnell die große Eiche damals gefallen war.
Indes war das Raunen niemals ganz verstummt, wonach sich einige Franken vom Buraberg in der Nacht vor der Fällung bereits an dem heiligen Baum zu schaffen gemacht hätten. Andere sagten aber, er sei einfach morsch und hohl gewesen, mit einem Wunder hätte das wenig zu tun gehabt.
Bonifatius hatte das alles nicht geschert. Sehr bald nach der Fällung war er wieder fortgegangen, um seine heilige Mission in das ganze Land zu tragen. Zuvor hatte der rastlose Missionar aber noch Wigbert aus Britannien, wo dieser bereits eine gewisse Verehrung genossen hatte, nach Germanien gerufen, und ihm die Leitung seines Klosters übertragen.
Dem freundlichen Wigbert.
Dem gütigen Wigbert.
Dem heiligen Wigbert.
Denn es zweifelte kaum noch einer daran, dass der Abt eines Tages, vermutlich sogar unmittelbar nach seinem Ableben, heiliggesprochen werden würde.
Er war tugendhaft und wundertätig, ihnen allen ein Vorbild, ganz bestimmt war er das. Trotzdem vermochte Paulus die Verehrung von Wigbert nicht in dem Maße zu teilen. Zwar war der Abt freundlich und gütig, fromm und hilfsbereit, und ihm ganz allein war es zu verdanken, wenn in der klösterlichen Gemeinschaft, die Bonifatius ins Leben gerufen, sehr bald aber schon wieder in beklagenswertem Zustand verlassen hatte, Zucht und Ordnung eingekehrt waren.
Doch Wigbert war auch streng und unnachsichtig, und vor allem war er völlig unlustig, was die Einführung der Rutenstrafe deutlich zeigte, auch wenn es der Novizenmeister Witta gewesen war, der diesen Vorschlag eingebracht hatte.
Paulus konnte sich noch an die Jahre vor Wigbert erinnern, als er hin und wieder mit seinem Vater zu dem aufstrebenden Kloster gekommen war, um bei den Mönchen Honig gegen Gerstensaft einzutauschen. Das emsige Gewusel auf dem weitläufigen Gelände hatte ihn jedes Mal sehr beeindruckt. Damals, so sagte ihm seine Erinnerung, war nicht selten lautes Lachen über den Platz gedrungen, und wenn ein Novize sein Pensum nicht gelernt oder sich über einen älteren Bruder belustigt hatte, dann wurde er zwar ermahnt und gewiss auch bestraft, aber nicht gleich geschlagen.
Diese freundliche Stimmung war einer der Gründe gewesen, warum Paulus dem Wunsch seiner Mutter am Ende entsprochen hatte.
Doch dann war Wigbert gekommen, und alles hatte sich geändert. Ihm eine lustige Zote erzählen zu wollen – da hätte man dieselbe auch dem Schnittlauch im Kräutergarten zuflüstern können: Eher noch hätten sich die Halme vor Lachen gebogen als der Mann, der selig darüber schritt. Die Rute führte er zwar niemals selber, aber er befürwortete durchaus, dass Männer wie Bruder Witta oder Bruder Bernhard sie gebrauchten.
Insbesondere der Novizenmeister hatte sich zum Quälgeist aller Schüler entwickelt. Und wann immer eine Strafe auszuführen war, war Witta zur Stelle:
Wenn man nicht sofort zum Gottesdienst eilte, sobald das Zeichen dazu gegeben war ...
Wenn man nicht pünktlich zum Singen der Verse vor dem Mahl bei Tische war ...
Wenn man außerhalb der festgelegten Zeiten aß oder trank ...
Wenn man beim Müßiggang angetroffen wurde ...