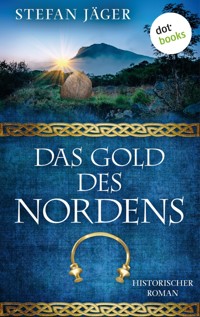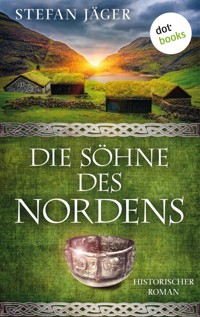8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die lange Geschichte Nordhessens in fünfundzwanzig kurzen Geschichten aus zwölf Jahrhunderten. Mal von Ihm erzählt und mal von Ihr - aber fast immer Stimmen aus dem Volk: Von Frauen, Männern und Kindern. Von Christen, Heiden und Mönchen. Von Bauern, Bürgern und Besenbindern. Von Schülern, Novizen und Zauberlehrlingen. Von Hexen, Soldaten und Revolutionären. Aber auch von Rittern, Priestern und Landgrafen, von Bischöfen, Kurfürsten und Königen. Sie alle haben ihre Geschichten, zu denen kurze Erläuterungen den historischen Hintergrund liefern. Wie Nordhessen wurde, was es heute ist, zeigen die abwechslungsreichen und ganz unterschiedlichen Geschichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zu diesem Buch:
Fünfundzwanzig Geschichten aus zwölf Jahrhunderten, mal von Ihm erzählt und mal von Ihr - aber fast immer Stimmen aus dem Volk: Von Frauen, Männern und Kindern. Von Bauern, Bürgern und Besenbindern. Von Schülern, Novizen und Zauberlehrlingen. Von Hexen, Soldaten und Revolutionären. Aber auch von Rittern, Priestern und Landgrafen. Sie alle haben ihre Geschichten, zu denen kurze Erläuterungen den historischen Hintergrund liefern.
Über den Autor:
Stefan Jäger, geb. 1970 inmitten des alten Chattenlandes, hat im Piper-Verlag die historischen Romane 'Der Silberkessel' und 'Das Gold des Nordens' veröffentlicht. Mehrere Theaterstücke liegen bei verschiedenen Verlagen vor, zumeist Stücke für Familien.
Die Chatten und die Hessen verfolgen ihn bereits länger: Wie wurde Nordhessen zu dem, was es heute ist?
Geschichte und Geschichten, Theaterstücke und Rätseleien, Bücher und Brettspiele, Stadtführungen und Physiotherapie - das sind die Dinge, mit denen er sich gern beschäftigt.
Inhalt
Vorbemerkungen
Chattenland
(
1. Jhd.)
Wilfirs Wahl
(
7. Jhd.)
Im Winterwald
(
8. Jhd.
)
Grenzland
(
8. Jhd.)
Heiligenverlegung
(
8. Jhd.)
Des Königs neue Kleider
(
10. Jhd.)
Eine einsame Entscheidung
(
13. Jhd.)
Windmüller
(
14. Jhd.)
Ammenmär
(
15. Jhd.)
Weibertreue
(
15. Jhd.)
O Hassia fortissima!
(
15. Jhd.)
Lehrlingsjahre
(
16. Jhd.)
Die Hand
(
16. Jhd.)
Wie haltet ihr es denn mit dem Glauben?
(
16. Jhd.)
Mehr Teile, weniger Ganzes
(
16. Jhd.)
Die Ratte im Stroh
(
17. Jhd.)
Sorglos
(
17. Jhd.)
Die Kunst des Backens
(
17. Jhd.)
Winterschüler
(
18. Jhd.)
Aus Neun mach Eins - ein Dialog
(
19. Jhd.)
Die Erben des großen Friederich
(
19. Jhd.)
Lustigk’s Land
(
19. Jhd.)
Flucht
(
19. Jhd.)
Nach dem Krieg
(
20. Jhd.)
Die gute Stube meines Großvaters
(
20. Jhd.)
Nachbemerkungen
Wer nicht von dreitausend Jahren
Sich weiß Rechenschaft zu geben,
Bleib im Dunkel unerfahren,
Mag von Tag zu Tage leben.
Goethe
Vorbemerkungen
Warum ähneln sich eigentlich die Wappen von Thüringen und Hessen so sehr? Wenn Hessen doch eine Landgrafschaft war, warum lesen wir dann mitunter vom Kurfürstentum Hessen oder gar Kurhessen? Und warum finden sich immer wieder Spuren von Mainz in unserem Land? Was hat es überhaupt mit der Bezeichnung Chattengau auf sich? Und warum wird Hessen manchmal in einem Atemzug mit Nassau genannt?
Kennen Sie die Antworten auf diese Fragen? Nur teilweise? Oder gar nicht? Mutet es nicht seltsam an, dass man sich in der ‚größeren‘ Geschichte, also der deutschen oder der europäischen, meist sehr viel besser auskennt als in der uns näher liegenden hessischen und vor allem der nordhessischen Geschichte?
Vielleicht kennt man das ein oder andere Ereignis daraus, vielleicht hat man auch den ein oder anderen Namen bereits gehört. Erst aber wenn man dieses Ereignis mit jenem Namen verbindet, wenn man hier noch ein wenig liest und dort noch ein bisschen recherchiert, erhält man endlich das größere Bild: Die Ereignisse und Namen machen der eigentlichen Geschichte Platz.
Und Nordhessen hat viel davon, hat eine lange und reiche Geschichte, obwohl diese oft genug zurücktritt, wenn von der Geschichte Hessens gesprochen wird: Zu dominant sind dann für gewöhnlich die Geschehnisse aus dem hessischen Süden, aus dem Rhein-Main-Gebiet und aus Frankfurt - und dabei bildeten sowohl diese Landschaft als auch diese Stadt nur die kürzeste Zeit überhaupt ein gemeinsames ‚Staatswesen‘ mit dem hessischen Norden.
Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Geschichten erfolgt an dieser Stelle bereits ein grober Überblick, der im Anschluss an jede Geschichte ein wenig vertieft wird:
Aus dem Kerngebiet des germanischen Chattenstammes wurde im frühen Mittelalter der fränkische Hessengau um die Grafschaft Gudensberg herum. Sehr bald wurde dieser auch Niederhessen genannt, in Abgrenzung zu Oberhessen. Für mehr als 100 Jahre gehörten beide zur Landgrafschaft Thüringen. Weitere 150 Jahre nach der Loslösung von den thüringischen Landgrafen verband der Erwerb der Grafschaft Ziegenhain die beiden Landesteile miteinander, die wir heute Nord- und Mittelhessen nennen. Zusammen bildeten sie die Landgrafschaft Hessen. Erst mit dem Erwerb der Grafschaft Katzenelnbogen kam schließlich auch Südhessen ins Spiel, allerdings nur vorübergehend, denn das Hessenland wurde bald wieder geteilt. Aus seinem nördlichen Teil, der Landgrafschaft Hessen-Kassel, wurde zur Zeit Napoleons dem Titel nach ein Kurfürstentum, Kurhessen genannt, und noch später eine preußische Provinz. Diese hieß für einige Jahrzehnte offiziell Hessen-Nassau. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstand aus Nord- und Südhessen das Land Hessen, wie wir es heute kennen.
Alle weiteren Informationen, die Sie benötigen, um Ordnung in dieses Durcheinander zu bringen, finden Sie in den Geschichten selbst und in den Erläuterungen dazu.
Chattenland1 (9 n. Chr.)
«Mache mich dann mal auf den Weg.»
Der Klang von Vaters Worten folgte dem Rauch des Feuers bis unter das Dachstroh. Durch das Giebelloch entwich beides hinaus in den Morgen.
Mit zusammengekniffenen Lippen wartete Vater auf eine Entgegnung von uns.
Da keine kam, griff er nach Speer und Schild. Seine Bewegungen wirkten auf mich alles andere als leicht. Ich wunderte mich, wie unglücklich er darüber zu sein schien, dass dieser Augenblick gekommen war. Was hätte ich an seiner Stelle gebebt vor Freude!
Doch was wusste ich, ein Junge von vierzehn oder fünfzehn Wintern, von den Pfaden eines Kriegers, welche ein Ackermann beschreiten musste? Was von den Ängsten, welche das Töten in den Wäldern mit sich brachte? Und was vor allem von dem Schicksal, das unserem Stamm in jenen Tagen beschieden war?
Vater wusste dagegen manches, ahnte anderes und fürchtete vieles. Seine Mundwinkel hingen herab, so wie der Lederbeutel mit dem entspelzten Getreide von seinem Gürtel schwer herabhing.
Mit verbitterter Miene sah er auf Mutter hinunter: «Sagst gar nichts dazu.»
«Was soll ich schon sagen?», fragte sie, blickte aber nicht auf.
Das Reiben von Körnern zwischen zwei Steinen begleitete ihre leisen Worte, ein Seufzen beschloss es. Mutter seufzte oft. Sie hockte auf dem Lehmboden, während Vater stand. Ich saß dagegen auf einer unserer drei Sitzbänke, löffelte meinen Hirsebrei aus der Schale mit dem Sprung und spitzte die Ohren wie eine Hirschkuh. Dabei spürte ich gar keinen Hunger, obwohl ich sonst nie genug bekommen konnte, gleich ob die Mutter Fladen buk, Kraut kochte oder Erbsen einweichte. Dass der Vater ging, erfüllte mich mit ungeheurer Aufregung.
Wie gern wäre ich mit ihm gegangen!
«Red doch lauter!», beschwerte sich Vater. «Könntest sagen …» Er verstummte. «Jedenfalls gehe ich jetzt. Muss ja.»
«Hm.»
«Frau, jetzt hör doch mal auf damit, deine Körner zu mahlen! Sein eigenes Wort versteht man nicht!»
«Die Jungen essen wie die Riesen, da mahl ich eben den halben Tag.» Mutter seufzte wieder, dachte aber nicht daran, den Mahlstein aus den Händen zu legen.
Ich grinste zu meinem jüngeren Bruder Askger hinüber, der mit vollen Backen zurückgrinste. Unsere beiden Schwestern sahen sich ebenfalls an. Askger schien die Aufregung nichts auszumachen, doch er verstand ohnehin selten etwas, während die Mädchen, obwohl jünger, überhaupt nichts essen konnten.
Was Chada anging, konnte das aber noch einen anderen Grund haben, sie hatte nämlich unseren allmorgendlichen Wettlauf um den süßen Rahm, der sich in der Nacht auf der Milch absetzte, knapp gewonnen. Wie schnell das kleine Biest aus den Fellen hüpfen konnte, war wirklich erstaunlich!
Dass Chada und Kunna hier und jetzt nicht gleich losflennten, war für mich hingegen eine Überraschung.
«Die Mäuse», fuhr Mutter dann fort, «fressen auch wieder so viele Körner.»
«Die Jungen sollen nachher noch mal Mäuse jagen! Verstanden?»
Ich nickte zu Vaters Worten, und Askger grinste schon wieder. Ich hasste es, aber mein Bruder liebte das Jagen von Mäusen und Ratten im Haus und in der engen Vorratsgrube: Dass diese verdammten Nager keine Winterruhe halten konnten! Wer nur einmal Mäuse gejagt hat, der weiß um die Mühsal einer solchen Jagd.
«Mach‘ mich dann auf den Weg. Gehen doch alle, da kann ich kaum daheimbleiben.» Trotz seiner Worte rührte Vater sich nicht von der Stelle, stellte sogar den hellbraunen Rundschild wieder auf den Boden. Dieser war so schwer, dass ich Vater verstehen konnte. Es brauchte eine Menge Übung, ihn tagelang durch die Wälder zu tragen.
Wenn ich einmal einen eigenen Schild hätte, wäre er in der Farbe wie alle Schilde unserer Sippe, aus Eiche bestünde er allerdings nicht.
«Nein.»
«Sagst nein und meinst ja, Frau. Schon deine Mutter hat immer alles verdreht. - Du verstehst das doch alles nicht! Wenn der Herzog ruft, muss ich eben gehen, ob ich will oder nicht. Die Ernte ist doch jetzt auch vorbei. Ich komm schon wieder, mach dir mal keine Sorgen.»
«Nein.» Mutter fegte das Mehl mit den Fingern in eine Schüssel und schüttete dann aus dem Leinenbeutel neue Körner in die Rundung des Reibsteines.
«Tust du doch! Ich weiß genau, dass du dich sorgst - machst du immer: ‚Das Futter reicht nicht, die Jungen essen zu viel, die beiden Kühe geben zu wenig Milch, das Dach ist undicht …‘ Machst dir immer Sorgen. Wie alle Weiber. Deine Mutter war auch so.»
«Muss ja eine den Überblick behalten.»
Ich hatte sie ganz gut verstanden und musste grinsen.
Vater, wohl nicht sicher über ihre Worte, war dagegen alles andere als belustigt. Nie hätte er sich eingestanden, dass es eigentlich Mutter war, die unseren Haushalt zusammenhielt.
«Was? Red doch lauter, verdammt, bei deinem Gemahle! Meinst du etwa, dass ich nicht darüber nachdenke, wie es euch geht, wenn ich weg bin? Jeden Tag denk ich an euch und bete und opfere ein paar Körner. Jedenfalls muss ich jetzt gehen, ob ich bei dem Scheißregen nun will oder nicht …»
«Willst doch.»
«Was sagst du? Götter, mach einmal nur den Mund auf, Frau! Deine Mutter konnte doch auch schreien wie ein Rind im Sumpf. Dein armer Vater! Kein Wunder, dass der taub war, wie er nachher in den Wald ist. Am Ende ist er noch wegen deiner Mutter weg und gar nicht, weil alles knapp war.»
An Großvater konnte ich mich kaum erinnern. Vor acht oder neun Wintern war er in den Wald gegangen und nie mehr zurückgekehrt. Ein Hungerwinter war das gewesen, lang und kalt, der zweite nacheinander.
«Du willst doch, sag ich», rief Mutter und verdrehte die Augen.
Ich war mir da nicht so sicher, ob Vater wirklich wollte.
«Was will ich?»
«Gehen.»
«Natürlich will ich gehen! Ist ehrenhaft zu gehen und zu kämpfen. Wodan schätzt den Kämpfer viel mehr als den Ackermann. Gepriesen sei er in Asgard!»
«Es gehen doch gar nicht alle mit.»
«Die Sippe geht aber!», raunzte Vater.
Eben das war ja mein Elend, weil alle aus unserer Sippe gingen, nur ich allein nicht.
Beinah flehentlich sah Mutter auf. «Wenn du doch nur den Großen dalassen würdest!»
Ja, und wenn du doch mich stattdessen mitnehmen würdest, dachte ich.
«Der Junge hat siebzehn Winter auf dem Buckel, der geht mit! Wir kommen schon zurück.»
Mutters Schnauben klang wie bei einem störrischen Pferd: «Wenn dann bloß alles noch dran ist an euch!» Mit der Rechten rieb sie ihre Augen.
«Frau, jetzt hör mal auf zu flennen. Werde ihn dir schon zurückbringen.»
Ich war mit einem ungeheuren Neid auf meinen großen Bruder erfüllt, der gerade einmal zwei oder drei Winter älter als ich war - genau konnte ich das nicht sagen, weil meine Eltern sich über mein eigenes Alter uneins waren. Ich hoffte sehr, Vater erinnerte sich besser als Mutter, denn dann wäre ich schon fünfzehn Winter alt und nicht erst vierzehn. In jedem Fall fühlte ich mich alt genug, um mit ihnen zu ziehen. Vater hatte aber nur müde abgewunken.
«Dass du nur auf ihn aufpasst!»
«Werd‘ ich schon.»
«Sag doch dem Herzog ...», Mutter hielt bewegt inne, ehe sie weitersprach. Das kleine Feuer knisterte vernehmlich. Sogar meine Schwestern hatten die Luft angehalten. «... dass du nicht gehst. Bist doch frei und nicht unfrei.»
Vater erbebte sichtlich. «Sollen die anderen Männer mit dem Finger auf mich zeigen? Ich muss gehen. Soll ich etwa Körner mahlen und mich um die Kinder kümmern? Das kommt noch soweit! Gerade weil ich frei bin, muss ich gehen - unsere Freiheit können sie nämlich nicht für ihre verdammten Silberscheiben eintauschen und auch nicht für ihren Vinum, die Romlinge.»
«Hm.» Mutter hatte sich wieder tief über die beiden Steine gebeugt.
«Was brummst du die Körner an? Hör doch endlich auf zu mahlen!»
«Muss trotzdem zusehen, dass du und die Kinder was zu essen haben, ob ich frei bin oder nicht. Den halben Tag mahl ich Körner, den halben Tag kümmere ich mich ums Viehzeug.»
«Jaja, deine Mutter hat auch immer gedacht, ohne sie geht alles vor die Hunde! - Aber Hauptsache frei, auch wenn man den Gürtel mal enger schnallen muss! Schmeckt auch besser, wenn man in Freiheit essen kann, statt Knechtsbrei zu löffeln.»
So frei wir auch waren: Dass Mutter kein Salz in den Brei gemischt hatte, weil wir knapp daran waren, sondern wieder nur irgendein Grünzeug, das bekam ihm gar nicht: Er schmeckte wie eingeschlafene Füße. Im Übrigen war ich mit Mutters Worten nicht einverstanden, denn zumeist war ich es, der die Schweine und Kühe fütterte. Und Chada mahlte meist die Körner.
«Frei sind wir, frei bleiben wir», rief Vater mit Klang in der Stimme, «frei wie die Asen.»
Mutter blickte trotzig auf. «Körnerbrei ist Körnerbrei. Und so frei sind die auch nicht, deine Asen.»
«Das sind doch Götter, Frau! Wer ist denn frei, wenn nicht die Asen?» Vater schwang den Eschenspeer, der dumpf an einen Deckenbalken stieß. «Verflucht!»
«Haben auch ihr Schicksal, Wodan, Donar und die anderen Asen2 und ...» Sie seufzte und verstummte.
«Ach, hör auf zu brummen, ich weiß schon, was du denkst!»
«Was denn?», fragte Mutter.
«Was denn, was denn?», machte Vater sie nach. «Woher soll man das wissen?»
«Angst hab ich, Angst um dich und den Jungen. Hast du denn keine?»
«Hm.»
«Jetzt brummst du selber!»
«Weil ich eben keine habe, darum!», bekräftige Vater. «Schwächlinge haben Angst. Soll ich den Strohtod sterben, wenn ich alt bin? Eine Schande ist das.»
«Der Herzog sagt, es ist gut, wenn man auch mal Angst hat.»
«Wann hat er das denn gesagt?»
Das hätte ich ebenfalls gern gewusst. Ich wollte jedenfalls nicht den Strohtod sterben, wollte nicht schmählich im hohen Alter auf einer weichen Lagerstatt meinen Atem aushauchen - ich würde ganz bestimmt den Schlachtentod suchen und ihn finden.
«Die Aska hat es gesagt, was dem Herzog seine Frau ist», sagte Mutter.
Vater machte eine abwehrende Bewegung mit der Hand. «Was ihr Weiber euch alles zusammenspinnt, wenn ihr in der Grubenhütte beisammenhockt und Wolle zupft! Das ist wieder so ein Unsinn.»
«Doch», beharrte Mutter, «hat sie erzählt. Sind uns vier Frauen gewesen, als die Aska das erzählt hat. Ich hab doch meinen Verstand noch beisammen! Du, Mann, ich hab wirklich Angst.»
«Frau, was soll ich denn machen? Denk doch mal an all die Sachen, mit denen wir heimkommen werden! Wo die Ernte schon nicht so gut war. Sind ja auch nicht sehr groß die Romlinge, was können die einem schon tun? Darum sind sie nämlich in Leder und Eisen gekleidet, weil sie Angst haben. Von meinem Getreide kriegen die jedenfalls nichts, nicht ein Korn!» Er machte eine kleine Pause für die Wirkung. «Niemand kriegt von meinem Getreide!»
«Hast denen aber schon mal Korn geben müssen. Wird doch dann auch mal gut sein damit.»
«Isses aber nicht, Frau, die wollen nämlich in jedem Sommer welches!» Voller Unverständnis schüttelte Vater seinen Kopf. «Jeden Sommer. Den Romlingen gibst du nicht einmal und dann gar nicht mehr. Bald sind wir hier so arm wie nur was, so wie die anderen Stämme im Süden. Frau, du weißt aber schon, was die hier wollen, die Romlinge?»
Mutter hob kurz ihre Schultern. «Weiß nur, was ich von den anderen Frauen so höre. Und was du mir erzählst. Ist aber auch nicht viel, was du weißt.»
«Was? Redest schon wieder so leise. - Hast doch wohl nicht gesagt, dass ich auch nicht viel weiß?»
Ich war mir sicher, dass Mutter genau das gesagt hatte. Sie schwieg aber und mahlte.
«Dachte schon. Die Romlinge kommen nämlich, um unser ganzes Land zu erobern. Jeder weiß das!»
Mutter seufzte, während ich ausatmete. «Nützt doch keinem was, der ganze Kampf, nur den Edelingen.»
«Bist du von allen guten Geistern verlassen und von Loki behaust?», rief Vater. «Allen nützt das, allen hier in Mattium und dem ganzen Stamm! Sogar allen Stämmen bis rauf zu den Chauken und Friesen am Weltmeer. Wir werden frei sein und müssen den Romlingen kein Getreide mehr abgeben. Da werden ja sogar die Götter noch irre: Warum sollen wir Chatten denen in jedem Sommer von unserem Getreide abgeben? Was tun die denn für uns Chatten? Was für ein Gedanke! Wo wir selbst kaum genug haben! Die Ernte war schon schlecht genug. Wenn das nur reicht bis nach dem Winter, sonst ist der Hunger da! Wäre die Ernte nicht vorbei, würde ich erst gar nicht gehen. Die anderen bestimmt auch nicht. Warum sollen wir das also tun, denen Getreide abgeben? Oder eine Kuh? Was haben die mit meinen Kühen zu schaffen? Was machen die für mich? Füttern die etwa meine beiden Kühe? Bringen die mir ihren Deckstier? Muss ich doch alles selber machen!»
Trotz der vielen Worte hatte Mutter nicht einmal aufgesehen. «Aska», sagte sie, «was die Frau vom Herzog ist, sagt: Die Römer beschützen uns dafür.»
Da sie nun die Worte von jemand anderem wiedergab, gebrauchte Mutter jene Bezeichnung, die alle anderen für die kleinen Männer aus dem Süden gebrauchten: Römer. Einzig Vater nannte sie beharrlich ‚Romlinge‘. Aber unserer Sippe sagte man ohnehin nach, wir hätten Köpfe, mit denen man Körner mahlen könne.
«Vor was wollen die uns denn beschützen?», bellte Vater, «vor den Hermunduren etwa? Vor denen können wir uns selber schützen.»
Die Hermunduren waren ein wilder Stamm, der das Land hinter der Ödnis innehatte, ein ganzes Stück nach Osten hin.3 Seit vielen Wintern und Sommern lagen wir im Krieg mit ihnen, aber ich fand auch, dass wir uns vor diesen Schweinehunden gut selber schützen konnten. Wo die Hermunduren beinah noch auf den Bäumen lebten!
«Die Romlinge kommen sowieso nur im Sommer. Im Winter sind die doch überhaupt nicht da! Wer schützt uns also im Winter? Und die meisten von denen sind doch viel kleiner als ich. Tun aber so, als seien sie alle so groß wie Riesen. Und die wollen uns beschützen?»
«Kleine Männer sind bösartig. Hat meine Mutter schon immer gesagt.»
«Die hat aber nicht die Romlinge gemeint, sondern bloß den alten Jökul, weil der sie vor zehnmal zehn Wintern ein fettes Ferkel genannt hat. - Horcht, das Horn! Die anderen werden denken, ich mach mir schon in die Hose.»
In dem Augenblick drang Tageslicht in die Dämmerung unseres Langhauses, da die Holztür schabend aufging und mein großer Bruder Ask seinen blonden Schopf hereinsteckte. Die Lederkappe darauf glänzte feucht.
«Vadder, komm doch! Hörst du das Horn nicht? Sie sammeln sich längst.» Er grinste und strich sich einige nasse Haare aus dem Gesicht. «Oder soll ich allein gehen und sagen, dass Mutter dich nicht lässt? Dass du Furcht hast?»
Ask war sehr groß, fast einen halben Kopf größer als ich, aber genauso dürr. Alle sagten, wir sähen einander sehr ähnlich.
«Untersteh dich! Den Winter fürchte ich und sonst gar nichts! - Muss dann los, Frau! Pass mir gut auf die Kinder auf! Und lass mal die Körner in Ruhe, und drück mich noch mal. - Ach, jetzt hör schon auf zu weinen!»
Unter Schniefen und Stöhnen war Mutter aufgestanden, um Vater fest zu umarmen. «Komm mal bloß heile wieder, ja? Und hab mir gut acht auf den Großen! Und auf Wölfe achtet ihr auch, nicht wahr?»
Vater griff nach seinem Rundschild und entgegnete brummig, Wölfe hätten mehr Angst vor den Menschen als umgekehrt. Außerdem habe er schon lange keinen mehr in der Gegend gesehen.
Dann, nachdem Mutter Ask so lange umarmt hatte, dass dieser sich losreißen musste, warf sie seufzend einen Blick auf das ohnehin niedrige Feuer, und wir verließen zusammen das Langhaus, um Vater und Ask zum Treffen zu begleiten: ich, die Mutter, der kleine Askger und die beiden Mädchen. Schnell waren wir alle nass. Aber der Regen war warm, denn der Sommer war eben erst vorübergegangen und der Winter noch fern.
Gemeinsam gingen wir zum westlichen Tor. Davor, oberhalb des Hanges, wartete der Herzog auf seinem Pferd. Mit strengem Blick beobachtete er, wie Mattiums Männer sich versammelten. Beinah alle waren sie da: seine eigenen Gefolgsleute mit ihren blauen Schilden und den eisernen Fingerringen und natürlich Vaters Brüder sowie etliche andere.
Ich glaube, es waren zehnmal zehn Männer und das drei- oder viermal, über die der Herzog seinen Blick gehen ließ. Viele waren aus der Umgebung Mattiums gekommen, denn so viele Männer konnte unser Ort allein gar nicht aufbieten. Und das war sehr erstaunlich, weil außerhalb Mattiums eher Ackermänner lebten als Krieger, während wir hier mehr Krieger waren und weniger Ackermänner. Aber wenn das Heer der Chatten durch die bunten Wälder nach Westen liefe, würden noch viele weitere Männer aus kleineren Siedlungen oder von einsamen Gehöften dazustoßen. Seit etlichen Wintern lebten wir nun schon in diesem schönen Hügelland, und selbst mein dummer Bruder Askger war alt genug, um zu verstehen, dass es uns vor vielem schützte, Hügelbewohner zu sein und vor den Romlingen nicht zuletzt.
Der Herzog saß als einziger außer seinem Bruder auf einem Pferd, einem dunklen Tier mit zottiger Mähne. Er war ein großer Mann mit einem Eisenhelm, unter dem blondes Haar hervorwallte.
So sehr wünschte ich mir bei diesem Anblick, ein eigenes Pferd zu haben und auf eine Schar von Gefolgsleuten herabzublicken, dass es mich beinah zerriss.
Wir gehörten zu den Letzten, die anlangten, eben hob der Herzog bereits die Hand. «Auf, ihr Männer der Chatten, denn Ruhm und Ehre warten auf jeden von uns. Ruhm und Ehre», er machte eine kleine Pause, «und reiche Beute.»
Ich spürte, wie es die Männer packte, und einige riefen zustimmende Worte. Aber der Herzog hatte da schon alles gesagt, was er zu sagen hatte. Mir lief es jedenfalls über den Rücken wie von kaltem Wasser, als der Herzog sein Pferd wendete, dem Tier die Fersen in die Seite stieß, und alle Männer in einen Laufschritt fielen. Die Frauen blickten ihnen stumm nach.
Herzog Arpo war in diesen Tagen der Erste unter allen chattischen Edelingen, und darum ritt er auch vor allen anderen. Noch lange erkannten wir aber Vater und seine Brüder an ihren hellbraunen Schilden.
Und so zogen die Chatten in den Krieg, denn dazu waren sie gerufen worden: Überall wurde es erzählt, schon seit Tagen, dass die Romlinge in die Falle liefen, die ihnen ein einziger Mann gestellt hatte, ein Herzog der Cherusker, der schlau wie Wodan sei. Selbst Vater nannte ihn - wenn auch nur sehr widerwillig - einen Fuchs. Auf allen Hügeln wurde aber geraunt, in allen Wäldern wurde gewispert, wie die Schlange in die Falle kröche, die der listige Fuchs ihr gestellt hatte. Und bald schon würde sie bluten, diese römische Schlange, schon winde sie sich und spucke ihr Gift ...
Durch alle Gaue rannten dieser Tage Läufer und riefen nach Kämpfern: Denn wenn der Mond erst voll wäre, dann - und bei dem Gedanken schauderte es mich - würde der Schlange die Haut abgezogen werden.
Obwohl mein Vater keine hohe Meinung von alldem gehabt hatte, weder von den Cheruskern im Allgemeinen noch von ihrem jungen Herzog im Besonderen, war er nun mit unserem Herzog gegangen, um gemeinsam mit den Cheruskern und anderen Stämmen gegen die Romlinge zu kämpfen.
Mir klangen aber seine Worte noch im Ohr, welche er mehr als einmal gesagt hatte: «Dieser Kerl, dieser junge Herzog, wahrhaftig, ein Fuchs ist der! Und dabei ist er doch nur ein Cherusker und ein überheblicher dazu! Dem seine ganze Sippe ist so gewesen, immer schon. Kriegsheil, na, vielleicht hat er das! Aber die Cherusker sind doch nur ein Räuberhaufen gewesen, immer schon. Und ausgerechnet die Cherusker kämpfen jetzt gegen die Romlinge? Ha! Die haben doch zuerst alle für die Romlinge gekämpft, das waren doch ganz enge Freunde von den Romlingen. Die Romlinge machen Räuber nämlich gern zu ihren Freunden. So ist das! Weil sie selbst die allergrößten Räuber sind! Und dann, als einige Cherusker von denen nicht mehr die Freunde sein wollten, hat dieser Räuberhäuptling erst noch gegen die eigenen Leute gekämpft. Und dafür haben die Romlinge schließlich ihm und seiner ganzen Räubersippe die Macht über die Cherusker gegeben! Und wie dankt der das den Romlingen jetzt? Der Kerl ist doch selbst mehr ein Romling als ein Cherusker. Aber ein Fuchs, na gut, das ist er schon!»
Wir Jungen folgten dem Kriegerhaufen ein ganzes Stück den Hang hinunter und weiter, aber schließlich wurde uns befohlen zurückzubleiben. Die meisten von uns keuchten da längst wie ein Eber auf einer rauschigen Sau. Da standen wir nun und trauerten dem Ruhm nach, der uns entging, dem Ruhm und der Beute.
Neben mir stand mein kleiner Bruder, auf der anderen Seite meine drei Vettern. Bernulf, der Älteste von ihnen, konnte ebenfalls nicht fassen, dass er zurückbleiben musste, obwohl er sogar älter war als ich. Auch Ariovist, der älteste Sohn des Herzogs, der Chatte mit dem Suebennamen, konnte sich einen Spott darüber nicht verkneifen. Laut beschrieb er seinen Brüdern, wie sicher und geborgen Bernulf bei den Weibern doch wäre.
Mein Vetter drehte ihm eine Nase, und wenige Herzschläge später hatten wir Jungen schon einen johlenden Kreis gebildet, in dessen Mitte sich Bernulf und Ariovist mit erhobenen Fäusten gegenüberstanden. Ariovist war etwas jünger und kleiner - noch, denn die Herzogssippe war für ihren großen Wuchs bekannt.
Ich stand mit meinem Bruder Askger bei meinen Vettern, und wir schrien für Bernulf, was unsere Stimmen hergaben, aber die Brüder und Vettern von Ariovist standen uns in nichts nach.
Bernulf hielt sich anfangs nicht übel, lag aber trotzdem schon bald auf dem feuchten Boden. Schließlich streckte er einen Arm mit geöffneter Hand weit nach oben. Ariovist ließ sofort von ihm ab.
Enttäuscht nahmen wir einen ebenso enttäuschten und dreckigen Bernulf in Empfang, priesen ihn aber dennoch für seinen Kampf. Den ein oder anderen Schlag hatte er Ariovist immerhin verpasst. Arpos Sohn hatte sogar Blut im Gesicht. Erstaunlich war die Niederlage jedoch nicht. Unsere Sippe war im Rudel stark, doch wussten wir alle, dass ein jeder von uns gegen Ariovist schlecht ausgesehen hätte - mit Ausnahme meines großen Bruders natürlich, der allerdings zwei Winter älter als der Herzogssohn war.
Von seinen Anhängern ließ dieser sich jetzt feiern, als ob er sämtliche Romlinge allein besiegt hätte, während ihm das Blut von der Schläfe über die Wange lief.
Mit einem Mal stand meine Schwester Chada vor unserem Haufen. Weiß der Himmel, aus welchem feuchten Loch das dumme Ding so plötzlich hervorgekrochen war! Und tatsächlich ging sie - kindische Chada mit ihren lächerlichen dreizehn Wintern - auf Ariovist zu und legte ihm sanft eine Hand auf den Kopf, als wäre er nichts weiter wie ein Lämmlein. Mit einem Leinenfetzen in der anderen Hand wischte sie ihm das Blut von der Wange. Und wie ein Lämmlein ließ der es geschehen und starrte Chada blöde an.
Ich spürte, wie sich in mir der Zorn regte, trat eilig hinzu und zog sie fort. Sie wehrte sich, nannte mich herzlos, eigensüchtig und dumm, aber ich fuhr ihr über den Mund, und es kam, was bei Weibern kommen musste: Tränen, dicke, runde Tränen, die sich mit dem Regen mischten.
Immerhin hatte sie aufgehört, sich in meinem Griff zu winden.
Und dann ging ich mit meinen Geschwistern und Vettern nach Hause, Bernulf in unserer Mitte, der dem Ariovist noch einmal eine Fratze zog, aber so, dass dieser es nicht sah.
Und während mein Bruder und ich in den Krieg gegen die Mäuse in unsrer Vorratsgrube zogen, begann in Mattium das große Warten auf Nachrichten aus den Wäldern des Westens, in welchen unsere Väter und Brüder zusammen mit Arminius und den Cheruskern gegen die kleinen Männer aus dem Süden kämpften.
Im Jahr 15 n. Chr. kamen die Römer mit einem großen Heer nach Mattium, dem Hauptort, möglicherweise aber auch der Hauptgegend der Chatten. Und das war der Zeitpunkt, zu welchem dieser Germanenstamm von römischen Historikern erstmals im Bereich der Eder lokalisiert werden konnte: Mit ihnen hatte Nordhessen seine ersten namentlich bekannten Ureinwohner bekommen.
Woher die Chatten ursprünglich kamen, ist nicht bekannt. In Nordhessen waren sie um die Zeitenwende herum zwar nur Einwanderer, sind im Gegensatz zu fast allen anderen Stämmen Germaniens, die irgendwann im Zuge der großen Völkerwanderung des 4. und 5. Jhds. in Bewegung geraten sind, dort aber geblieben - einige bedeutende Abspaltungen nicht gerechnet. Und über mehrere Lautverschiebungen sowie den Umweg Chatti - Hatti - Hassi - Hessi haben sie den späteren Hessen vermutlich sogar ihren Namen vererbt.
Ob die Chatten 9 n. Chr. bei der später so genannten Varus-Schlacht unter der Führung des Cheruskers Arminius überhaupt dabei waren, ist nicht bekannt. Erwähnt werden sie in diesem Zusammenhang nämlich nicht. Allerdings gibt es sehr starke Indizien, die für ihre Beteiligung sprechen. Vor allem sind das die großen römischen Feldzüge der Jahre 15 und 16 n. Chr., für die das Chattenland ein Hauptziel darstellte und in denen Mattium dem Erdboden gleichgemacht wurde.
1 Sie können es Kattenland aussprechen, Sie können das ch aber auch hauchen wie in dem Wort ach. Beides hat seine Befürworter.
2 Donar ist der mitteleuropäische Name des nordischen Thor, Wodan der von Odin. Beide gehören zur Götterfamilie der Asen.
3 In Teilen des heutigen Thüringens.
Wilfirs Wahl (um 650)
Er war der Erste, der versuchte, über den unsichtbaren Graben zu springen, welcher zwischen den beiden Hälften des kleinen Dorfes verlief.
Heimlich sahen ihm alle dabei zu. Und je nachdem, welchem Glauben sie anhingen, waren sie für Wilfir oder gegen ihn.
Das ganze Dorf wusste, wie viel Zeit er von Kindesbeinen an zusammen mit Hesa verbracht hatte. Damals war das gewesen, als Hesa noch nicht Maria hieß und ihre Eltern noch nicht Chlothilde und Markus. Wenn man es genau nahm - und viele erinnerten sich zwar daran, aber nur wenige nahmen es genau -, dann waren die beiden von ihren Vätern einander sogar versprochen worden. Alle Beteiligten hatten sich stets an dieses Versprechen gebunden gefühlt und waren bestrebt gewesen, es einzulösen.
Doch dann war der eifrige Mann mit dem Kreuz gekommen, und die Dinge hatten sich geändert, so wie ein Hungerwinter, ein verregneter Sommer oder eine Krankheit die Dinge ebenfalls ändern konnten.
Wäre jener Kreuzmann aus der großen Hügelfestung der Franken nicht gewesen, der einige Winter zuvor das Dorf besucht hatte - manche sagten heimgesucht -, dann hätte alles seinen einmal geplanten Verlauf genommen. Hesa wäre dem Wilfir vermählt worden, und sie hätte dabei Frija angerufen, die Schutzherrin der Ehe, er hingegen den Allvater Wodan, den Himmelsgott. Gemeinsam wären sie über das Feuer gesprungen und hätten damit ihren Bund besiegelt, der gehalten hätte bis zum Ende ihres Lebens.
So hatten die drei Strickerinnen des Schicksals es verfügt, denn sie allein kannten das Leben der Menschen im Ganzen, bemaßen und beendeten es.
Doch der Kreuzmann war über die Hügel gekommen, und die Dinge hatten sich geändert. Mit Feuereifer hatte er in einer unverständlichen Sprache große Worte von sich gegeben und dazu seltsame Gesten getan.
Dann hatte er einigen Dorfbewohnern das kalte Winterwasser des nahen Bachlaufes über ihr Haupt gegossen.
Anfangs war die Bereitschaft der Dörfler zu dieser Wassertaufe sehr verhalten gewesen. Da aber einige fränkische Soldaten mit dem Mann gekommen waren und weil die vornehmste Familie des Ortes sich schließlich dazu bereit erklärt hatte, waren andere ihrem Vorbild gefolgt.
Aber bei weitem nicht alle.
Hinterher wurde geflüstert, Catumer, das Oberhaupt jener Familie, sei für seine Taufe vom Herrn der hiesigen Franken reich entlohnt worden. Dieses Gerücht sorgte für böses Blut zwischen den Getauften und den Ungetauften, aber auch innerhalb der Gemeinschaft der Tauflinge.
Doch Hesa hieß von da ab Maria, was Wilfir an der Sache am meisten bekümmerte, denn ihre Eltern machten deutlich, dass es keine Vermählung mehr geben würde, keine Anrufung von Frija und erst recht keinen Feuersprung.
Und auf einmal machte sich ein Sohn von Catumer Hoffnungen auf Hesa.
Lange hatte Wilfir mit sich gerungen, aber am Tag der Wintersonnwende betrat er schließlich die Hütte von Marias Eltern. Es war seine feste Absicht, ihr endlich den blauen Glasarmreif zu schenken, welchen er in der großen Hügelfeste der Franken gegen zwei Schaffelle eingetauscht hatte.
Als Wilfir, den Reif fest in der Hand, die verräucherte Hütte betrat, sprang Marias Vater Markus - Catualda, dachte Wilfir - mit einem Satz von dem klobigen Tisch auf, an dem er über einer frischen Scheibe dunklen Brotes und einer Schale Sauermilch gesessen hatte. Hastig griff er nach seinem Jagdspeer, der an der Wand lehnte. Was ein Ungetaufter im Heim eines getauften Christenmenschen wolle, rief Marias Vater erbost. Und: Er solle sich doch besser gleich wieder hinausscheren, sonst spieße er ihn auf wie eine Wildsau.
Maria war ebenfalls aufgesprungen, bleich wie der volle Mond und in Wilfirs Augen nicht weniger schön. Er konnte aber keinen weiteren Gedanken auf sie verwenden, so gern und so oft er das eigentlich tat, denn die Speerspitze ihres Vaters wies genau auf sein Gesicht. Die Furcht um sein Leben hielt sich jedoch in Grenzen. An diesem Tag musste ein anderes Opfer gebracht werden.
Marias Mutter rief mit sich beinah überschlagender Stimme ihren neuen Gott an und drohte, sofern er, Wilfir, sich nicht füge und augenblicklich wieder gehe, werde er, bei Gott, stehenden Fußes vom Blitz erschlagen werden, welchen der allmächtige Gott, gepriesen sei er in seiner ganzen Herrlichkeit, schicken werde.
In diesem Augenblick, den Speer vor Augen, erinnerte sich Wilfir, worüber all jene gern spotteten, die noch zu Wodan und Donar beteten: Dass die Christen, wie sie sich nach einem Untergott oder so ähnlich nannten, dass die Christen also ihren Obergott beinah so häufig im Wort führten, wie sie Luft holten.
Wilfir wusste hingegen, was er seinen Wünschen schuldete. Wenn er aber nun bereit wäre, fragte er darum mit unbewegter Miene, ein Christ zu werden? Dabei sah er nicht Maria an und nicht ihre Mutter, sondern ihren Vater.
Was?
Wilfir konnte gar nicht sagen, wer das Wort ausgestoßen hatte, vielleicht alle drei, vielleicht nur Maria und ihr Vater. Ein wenig senkte sich die Spitze des väterlichen Speeres.
Er solle nicht über den Herrgott spotten, denn dieser werde ihn richten, rief Marias Mutter mit großem Eifer in der Stimme, gewiss, das werde er, denn seine Macht sei einzigartig, bei Gott, das sei sie.
Wilfir wusste, unter der Führung dieser fremden Männer mit dem Kreuz waren die neuen Christen im Dorf schnell zu Eiferern geworden. Selbst wenn das Dorfgefüge darüber zu zerbrechen drohte, so waren sie dennoch stolz auf ihren jungen Glauben und trugen ihn nur zu gern nach außen. Es sei ihm ernst, beteuerte er, ohne die Augen niederzuschlagen.
Und es war ihm tatsächlich ernst damit, innerhalb gewisser Grenzen zwar, aber immerhin. Seine eigenen Eltern würden hingegen bittere Tränen vergießen, wenn sie von seiner Absicht erfuhren. Das war Wilfir bewusst. Er roch die grünen Tannenzweige in der Hütte und sah das Gebildbrot auf dem Sockel neben der Feuerstelle liegen. Hier hatte es zwar die Umrisse eines Engelwesens - eine Walküre, dachte er unwillkürlich - und nicht die sonst üblichen eines Tieres. Die Früchtekuchen aber, die für diesen besonderen Tag auch von seiner Mutter und seiner Schwester gebacken worden waren, waren ganz und gar dieselben.
Insgeheim fragte sich Wilfir, das Speerblatt nun auf Höhe seiner Brust, was in dieser Hütte eigentlich anders war als in der seiner Eltern.
Ernst sei es ihm also? Bei Gott, rief Marias Mutter Chlothilde wieder und machte eine Geste vor ihrer Brust, das könne sie nicht glauben, das könne sie wirklich nicht glauben.
Die Geste hatte Wilfir schon oft bei den Kreuzmännern aus der Frankenfestung gesehen. Sie erinnerte ihn an die Form von Donars Hammer. Er wusste aber, dass sie in Wirklichkeit ein Kreuz darstellen sollte, weil der Untergott an einem Kreuz gestorben war. Es hatte ihn stets verwundert, dass die Christen einen solchen Tod, den er sich schlimm vorstellte, noch verherrlichten.
Ob er denn an diesem Abend auch die Geburt des Herrn Jesu feiern wolle, fragte dagegen Marias Vater Markus. Dessen Stimme hatte mit einmal etwas Feierliches bekommen. Der Eschenspeer zeigte plötzlich mit der Spitze gen Boden.
Wilfir legte eine Festigkeit in seine eigene Stimme, die er ganz und gar nicht verspürte. Ja, wenn sie ihn nur in ihre Gebräuche einführten, dann wolle er auch mit ihnen ihr Fest feiern.
Was würde Wodan dazu sagen? Doch hatte der Allvater nicht auch geschwiegen, als ein Teil des Dorfes sich von ihm abgewandt hatte? Und vielleicht änderte sich gar nicht viel für Wilfir, denn hatten die Christen nicht so manches bedeutungsvolle Zeichen und so manchen Brauch von den alten Göttern genommen? Auch der Blitz, mit dem Marias Mutter gedroht hatte, war doch immer das Zeichen des Donnerers gewesen und würde es stets für ihn bleiben. Und Donars ehrwürdige, uralte Eiche würde im Heiligen Hain noch solange stehen, bis erst Alter oder Götterdämmerung sie fällten. Kein Mensch würde es bemerken, ginge er heimlich dorthin, um dem Gott sein Opfer zu entbieten ...
Ob er denn darauf verzichten wolle, fragte Markus weiter, in der geweihten Zeit und überhaupt danach den Heidengöttern Opfer zu bringen?
‚Heiden‘, so wurden die Nichtchristen von den Christen gern geschimpft.
Ja, sagte Wilfir schlicht und spürte, wie er das Feuergesicht bekam.
Doch Markus war noch nicht am Ende. Ob Wilfir an diesem Tag mit ihnen fasten wolle, anstatt mit seinen Eltern ein Feuer zu entzünden? Chlothilde nickte heftig dazu und rang ihre Hände, während Maria stumm schaute.
Denn Wilfirs Eltern ehrten an diesem besonderen Tag die alten Götter des Hügellandes. Die Mehrheit der Dorfbewohner bereitete mit ihnen gemeinsam das Sonnwendfeuer vor, welches das Ende der kurzen Tage und langen Nächte kennzeichnen würde und die Wiederkehr der Sonne. Die großen Feuer, die im ganzen Hügelland auflodern würden, erzürnten die Christen aber in jedem Winter aufs Neue, obgleich sie ihr eigenes Fest doch stets hinter verschlossenen Türen und mit öden Gebeten begingen.
Warum also störten sie sich daran? Wo doch die Franken selbst, die schon so lange in der Gegend waren, sich nie daran gerieben hatten.
Wilfir nahm aber an, es müsse etwas mit diesen Kreuzmännern zu tun haben, diesen eifrigen Monachos oder Mönchen, wie sie sich nannten, welche selbst nicht einmal Franken waren. Angeblich lag es noch nicht lange zurück, dass sie von weit her über ein Meer ins Frankenland gekommen waren. Nie waren diese Männer des Kreuzes zufrieden, nie konnten sie Ruhe geben, sondern wollten immer mehr und noch mehr Menschen zu ihrem eigenen Glauben bekehren.
Wilfir erinnerten sie an den unzufriedenen Ackermann, welcher, anstatt sich zu freuen, wenn seine Sau sieben Ferkel geworfen hatte, enttäuscht fragte, warum es denn nicht acht gewesen wären.
Bereits in den vergangenen Wintern war es immer dieser Tag der Wintersonnwende gewesen, welcher das kleine Dorf am deutlichsten in seine zwei Hälften geschieden hatte.
Ja, sagte Wilfir schweren Herzens, er werde kein Feuer entzünden und stattdessen fasten.
Wenn er nur daran dachte, dann schien bereits sein Magen zu knurren.
Markus nickte zufrieden. Am nächsten Tag, fragte er und sah ihm fest in die Augen, ob Wilfir dann mit ihnen in das Haus Gottes gehen werde, anstatt an den lauten Umzügen teilzunehmen?
Wilfir wusste, dass die Christen an diesem Tag das ‚Fest der geweihten Nacht‘ begingen, wie sie es nannten. Das war der Tag der Geburt ihres Untergottes, welcher ihnen allen seinen Namen gegeben hatte. Über die waldreichen Hügel würden die neuen Christen hinüberwandern zu dem ansehnlichen Gebäude aus Stein, welches die Kreuzmänner inmitten der Frankenfestung errichtet hatten. Und in diesem Haus würden sie gemeinsam mit den Soldaten ihren Gott und seinen Untergott preisen, welche beiden von den Fremden inmitten des Hügellandes freigelassen worden waren. Manchmal nannten die Christen das Haus ihres Gottes auch Kyriakee oder in ihrer hiesigen Aussprache Kirche.
Wilfir verstand allerdings nicht so recht, warum man eigens in ein Haus gehen musste, um diesen Obergott zu preisen.
Obwohl er zugeben musste, dass das große Steinhaus wirklich eindrucksvoll war, sehr viel eindrucksvoller jedenfalls als ihre kleinen Häuschen aus Flechtwerk und Lehm. Die Christen sangen auch viele schöne Lieder in dem Steinhaus, das musste Wilfir ebenfalls zugeben, und der Gesang hallte herrlich von den Wänden wider. Vielleicht war das überhaupt der Grund, warum sie solche Häuser errichteten.
Er wusste, dass das Haus einer Frau geweiht war, die auf den fremden Namen Brigida hörte. Den Christen war nämlich auch diese Frau heilig, weshalb Wilfir sich fragte, ob sie ebenfalls eine Göttin war. Diese Sache verwirrte ihn allerdings, denn es hieß stets, für einen Christen gäbe es nur einen einzigen Gott, und trotzdem waren da dieser Untergott und diese Brigida - und dann war da noch ein Mann, den sie den heiligen Martinus nannten und welchen die Franken sehr verehrten. Andererseits war er sich sicher, dass für alle Frauen des Dorfes gerade Brigida ein gewichtiger Grund war, den Christenglauben überhaupt anzunehmen.
Noch aus einem anderen Grund zögerte Wilfir mit seiner Antwort auf die Frage nach dem Kirchgang, wenn auch nur für einen winzigen Augenblick: An den friedlichen Jultagen, wie man diese Zeit nannte, wurden mit lauten Umzügen die garstigen Unholde ausgetrieben, was überaus lustig sein konnte.
Wenn er aber erst den weiten Weg zu den eifernden Mönchen gegangen wäre, dann gäbe es kein Zurück mehr.
Sein Seufzen war kaum zu vernehmen, doch er spürte den Armreif in seiner Hand.
Ja.
Ja, er würde mit ihnen in das Haus Gottes gehen.
Inständig hoffte er, dass Markus-Catualda nicht auch noch fragen würde, ob er sich eines Tages - eines hoffentlich fernen Tages - in eine Totenkiste betten ließe, statt verbrannt zu werden. Denn er wusste nicht, was er auf diese Frage entgegnet hätte. Allein die Vorstellung, sein toter Leib läge in bloßer Erde und würde von Maden zerfressen werden, ließ ihn ein Grauen empfinden, das er kaum in Worte fassen konnte.
Markus sah ihm in die Augen. Ob er, wenn kein Leben mehr in seinem Leib wäre, ob er sich dann in die Erde legen würde, um begraben zu werden?
Wilfir fragte nicht, wie er das wohl unternehmen sollte: sich in die Erde legen, wenn er doch tot war. Er wusste genau, was gemeint war. Die Christen hatten unheimliche Bräuche mit in das Hügelland gebracht. Zu seinem eigenen bleibenden Erstaunen antwortete er jedoch ohne weiteres Zögern: Ja, das werde er, er werde sich in die Erde legen, um begraben zu werden.
Ihn schauderte.
Doch schien ihm das alles in diesem Augenblick fern zu sein, viele Winter und Sommer in der Zukunft. Bis dahin würde sich ein Weg finden lassen, um seinen toten Körper so zu behandeln, wie die Sitte es gebot. Maria strahlte ihn aber in diesem Augenblick an, und das allein zählte. Auch ihre Eltern lächelten auf einmal. Beinah war es wie all die Winter und Sommer, bevor die Kreuzmänner gekommen waren.
Endlich durfte er Maria den blauen Armreif geben und sie in den Arm nehmen. Anstatt das große Feuer anzuschauen, verbrachten die beiden den Abend gemeinsam mit Marias Eltern, und bereits am nächsten Tag goss man Wilfir in dem steinernen Gotteshaus inmitten der Frankenfestung eiskaltes Wasser aus einem Steinbecken über den Kopf und machte ihn zum Christen. Einen neuen, fränkischen Namen erhielt er noch obendrein: Willehalm.
Seine Mutter weinte, und sein Vater schüttelte zornig den Kopf, doch der Grund für Wilfirs Sinneswandel hatte einen Namen, und die Frau, welche ihn trug, war ihm ein reicher Lohn für all die christlichen Seltsamkeiten.
Statt gemeinsam über das Feuer zu springen, spendete ihnen einige Monde später ein eifriger Mönch - klein von Gestalt, mit wenig Haaren auf dem Kopf und in einer seltsam getragenen Sprache redend, welche einfach nicht zu verstehen war - die heiligen Sacramenta. So nannten die Christen all jene geheimen Verrichtungen, welche Taufe und Eheschließung begleiteten. Den schönen blauen Armreif trug Maria dabei an ihrem Handgelenk.
Wilfir war glücklich, trotz allem, und er baute für sich und sein Weib am Rande des Dorfes eine kleine Hütte mit Wänden aus Flechtwerk und Lehm. Darin beteten sie gemeinsam, und in dem Steinhaus gehört er bald zu den lautesten Sängern.
Jedes Mal aber, wenn er im Wald allein oder auch mit seinem Vater unterwegs war, bat Wilfir mit leiser Stimme die alten Götter um dieses und jenes, pries und lobte sie. Dabei hoffte er inbrünstig, dass sie ihn immer noch erhörten.
Im Gegensatz zu den anderen großen Stämmen oder Stammesbünden, den Franken, den Sachsen, den Schwaben oder den Baiern, gelang es den Chatten nicht, ein dauerhaftes Stammesherzogtum zu errichten. Anders als die benachbarten Thüringer, die von den Franken schon frühzeitig gewaltsam unterworfen worden waren, sind die frühmittelalterlichen Chatten in Nordhessen aber in keiner uns bekannten Schlacht geschlagen worden. Vermutlich sind sie einfach in dem ihnen verwandten Frankenstamm aufgegangen.
Die bereits seit längerem christianisierten Franken, die während und nach der großen Völkerwanderung ein gewaltiges Reich in Gallien und Germanien errichteten, ließen sich im sechsten und siebten Jahrhundert in weitläufigen, strategisch wichtigen Festungsanlagen in Nord- und Mittelhessen nieder. Dazu zählen die Glauburg am Vogelsberg, die Amöneburg bei Marburg und die Büraburg bei Fritzlar.
Unter tatkräftiger Mithilfe von missionierenden Mönchen aus Irland und Schottland - die in sehr starker Konkurrenz zur römisch-katholischen Kirche standen - bekehrten sie von diesen Orten aus vermutlich erst einmal die chattische Oberschicht zu ihrem Glauben. Im Lauf der Jahre vermischten die Franken sich mit den ‚gewöhnlichen‘ Nachfahren der Chatten und bekehrten diese ebenfalls zum Christentum - ein Prozess, der noch einmal viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gedauert haben wird. Unter dem Deckmantel des Christentums dürften die meisten Ureinwohner noch lange an ihren alten Bräuchen festgehalten haben, sei es aus Überzeugung, sei es aus Furcht vor der Macht der älteren Götter.
Auf dem Büraberg, wie er inzwischen heißt, steht noch heute ein Kirchenbau, welcher der heiligen Brigida geweiht ist. Einige seiner Bauelemente datieren auf das frühe 7. Jahrhundert und weisen ihn als mutmaßlich älteste Steinkirche Europas nördlich des Limes und rechts des Rheins aus.
Im Winterwald (723)
Unter den Bäumen war der Schnee weniger tief. Dem vorangehenden Mädchen reichte er aber immer noch bis zur Mitte ihrer Unterschenkel. Der Junge hinter ihr sank an manchen Stellen sogar bis zu den Knien ein, während seine Hose bis hinauf zu den Hüften feucht war. Selbst unter ihrer Fellmütze klang sein Schnaufen dem Mädchen bei jedem Schritt in den Ohren. Zwischendurch hörte sie regelmäßig, wie der Junge den Rotz hochzog, der ihm aus beiden Nasenlöchern lief.
«Winter», sagte der Junge und schnaufte schwer, «ist Mist.» Dann schniefte er.
«Ich habe mal gehört», sagte das Mädchen über die Schulter, «dass es weit im Süden ein Land geben soll, in dem es im Winter nicht schneit. Kein bisschen.»
Weil das Schnaufen des Jungen ausblieb, verhielt das Mädchen und drehte sich um.
Der Junge war stehen geblieben. «Du, Embla, das glaube ich nicht!» Er atmete durch den Mund weiter, vor dem kleine Wolken wuchsen und vergingen.
«Doch, wirklich. Aber dafür sind die Sommer so heiß, dass die Haut der Menschen verbrennt. Alle sind ganz schwarz.»
Der Junge schlug sich eine Hand vor den Mund. «Wie bei den Feuerriesen?», fragte er mit großen Augen. Es klang ein wenig undeutlich. «Dann will ich doch lieber einen kalten Winter ertragen.»
Das Mädchen nickte zustimmend und wendete sich wieder um. Schweigend mühten sich die Kinder weiter durch den Schnee, aus dem die dicken Buchenstämme wie graue Säulen aufragten. Von Zeit zu Zeit fuhren Windböen durch die kahlen Baumkronen über ihnen. Embla, ihr Kleid mit beiden Händen leicht gerafft, hörte aufmerksam auf die Geräusche, die der Junge hinter ihr machte. Als sein Stapfen und Schnaufen wieder ausblieben, hielt sie abermals inne und blickte zurück. Der Junge stand reglos.
«Ask?»
Der Junge zog den Rotz hoch, rührte sich aber sonst nicht und starrte vor sich hin.
«Komm, Ask, wir müssen weiter.»
«Ich kann nicht mehr, Embla. Und meine Füße sind kalt.»
«Das ist nur, weil wir durch die Furt gehen mussten. Der Ohm hätte uns rüber getragen. Dabei hatten wir noch Glück, weißt du? Wenn der ganze Schnee erst geschmolzen ist, kommen wir da überhaupt nicht mehr rüber. - Komm jetzt, wir wollen nach Hause, mir ist auch kalt. Und so weit ist es gar nicht mehr. Deine Füße werden wieder warm, wenn du weiter gehst. Tritt einfach in meine Spur.»
Aber der Junge blieb, wo er war.
Embla ging unwillig zurück, fasste Ask am Arm und zog daran. «Komm.» Es reichte, um ihn wieder in Bewegung zu bringen.
«Weißt du», sagte Embla in leichtem Ton, «in ein paar Tagen, wenn das Julfest ist, wird die große Eiche im Hain geschmückt werden, und ein riesengroßes Feuer wird daneben angezündet. Und wir werden nachher in unserer Hütte sitzen, und Mama hat Tannenzweige aufgehängt und macht uns Brei aus Äpfeln, und wir können Nüsse aus dem Wintervorrat essen - so viele wir wollen.»
«So viele wir wollen?», staunte Ask, während er die Hand seiner Schwester losließ, weil er sonst nicht in ihre Spur treten konnte.
«Ja», Embla drehte den Kopf zur Seite und nickte. «Aber das ist nicht einmal das Beste.» Sie machte eine Pause, in der Ask erwartungsvoll ihren blonden Zopf unter der Mütze anstarrte. «Wir kriegen auch Honig. So viel wir essen können.»
«Wirklich?» Asks Augen wurden groß.
«Ja, einen ganzen Eimer.»
Ask schüttelte den Kopf und schwieg eine Weile. Es schien sein Vorstellungsvermögen zu übersteigen, dass ein Kind einen ganzen Eimer Honig für sich allein haben könnte. «So viel hat Vater noch?» Dann wurde er misstrauisch. «Wo denn?» Die Frage klang leiser in Emblas Ohren.
Ask war wieder stehen geblieben und schniefte laut.
Embla seufzte und verhielt. «Na, er hat ihn beim Ohm hingestellt, damit wir nicht heimlich davon naschen.»
«Wirklich?» Mit dem Handrücken wischte Ask über seine Nase und rieb die Hand an der wollenen Hose ab.
«Er will doch Met davon machen.»
Unter der Fellmütze des Jungen wurden die Augen schmal. «Dann ist er also gar nicht für uns?»
Embla zögerte nur unmerklich. «Doch. Dieser Honig ist nur für das Julfest, damit wir …»
Ein nahes Heulen ließ die Kinder plötzlich erstarren. Schon nach wenigen Augenblicken ergriff Embla aber die Hand ihres Bruders und zog ihn einfach vorwärts. Willig folgte Ask, wobei er immer wieder angstvoll nach allen Seiten blickte.
Als das langgezogene Heulen erneut ertönte, hastete das Mädchen zu einer jungen Buche, die mannshoch aus dem Schnee ragte. Unter ihrem Überwurf zog sie ein Messer hervor. «Wir müssen uns Waffen machen. Die sind ganz nah.»
Hektisch schnitt sie an einem Ast herum und drehte und zerrte daran, bis sie das Holz in den Händen hielt: Zwei Fuß lang und daumendick. Eilig spitzte sie ein Ende des Astes mit dem Messer an, prüfte die Spitze kurz mit den Fingern, schnitt noch ein-, zweimal, prüfte abermals und seufzte. Sie wusste nicht, wie sie in der kurzen Zeit etwas Besseres schaffen sollte.
«Hier, du nimmst das Messer!» Der Junge regte sich nicht, und Embla nahm seine kleine Hand. Sie war kalt. Embla drückte das Messer hinein und schloss die Finger um den Holzgriff. «Lass es bloß nicht los, ganz gleich, was passiert, hörst du? Und stich immer von unten nach oben, ja?»
Der Junge nickte mit großen Augen, dann stieß er einen Schrei aus und wies mit der freien Hand in eine Richtung. Embla blickte dorthin, und obwohl die Dämmerung nun langsam einsetzte, sah sie die grauen Schatten unter den Bäumen. «Komm, schnell.»
Sie griff die Hand ihres Bruders. Die Kinder hasteten los, so schnell der tiefe Schnee es ihnen erlaubte.
Das nächste Heulen ließ sie zusammenfahren, so dicht schien es hinter ihnen zu sein. «Das schaffen wir nicht, Ask. Wir müssen auf einen Baum klettern.»
Die beiden sahen sich verzweifelt um, aber die grauen Stämme der großen Buchen waren glatt und unendlich hoch.
«Embla, was machen …» Ein Schluchzen erstickte Asks weitere Worte.
«Da!» Embla zeigte auf einen halb entwurzelten Baum, der gegen seine beiden Nachbarn gestürzt war. Seine mächtige, runde Wurzel hatte sich aus dem Erdreich gehoben. Zwischen dem weißen Waldboden und dem gefrorenen, mit Erde behangenen Wurzelballen klaffte eine schmale Öffnung. «Schnell, da rein.»
Embla schob Ask zu dem Spalt, der ihm bis zur Brust reichte und Embla bis zu den Hüften.
Der Junge blieb davor stehen. «Ich will da nicht rein!», sagte er mit ängstlicher Stimme.
Das Mädchen blickte sich hektisch um, sah die Schatten. Schnell, geschmeidig, groß. «Geh schon!»
«Da ist der Drache drin.» Die Stimme des Jungen war ein Flüstern. «Unter der Wurzel ...»
«Ask! Das ist nicht die Weltesche, das ist irgendein blöder Baum, der vom Sturm …»
Noch einmal ertönte das Heulen, sehr nah und sehr laut in dem einsamen Wald. Ein Stoß in Asks Rücken genügte nun. Embla bückte sich und kletterte eilig hinter ihm nach unten. Einige Wurzeln steckten noch im Boden, und sie musste sich drumherum winden. Das Wurzelloch war nicht sehr tief, und die Kinder duckten sich in der engen Höhle, die durch die Neigung des Baumes entstanden war, und drängten sich aneinander. Embla richtete ihren kleinen Holzspeer gegen das abnehmende Tageslicht und wartete. Sie spürte ein Zittern und fragte sich, ob es von Ask kam oder von ihr selbst.
Das nächste Heulen ertönte jetzt über ihnen, und Ask schrie auf. Emblas Augen wanderten hin und her. Die Kinder hörten ein Keuchen. Ask wimmerte, als sich ein Schatten vor den Spalt schob - der Umriss eines grauen Tieres mit buschigem Schwanz. Der Junge versuchte, sich noch etwas mehr in das Wurzelwerk zurückzuziehen. Embla drängte ihm nach, während sie ihre Waffe mit beiden Händen fester umklammerte. Das kalte, abgerissene Wurzelwerk stach ihr unangenehm gegen den Kopf und in den Nacken.
Von der Seite steckte ein zweites Untier seine spitze Schnauze in die Öffnung. Embla sah gelbe Augen und Geifer, hörte Keuchen und Knurren, und ihr Magen zog sich zu einer steinharten Kugel zusammen. Über ihnen knirschte der Schnee.
Trotz ihrer fast alles überlagernden Furcht wunderte sich Embla, wie die leichtfüßigen Tiere so viele Geräusche machen konnten. Sie hatte ihren Stock längst in beide Hände genommen und die Spitze gegen das erste Ungeheuer gerichtet.
Auf einmal zuckte eines der Tiere zusammen und jaulte auf. Blitzartig zogen sich die beiden Wölfe zurück. Ein unverständlicher Ruf ertönte, gefolgt von einem weiteren kurzen Aufheulen. Embla spürte, wie sich die Kugel in ihrem Magen ein wenig entspannte, und sie drückte Asks Arm so fest, dass der Junge aufstöhnte. Wieder ein Ruf, den sie nicht verstand, aber es hörte sich wie ein Fluch an. Und ein weiteres Jaulen erklang, doch ein Stück weiter entfernt als das letzte.
Und dann eine tiefe Stimme: «Kinderlein, kommet heraus. Sin‘ wohl nu davon die dumm Tierlein.»
Emblas Magen entkugelte sich noch einmal. Sie stieß ihren Bruder an, und die beiden krochen nach draußen.
Vor der Wurzel stand ein sehr großer, sehr bärtiger Mann in einem dunklen, am Hals geschlossenen Mantel. Ein Stück hinter ihm stand ein zweiter, fast einen Kopf kleiner, aber ebenso vollbärtig. Dieser hielt einen Speer in der einen Hand und einen hölzernen Rundschild in der anderen. In seinem Ledergürtel steckte eine Axt. Wie die Kinder trugen beide Männer Fellmützen auf dem Kopf. Zwei gesattelte Pferde hielten in der Nähe, große Tiere in ihrem dichten, dunklen Winterfell.
Embla drehte den Kopf hin und her. Von den heulenden Raubtieren war nichts zu sehen.
Sie hatte die beiden Männer noch nie gesehen, aber der Große sah die Kinder nicht unfreundlich an. «Doch, doch, sin‘ wahrhaftig davon und auf die dumm Tierlein. - Aber wohin ihr Kinderlein wohl gehöret, so allein in das Wald?» Der Mann hatte wahrhaftig eine sehr tiefe Stimme. Und etwas sehr Fremdes war darin, das Embla aber mochte.
«Nach Hause», sagte Embla zurückhaltend. Ask hatte sich von hinten eng an seine große Schwester gedrückt.
Der Mann lachte laut auf. Es war ein angenehmes, lautes, fröhliches Lachen, das Embla noch mehr für ihn einnahm. «Wie wir alle, wahrhaftig. Und is das wo?»
Die tiefe Stimme des Mannes war nicht unangenehm, nur wie er die Worte setzte, das belustigte Embla. Er lächelte sie an, und sie lächelte verhalten zurück. Der kleinere Mann mit dem Speer schaute dagegen recht grimmig drein, wendete oft den Kopf und musterte misstrauisch einmal die Kinder und dann wieder die Räume zwischen den Bäumen. Er musste deutlich jünger sein als der Erste, dessen Barthaare schon weitgehend grau waren.
«In Gaesmere», beantwortete Embla die Frage des Großen. Sie drehte sich zu ihrem Bruder und wollte ihm das Messer aus der Hand nehmen. «Lass doch los, Ask!»
Der Junge starrte auf seine Hand, die den Holzgriff fest umklammert hielt. «Ich kann nicht», sagte er leise.
Embla musste jeden seiner Finger einzeln aufbiegen, während die beiden Fremden sie dabei beobachteten. Schließlich fragte der große Mann: «Und Gaesmere is hier von ganz weit?»
Sie schüttelte ihren Kopf, während sie das Messer wieder in die Schlaufe eines Strickes steckte, der unter ihrem Überwurf um die Hüften hing. Dann deutete sie mit der Hand: «Gleich da, hinter dem Wald! Noch zehn mal zehn Schritte und das», sie überlegte kurz, «vielleicht zehnmal.»
«Schön, schön. Na, dann mal aufsitzt. Dahin wir euch nu bringen, ihr Kinderlein, kommet.»
Ask machte keine Anstalten, sich zu bewegen, er hatte sich wieder eng an Emblas Rücken gedrückt. Nun schob er seinen Kopf an dem Mädchen vorbei. Vor allem blickte er den Bewaffneten an. «Ist das ein wilder Sachse?»
Der große Mann lachte. «Ne, nein. Is keine Saxone nicht, is ein Frankenmensch. Und ich komme von die Heilig Vater in Roma, dem allergroß Oppidum von alle.»
«Warum ist dein Vater heilig?», wollte Ask wissen.
Der Mann lächelte. «Is er, weil er eine heiligmäßig Leben lebt und mit Gott sprecht.»
«Das tue ich auch», sagte Ask im Brustton kindlicher Überzeugung. «Jedes Mal wenn ich mit Vater zum Heiligen Hain gehe. Bin ich auch heilig?»
«Nu ja, ich glaube, eine bisschen was heilig sin‘ wir allesamt, nit wahr?», sagte der Fremde und schaute den Jungen nachdenklich an. «Aber mit was für eine Gott sprechst du wohl?»