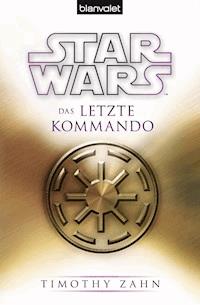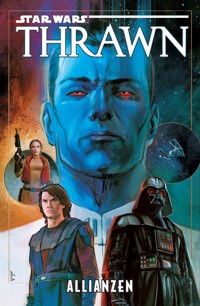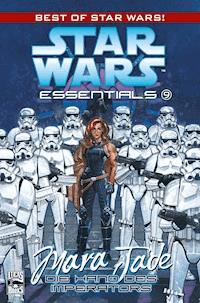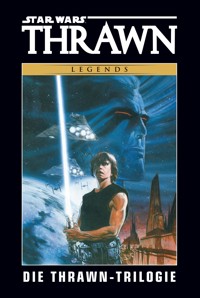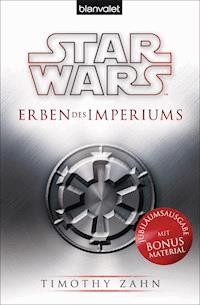
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Thrawn-Trilogie (Legends)
- Sprache: Deutsch
Sie glaubten, das Imperium wäre endgültig besiegt …
Fünf Jahre sind seit dem Sieg über den Imperator vergangen und die Galaxis versucht, sich von den Auswirkungen des Krieges zu erholen. Tausende von Lichtjahren entfernt aber hat der letzte der imperialen Kriegsherren, der brillante Großadmiral Thrawn, das Kommando über die zerrüttete Imperiale Flotte übernommen – und richtet diese auf die noch schwache Neue Republik. Denn Thrawn hat zwei entscheidende Entdeckungen gemacht, die alles zerstören könnten, wofür Luke Skywalker, Han Solo, Prinzessin Leia und all die tapferen Rebellen so hart gekämpft haben …
Die Jubiläumsausgabe des erfolgreichen Romans – jetzt mit Einleitung und Anmerkungen des Autors Timothy Zahn, exklusiven Kommentaren von Lucasfilm und des Originalverlags und einer brandneuen Bonusstory.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 720
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Timothy Zahn
ERBEN DES IMPERIUMS
Jubiläumsausgabe
Aus dem Englischen
von Thomas Ziegler (Roman)
und Andreas Kasprzak (Bonusmaterial)
Neu bearbeitet von
Marc Winter
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Star Wars™ Heir to the Empire. The 20th Anniversary Edition«
bei Del Rey/The Ballantine Publishing Group, Inc., New York.
1. Auflage
der Jubiläumsausgabe bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 1991, 2011 by Lucasfilm Ltd. & ® or ™ where indicated.
All rights reserved. Used under authorization.
Translation Copyright © 2013 by
Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, München
Umschlagmotiv: Birgit Gitschier, München, nach einer Originalvorlage
Cover Art Copyright: © 2011 by Lucasfilm Ltd.
Jacket Design: Scott Biel
Redaktion: Marc Winter
HS · Herstellung: sam
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN 978-3-641-10307-1
www.blanvalet.de
An alle Fans des erweiterten Star-Wars-Universums:
Danke, dass ich während der vergangenen zwei Jahrzehnte ein Teil eures Lebens sein durfte. Ich hoffe, ihr hattet ebenso viel Spaß dabei wie ich selbst.
Vorwort
In einer Zeit, in der Star Wars derart fest in unserer Kultur verwurzelt und scheinbar so allgegenwärtig ist, fällt es schwer, sich vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn all dies mit einem Mal nicht mehr so sein würde. Doch genau das war Ende der achtziger Jahre der Fall.
Als die klassische Trilogie in die Kinos kam, war Star Wars unglaublich erfolgreich. Die Filme brachen sämtliche Einspielrekorde. Das dazugehörige Spielzeug verkaufte sich wie geschnitten Brot. Jüngere Inkarnationen unserer selbst tanzten zu Star-Wars-Discomusik. Doch dann war das plötzlich alles vorbei. George drehte keine weiteren Filme. Die Jungs, die die Spielzeuge kauften, interessierten sich stattdessen auf einmal für Sport und Mädchen, und die Discotypen wurden seriös und machten Karriere. Die Welt drehte sich weiter.
Einem klugen Rat unseres Alleingesellschafters und ortsansässigen Yodas folgend, beschloss Lucas Licensing 1986, dass die Zeit gekommen sei, Star Wars eine Pause zu gönnen. Als sich einige Jahre später noch immer keine neuen Filme am Horizont abzeichneten, begannen wir zaghaft, darüber nachzudenken, welche Produkte heutzutage für Star-Wars-Fans von Interesse sein könnten. Das Erste, das uns bewusst wurde, war, dass unsere Fanbasis inzwischen ein wenig älter geworden war. Die Kinder, die das Spielzeug gekauft hatten, gingen jetzt aufs College. Fans, die Teenager oder junge Erwachsene gewesen waren, als die Filme herauskamen, gingen mittlerweile vermutlich einem Beruf nach oder hatten Familie. Wohin konnten wir Star Wars führen, dass es für ihr Leben noch immer von Bedeutung wäre?
Für uns war klar, dass es nicht sonderlich interessant sein würde, einfach die Vergangenheit neu aufleben zu lassen. Für Nostalgie war es noch zu früh, und offen gesagt, schien uns das auch nicht sonderlich anregend zu sein. Wir mussten den Fans etwas Neues bieten, etwas, das eher reifere Gemüter ansprach. Und, argumentierten wir, weil bei Star Wars die Geschichte im Mittelpunkt steht, war die natürliche Schlussfolgerung, es mit Romanen zu versuchen – Romane, die die Story erweitern konnten, ausgehend von den Charakteren und Situationen, die in den Filmen so lebendig etabliert worden waren, um sie an Orte zu führen, die man bislang nicht für möglich gehalten hatte.
Ich war der Leiter der Lizenzabteilung, und damals hatte ich ein winziges Team. Meine Finanzdirektorin, Lucy Autrey Wilson, war eine der Ersten gewesen, die das Unternehmen eingestellt hatte. 1974 arbeitete Lucy tatsächlich bei George zu Hause und half dabei, die Drehbücher für Star Wars: Eine neue Hoffnung zu tippen. Sie war eine gute Finanzkraft, aber auch eine ruhelose Seele mit einer Leidenschaft fürs Verlagswesen. Sie hatte mich jahrelang angefleht, ihr die Chance zu geben, neue Buchdeals für Star Wars an Land zu ziehen. Doch jahrelang hatte ich darauf so ähnlich wie Han reagiert, als er zu Luke sagt: »Und wer soll es dann fliegen, Kleiner. Du?«
Zum Glück für Lucy – und zum Glück für uns alle – kam es 1989 zu einer Konvergenz in der Macht. Ich wurde davon überzeugt, dass es an der Zeit war, unser Romanprogramm für Erwachsene neu aufzulegen und mit der gebotenen Ernsthaftigkeit neue Geschichten im Star-Wars-Universum zu erkunden. Und ich war bereit, Lucy die Gelegenheit zu geben, einen Verlag zu finden, der unsere Vorstellung teilte. Doch bevor wir das in Angriff nehmen konnten, gab es noch eine letzte Hürde. Wenn wir in diesem bestimmten Sandkasten spielen wollten, mussten wir vorher den Besitzer des Sandkastens konsultieren. Also ging ich zu George Lucas und bat demütig um die Erlaubnis, sein Universum ausbauen zu dürfen. George war zwar einigermaßen skeptisch (soweit ich mich erinnere, reagierte er mit so etwas Ähnlichem wie: »Das kauft doch kein Mensch!«), aber dennoch entgegenkommend genug, mir die Chance zu geben, es in den Sand zu setzen. Wir legten einige sehr grundlegende Vorgaben fest: Die Geschichten mussten nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielen; Ereignisse, die vor Eine neue Hoffnung spielten, waren Tabu, denn falls George je weitere Star-Wars-Filme produzieren würde, wollte er sich damit befassen; und keine Hauptfiguren durften sterben. Abgesehen davon, das machte George deutlich, würde er sich nicht einmischen. Alles schien so simpel und unkompliziert. Ich glaube nicht, dass George oder ich auch nur die leiseste Ahnung hatten, worauf wir uns damit einließen.
Lucy zog los und stellte bei diversen Verlagen das Konzept für eine neue Reihe von Star-Wars-Begleitromanen vor. Sie geriet an mehrere Verleger, die das Gefühl hatten, Star Wars sei ein erfolgloses Unterfangen, und sich die Gelegenheit entgehen ließen. Gleichwohl, zu unserer großen Erleichterung teilte ein Verlag – Bantam Books – unsere Überzeugung, nämlich, dass neue, von großartigen Autoren geschriebene Star-Wars-Geschichten die Fans wirklich mobilisieren konnten. Lucy schloss den Vertrag ab, und Bantam präsentierte uns einen tollen Autor – Tim Zahn. Und Tim lieferte ein grandioses Buch ab.
Nie werde ich den Tag im Jahre 1991 vergessen, an dem Lucy in mein Büro kam, um mir die Neuigkeit mitzuteilen, dass Tims Erben des Imperiums von null auf Platz eins der New-York-Times-Hardcover-Bestsellerliste eingestiegen sei. Das war ein emotionaler Moment. Mit einem Schlag wussten wir, dass wir instinktiv richtig gelegen hatten. Noch mehr als das: Wir wussten, dass das Feuer der Leidenschaft für Star Wars unter unseren Fans nicht im Geringsten erloschen war. Es war bloß der richtige Funken zur rechten Zeit nötig, um es von Neuem zu entfachen – und zwar stärker als je zuvor!
– Howard Roffman
Präsident, Lucas Licensing
Einleitung
ES WAR EINMAL VOR LANGER ZEIT IN EINER WEIT, WEIT ENTFERNTEN GALAXIS …
Nun, eigentlich war es in Illinois, aber es ist wirklich schon lange her.
Es war Montag, der 6. November 1989, um genau zu sein, gegen vier Uhr nachmittags. Ich saß zu Hause in meinem Arbeitszimmer in Champaign, Illinois, und arbeitete an einem Roman mit dem Titel Engelssturz, den ich gerade an Bantam Books verkauft hatte, als ich einen unerwarteten Anruf meines Agenten Russell Galen erhielt. Nachdem wir die üblichen Freundlichkeiten ausgetauscht hatten, gab er etwas von sich, das sich für mich als die Untertreibung des Jahrzehnts erweisen sollte: »Tim, uns liegt hier ein sehr interessantes Angebot vor.«
Während ich dort stand und mit wachsendem Erstaunen zum Fenster hinausschaute, berichtete Russell mir, wie Lou Aronica, der Chef von Bantam Spectra, Lucasfilm ein Jahr zuvor vorgeschlagen hatte, der Star-Wars-Saga quasi einen Neustart zu verschaffen. Lou hatte vor, ein drei Romane umspannendes Epos zu erzählen, das die Geschichte nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter fortsetzte, um von einer Ära zu berichten, über die bislang kein Autor schreiben durfte.
Wie das Schicksal – oder die Macht – es wollten, traf dieser Brief just in dem Moment ein, als Howard Roffman und das Team von Lucasfilm beschlossen hatten, ihr Romanprogramm für Erwachsene in eine neue Richtung zu lenken. Das an sich wäre schon grandios genug gewesen. Doch was das Ganze in ungeahnte Sphären hievte, war der Umstand, dass Bantam und Lucasfilm mir anboten, diese Bücher zu schreiben.
Damals war ich bereits ebenso lange ein Star-Wars-Fan wie alle anderen auf dem Planeten. (Okay, vielleicht nicht ganz so lange wie alle anderen, da ich mir den Film erst am zweiten Abend im Kino ansehen konnte.) In den Achtzigern, als ich versuchte, mir in der Branche einen Namen zu machen, gehörten die Soundtracks der Star-Wars-Filme zu meinen Lieblingsplatten, die ich mir beim Schreiben anhörte. Das ging so weit, dass ich mich deutlich an die Zeit erinnere, in der ich dachte, dass ich, wenn George Lucas praktisch aus dem Nichts kommen und Erfolg haben konnte, ich dazu vielleicht ebenfalls imstande wäre. Und jetzt wurde ich eingeladen, in dem Universum zu spielen, das er ersonnen hatte.
Wie auch immer, Russ und ich sprachen gute vierzig Minuten über die Sache, und ich sagte ihm, ich würde eine Nacht darüber nachdenken und ihm am nächsten Morgen meine Antwort mitteilen. Wir verabschiedeten uns, und dann legte ich den Telefonhörer auf … und war die nächsten paar Stunden von völliger Panik erfüllt.
Was mir Sorgen bereitete, war der Umstand, dass dieses Angebot ein ziemlich zweischneidiges Schwert war. Ich hatte die Chance, meiner Karriere auf eine Art und Weise einen Schnellstart zu verpassen, die ich niemals erwartet oder mir auch nur erhofft hatte. Doch außerdem bestand das Risiko, vor einer potenziellen Millionen-Leserschaft spektakulär zu versagen.
Schließlich sollte ich für Star Wars schreiben. Nicht irgendwelchen x-beliebigen Science-Fiction-Kram oder eine Weltraumoper, die irgendwas mit Krieg der Sterne im Titel hatte. Ich sollte Star Wars schreiben! Ich würde irgendwie die gewaltigen Ausmaße und die Atmosphäre dieses Universums einfangen müssen, die Gesichter und Stimmen der Hauptfiguren, das Hin und Her und den Rhythmus der Filme. Die Leser mussten die Stimmen von Mark Hamill, Carrie Fisher und Harrison Ford zwischen meinen Anführungszeichen hören. Die Leute, die diese Seiten durchblätterten, mussten John Williams’ Musik in ihrem Hinterkopf vernehmen.
Wenn ich dazu nicht oder zumindest nicht in ausreichendem Maße fähig war, würde das Ganze nicht Star Wars sein. Dann wäre es einfach nur ein Abenteuer von zwei Typen namens Han und Luke – und das wäre die reinste Zeitverschwendung für alle Beteiligten gewesen.
Aber das war noch nicht alles. Ich musste nicht bloß die Stimmung des Universums richtig hinbekommen, sondern mir außerdem auch eine Geschichte ausdenken – eine drei Romane umfassende Geschichte, um genau zu sein –, die nicht einfach bloß ein Abklatsch dessen war, was George bereits gemacht hatte. Ich musste die Filmcharaktere glaubhaft altern lassen und neue Figuren ersinnen, die sich nahtlos in das Ganze einfügten.
Am nächsten Morgen wusste ich noch immer nicht, ob ich dazu in der Lage war, das alles hinzubekommen. Doch zumindest war ich mir mittlerweile darüber im Klaren, dass ich es unbedingt versuchen wollte. Also sagte ich Russ, ich sei mit an Bord, und machte mich an die Arbeit.
Der erste Schritt war ausgesprochen einfach. Um Thanksgiving herum, knappe zwei Wochen später, hatte ich einen vierzigseitigen ersten Entwurf für die Trilogie verfasst und mehrere Gespräche mit Betsy Mitchell geführt, meiner Lektorin bei dem Projekt.
Dann jedoch stießen wir auf einen unerwarteten Haken – unerwartet für mich jedenfalls: Die Anwälte von Bantam und Lucasfilm waren immer noch dabei, ihre Verträge zu zimmern. Solange es zwischen Lucasfilm und dem Verlag keine Übereinkunft gab, konnte Bantam auch mir keinen Vertrag geben, um die Romane zu schreiben, und solange ich keinen Vertrag hatte, war Lucasfilm nicht bereit, sich meinen Entwurf anzusehen – aus rechtlichen Gründen, die ich durchaus verstand. Doch bis Lucasfilm meinen Entwurf für gut befand, war es sinnlos, dass ich mit dem Schreiben anfing.
Geschlagene sechs Monate verstrichen, in denen die Sache zwischen den Anwälten und LFL hin und her ging, bis schließlich alles abgesegnet war und ich mit der Arbeit beginnen konnte. (Um ehrlich zu sein, hatte ich einen Frühstart hingelegt und schon eine Woche eher angefangen, da ich annahm, dass die letzten Änderungen, die LFL vielleicht wollte, keine großen Auswirkungen auf die ersten zwei oder drei Kapitel haben würden.)
In der Folgezeit ergaben sich Probleme, die aus dem Weg geräumt werden mussten, Meinungsverschiedenheiten, die es auszudiskutieren galt, es mussten Kompromisse gemacht werden, und gelegentlich blieb mir auch nichts anders übrig, als gnädig zu kapitulieren. Letzteres sorgte dafür, dass ich ein wenig meckerte. Wir Autoren meckern für gewöhnlich immer, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Zurückblickend jedoch kann ich aufrichtig sagen, dass das Buch durch die Vorschläge und Änderungen, die ich zuweilen nur widerwillig akzeptierte, wesentlich besser geworden ist.
Ich schickte Betsy den Roman am 2. November 1990 per Post – ja, damals versandten wir noch auf Papier ausgedruckte Manuskripte –, etwas weniger als sechs Monate, nachdem ich angefangen hatte und fast genau ein Jahr, nachdem man mir das Projekt angeboten hatte. Für mich waren sechs Monate zu jener Zeit phänomenal schnell, um ein Buch zu schreiben, obgleich ich in den letzten zwanzig Jahren beträchtlich flotter geworden bin. (Beispielsweise hat es bloß drei Monate gedauert, meinen jüngsten Star-Wars-Roman Einsame Entscheidungen zu Papier zu bringen.) Genau wie der Entwurf durchlief auch das fertige Manuskript einen ausgedehnten Absegnungs- und Änderungsprozess zwischen Bantam und Lucasfilm, und nach einer Menge – größtenteils kleiner – Korrekturen wurde es schließlich für druckfertig erklärt. Das Cover lag vor, die anderen redaktionellen Arbeiten waren erledigt, die Werbe- und Anzeigenkampagnen waren vereinbart, und alles war startklar.
Die einzige Frage, die sich noch stellte, war die, die bereits ganz von Beginn an über dem Projekt schwebte: Wer würde das Buch tatsächlich kaufen? Lou war zwar von Anfang an überzeugt, dass das Publikum für den Roman da draußen war. Doch selbst er vertraute größtenteils einfach auf unser Glück. Immerhin waren seit Die Rückkehr der Jedi-Ritter acht Jahre vergangen, und um die Star-Wars-Fans war es sehr ruhig geworden.
Natürlich gab es gewisse Anzeichen. Einige Monate vor dem Erscheinen von Erben des Imperiums sprach ich vor einer Klasse von Viertklässlern und nahm eine Kopie des Buchumschlags mit, um sie ihnen zu zeigen. Diese Kinder, die kaum auf der Welt gewesen waren, als der letzte Star-Wars-Film ins Kino kam, starrten das Cover aufgeregt an und zeigten einander Han, Luke und Chewie. Dank dem Zauber der Videokassette waren sie vollends auf dem Laufenden in Bezug auf alles, was Star Wars betraf.
Wie auch immer, Anzeichen sind eben bloß Anzeichen. Deshalb gingen Bantam und Lucasfilm auf Nummer sicher. Sie setzten den Buchpreis auf fünfzehn Dollar fest, deutlich unter dem marktüblichen Standardpreis für gebundene Bücher. Der Verkaufsstab tat sein Bestes, um in den Buchläden die Werbetrommel zu rühren – mit gemischten Ergebnissen. Sie schalteten Zeitungsanzeigen und brachten sogar einen Werbespot im Radio. (Noch nie zuvor gab es Radiowerbung für eins meiner Bücher, und ich glaube auch nicht, dass ich seitdem jemals wieder dieses Vergnügen hatte.)
Anschließend gab es nichts weiter zu tun, als sich zurückzulehnen und die Daumen zu drücken.
Mai 1991. Einige behaupten, die Thrawn-Trilogie habe die Star-Wars-Saga noch einmal von Neuem beginnen lassen. Das klingt zwar sehr beeindruckend, stimmt aber eigentlich nicht. Genauer wäre es zu sagen, dass ich seit Die Rückkehr der Jedi-Ritter der Erste war, dem es erlaubt war, mit der Gabel in die Pastete zu piksen, um zu sehen, ob sie noch heiß ist.
Sie war heiß. Oh Mann, sie war verdammt heiß! Die erste Auflage von 70.000 Exemplaren war innerhalb von zwei Wochen ausverkauft, und Bantam rotierte förmlich, um nachdrucken zu lassen. (Eine mehr oder minder amüsante Anekdote am Rande: Nach der dritten Auflage ging der Druckerei der Vorrat an blauen Bezügen aus, weshalb die vierte Auflage eine hellbraune Buchdecke ziert. Wenn mir bei Signierstunden eins dieser Bücher unterkommt, vollführe ich auch heute noch ein regelrechtes »Ich weiß, welche Auflage das ist«-Machtspektakel.) Einige Buchhändler haben mir erzählt, dass sieErben des Imperiumsquasi aus dem Karton heraus verkauft hätten oder sie die Bücher ins Regal stellten und jemand dasStar-Wars-Logo auf dem Umschlag entdeckte, sich eins schnappte und dann sofort zur Kasse ging.
Das Buch schaffte es auf den ersten Platz der New York Times-Bestsellerliste, dem Heiligen Gral der Schriftstellerriege. (Tatsächlich verdrängte der Roman John Grishams Die Firma. Grisham schickte mir später ein signiertes Exemplar seines Buches, zusammen mit der sehr netten, durchaus ironisch gemeinten Bitte, ihm gefälligst nicht die Tour zu vermasseln.)
Seitdem hat Erben des Imperiums zahlreiche Neuauflagen erfahren – wie viele genau, weiß ich nicht. Tatsächlich druckte Bantam auch dann noch Hardcover nach, als das Taschenbuch bereits auf dem Markt war – etwas, das so gut wie nie passiert, wie Russ mir erzählte. (Soweit ich mich erinnere, war sein diesbezüglicher Kommentar seinerzeit ein bisschen euphorischer – er war darüber so verblüfft, wie alle anderen auch.)
Unglaublicherweise brachte der Roman es sogar zur Jeopardy!-Frage, was selbst den Heiligen-Gral-Status der New York Times übersteigt. (»Timothy Zahns Bestseller Erben des Imperiums ist die Fortsetzung dieser Film-Trilogie.« Ich habe diese Ausgabe der Sendung immer noch irgendwo auf Video.)
Die Star-Wars-Fans waren überall da draußen, keine Frage. Und nach drei neuen Kinofilmen, der erfolgreichen The Clone Wars-Fernsehserie und unzähligen Büchern und Comics ist Star Wars nach wie vor extrem beliebt.
Erben des Imperiums nach all diesen Jahren noch einmal zu lesen, war eine interessante und ein wenig verwirrende Erfahrung. Einerseits sehe ich all die stilistischen Dinge, die ich ändern würde, wenn ich den Roman heute schriebe – einiges an der Satz- und Absatzstruktur, dies und das an der Schreibtechnik, vielleicht ein wenig das Tempo. Doch andererseits schlägt sich die Geschichte nach wie vor wacker. Vielleicht sogar ein bisschen besser, als ich erwartet hatte.
Dementsprechend lade ich Sie jetzt ein, Betsy und mir auf einer Reise in die Vergangenheit Gesellschaft zu leisten. Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit, aber wir werden unser Bestes tun, um uns daran zu erinnern, wie es zu all dem kam.
– Timothy Zahn
1. Kapitel
»Captain Pellaeon?«, rief eine Stimme unten aus dem backbord gelegenen Mannschaftsgraben und übertönte das Brummen der Hintergrundgespräche. »Eine Meldung von den Patrouillenbooten: Die Scoutschiffe haben soeben den Hyperraum verlassen.«
Pellaeon beugte sich über die Schulter des Mannes am Kontrollmonitor der Schimäre1 und ignorierte den Ruf. »Überprüfen Sie diesen Reflex«, befahl er und tippte mit dem Lichtstift gegen das Diagramm auf dem Bildschirm.
Der Techniker warf ihm einen fragenden Blick zu. »Sir …?«
»Ich habe es gehört«, sagte Pellaeon. »Sie haben Ihren Befehl, Lieutenant.«
»Ja, Sir«, sagte der Mann gehorsam und machte sich an die Überprüfung des Reflexes.
»Captain Pellaeon?«, meldete sich die Stimme wieder, näher diesmal. Pellaeon hielt die Augen auf den Kontrollmonitor gerichtet und wartete, bis er näher kommende Schritte hörte. Dann, mit der ganzen majestätischen Würde, die sich ein Mann in fünfzig Jahren Dienst bei der Imperialen Flotte aneignete, richtete er sich auf und drehte sich um.
Die energischen Schritte des jungen diensthabenden Offiziers verlangsamten sich und kamen zu einem abrupten Halt. »Äh, Sir …« Er blickte in Pellaeons Augen, und seine Stimme versagte.
Pellaeon ließ die Stille im Raum hängen, wartete einige Herzschläge, lange genug, dass die Umstehenden es bemerkten. »Wir befinden uns hier nicht auf dem Viehmarkt von Shaum Hii, Lieutenant Tschel«, sagte er schließlich mit ruhiger, aber eiskalter Stimme. »Das ist die Brücke eines imperialen Sternenzerstörers. Routinemäßige Meldungen werden hier nicht – ich wiederhole nicht – einfach in die ungefähre Richtung des Adressaten gebrüllt. Ist das klar?«
Tschel2 schluckte. »Jawohl, Sir.«
Pellaeon fixierte ihn noch einige Sekunden mit starrem Blick und neigte dann den Kopf zu einem angedeuteten Nicken. »Gut. Berichten Sie.«
»Jawohl, Sir.« Tschel schluckte erneut. »Wir haben soeben eine Nachricht von den Patrouillenbooten erhalten, Sir. Die Scouts sind von ihrem Aufklärungsflug ins Obroa-skai-System zurückgekehrt.«
»Sehr gut.« Pellaeon nickte. »Hat es Schwierigkeiten gegeben?«
»So gut wie keine – die Eingeborenen haben es ihnen offenbar übel genommen, dass sie ihre Zentralbibliothek angezapft haben. Der Geschwaderkommandant sagte, sie wären eine Weile verfolgt worden, aber die Verfolger hätten ihre Spur bald verloren.«
»Hoffentlich«, meinte Pellaeon grimmig. Obroa-skai hatte für die Grenzregionen eine wichtige strategische Bedeutung, und nach den vorliegenden Geheiminformationen versuchte die Neue Republik mit aller Macht, sie auf ihre Seite zu ziehen. Wenn sich zum Zeitpunkt des Angriffs bewaffnete Rebellenschiffe im System aufgehalten hatten … Nun, er würde es noch früh genug erfahren. »Sorgen Sie dafür, dass sich der Geschwaderkommandant auf der Brücke zum Rapport meldet, sobald die Schiffe an Bord sind«, befahl er Tschel. »Und geben Sie für die Patrouillenboote Alarmstufe Gelb. Sie können gehen.«
»Jawohl, Sir.« Der Lieutenant vollführte eine zackige militärische Drehung und kehrte an die Kommunikationskonsole zurück.
Der junge Lieutenant … was, wie Pellaeon mit einem Anflug von alter Bitterkeit dachte, das eigentliche Problem war. In den alten Tagen – als sich das Imperium auf der Höhe seiner Macht befunden hatte – wäre ein so junger Mann wie Tschel niemals als Brückenoffizier auf einem Schiff wie der Schimäre eingesetzt worden. Heute aber … Er sah auf den ebenso jungen Mann am Kontrollmonitor hinunter. Heute aber gab es an Bord der Schimäre nur junge Männer und Frauen.
Langsam ließ Pellaeon den Blick über die Brücke wandern und spürte, wie der alte Zorn und der alte Hass in ihm aufbrandeten. Er wusste, dass viele Kommandanten der Flotte im ersten Todesstern nur einen dreisten Versuch des Imperators gesehen hatten, die militärische Macht des Imperiums völlig unter seine Kontrolle zu bringen, wie er es zuvor schon mit der politischen Macht des Imperiums getan hatte.3 Die Tatsache, dass er die nachgewiesene Verwundbarkeit der Kampfstation ignoriert und einen zweiten Todesstern erbaut hatte, musste diesen Verdacht nur erhärten. In den höheren Rängen der Flotte gab es nur wenige, die seinen Tod ehrlich bedauert hätten – hätte er nicht den Supersternenzerstörer Executor mit in den Untergang gerissen.
Selbst jetzt, fünf Jahre danach, zuckte Pellaeon bei der Erinnerung unwillkürlich zusammen: die Executor, wie sie steuerlos mit dem unfertigen Todesstern kollidierte und dann in der gewaltigen Explosion der Kampfstation verging. Der Verlust des Schiffes war schon schlimm genug gewesen, aber die Tatsache, dass es sich dabei um die Executor gehandelt hatte, machte alles noch viel schlimmer. Der Supersternenzerstörer war Darth Vaders Schiff gewesen, und trotz der legendären – und oftmals mörderischen – Launenhaftigkeit des Dunklen Lords war der Dienst auf seinem Schiff identisch mit der Aussicht auf rasche Beförderung gewesen. Das wiederum bedeutete, dass mit der Executor auch viele der besten jungen Offiziere und Mannschaftsdienstgrade gestorben waren.4
Die Flotte hatte sich nie von dieser Katastrophe erholt. Ohne die Führung der Executor hatte sich die Schlacht schnell in eine wilde Flucht verwandelt, bei der eine Reihe anderer Sternenzerstörer vernichtet wurden, ehe endlich der Rückzugsbefehl kam. Pellaeon, der nach dem Tod des Kapitäns das Kommando über die Schimäre übernommen und die Reihen geordnet hatte, war es trotz aller verzweifelten Bemühungen nicht gelungen, die Handlungshoheit gegenüber den Rebellen zurückzugewinnen. Stattdessen waren sie immer weiter zurückgetrieben worden … bis zu der Stellung, die sie hier jetzt hielten.
Hier, in der einstmals tiefsten Provinz des Imperiums, das inzwischen kaum noch ein Viertel seiner früheren Systeme unter Kontrolle hatte.5 Hier, an Bord eines Sternenzerstörers, der fast ausschließlich mit sorgfältig ausgebildeten, aber völlig unerfahrenen jungen Leuten bemannt war, von denen man die meisten zwangsweise oder unter Androhung von Gewalt auf ihren Heimatwelten rekrutiert hatte.6 Hier, unter dem Kommando des wahrscheinlich größten militärischen Genies, das das Imperium je gesehen hatte.
Pellaeon lächelte – ein schmales, wölfisches Lächeln –, als er sich erneut auf der Brücke umsah. Nein, das Imperium war noch nicht am Ende. Wie die arrogante, selbst ernannte Neue Republik bald herausfinden würde.
Er warf einen Blick auf seine Uhr. Fünfzehn Minuten nach zwei. Großadmiral Thrawn7 würde jetzt in seinem Kommandoraum meditieren … und wenn es schon gegen die imperiale Dienstvorschrift verstieß, quer über die Brücke zu brüllen, so verstieß es erst recht gegen sie, die Meditation eines Großadmirals durch einen Interkomruf zu stören. Entweder man sprach mit ihm von Angesicht zu Angesicht, oder man sprach überhaupt nicht mit ihm. »Halten Sie weiter diese Reflexe im Auge«, wies Pellaeon den Ortungsoffizier an, als er sich zur Tür wandte. »Ich bin bald wieder zurück.«
Der neue Kommandoraum des Großadmirals lag zwei Ebenen unter der Brücke, dort, wo sich einst die luxuriöse Freizeitsuite des früheren Kommandanten befunden hatte. Thrawns erste Tat an Bord war es gewesen, die Suite zu übernehmen und aus ihr eine zweite Brücke zu machen – eine zweite Brücke, einen Meditationsraum … und vielleicht noch etwas anderes. An Bord der Schimäre war es kein Geheimnis, dass der Großadmiral seit dem Umbau den größten Teil seiner Zeit dort verbracht hatte. Geheim allerdings war, was er in diesen langen Stunden dort trieb.
Pellaeon trat vor die Tür, strich die Uniform glatt und wappnete sich. Vielleicht würde er es bald herausfinden. »Captain Pellaeon wünscht Großadmiral Thrawn zu sprechen«, erklärte er. »Ich habe Informa…«
Die Tür glitt zur Seite, ehe er seinen Satz zu Ende führen konnte. Innerlich vorbereitet trat Pellaeon in den dämmrigen Vorraum. Er blickte sich um, sah nichts von Interesse und steuerte die fünf Schritte entfernte Tür zur eigentlichen Suite an.
Ein Luftzug im Nacken war die einzige Warnung. »Captain Pellaeon«, miaute ihm eine tiefe, raue, katzenähnliche Stimme ins Ohr.
Pellaeon fuhr herum und verfluchte sich und die kleine, drahtige Kreatur, die direkt vor ihm stand. »Verdammt, Rukh!«, schnappte er. »Was soll der Unsinn?«
Für einen langen Moment sah Rukh ihn wortlos an, und Pellaeon spürte, wie ihm ein Schweißtropfen über den Rücken rann. Mit seinen großen dunklen Augen, dem vorstehenden Kiefer und den glitzernden, nadelspitzen Zähnen8 war Rukh im Halbdunkel ein noch gespenstischerer Anblick als unter normalen Lichtverhältnissen – vor allem für jemanden wie Pellaeon, der wusste, für welche Aufgaben Thrawn Rukh und die anderen Noghri einsetzte.9
»Ich mache nur meine Arbeit«, sagte Rukh schließlich. Er wies fast beiläufig mit seinem dünnen Arm auf die innere Tür, und Pellaeon erhaschte einen kurzen Blick auf den schmalen Dolch, ehe er im Ärmel des Noghris verschwand. Er ballte die Hand zur Faust und öffnete sie wieder. Unter der dunkelgrauen Haut10 spannten sich Muskeln wie Drahtseile. »Sie dürfen eintreten.«
»Danke«, grollte Pellaeon. Erneut strich er über seine Uniform und wandte sich dann zur Tür. Sie öffnete sich selbsttätig, und er trat ein … in ein dezent beleuchtetes Kunstmuseum.
Hinter der Türschwelle blieb er abrupt stehen und sah sich verblüfft um. An den Wänden und der gewölbten Decke hingen Gemälde und Flachplastiken, von denen einige vage menschlich wirkten, aber größtenteils eindeutig nicht menschlichen Ursprungs waren. Zahlreiche Skulpturen standen im Raum, einige frei, andere auf Podesten. In der Mitte der Suite befand sich ein doppelter Ring aus Wiedergabedisplays, wobei der äußere Ring etwas höher angeordnet war als der innere. Bei beiden schien es sich, soweit Pellaeon dies beurteilen konnte, ebenfalls um Kunstwerke zu handeln.
Und im Zentrum des Doppelrings, in einem Duplikat des Admiralssessels auf der Brücke,11 saß Großadmiral Thrawn. Reglos saß er da, schimmernd blauschwarz das Haar, glitzernd im matten Licht, hellblau die Haut, die seiner ansonsten völlig menschlichen Gestalt etwas Kühles, Fernes, Fremdartiges verlieh. Als er sich zurücklehnte, waren seine Augen fast ganz geschlossen, und zwischen den Lidern leuchtete rote Glut hervor.
Pellaeon befeuchtete die Lippen, und plötzlich hatte er Zweifel, ob es richtig gewesen war, in Thrawns Allerheiligstes einzudringen. Wenn sich der Großadmiral gestört fühlte …
»Kommen Sie, Captain«, schnitt Thrawns sorgfältig modulierte Stimme in Pellaeons Gedanken. Die Augen noch immer zu Schlitzen verengt gab er ihm einen knappen Wink. »Was halten Sie davon?«
»Es ist … sehr interessant, Sir«, war alles, was Pellaeon herausbrachte, als er an den äußeren Displayring trat.
»Es sind natürlich nur Holografien«, erklärte Thrawn, und Pellaeon glaubte, einen Hauch von Bedauern in seiner Stimme zu hören. »Die Skulpturen und Gemälde. Einige sind verschollen, von den anderen befinden sich viele auf Planeten, die jetzt von der Rebellion kontrolliert werden.«
»Ja, Sir.« Pellaeon nickte. »Ich dachte, es würde Sie interessieren, Admiral, dass die Scouts aus dem Obroa-skai-System zurückgekehrt sind. Der Geschwaderkommandant wird Ihnen in Kürze Bericht erstatten.«
Thrawn nickte. »Haben sie die Zentralbibliothek anzapfen können?«
»Zumindest sind sie in das System eingedrungen«, antwortete Pellaeon. »Ich weiß nicht, ob es ihnen gelungen ist, den Auftrag auszuführen – offenbar hat man sie entdeckt. Allerdings ist der Commander überzeugt, die Verfolger abgeschüttelt zu haben.«
Thrawn schwieg einen Moment. »Nein«, sagte er. »Nein, das glaube ich nicht. Vor allem dann nicht, wenn es sich bei den Verfolgern um Rebellen gehandelt hat.« Er holte tief Luft, setzte sich aufrecht hin und öffnete zum ersten Mal seit Pellaeons Eintreten die rot glühenden Augen.
Pellaeon hielt dem Blick des Admirals stand und war stolz auf diese Leistung. Viele der führenden Kommandanten und Höflinge des Imperators hatten sich vor diesen Augen gefürchtet – oder besser gesagt: vor Thrawn. Wahrscheinlich war das der Grund dafür gewesen, dass der Großadmiral den größten Teil seines Lebens in den Unbekannten Regionen verbracht hatte, unermüdlich dafür kämpfend, jene barbarischen Gebiete der Galaxis unter imperiale Kontrolle zu bringen.12 Seine brillanten Erfolge hatten ihm den Titel eines Kriegsherrn13 und das Recht auf die weiße Uniform eines Großadmirals eingebracht – der einzige Nichtmensch, dem der Imperator je diese Auszeichnung gewährt hatte.
Ironischerweise hatte ihn dies für die Grenzfeldzüge noch unentbehrlicher gemacht. Pellaeon hatte sich oft gefragt, wie die Schlacht von Endor ausgegangen wäre, wenn Thrawn und nicht Vader die Executor kommandiert hätte. »Ja, Sir«, sagte er. »Ich habe für die Patrouillenboote Alarmstufe Gelb gegeben. Sollen wir auf Rot gehen?«
»Noch nicht«, wehrte Thrawn ab. »Uns bleibt noch etwas Zeit. Sagen Sie, Captain, verstehen Sie etwas von Kunst?«
»Äh … nicht sehr viel«, stieß Pellaeon hervor, vom plötzlichen Themenwechsel leicht verwirrt. »Ich hatte bisher kaum Gelegenheit, mich näher damit zu beschäftigen.«
»Sie sollten sich die Zeit nehmen.« Thrawn deutete auf einen Teil des inneren Displayrings zu seiner Rechten. »Saffa-Gemälde«, erklärte er. »Circa 1550 bis 2200 präimperialer Zeitrechnung. Achten Sie darauf, wie sich nach dem ersten Kontakt mit den Thennqora der Stil ändert – genau da. Dort drüben.« Er wies auf die linke Seite. »Das sind paoniddische Werke aus der Extrassa-Periode. Beachten Sie die Parallelen zu den frühen Saffa-Werken und den Vaathkree-Flachplastiken aus dem achtzehnten Jahrhundert präimperialer Zeitrechnung.«
»Ja, ich verstehe«, sagte Pellaeon nicht ganz wahrheitsgemäß. »Admiral, sollten wir nicht …?« Er verstummte, als ein schriller Pfiff ertönte.
»Brücke an Großadmiral Thrawn«, drang Lieutenant Tschels nervös klingende Stimme aus dem Interkom. »Sir, wir werden angegriffen!«
Thrawn presste den Knopf der Gegensprechanlage. »Hier spricht Thrawn«, sagte er ausdruckslos. »Geben Sie Alarmstufe Rot und berichten Sie. Aber in Ruhe, wenn es geht.«
»Jawohl, Sir.« Die Alarmlichter flackerten, und Pellaeon hörte das ferne Heulen der Sirenen. »Die Sensoren orten vier Angriffsfregatten14 der Neuen Republik«, fuhr Tschel mit gepresster, aber kontrollierter Stimme fort, »und drei Geschwader X-Flügler. Sie nähern sich in symmetrischer V-Formation rasch dem Vektor unserer Scoutschiffe.«
Pellaeon fluchte lautlos. Ein einziger Sternenzerstörer mit einer unerfahrenen Crew gegen vier Angriffsfregatten und ihre Begleitjäger … »Maschinen auf volle Kraft!«, rief er ins Interkom. »Sprung auf Lichtgeschwindigkeit vorbereiten.«
»Befehl zum Sprung aufgehoben«, sagte Thrawn mit eiskalter Stimme. »TIE-Jäger-Crews auf ihre Stationen. Deflektorschilde aktivieren.«
Pellaeon, der schon an der Tür war, fuhr herum. »Admiral …!«
Thrawn hob abwehrend die Hand. »Kommen Sie, Captain«, befahl der Großadmiral. »Wir sollten uns das einmal ansehen, meinen Sie nicht auch?« Er legte einen Schalter um, und unversehens verschwanden die Kunstwerke.
Die Suite verwandelte sich in eine Miniaturausgabe der Brücke, mit Navigations-, Maschinen- und Waffenkontrollen an den Wänden und dem doppelten Displayring. Ein taktisches Holodisplay nahm den freien Raum ein; die pulsierende Kugel in einer Ecke stellte die Angreifer dar. Das ihnen am nächsten befindliche Wanddisplay meldete, dass sie in ungefähr zwölf Minuten in Gefechtsreichweite sein würden.
»Zum Glück sind die Scoutschiffe nicht in unmittelbarer Gefahr«, stellte Thrawn fest. »So. Schauen wir uns nun an, mit was genau wir es zu tun haben. Brücke, Angriffsbefehl für die drei nächsten Patrouillenboote.«
»Jawohl, Sir.«
Drei blaue Punkte lösten sich aus der Abwehrformation und schnitten dem Feind den Weg ab. Aus dem Augenwinkel sah Pellaeon, wie sich Thrawn nach vorn beugte, als die Angriffsfregatten und die sie begleitenden X-Flügler ebenfalls den Kurs änderten. Einer der blauen Punkte erlosch …
»Hervorragend«, sagte Thrawn und lehnte sich im Sessel zurück. »Das genügt, Lieutenant. Die beiden anderen Patrouillenboote sollen sich zurückziehen, die Einheiten im Sektor vier den Vektor der Angreifer verlassen.«
»Jawohl, Sir«, bestätigte Tschel hörbar irritiert.
Pellaeon konnte seine Irritation nur zu gut verstehen. »Sollten wir nicht zumindest den Rest der Flotte alarmieren?«, fragte er gepresst. »Die Totenkopf könnte in zwanzig Minuten, die meisten anderen in weniger als einer Stunde hier sein.«
»Noch mehr von unseren Schiffen herzuholen wäre das Letzte, was wir jetzt tun sollten, Captain«, entgegnete Thrawn. Er sah Pellaeon an, und ein leises Lächeln spielte um seine Lippen. »Schließlich könnte es Überlebende geben, und wir wollen doch nicht, dass die Rebellen von uns erfahren. Oder?«
Er wandte sich wieder den Displays zu. »Brücke, Drehung um zwanzig Grad nach Backbord. Aufbauten auf den Vektor der Angreifer ausrichten.15 Sobald sie sich im äußeren Perimeter befinden, sollen sich die Einheiten im Sektor vier hinter ihnen neu formieren und den Funkverkehr blockieren.«
»J-ja, Sir. Sir …«
»Es ist nicht notwendig, dass Sie meine Befehle verstehen, Lieutenant«, sagte Thrawn mit kalter Stimme. »Gehorchen Sie.«
»Jawohl, Sir.«
Pellaeon atmete zischend aus, als die Displays zeigten, wie sich die Schimäre dem Befehl entsprechend drehte. »Ich fürchte, ich verstehe ebenfalls nicht, Admiral«, gestand er. »Ihnen unsere Aufbauten zuzudrehen …«
Erneut hob Thrawn abweisend die Hand. »Schauen Sie zu und lernen Sie, Captain. In Ordnung, Brücke, Drehung beenden und Position beibehalten. Deflektoren der Andockbuchten deaktivieren, alle anderen Schilde hochfahren. TIE-Jäger, fertig machen zum Start. Begeben Sie sich in zwei Kilometer Entfernung von der Schimäre, und bilden Sie dann eine offene Formation. Gefechtsgeschwindigkeit, zonale Angriffsstruktur.«
Er erhielt die Bestätigung und sah dann wieder Pellaeon an. »Verstehen Sie jetzt, Captain?«
Pellaeon verzog den Mund. »Ich fürchte, nein«, gab er zu. »Mir ist klar, dass Sie das Schiff beidrehen ließen, um den Jägern beim Start Deckung zu geben, aber alles andere ist nichts weiter als ein klassisches Marg-Sabl-Einkesselungsmanöver. Auf so etwas Einfaches werden sie kaum hereinfallen.«
»Im Gegenteil«, korrigierte ihn Thrawn kühl. »Sie werden nicht nur darauf hereinfallen, sondern auch alle vernichtet werden. Sehen Sie zu, Captain, und lernen Sie.«
Die TIE-Jäger starteten, entfernten sich mit hoher Beschleunigung von der Schimäre, drehten abrupt bei und schossen dann wie die Gischttropfen einer exotischen Quelle in die entgegengesetzte Richtung davon.16 Die angreifenden Schiffe entdeckten sie und änderten den Kurs …
Pellaeon blinzelte. »Beim Imperium, was machen die?«
»Sie greifen zur einzigen Verteidigung gegen ein Marg-Sabl,17 die sie kennen«, erklärte Thrawn, und die Befriedigung in seiner Stimme war unüberhörbar. »Oder, um genauer zu sein, der einzigen Verteidigung, zu der sie psychologisch in der Lage sind.« Er nickte in Richtung der pulsierenden Kugel. »Sehen Sie, Captain, dieser Verband wird von einem Elomin kommandiert … und Elomin können mit dem unstrukturierten Angriffsprofil eines sorgfältig durchgeführten Marg-Sabl nicht zurechtkommen.«
Pellaeon starrte die Angreifer an, die noch immer mit dem Aufbau ihrer nutzlosen Abwehrformation beschäftigt waren … und allmählich dämmerte ihm, was Thrawn getan hatte. »Dieser Angriff der Patrouillenboote vor ein paar Minuten – er hat Ihnen verraten, dass es sich um Schiffe der Elomin handelt?«
»Beschäftigen Sie sich mit der Kunst, Captain«, riet Thrawn mit verträumt klingender Stimme. »Wenn Sie die Kunst einer Spezies verstehen, dann verstehen Sie die Spezies.«18 Er richtete sich im Sessel auf. »Brücke, auf Höchstgeschwindigkeit gehen. Angriff unterstützen.«
Eine Stunde später war alles vorbei.19
Die Tür des Kommandoraums schloss sich hinter dem Geschwaderkommandanten, und Pellaeon richtete den Blick wieder auf die Displaykarte. »Das hört sich an, als wäre Obroa-skai eine Sackgasse«, sagte er bedauernd. »Unsere Streitkräfte reichen nicht aus, um das System zu befrieden.«
»Vielleicht im Moment«, stimmte Thrawn zu. »Aber nur im Moment.«
Pellaeon sah ihn über den Tisch hinweg fragend an. Thrawn spielte mit einer Datenkarte, rieb sie geistesabwesend zwischen Daumen und Zeigefinger, während er durch das Sichtfenster die Sterne betrachtete. Ein seltsames Lächeln umspielte seine Lippen. »Admiral?«, fragte er vorsichtig.
Thrawn drehte den Kopf, ließ die glühenden Augen auf Pellaeon ruhen. »Das ist das zweite Teil des Puzzles, Captain«, sagte er leise und hielt die Datenkarte hoch. »Das Teil, nach dem ich ein ganzes Jahr gesucht habe.« Unvermittelt drehte er sich zum Interkom und aktivierte es. »Brücke, hier spricht Großadmiral Thrawn. Nehmen Sie Verbindung mit der Totenkopf auf. Informieren Sie Captain Harbid, dass wir uns vorübergehend von der Flotte trennen. Er soll die lokalen Systeme weiter überwachen, so viel Daten wie möglich sammeln und anschließend Kurs auf ein System namens Myrkr nehmen – die Koordinaten sind im Navicomputer gespeichert.« Die Brücke bestätigte, und Thrawn wandte sich wieder Pellaeon zu. »Sie wirken irritiert, Captain«, stellte er fest. »Ich nehme an, Sie haben noch nie von Myrkr gehört.«
Pellaeon schüttelte den Kopf und versuchte erfolglos, im Gesicht des Großadmirals zu lesen. »Sollte ich das?«
»Vermutlich nicht. Die meisten, die diesen Planeten kennen, sind Schmuggler, Aufrührer oder sonstiger Abschaum der Galaxis.« Er schwieg und trank einen kleinen Schluck aus dem Krug, der neben seinem Ellbogen stand – und der nach dem Geruch zu urteilen starkes forwisches Bier enthielt.
Pellaeon zwang sich zur Geduld. Was ihm auch immer der Großadmiral mitteilen wollte, er würde es ihm auf seine Art und zu einem ihm genehmen Zeitpunkt sagen. »Ich habe vor etwa sieben Jahren durch Zufall von ihm erfahren«, fuhr Thrawn fort und stellte den Krug ab. »Was meine Aufmerksamkeit erregte, war die Tatsache, dass der Planet zwar schon seit mindestens dreihundert Jahren bewohnt ist, aber sowohl von der Alten Republik als auch von den Jedi strikt gemieden wurde.« Er hob eine blauschwarze Augenbraue. »Was schließen Sie daraus, Captain?«
Pellaeon zuckte mit den Schultern. »Dass es sich dabei um einen Grenzplaneten handelt, zu abgelegen, um für irgendjemanden von Interesse zu sein.«
»Sehr gut, Captain. Das war auch mein erster Gedanke … nur dass es nicht stimmt. Myrkr ist in Wirklichkeit nicht mehr als hundertfünfzig Lichtjahre von hier entfernt – dicht an unserer Grenze zur Rebellion und innerhalb der Grenzen der Alten Republik.« Thrawn sah die Datenkarte in seiner Hand an. »Nein, die richtige Antwort ist viel interessanter – und weitaus nützlicher.«
Pellaeon richtete den Blick ebenfalls auf die Datenkarte. »Und bei dieser Antwort handelt es sich um das erste Teil Ihres Puzzles?«
Thrawn lächelte ihn an. »Sehr gut, Captain. Ja, Myrkr – oder genauer gesagt, eine der dort lebenden Tierarten – war das erste Teil. Das zweite ist eine Welt namens Wayland.« Er wedelte mit der Datenkarte. »Eine Welt, deren Koordinaten ich dank der Obroaner inzwischen kenne.«
»Ich gratuliere Ihnen«, sagte Pellaeon, des Spieles plötzlich überdrüssig. »Darf ich fragen, um was für eine Art Puzzle es sich handelt?«
Thrawn lächelte – ein Lächeln, das Pellaeon frösteln ließ. »Nun, das einzige Puzzle, das die Beschäftigung lohnt«, antwortete der Großadmiral sanft. »Die vollständige, totale und endgültige Niederschlagung der Rebellion.«20
1In jedem der drei klassischenStar-Wars-Filme taucht in der Anfangssequenz ein Sternenzerstörer auf. Bei all meinen Romanen über die Rebellionsära ist das genauso. – TIMOTHY ZAHN
2Ich wollte die Flotte so darstellen, als habe sie unter dem Chaos und dem Militärabbau in den Jahren nach der Schlacht von Endor gelitten, als sei sie von einer generell effektiven Kriegsmaschinerie, wie sie in den Filmen dargestellt wurde, zu etwas weniger Glanzvollem avanciert. Lieutenant Tschel war ein Beispiel für die eifrigen, aber unerfahrenen Besatzungsmitglieder, die das Imperium jetzt in Kampfform prügeln musste – ein deutlicher Kontrast zur Kompetenz und Tradition von Captain Pellaeon, einem Offizier alter Schule. – TZ
3Die Großadmiräle sollten Teil dieses großen, übergeordneten Plans sein: eine Elite, die an oberster Stelle der militärischen Kommandokette stand und deren Mitglieder vom Imperator persönlich ernannt wurden, um auch nur ihm gegenüber Rechenschaft ablegen zu müssen. – TZ
4Später, nach dem Aufkommen der Fangruppe 501st Legion, wurde außerdem etabliert, dass Vader auch die besten Sturmtruppler des Imperiums um sich versammelte und sie seiner persönlichen Legion einverleibte. In späteren Romanen habe ich ein wenig mit dieser Idee herumgespielt. – TZ
5AlsErben des Imperiumserstveröffentlicht wurde, fragten mich einige, wie sich das Ganze mit den Feierlichkeiten in Einklang bringen ließe, die am Ende vonDie Rückkehr der Jedi-Ritterzu sehen waren. Ich antwortete darauf, dass es sich hierbei um spontane Zurschaustellungen der Erleichterung und des offenen Ungehorsams der gewöhnlichen Bürger der Galaxis handelte, dass das Militär des Imperiums jedoch bei Weitem nicht vernichtend geschlagen wäre. Tatsächlich sollten bisDer Zorn des AdmiralsinStar-Wars-Zeit noch zehn weitere Jahre vergehen, bis der Krieg mit dem Imperium schließlich sein Ende fand. – TZ
6Ich betrachte Thrawn nicht als jemanden, der unwillige Rekruten für seine Zwecke missbraucht. Offensichtlich handelte es sich hierbei um etwas, das andere imperiale Anführer vor seiner Rückkehr in die Wege geleitet hatten. – TZ
7Ich wollte, dass der Oberschurke inErben des Imperiumsein Militärführer ist, kein Gouverneur, Moff oder Sith. Ein gewöhnlicher Admiral kam mir allerdings zu banal vor. Aus diesem Grund ersann ich die Großadmiräle. Übrigens stieß ich das erste Mal im Zusammenhang mit der deutschen Marine in William L. ShirersAufstieg und Fall des Dritten Reichesauf diese Rangbezeichnung. – TZ
8Da damals nichts über Vaders Hintergrundgeschichte bekannt war und ich gerade die Spezies der Noghri für diese Geschichte ersonnen hatte, kam mir die Idee, dass Vader seine Maske vielleicht so gestaltet hatte, dass sie der stilisierten Version eines Noghri-Gesichts ähnelte, um seine Befehlsgewalt über die Todeskommandos zu untermauern. (Natürlich wusste ich zu jener Zeit nicht, dass inDie Rache der Sithenthüllt werden würde, dass er die Maske Palpatine zu verdanken hatte.) Es war mir zwar nicht erlaubt, diese Verbindung inErben des Imperiumsausdrücklich herzustellen, aber ich dachte, dass man mir das vielleicht in einem der späteren Bände der Trilogie genehmigen würde. Also machte ich weiter und entwickelte die Gesichter der Fremdweltler mit diesem Bild im Hinterkopf. Selbstverständlich wissen wir mittlerweile, dass die Maske – die ursprünglich auf Ralph McQuarries Vorproduktionszeichnungen basierte – Vader von Palpatine überlassen wurde, beruhend auf seinen eigenen finsteren Sith-Spezifikationen, und sie nicht das Geringste mit den Noghri zu tun hatte. Mir kann es nur recht sein, dass mir LFL das nicht durchgehen ließ. Bloß ein weiteres Beispiel dafür, wie ihre Vorsicht, meine Fantasie keine zu abwegigen Blüten treiben zu lassen, mir künftige Verlegenheiten erspart hat. – TZ
9Ursprünglich sollten Rukh und seine Gefährten Sith sein, angelehnt an Vaders Titel »Lord der Sith«. Da dieser Begriff zu jener Zeit noch nicht näher definiert worden war, nahm ich an, auf der sicheren Seite zu sein. Allerdings sorgte sich Lucasfilm, dass George die Sith irgendwann in Zukunft selbst verwenden wollen würde – was er, wie wir alle wissen, auch getan hat –, weshalb sie mich baten, mir für sie eine andere Bezeichnung einfallen zu lassen. Ich war wegen dieser Sache eine Weile ziemlich sauer, aber natürlich bin ich heute ausgesprochen dankbar dafür, dass sie mich zu dieser Änderung zwangen. – TZ
10Meine ursprüngliche Idee war, dass Noghri-Haut bei Geburt blassgrau ist und dann schrittweise schwarz wird, wenn die Noghri erwachsen werden. Allerdings gab es Bedenken wegen möglicher Rassismusvorwürfe (auch wenn die Noghri äußerst ehrbar waren und schließlich zu Verbündeten der Neuen Republik wurden), deshalb änderte ich die Hautfarbe zu Grau. – TZ
11In keinem der Filme war je ein Kommandosessel zu sehen. Die Brücke der Sternenzerstörer scheint dem alten Segelschiffdesign nachempfunden zu sein, wo die Offiziere dastanden oder auf und ab schritten, während sie das Deck und die Takelage überschauten und Befehle gaben. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass Thrawn dort oben eine Menge Zeit verbringen würde und allein schon deshalb einen Sessel aufstellen ließe, um die Ablenkung durch Müdigkeit zu minimieren. Außerdem würden es ihm an den Sessel montierte Bildschirme erlauben, das, was an Bord seines Schiffes vorging, näher im Auge zu behalten. – TZ
12Thrawns – und Palpatines – wahre Absichten für ihre Feldzüge in den Unbekannten Regionen sind hier ausgesprochen vage gehalten. Die Hintergründe all dessen sollten in künftigen Büchern allmählich entwickelt und enthüllt werden. – TZ
13Erben des Imperiumswar nicht mein ursprünglicher Titel für den Roman, sondern wurde von Lou Aronica bei Bantam ins Spiel gebracht. Zu meinen Vorschlägen gehörtenWild Card(wogegen Einspruch erhoben wurde, weil Bantam ebenfalls eine Superhelden-Anthologiereihe namensWild Cardsherausbrachte) undWarlord Gambit(»Kriegsherren-Gambit«). Obgleich wir uns letztlich aufErben des Imperiumseinigten, gibt es – wie hier – trotzdem gewisse Hinweise auf diesen anderen Titel. – TZ
14Angriffsfregatten waren modifizierte Großkampfschiffe derDreadnaught-Klasse, kaum mehr als ein Drittel so groß wie ein Sternenzerstörer. Es handelte sich dabei um ältere Schiffe – aus der Klonkriegsära –, die aber immer noch gehörig Bums hatten. Sowohl die Angriffsfregatten als auch die Dreadnaughts stammen ursprünglich aus denStar-Wars-Rollenspiel-Quellenbüchern von West End Games (WEG). Auf WEG kommen wir später noch eingehender zu sprechen. – TZ
15Einer der Gründe dafür, dass wir Lucasfilm Tim als Autor der neuenStar-Wars-Trilogie vorschlugen, war seine Erfahrung im Schreiben von Militär-Science-Fiction. Seine bisherigen Romane – darunter dieCobra-Reihe undDie Backlash-Mission – waren ausgezeichnete Vertreter dieser Sparte. – BETSY MITCHELL
16Einer der Kritikpunkte, die manStar Warshäufig vorwirft, ist, dass sich X-Flügler genau wie Atmosphärenflieger verhalten. Sie drehen bei und beschreiben Kehren, die im luftleeren Raum eigentlich nicht möglich sind. Allerdings führten die Filme sogenannte S-Flügel (»S-foils«) ein, die ich damals als »space-foils« (»Weltraumtragflächen«) interpretierte, im Gegensatz zu »air-foils« (Flugzeugtragflächen). Überdies nahm ich an, dass sie »Druck« gegen die Vakuumenergie des Universums (manchmal auch als Nullpunktenergie bezeichnet) ausübten. In diesem Sinne erfand ich zudem das Ätherruder, das ebenfalls mit der Vakuumenergie interagiert, um dem Schiff bessere Manövriermöglichkeiten zu verschaffen. Allerdings setzte sich der Begriff nie durch und wurde seit damals stillschweigend fallen gelassen. Trotzdem denke ich, dass das Prinzip an sich nach wie vor seine Berechtigung hat. – TZ
17Eins der coolsten Dinge dabei,Star-Wars-Romane zu schreiben, ist, wenn man gelegentlich sieht, dass etwas, das man selbst erfunden hat, in einem anderen Teil des ausgedehnten Lucasfilm-Universums Verwendung findet. In diesem Fall war es in der Episode »Sturm über Ryloth« der FernsehserieThe Clone Wars, in der das Marg-Sabl-Manöver gegen eine Blockade der Handelsföderation eingesetzt wird. Noch cooler ist, dass dieses Manöver im DVD-Bonusmaterial zu dieser Episode ganz speziellErben des Imperiumszugeschrieben wird. Thrawn wäre hocherfreut gewesen. – TZ
18Ich werde häufig gefragt, woher diese ganze Kunst-als-taktisches-Verständnis-Idee stammt. Bedauerlicherweise gibt es da keine besondere Offenbarung und keinen geschichtlichen Bezug, auf den ich hinweisen könnte. Die Sache kam mir während der Entwicklung von Thrawn einfach so in den Sinn. – TZ
19Eine der Fragen, die man mir am häufigsten stellt, ist, wie ich auf die Figur des Großadmirals Thrawn gekommen bin. DieStar-Wars-Filme drehen sich um Schurken, die mittels Zwang und Furcht führen. Das mag bei zeitlich begrenzten Operationen funktionieren (Vaders Besatzung war mit Sicherheit mit ganzem Herzen bei der Sache), auf lange Sicht ist das aber keine allzu gute Sache. Deshalb beschloss ich, einen anderen Weg zu gehen, indem ich versuchte, einen Kommandanten zu ersinnen, dem seine Männer aus Loyalität folgten. Welche Eigenschaften muss ein solcher Kommandant besitzen? An erster Stelle natürlich offensichtlich taktisches und strategisches Geschick. Seine Soldaten mussten glauben, dass jede Operation, die sie bestritten, gute Erfolgschancen hatte, mit so wenigen Verlusten auf ihrer Seite, wie nur irgend möglich. Im Laufe des Buchs wird es noch viele weitere Beispiele für Thrawns taktische Fähigkeiten geben, aber dies ist das Erste: Er besiegt den gesamten Kampfverband der Neuen Republik, ohne sich offenbar auch nur die Mühe machen zu müssen, seinen Meditationsraum zu verlassen. Als ich über Thrawns Charakter nachdachte, kamen mir noch einige andere Qualitäten in den Sinn, die ich an gegebener Stelle eingehender kommentieren werde. – TZ
20Thrawn hat die Rechtmäßigkeit der Neuen Republik niemals anerkannt. Später, als ich mehr von seiner Hintergrundgeschichte einfließen ließ, versuchte ich, einige nachvollziehbare Gründe für seine Dickköpfigkeit in dieser Angelegenheit anzuführen. – TZ
2. Kapitel
»Luke?«
Die Stimme war leise, aber nachdrücklich. Luke Skywalker blieb inmitten der vertrauten Landschaft von Tatooine stehen – vertraut, aber dennoch seltsam verzerrt – und drehte sich um.
Eine gleichermaßen vertraute Gestalt stand nicht weit von ihm und sah ihn an. »Hallo, Ben«, sagte Luke mit schwerfällig klingender Stimme. »Es ist lange her.«
»In der Tat«, bestätigte Obi-Wan Kenobi ernst, »und ich fürchte, dass bis zu unserer nächsten Begegnung noch mehr Zeit vergehen wird. Ich bin gekommen, um dir Lebewohl zu sagen, Luke.«
Die Landschaft schien zu erbeben, und auf einmal erinnerte sich ein Teil von Lukes Bewusstsein, dass er schlief. Er schlief in seiner Suite im Imperialen Palast und träumte von Ben Kenobi.21
»Nein, ich bin kein Traum«, versicherte Ben und beantwortete damit Lukes unausgesprochene Frage. »Aber die Entfernung, die uns trennt, ist zu groß geworden, als dass ich dir auf andere Weise erscheinen könnte. Und selbst dieses letzte Tor wird bald für mich versperrt sein.«
»Nein«, hörte Luke sich selbst sagen. »Du darfst uns nicht verlassen, Ben. Wir brauchen dich.«
Ben hob leicht die Brauen, und die Andeutung eines alten Lächelns umspielte seine Lippen. »Du brauchst mich nicht, Luke. Du bist ein Jedi, und die Macht ist stark in dir.« Das Lächeln verblasste, und einen Moment lang schienen sich seine Augen auf etwas zu richten, das Luke nicht sehen konnte. »Wie dem auch sei«, fuhr er fort, »es ist nicht meine Entscheidung. Ich habe bereits zu lange gezögert, und ich kann meine Reise in die Regionen jenseits dieses Lebens nicht länger verschieben.«
Eine Erinnerung regte sich: Yoda auf dem Sterbebett und Luke, wie er ihn anflehte, ihn nicht zu verlassen. Stark bin ich dank der Macht, hatte der Jedi-Meister leise zu ihm gesagt. Aber jetzt nicht mehr.22
»Die Vergänglichkeit gehört zum Leben dazu«, erinnerte ihn Ben. »Auch du wirst eines Tages diese Reise antreten müssen.« Erneut schweifte seine Aufmerksamkeit ab und kehrte wieder zu ihm zurück. »Die Macht ist stark in dir, Luke, und mit Entschlossenheit und Disziplin wirst du immer stärker werden.« Sein Blick wurde streng. »Aber du darfst nie in deiner Wachsamkeit nachlassen. Der Imperator ist tot, aber die Dunkle Seite ist noch immer mächtig. Vergiss das niemals.«
»Ich werde es nicht vergessen«, versprach Luke.
Bens Gesicht wurde weich, und er lächelte wieder. »Dennoch wirst du dich großen Gefahren stellen müssen, Luke«, sagte er. »Aber du wirst auch neue Verbündete finden, an Zeiten und Orten, wo du sie am wenigsten erwartest.«
»Neue Verbündete?«, wiederholte Luke. »Wer sind sie?«
Die Vision schien zu flimmern und zu verblassen. »Und jetzt … lebe wohl«, sagte Ben, als hätte er die Frage nicht gehört. »Ich habe dich wie einen Sohn geliebt, wie einen Schüler und wie einen Freund. Bis wir uns wiedersehen, möge die Macht mit dir sein.«
»Ben …!« Aber Ben wandte sich ab, und seine Gestalt verblasste … und im Traum wusste Luke, dass er fort war. Dann bin ich allein, sagte er sich. Ich bin der letzte der Jedi.
Er glaubte noch einmal Bens Stimme zu hören, matt und fast unhörbar, wie aus weiter Ferne. »Nicht der letzte der alten Jedi, Luke. Der erste der neuen.«23 Die Stimme verklang und war fort …
… und Luke erwachte. Für einen Moment blieb er liegen, starrte die Decke über seinem Bett an, über die die matten Lichter von Imperial City spielten, und kämpfte gegen die Benommenheit, die der Schlaf hinterlassen hatte. Gegen die Benommenheit und die schier unerträgliche Trauer, die seine ganze Seele erfüllte. Zuerst waren Onkel Owen und Tante Beru ermordet worden, dann hatte Darth Vader, sein richtiger Vater, sein eigenes Leben für das von Luke geopfert, und jetzt hatte ihn selbst Ben Kenobis Geist verlassen. Zum dritten Mal war er zum Waisen geworden.24
Mit einem Seufzer glitt er unter der Decke hervor und schlüpfte in sein Gewand und die Hausschuhe. Zu seiner Suite gehörte eine Kochnische, und er brauchte nur ein paar Minuten, um ein Getränk aufzubrühen, ein ausgesprochen exotisches Gebräu, das ihm Lando bei seinem letzten Besuch auf Coruscant mitgebracht hatte. Dann hängte er sein Lichtschwert an den Gürtel und stieg hinauf aufs Dach.
Er hatte sich erbittert dagegen gewehrt, das Zentrum der Neuen Republik nach Coruscant zu verlagern,25 hatte sich noch entschiedener dagegen gewehrt,26 dass die vor Kurzem erst gebildete Regierung ihren Sitz im alten Imperialen Palast nahm. Der Symbolismus allein war falsch, vor allem für eine Gruppe, die – nach seinem Geschmack – ohnehin zu viel Wert auf Symbole legte.
ENDE DER LESEPROBE