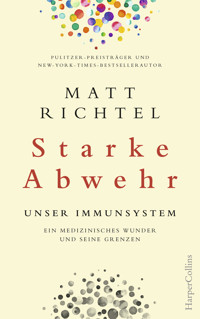
Starke Abwehr - Unser Immunsystem. Ein medizinisches Wunder und seine Grenzen. E-Book
Matt Richtel
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ein Krebspatient im Endstadium springt dem Tod von der Schippe, ein HIV-Patient gilt als medizinisches Wunder, und zwei Frauen müssen damit leben, dass sich ihr eigener Körper gegen sie wendet. Unser Immunsystem ist unser körpereigenes Verteidigungssystem, der Schlüssel zur unserer Gesundheit – und Entscheider über Leben und Tod. Matt Richtel, Bestsellerautor und Pulitzer-Preis-Träger, nimmt uns mit auf eine spannende Reise in die Welt der Wissenschaft und ihrer neuesten Erkenntnisse: Wieso erkranken weltweit immer mehr Menschen an Autoimmunerkrankungen? Worin liegt der bahnbrechende Erfolg der Immuntherapie? Was ist das Mikrobiom? Und was passiert, wenn die körpereigene Abwehr nicht mehr funktioniert? Vom Glück, gesund zu sein und vom Kampf gegen tödliche Krankheiten – Matt Richtel schreibt über unser Immunsystem so spannend wie über einen Kriminalfall. »Eine spannende Reise in die Welt der Wissenschaft!« Buch aktuell
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
HarperCollins®
Copyright © 2019 für die deutsche Ausgabe by HarperCollins in der HarperCollins Germany GmbH, Hamburg
© 2019 by Matt Richtel
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel An Elegant Defense. The Extraordinary New Science of the Immune System. A Tale in Four Lives bei William Morrow, einem Imprint von HarperCollins Publishers US, New York.
Published by arrangement with William Morrow, an imprint of HarperCollins Publishers, US
Covergestaltung von Birgit Tonn, Artwork Elsie Lyons & Typo Hafen Werbeagentur, Hamburg Coverabbildung von DoozyDo / Shutterstock Lektorat: Volker Jarck E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783959678957
www.harpercollins.de
Widmung
Für Jason und die Argonauten
Anmerkung des Autors
Anmerkung des Autors
Um zwischen Ärzten und Wissenschaftlern mit Doktortitel zu unterscheiden, versehe ich die Namen der Ärzte mit dem Titel Dr., während ich die Wissenschaftler nur mit ihrem Nachnamen nenne. Das ist ein ärgerlicher Kompromiss, bedenkt man, dass diese Menschen nicht nur sich ihren Doktortitel hart erarbeitet, sondern auch die wichtigsten Entdeckungen auf diesem Gebiet gemacht haben. Ich habe mich aber so entschieden und bin damit einer informellen Regel bei der New York Times gefolgt, um dem Leser durch eine Geschichte mit zahlreichen Beteiligten zu helfen, von denen manche Forschungserfahrungen haben und andere über klinische Expertise verfügen und meist Ärzte sind. Ich bitte die Wissenschaftler, die eine so zentrale Rolle unter den Argonauten der Odyssee spielen, um Nachsicht.
Schließlich habe ich bei Jason Greenstein, seiner Familie und seinen Freunden nur den Vornamen verwendet, ebenso bei anderen, zu denen ich ein nahes Verhältnis hatte, wie bei Bob Hoff, Linda Segre und Merredith Branscombe. Der persönliche Charakter ihrer Geschichten, ihrer medizinischen Entwicklung verlangte eine eher zwanglosere Wortwahl.
Teil I: Leben im Gleichgewicht
TEIL I
LEBEN IM GLEICHGEWICHT
1: Enge Bindungen
1
Enge Bindungen
Jason Greenstein saß schweigend auf dem Beifahrersitz eines Ford Windstar. Es war Freitag, der 13. März 2015, ein grauer Tag. Jason war unterwegs, um ein Wunder zu erleben, und er legte die Strecke so zurück, wie er es gewohnt war – umgeben von Müll.
Sein silberfarbener Kombi glich einem Schrotthaufen auf Rädern. Die Heizung hustete und spuckte und funktionierte offenbar nur, wenn es draußen warm war, also wenn man sie nicht brauchte. Die Hecktür klemmte. Auf dem Armaturenbrett leuchteten diverse Lichter auf und warnten vor Fehlern in der Elektronik, die von Jason aber ignoriert wurden. Und aus den Ablagefächern quollen Straßenkarten und Atlanten, wenn sie nicht gar auf dem Boden lagen.
Hinzu kam der durchdringende Geruch. Er stammte von dem 20-Liter-Benzinkanister, den Jason für den Notfall hinten im Wagen verstaut hatte, und von dem im Auto angesammelten fettgetränkten Einwickelpapier unzähliger Mahlzeiten aus dem Schnellimbiss – vor allem von den Hotdogs aus dem 7-Eleven, die Jason zwar als »Teufelszeug« und »eklig« bezeichnete, denen er aber in der Regel nicht widerstehen konnte.
Wenn Jason zu einer seiner Verkaufstouren über Land fuhr, schlief er manchmal hinten im Auto. Dann rollte er sich auf einem fleckenübersäten orangefarbenen Perserteppich zusammen, und sein Kopf kam neben dem Benzinkanister zum Liegen. Hin und wieder schlief er sogar auf den Kartons mit dem glitzernden, mit Strasssteinen besetzten Tand, den er an Casinos in der Provinz verkaufte, die sie als Werbegeschenke bereithielten.
Jason war siebenundvierzig, hatte seinen Bachelor an einer Elite-Uni und anschließend den Master in Wirtschaftswissenschaften und Jura gemacht; akademische Titel flößten ihm aber weder besonderes Vertrauen noch Respekt ein. Er hangelte sich von einem unternehmerischen Projekt zum nächsten, von einem Abenteuer zum andern. Nie war er glücklicher, als wenn er am Steuer seines Ford saß, eine Prise Skoal-Kautabak eingeschoben hatte und wenn, während Bruce Springsteen lief oder Songs eines lokalen Rundfunksenders aus dem Radio dröhnten, am Horizont eine neue Stadt in Sicht kam. Jason folgte dem Prinzip entdecken, erforschen, den eigenen Weg gehen. Er lebte den Traum der amerikanischen Siedler, und der Kombi war sein Planwagen.
»Wenn mir etwas zustoßen sollte, musst du dich bitte um den Kombi kümmern. Hast du gehört, Ma?« Das Verhältnis von Jason zu Catherine, seiner Mutter, pendelte zwischen liebevoller Verehrung bis zu passiv-aggressiven Konflikten mit Wortgefechten, die derart brutal unter die Gürtellinie gingen, dass Arthur Miller seine Freude daran gehabt hätte.
Jetzt saß Jason auf dem Beifahrersitz, und Beth, seine Freundin, fuhr. Er war im Begriff, einen derart unkonventionellen Schritt zu tun, wie er ihn sich nicht einmal selbst hätte ausdenken können. Er wollte ein medizinisches Wunder erleben und damit zum Aushängeschild werden, wie er es nannte, für eine Wunder wirkende neue Krebstherapie. Jason war entschlossen, dem Tod von der Schippe zu springen, obwohl er am Abgrund stand und mit einem Fuß bereits über dem Nichts schwebte.
Jason hatte Krebs. Die Krankheit war im Endstadium und nach allen rationalen Einschätzungen nicht mehr heilbar.
In seinen Lungen und auf der linken hinteren Körperhälfte hatte sich ein vierzehnpfündiger Tumor des Hodgkin-Lymphoms ausgebreitet, der seinen Umfang im Abstand einiger Wochen jeweils verdoppelt hatte. Jasons vierjährige Behandlung mit Chemo- und Strahlentherapie hatte, abgesehen von kurzen Verschnaufpausen, kaum etwas bewirkt, obwohl man diesem Krebsleiden allgemein gute Heilungschancen zuschreibt. Die Ärzte hatten alles versucht, einige Medikamente in erhöhter Dosierung oder in Kombination eingesetzt, was oft mit brutalen Nebenwirkungen verbunden gewesen war. Doch das bösartige Zellwachstum war stets zurückgekehrt. Mittlerweile hatte sich eine Schwellung gebildet, die sich deutlich auf Jasons Rücken abzeichnete, sodass Beth ihn liebevoll »Quasimodo« nannte. Da der Tumor auf seinen Ellennerv drückte, litt Jason unter schrecklichen Schmerzen und konnte seine linke Hand nicht mehr bewegen, die geschwollen war und wie ein Fleischklumpen aussah.
Dieses letzte Symptom empfand ich vor allem deshalb als so grausam, weil Jason in seiner Jugend – in unserer Jugend – ein hervorragender Sportler, ein gerissener, zäher, pfeilschneller Linkshänder gewesen war. Obwohl er nicht gerade zu den Größten gehörte, spielte er Baseball und Basketball in der Spitzenliga Colorados, denn er konnte springen wie eine Antilope mit Froschbeinen. Hinzu kam sein Aussehen: Mit den dunklen Haaren und Augen, seinem breiten Lächeln und seiner halb italienischen und halb jüdischen Herkunft war er der Inbegriff des amerikanischen Schmelztiegels und wirkte auf Mädchen einfach unwiderstehlich. Unvergesslich ist für mich sein explosionsartiges Lachen in den höchsten Tonlagen. Oft lachte er sich über die eigenen Witze kaputt, was einfach nur ansteckend wirkte.
Auf der Straße von Denver nach Boulder stach plötzlich die Sonne durch die Wolken, als könnte sich der März nicht zwischen Frühling und Winter entscheiden. Jason war in sich zusammengesunken. Weil er auf den schmerzenden Schwellungen nichts anderes ertragen konnte, hatte er locker sitzende graue Trainingshosen, Leinenschuhe und ein Flanellhemd angezogen. Selbst seine Füße waren geschwollen. Der Krebs hatte Jason nichts von seinen Begleiterscheinungen erspart. Sein Onkologe hatte Jason den Spitznamen »Steel Bull« gegeben, weil er eisern alle ihm vorgeschriebenen Behandlungen ertrug und oft noch einen Scherz oder ein Lächeln auf den Lippen hatte.
Doch am vergangenen Montag hatte sein Onkologe Jasons Todesurteil gesprochen. Nach der Untersuchung des Tumor-Wachstums hatte ihm der Arzt unter Tränen erklärt, sie seien am Ende ihrer Möglichkeiten angelangt. Man hätte an ihm alle Behandlungsformen ausprobiert, ihm alle verfügbaren Medikamentencocktails verabreicht, und doch sei stets der Krebs mit voller Kraft zurückgekehrt. Nun sei es an der Zeit, die Waffen zu strecken.
Nach der Konsultation schrieb der Arzt auf das Patientenblatt, es sei »trotz der emotionalen Belastung wohl das Vernünftigste, für Mr. Greenstein die Versorgung in einem Hospiz« zu erwägen. Und er organisierte ein Treffen mit Jasons Angehörigen zur Vorbereitung der Palliativbetreuung.
»Jede zusätzliche therapeutische Maßnahme«, schrieb der Arzt, »wird sich eher schädigend als nützlich auswirken« und sei keinesfalls angebracht, »es sei denn, er erlebt eine Spontanheilung«.
Beth lenkte den Wagen durch das gutbürgerliche Wohnviertel, in dem das St. Luke’s Medical Center in Denver angesiedelt ist. Normalerweise plauderte Jason für sein Leben gern, doch diesmal war er ausgesprochen einsilbig.
Nachdem Beth den Wagen geparkt hatte, stützte sie Jason auf dem Weg zum Aufzug, und sie fuhren in den zweiten Stock. Jason hatte viele Stunden seines Lebens in der Onkologie dieses Krankenhauses verbracht, in einem schuhschachtelgroßen Zimmer auf einem der sperrigen braunen Liegesessel ausgestreckt, während er die ihm verschriebene Infusion mit der aggressiven Chemotherapie bekam. Nicht so an diesem Tag.
Jason ließ sich vorsichtig auf die Liege gleiten. Eine Krankenschwester befestigte den Infusionsschlauch an dem Port in seiner Brust. Zunächst ließ sie Kochsalzlösung hineinfließen, um die Reinheit des Zugangs sicherzustellen, dann gab sie ihm zur Beruhigung ein Antihistamin. Schließlich ersetzte sie den Infusionsbeutel durch einen anderen, der ebenfalls eine klare Lösung enthielt. Allerdings handelte es sich um etwas völlig Neues.
Krebs gehört weltweit zu den führenden Todesursachen. Allerdings geht es hier nicht um Krebs. Auch nicht um Herz- oder Atemwegserkrankung, um Unfälle, Schlaganfall, Alzheimer, Diabetes, Grippe oder Lungenentzündung, Nierenversagen oder Aids. Sie alle können uns krank machen und zum Tod führen. Dieses Buch aber befasst sich nicht mit konkreten Krankheiten oder Verletzungen, sondern ganz allgemein mit der außergewöhnlichen Kraft, die sich ihnen entgegenstemmt. Diese Kraft ist das Bindeglied, der Leim, der Gesundheit und Wohlbefinden eines Menschen in seiner Gesamtheit zusammenhält. Es ist ein Buch über das Immunsystem.
Es erzählt von den erstaunlichen Erkenntnissen über das Immunsystem, die vor allem in den letzten siebzig Jahren gewonnen wurden, und von seiner Wirkungsweise in praktisch jedem Bereich unserer Gesundheit. Wenn ein Kratzer oder Schnitt den Schutzschild unserer Haut – so etwas wie die erste Verteidigungslinie – durchbricht, tritt das Immunsystem in Aktion. Immunzellen strömen in die Wunde, bilden neues Gewebe oder heilen die durch Kratzer oder Schnitte entstandenen inneren Schäden, sie versorgen Bisse und Verbrennungen. Ein komplexes Zellnetzwerk greift alle Erkältungsviren an, mit denen wir zwei-, dreimal im Jahr konfrontiert sind, es überwacht die zahllosen malignen Einflüsse, von denen uns Krebs droht, hält Viren wie die des Herpes in Schach, die sich in vielen Menschen angesiedelt haben, und befasst sich mit den jährlich auftretenden hundertmillionenfachen Fällen von Lebensmittelvergiftung. Und in den letzten Jahren hat sich abgezeichnet, wie wichtig die Rolle des Immunsystems sogar in der Funktionsweise unseres Gehirns ist, da die ihm eigenen Abwehrzellen dieses Organ von geschädigten oder abgestorbenen Zellen reinigen und so seine neurologische Gesundheit sichern.
Ununterbrochen, aber von uns unbemerkt, hält das Immunsystem Wache; es ist im sprichwörtlichen Sinne unser »Bodyguard«. Und jene Funktionen, die unsere Gesundheit sichern, bestimmen anscheinend auch derart entscheidende Prozesse wie unsere Partnerwahl – indem sie dazu beitragen, inzestuöse Verbindungen zu verhindern, die sich schädigend auf die Gesundheit und das Überleben unserer Spezies auswirken könnten.
Zur Beschreibung des Immunsystems werden oft Begriffe herangezogen, die an Kriegsführung erinnern: Es mobilisiert unsere inneren Abwehrkräfte gegen eine böse Krankheit mithilfe mächtiger Zellen, die mit der Fähigkeit zu Überwachung und Spionage, zu chirurgisch gezielten Attacken und kerntechnischen Angriffen ausgestattet sind. Dehnt man diese Begrifflichkeit aus, heuert das Verteidigungsnetzwerk zudem auch verdeckte, mit Selbstmordpillen ausgerüstete Agenten an und ist angeschlossen an ein hochkomplexes und reaktionsschnelles Telekommunikationsnetz, das weltweit seinesgleichen sucht. Das Abwehrsystem erfreut sich außerdem einer Stellung, die im Verhältnis zu allen anderen Bereichen der menschlichen Biologie geradezu einzigartig ist. Es strömt ungehindert im Innern des Körpers umher und bewegt sich durch Organsysteme hindurch und über sie hinweg. Wie die Polizei während eines Ausnahmezustands konzentriert es sich auf Bedrohungen und hindert sie an ihrem schädlichen und tödlichen Wirken; es erkennt fehlerfrei bis zu einer Milliarde von außen stammender Gefährdungen – auch solche, die von der Wissenschaft noch gar nicht beschrieben worden sind.
Doch die Kriegsmetapher führt in die Irre; sie ist unvollständig und womöglich sogar grundfalsch. Unser Immunsystem ist keine Kriegsmaschine, sondern widmet sich der Erhaltung des Friedens und bemüht sich mehr als alles andere um die Erzeugung von Harmonie.
Welch außerordentlich komplexe Herausforderung, betrachtet man das lärmende Fest des Lebens! In unserem Körper tobt eine wüste Party, eine turbulente, rauschende Feier, besucht von den Milliarden von Zellen, aus denen wir bestehen: Gewebezellen und Blutzellen, Proteine und Moleküle, Mikroben und, ja, Bakterien. Fast die Hälfte unserer Zellen sind – größtenteils im Darm angesiedelte – Bakterien. Das Immunsystem hat die Aufgabe, durch diese wilde Party zu streifen, auf Störenfriede zu achten und sie – und das ist der entscheidende Punkt – hinauszuwerfen, ohne dass andere Zellen dabei nennenswerten Schaden nehmen.
Allerdings wird dem Immunsystem der Job als Friedensstifter dadurch erschwert, dass die Membran unseres Körpers ausgesprochen porös ist und nahezu jeder Organismus, der es darauf abgesehen hat, in ihn eindringen kann. Heute behaupten einige, dass manche dieser Mikroben nicht bedrohlich, sondern sogar nützlich sind. Unsere Gesundheit beruht auf dem harmonischen Zusammenwirken einer Vielzahl von Bakterien. Wenn wir Antibiotika einnehmen, uns mit bakterizider Seife waschen oder mit Giftstoffen in Berührung kommen, die unsere Darmflora beeinträchtigen, schädigen wir unter Umständen Bakterien, die für den wirksamen Einsatz unseres Immunsystems unerlässlich sind.
Umgekehrt kann das Immunsystem ganz von selbst überhitzen und so wild agieren, dass es ebenso gefährlich wird wie jede von außen eingeschleppte Krankheit. Dann kommt es zur sogenannten Autoimmunität, einem Leiden, das immer weiter um sich greift. Nach einigen Schätzungen sind es bis zu 75 Prozent Frauen, die Gelenkrheumatismus, Lupus, Morbus Crohn oder ein Reizdarmsyndrom haben – und jede dieser Erkrankungen ist schrecklich, belastend und schwer zu diagnostizieren. Autoimmunität in ihren verschiedenen Formen ist (nach Herz-Kreislauf-Störungen und Krebs) die dritthäufigste Erkrankung in den Vereinigten Staaten. Diabetes, das in den USA die meisten Opfer fordert, entsteht, wenn das Immunsystem die Bauchspeicheldrüse angreift.
In den letzten Jahrzehnten brachte die Forschung noch eine weitere entscheidende Eigenschaft des Immunsystems zutage: Es lässt sich übertölpeln. Wenn sich eine Krankheit einnistet, zu wachsen beginnt und sich ausbreitet, überlistet sie unsere Abwehr, indem sie ihr vorgaukelt, sie sei letztlich gar nicht so schlimm. So bringt sie das gesamte Abwehrnetz dazu, ihr Wachstum zu unterstützen. Wie es im Fall von Jason geschehen war.
Der Krebs führte Jasons starke Abwehr ganz gemein hinters Licht. Er vereinnahmte Jasons Kommunikationskanäle und wies die Soldaten seines Körpers an, untätig zu bleiben. Dann benutzte er Jasons Immunsystem, um sich selbst, also den Krebs, so zu schützen, wie es gewöhnlich nur kostbarem, gesundem neuen Gewebe vorbehalten ist. Dieser Prozess hätte sich beschleunigt und Jason geradewegs ins Grab geführt.
Doch als man an jenem denkwürdigen Freitag, dem 13., die klare Flüssigkeit in Jasons Blutbahn tropfen ließ, wollte man den Prozess wieder umkehren. Sie sollte sein Immunsystem zum Kämpfen anregen. Jason gehörte zu den ersten fünfzig Patienten, an denen eine der größten Errungenschaften in der Geschichte der Medizin getestet wurde, mit der die moderne Forschung einem der hartnäckigsten und wirksamsten Tötungsmechanismen entgegentritt, die das Pantheon der Krankheiten zu bieten hat.
Als sich abzeichnete, dass Jason eventuell als Beispiel für einen bemerkenswerten Wendepunkt in der Medizin dienen würde, griff ich zur Feder.
Der Autor und Jason Greenstein. »Ich bin wieder da«, verkündete Greenie.
Als New-York-Times-Journalist, aber auch als Jasons Freund, machte ich mich auf, um mehr über das Immunsystem zu erfahren. Ich wollte herausfinden, wie wir so weit gekommen sind, dass wir in das Immunsystem eingreifen können, und welche Konsequenzen das hat. Dabei stieß ich auf eine Geschichte mit wissenschaftlichen Helden und Entdeckungen, deren Faden in Großbritannien begann und sich – da die Forscher sich stets auf die hart erarbeiteten Erkenntnisse ihrer Vorgänger stützten – über Europa, Russland, Japan und die Vereinigten Staaten um die ganze Welt spann. Meine Einblicke in all die entscheidenden Momente und Schlussfolgerungen, persönliche Erfahrungen und wissenschaftliche Aha-Erlebnisse machen aus diesem Buch weniger ein Lehrstück als eine Erzählung. Sie handelt von der Funktionsweise des Immunsystems und seiner praktischen Bedeutung für unsere Gesundheit – für den Schlaf, für die Fitness, für Ernährung, Alter und Demenz.
Außerdem geht es darin um Jason und um drei weitere Menschen mit einer aufsehenerregenden medizinischen Geschichte: Bob Hoff, der ein wahrlich außergewöhnliches Immunsystem besitzt, und Linda Segre und Meredith Branscombe, die standhaft gegen einen unsichtbaren Killer ankämpfen: ihr eigenes hyperaktives Immunsystem.
Wie Jason markieren sie einen entscheidenden Augenblick in der Geschichte der Forschung, die Dämmerung einer neuen Ära mit einer Fülle von Erkenntnissen, die, nach Einschätzung von Experten, auf einer Stufe mit den größten Errungenschaften der Menschheit stehen.
Die neuen Entdeckungen seien »ebenso bedeutsam wie die Entdeckung der Antibiotika«, erklärte Dr. John Timmermann von der University of California, der mit seinen Forschungen zum Immunsystem wegweisend gewesen ist. Wenn es darum gehe, einen Wirt von Krankheiten zu bekämpfen, die sowohl Lebensqualität als auch Lebensdauer beeinflussen, sei unsere Situation »gegenwärtig vergleichbar mit Apollo 11. Der Adler ist gelandet.«
Jasons Infusion im St. Luke’s Hospital am Freitag, dem 13., dauerte eine Stunde. Anschließend fuhr ihn Beth die 45-minütige Strecke zurück nach Boulder, wo er sich im Coors Event Center auf dem Campus der University of Colorado das Basketballspiel seines Neffen Jack ansehen wollte. Bei ihrem Eintreffen fühlte sich Jason jedoch zu schwach, um die Stufen der Stadiontribüne hochzusteigen, daher überredeten sie die Verantwortlichen, ihn durch einen Sondereingang direkt zum Spielfeld vorzulassen.
Auf die gleiche Weise war Jack zu seinen Spitzenzeiten ins Stadium gekommen: direkt aufs Spielfeld, im Mittelpunkt des Geschehens. Ich selbst hatte vor Jahrzehnten auf der gleichen Tribüne gesessen und gesehen, wie Jason zu einem der spektakulärsten Würfe dribbelte, die ich mein Lebtag je gesehen hatte. Sein spielentscheidender Wurf gegen das gegnerische Team fiel genau auf den Augenblick, als der Buzzer das Ende der Nachspielzeit meldete. Seine Mannschaft kam dadurch in die Play-off-Runde von Colorado.
Viele Jahre später, als er umringt von seinen Freunden unter den Zuschauern saß, war er ein Schatten seiner selbst. Bei seinem Anblick drängte sich der Eindruck auf, dass dies das letzte Basketballspiel sein könnte, das er live erlebte.
2: Jason
2
Jason
In der Geschichte des Immunsystems geht es um Leben und Tod, um das Überleben unter tödlichsten Bedingungen. Es ist aber auch die Geschichte vom Einsatz für Frieden und Harmonie, für erfolgreiche Integration, für die Eingliederung von Organismen, die körperliche Grenzen überwinden konnten, für die Erfüllung des Schicksals und für Weiterentwicklung. Es ist die Geschichte einer Freundschaft.
Jason in der oberen Reihe, Zweiter von links; der Autor unten rechts, direkt unterhalb von Jasons Vater.
Meine Erinnerungen an Jason reichen zurück in unsere Zeit auf dem Spielfeld und auf der Reservebank. Wir waren zehn Jahre alt und trugen weiße Trikots mit gelben Zierstreifen. Jasons dichte Haare türmten sich breit über seinem Kopf auf, und beinahe ebenso breit war sein Lächeln. Auf den Mannschaftsfotos stand er in der letzten Reihe, und ich kniete vorne. Ich war zwar in vielerlei Hinsicht glücklich und zufrieden in der Schule, doch damals wuchsen in mir bereits die Selbstzweifel eines körperlich kleinen Jungen, den die Sehnsucht plagt, beachtet zu werden.
Für mich verkörperte Jason das Ideal des amerikanischen Jungen, denn er war nicht nur ein hervorragender Sportler, sondern von Natur aus auch mit Wissensdurst, Freundlichkeit und einem ungeheuren Charisma ausgestattet. In der siebten Klasse wurde er zum beliebtesten Schüler gewählt. In seiner Gegenwart schien sich der Raum auszudehnen, und er bekam den Spitznamen »Golden«. Er wirkte auch deshalb so liebenswert, weil er niemals auf die Idee gekommen wäre, andere zu schikanieren. »Los, hau ihn raus«, rief er mir zu, wenn ich am Schlag war. »Dann eben beim nächsten Mal«, tröstete er mich, wenn ich zur Bank zurücktrottete.
Wir hatten einiges gemeinsam, wie unsere Väter, zu denen wir aufsahen und die in unserem Leben und in unserer Gemeinde eine große Rolle spielten. Mein Vater war Richter in unserer relativ kleinen Stadt und Jasons Vater Joel ein angesehener Scheidungsanwalt. Außerdem trainierte er unsere Little-League-Mannschaft, war überhaupt der Little-League-Trainer der Stadt und, vom Fluchen und Trinken einmal abgesehen, unsere Version von Walter Matthau. Die Zigarre im Mund war sein Markenzeichen, er hatte ein trockenes Grinsen und einen noch trockeneren Humor und war auf dem Baseball-Feld schon aus weiter Ferne an der marineblauen Windjacke der New York Yankees zu erkennen. Das Bein auf eine Stufe gestützt, stand er an der Spielerbank, die Faust in seinen rissigen Lederhandschuh gerammt.
Joel war vernarrt in Jason. Liebevoll, aber klug lenkte er sein Vorankommen, wie ein umsichtiger Trainer, dem per Zufall ein Vollblut in die Hände gefallen war.
»Jason hat unseren Vater angebetet«, sagte mir Jasons Schwester Yvette. »Er stand ihm sehr nahe, und mein Dad war Jasons größter Fan.«
Jasons älterer Bruder Guy sagte über Jason: »Unser Dad war sein Guru.«
Auf gesundheitlicher Ebene gab es zwischen unseren Vätern – Murray (mein Vater) und Joel – jedoch einen gewaltigen Unterschied. Murray entdeckte während der Modewelle in den 1970ern das Joggen, wurde zum wahren Fanatiker und brachte es schließlich auf dreizehn Marathons. Joel war zwar ebenfalls fit, rauchte aber Zigarre. Cathy, Jasons Mutter, rauchte eine Schachtel Zigaretten pro Tag, und das Haus der Greensteins roch ständig nach Aschenbecher. Rauchen belastet das menschliche Immunsystem mehr als alle anderen unserer Laster; die kleinen Kerben und Einschnitte, die dadurch im weichen Lungengewebe entstehen, bedeuten nicht nur eine ständige Verletzung, sondern zwingen die Zellen, sich zu teilen, um das geschädigte Gewebe zu ersetzen. Mit der erhöhten Zellteilung steigt schon rein rechnerisch die Gefahr von bösartigem Wachstum, von Krebs. Und das kann tödlich sein.
Als wir in der achten Klasse waren, erfuhr Jason vom Darmkrebs seines Vaters.
Nach außen hin gab er sich unbeeindruckt von dem Umstand, dass Joel von bösartigen Geschwüren aufgefressen wurde – erste Anzeichen einer emotionalen Abkopplung, die sich in ihm aufbaute. Als wir in der neunten Klasse waren, ließ er sich zur Wahl des Schulsprechers aufstellen und hielt eine wunderbare Rede voller Selbstvertrauen. Darin versicherte er seinen Mitschülern, sich voll und ganz für sie einzusetzen.
»Ich werde mein Bestes und meine ganze Kraft geben, wenn ich gewählt werde.«
Wenn! Natürlich wurde er gewählt.
In der zehnten Klasse an der Boulder High School entwickelte Jason schließlich eine Philosophie, die uns für einige naive und wundervolle Jahre prägen sollte. Er gab einer Gruppe von Freunden den Namen »Concerned Fellow League«, die »Liga der Betroffenen«.
Über diese Weltsicht wollten wir uns – Jason und sechs andere, nämlich Josh, Noel, Adam, Bob, Jason und ich, die in der Highschool einen engen Zusammenhalt hatten – definieren. Allerdings bedeutete die Philosophie das Gegenteil von dem, was ihr Name besagte: Jasons Ansicht nach brauchten wir nämlich keineswegs betroffen zu sein. Uns sorgte gar nichts. Wir sahen dazu keinen Grund. Wir hatten das Leben voll im Griff. Und falls das nicht zutraf, sollte es uns nicht weiter stören. Sorgen waren etwas für Menschen, die keine Perspektive mehr hatten.
Wie alle überdauernden Philosophien und Religionen fällt auch diese auf sich selbst zurück und wird zum Widerspruch in sich. Man darf nicht zu genau hinschauen. Als Einzelner sorgte sich jeder von uns um alles Mögliche; wir hatten eine Heidenangst und fühlten uns unsicher, obwohl wir zu dieser coolen Gruppe gehörten. Von außen betrachtet aber galten wir als Glückskinder, als gute Schüler und Sportler, die von Mädchen umschwärmt wurden – allen voran Jason, der sich in der elften Klasse mit einer wahnsinnigen Leistung hervortat.
Als zu klein geratener Oberstufenschüler half er den Boulder High School Panthers mit einer geradezu märchenhaften Erfolgssträhne in die Basketball-Play-off-Runde Colorados des Jahres 1984 zu kommen. Mit seinen 1,74 Metern in Turnschuhen gehörte Jason keineswegs zu den Stars der Mannschaft – einige aus der Abschlussklasse waren Spitzenspieler –, doch niemand bestritt, dass er mit seiner beispiellosen Intensität das Team zusammenhielt, dass er den Überblick behielt und die Identifikationsfigur schlechthin war.
Der Highschool-Trainer jener herausragenden Mannschaft, ein Choleriker namens John Raynor, hielt Jason für einen Jungen, dem nichts und niemand etwas anhaben konnte. »Manchmal spielte er mit fahrlässigem Leichtsinn«, erinnerte sich Coach Raynor. Er ging zu Boden, »und wenn er aufstand, humpelte er. ›Du meine Güte‹, dachte ich, ›wie kann er sich davon nur wieder erholen?‹«
Auf der Tribüne saßen jubelnd – als anfeuernde Vertreter unseres gesamten Bundesstaats – die restlichen »Betroffenen«, die Gesichter mit den kleinen Tatzen der Boulder Panthers bemalt.
Und ganz in der Nähe hockte Joel, in sich zusammengesunken, nur noch ein Schatten, der sich ans Leben klammert, um seinem geliebten Sohn zuzusehen.
Von Spielbeginn an lief es schlecht.
Jason, der wegen mangelnder Körpergröße und Kraft bereits von vornherein im Nachteil war, laborierte an einer Fußgelenksverletzung aus einem früheren Spiel und holte nur vier Punkte. Die beiden besten Werfer der Panthers fanden nicht zu ihrer Form. Endstand 52:42.
Nur wenige Monate später, am 13. Juli 1984, starb Joel. Er war fünfzig Jahre alt.
Jason erfuhr davon an seinem Arbeitsplatz. Als er nach Hause kam, fand er seinen Vater auf einer Tragbahre im Wohnzimmer, hergerichtet von Palliativpflegern. Jason weinte. Irgendwie hatte er nicht geglaubt, dass es so weit kommen würde.
Später sagte er mir: »Es gibt zwei Dinge auf der Welt, die ich hasse, und das sind Krankenhäuser und Krebs.«
Angehörige stellten die Vermutung an, Jason habe der Tod seines Vaters derart mitgenommen, dass er in der Folge den Boden unter den Füßen verlor. Er wurde rastlos – körperlich, geistig und emotional. Nach Joels Tod lief er wie ein Vollblutpferd, das seinen Trainer verloren hatte, weiter und schneller als je zuvor. Es war ein hektisches Leben mit Reisen in die ganze Welt – Unterrichten in Japan, eine Tour durch Lateinamerika – und mehreren Collegeabschlüssen. Zumindest halbwegs. Da er Studiengebühren schuldig blieb, konnte er seinen Jura-Abschluss nicht nutzen. Er gründete reihenweise Unternehmen und Ein-Mann-Agenturen, war Repräsentant von Handyunternehmen, verkaufte Crocs in der Fußgängerzone und Entsafter an Restaurants. Er gründete und leitete eine Firma für Wohnmobile für den Wintersport. Jedes seiner Konzepte nahm er mit einer Begeisterung in Angriff, als sei er im Begriff, das große Los zu ziehen.
Rückwirkend könnte man meinen, dass er schon damals seine Gesundheit aufs Spiel setzte, doch dann war ich es, der als Erster Probleme bekam. Unter dem Druck meiner überzogenen, ehrgeizigen, aber fehlgeleiteten Ziele und in Unkenntnis meiner wahren Leidenschaft erlitt ich nach dem College einen Zusammenbruch, der von Schlafstörungen und Ängsten begleitet war. Um weitermachen zu können, musste ich zu mir finden. Dank diesem Prozess wurde ich im Wesentlichen zu einem mit sich selbst im Einklang lebenden Menschen, der sich in seiner Haut wohlfühlt. Ich war in der Lage, meine eigentliche Bestimmung zu erkennen und sie ohne Angst zu verwirklichen.
Ende der 1990er-Jahre entwickelte sich zwischen mir – einer gesunden und glücklichen Person – und Jason – dem Abenteurer, der mit einer verrückten Geschäftsidee nach der anderen aufwartete – eine wahre, tiefe Freundschaft. Uns verbanden Begeisterungsfähigkeit und gemeinsame Erinnerungen; hinzu kam unsere Begabung, uns selbst nicht allzu ernst zu nehmen, während wir uns mit vollem Engagement dem Aufbau unserer Zukunft widmeten. Doch dann meldete sich bei Jason das Schicksal.
Am 9. Mai 2010 landete sein Flugzeug unter einem prächtigen Abendhimmel in Phoenix, Arizona. Es war ein Sonntag; Jason hatte das Wochenende auf einer Messe für Spielcasino-Betreiber in Biloxi im Bundesstaat Mississippi verbracht. Sein jüngstes Projekt war der Handel mit Geschenkartikeln – in China produzierte hübsche Emailledosen –, die von Casinos an ihre Stammbesucher oder an plötzliche Gewinner überreicht wurden. Seine Firma hieß »Green Man Group«.
Das Projekt entsprach Jason in jeder Hinsicht. Er wohnte in Las Vegas, dem Traumziel der Spieler, und verkaufte glitzernde Kinkerlitzchen für Träumer, wie er selbst einer war. Um sich einen Kundenstamm aufzubauen, reiste er durch die Lande und erklärte den Betreibern, warum seine Dosen die Gäste noch fester an ihr Casino binden würden. Der Chrysler Concorde, den er besaß, war, wie er mir versicherte, »in 98 Prozent der Fälle der letzte Schlitten von Juden, ehe sie sterben oder den Führerschein abgeben müssen und ihn an eine mexikanische Familie verkaufen. Jeder Einzelne von ihnen ist in Händen von Mexikanern, abgesehen von dem, den ich fahre.«
Dann stimmte er sein ansteckendes Lachen an, entweder weil ihm wegen der etwas verfänglichen Bemerkung unwohl wurde oder weil er sie, im Gegenteil, einfach nur lustig fand. Und irgendwie musste man zwangsläufig mitlachen. Jason war in seinem Element, die Fenster heruntergekurbelt, in der warmen Brise, während ein Abenteuer auf ihn wartete.
»Ich habe es geliebt, die Stadt hinter mir zu lassen und durch die Wüste zu fahren.«
Auf dem Rückweg nach Las Vegas machte er einen Zwischenstopp in Phoenix, weil er in Arizona ein paar Dinge zu erledigen hatte. Als er am 9. spätabends landete, erfuhr er von der Fluglinie, dass sein Koffer, der auch die Muster seiner Dosen enthielt, nicht mit an Bord gewesen war. Er musste also vor Ort bleiben und warten. Da merkte er, dass er einen rauen Hals hatte, und dachte: »Das sind wohl diese Allergien, die ich manchmal in der Wüste habe. Vielleicht auch eine Halsentzündung oder ein Virus.«
Er übernachtete eine halbe Stunde vom Flughafen entfernt im Days Inn. Am nächsten Morgen ging es ihm mies. Er fühlte sich völlig ausgepowert. »Es war ein wunderschöner Maitag, aber mir ging es dreckig. Ich hatte Kopfschmerzen.« Um sich aufzuputschen, griff er wie gewohnt zu einem Stück Skoal-Kautabak und schob es sich in den Mund – »Ich habe gekaut wie ein Verrückter« –, und als er sich danach immer noch schlecht fühlte, hielt er an, um etwas zu essen – an einer Tankstelle.
Da hockte er nun, ein Häufchen Elend, und das, obwohl er auf der Landstraße von jeher in seinem Element und glücklich war.
»Jason wäre einer dieser Typen gewesen, die damals aufbrachen, um den Wilden Westen zu besiedeln«, meinte seine Schwester Natalie. »Er hätte die Stadt hinter sich gelassen, ohne Rücksicht auf Indianer oder andere Gefahren.« Allerdings konnte sie nicht einschätzen, ob das einfach nur seiner Natur entsprach oder ob dieser Charakterzug durch den Tod ihres Vaters verstärkt worden war. Denn »als unser Dad starb, ist etwas in ihm kaputtgegangen. Oder es ist in ihm ein Schalter umgelegt worden.« Einen Hausstand zu gründen, die Dinge langsam anzugehen, lag nicht in Jasons Wesen. Er hatte seine eigenen Vorstellungen und verfolgte sie, auch wenn andere sie für extrem hielten – so wie sein Hausrezept, das er kurz darauf entwickelte, um seine Halsentzündung zu heilen.
Jason wohnte in Las Vegas mit – wie konnte es anders sein – einer Striptease-Tänzerin zusammen, die seine Untermieterin war. Das im Ranchstil gebaute Haus aus dem Jahr 1947 mit Swimmingpool im Garten, das seine Mutter für 175 000 Dollar als Geldanlage gekauft und ihm überlassen hatte, lag in einem Viertel, das damals seine besten Jahre schon lange hinter sich hatte. Irgendwann hatte einmal ein Casinomagnat auf der anderen Straßenseite gewohnt, und Jason hatte vor, das Haus zu renovieren und sich dann ein neues zu suchen. Jedenfalls behauptete er das.
Seine Beziehung zur Striptease-Tänzerin war rein platonisch, was Jason prinzipiell nichts ausmachte, war er doch mit seiner Freundin Beth zusammen.
Einige Tage, nachdem er krank geworden war, musste er verwundert zugeben, dass er sich immer noch elend fühlte.
»Ich habe das allgemein bekannte Rezept angewendet«, erzählte er lachend. »Bin am Freitagabend losgezogen und habe mir einen Kasten Bier gekauft. Dann habe ich mich volllaufen lassen, um die Erkältung zu bekämpfen.«
Am nächsten Morgen ging es ihm allerdings noch schlechter, und als er dann mit Beth telefonierte, erklärte sie ihm: »Du musst zum Arzt gehen.« Jason folgte ihrem Rat. Man nahm ihm Blut ab und stellte fest, dass einer seiner Lymphknoten am Hals stark geschwollen war. Der Arzt vermutete bei ihm das Pfeiffersche Drüsenfieber (Infektiöse Mononukleose) und verschrieb ihm Antibiotika. Doch die Tabletten halfen nicht.
Jeden Sommer fuhr Jason mit seiner Mutter an die Ostküste nach New York, um Verwandte zu besuchen. Fliegen kam für sie nicht infrage. Jason und seine Mutter hatten eine Beziehung, an der Sigmund Freud oder Arthur Miller ihre Freude gehabt hätten. Denn ihre von gegenseitiger Abhängigkeit wie auch von Zuneigung geprägten Streitereien erinnerten eher an verbal ausgetragene Ringkämpfe. Ständig hatten sie am anderen etwas auszusetzen und steigerten sich dabei zunehmend ins Theatralische.
Du hast mir nicht zugehört, Ma! Es geht mir nicht gut.
Wenn es dir nicht gut geht, musst du dich hinlegen, Jason!
Ist schon in Ordnung, Ma. Ich fahre dich nach New York.
Das ist nett von dir, Jason. Bist ein lieber Junge.
Er fuhr nach Colorado, um sie abzuholen, und dann ging es weiter an die Ostküste. »Ich bin wirklich nicht fit«, dachte er. Auf ihrem jährlichen Treck, der Jason zum amerikanischen Heimatort seiner Familie zurückführte, trafen sie Mitte Juni in Bayside Queens ein. Im Haus seiner Tante Rosy angekommen, war Jason so schwach, dass er einfach auf der Couch liegen blieb und nicht mehr aufstehen konnte.
Einen Hausarzt hatte er nicht. Er war nicht einmal krankenversichert.
»Ich hatte gerade im Internet eine Krankenversicherung abgeschlossen, aber das war eine Mogelpackung. Es hieß, sie wäre für Notfälle, aber Krebs war davon nicht abgedeckt. Außerdem zahlte sie maximal nur tausend Dollar. So habe ich damals gelebt. Als würde ich mit meiner Untermieterin um eine Flasche Captain-Morgan-Rum wetten, dass ihre Titten echt waren.«
Zurück in Colorado, ließ er schließlich sein Blut untersuchen. Dabei testete man ihn unter anderem auf eine eventuelle Entzündung mittels der nicht spezifischen Blutsenkungsreaktion. Jasons Ergebnis übertraf alles bisher Dagewesene.
»Hier stimmt etwas ganz und gar nicht«, sagte der Arzt, der Jason zurückrief. »In meinen dreißig Berufsjahren habe ich so was noch nie erlebt. Irgendwas ist da völlig aus dem Ruder gelaufen.«
Jason wurde mit dem Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. In seinem Immunsystem wüteten bösartige Kräfte. Doch immerhin gehörte Hodgkin zu den Krebsarten mit den besten Heilungschancen – für die meisten.
3: Bob
3
Bob
Der Halloween-Abend des Jahres 1977 kennzeichnete für Robert T. Hoff den Beginn seines Wegs zu einem medizinischen Wunder. Er war als Mumie verkleidet.
Bob war 1948 geboren und in Iowa aufgewachsen, Sohn eines Versicherungsangestellten und einer Aushilfslehrerin. Seit er vier war, musste er sich verstellen, denn in diesem Alter hatte er zum ersten Mal – wenn seine Erinnerung ihn nicht täuschte – mit einem Jungen Zärtlichkeiten ausgetauscht. Er fand es berauschend, lechzte nach dem körperlichen Ausdruck der Zuneigung mit Jungen und später mit Männern. Dass er in seiner Kindheit gelegentlich die Kleider und Schals seiner Mutter anzog, hielt er geheim. Für die Schule tat er mehr als nötig. Nachdem er sich einmal in der siebten Klasse einem Jungen anvertraut hatte und dieser, ein gewisser Steve Lyons, es herumerzählte, machte er den Fehler nicht noch einmal und bewahrte Stillschweigen über seine Vorliebe.
»Ich wurde als Scheißschwuchtel bezeichnet.«
Bob musste sich eine andere Strategie überlegen. Der beliebteste Junge der Schule hieß Art, und Bob begann, ihn zu imitieren.
»Ich kopierte alles, was Art tat. Seine Hobbys am Nachmittag. Das Schwimmen im YMCA. Ich übte, anders zu sprechen. Es gibt eine schwule Sprechweise, und ich überlegte mir meine Sätze schon im Voraus, um alle Wörter zu vermeiden, bei denen ich hätte lispeln können.
Mit der Zeit wurde ich immer beliebter, war Star des Schultheaters, gewählter Leiter des Schülerrats und Klassensprecher.«
Er traf sich mit Mädchen. Aus Angst vor Ächtung vermied er bis zum College jeden sexuellen Kontakt mit Männern.
Bob studierte Jura und heiratete eine Frau. Außerdem meldete er sich zum aktiven Dienst bei der US-Air-Force. Seine Frau und er gaben sich mit der Ehe alle Mühe, doch sie wollte nicht mit einem Homosexuellen verheiratet sein. Also ließen sie sich scheiden. Er heiratete erneut. Irgendwann entdeckte Bobs Mutter die Wahrheit über seine Neigungen. Weil sie Homosexualität für Sünde hielt, sprach sie über zwanzig Jahre lang kein Wort mehr mit ihm.
1977 arbeitete Bob, ein studierter Jurist, als stellvertretender Chefsyndikus in der General Services Administration, einer wichtigen Regierungsbehörde, und lebte in der Hauptstadt Washington. Am 31. Oktober besuchte er eine Halloween-Party – allein, weil sich seine damalige Ehefrau, die Teil seiner Tarnung war, als Flugbegleiterin auf Reisen befand.
Seiner Verkleidung als Mumie wegen mit Binden umwickelt, saß Bob auf der Party, als er von einem Typen namens John angesprochen wurde. John war ein körperlich durchtrainierter Rotschopf. Die beiden Männer gingen nach oben und hatten ungeschützten Sex.
Zwei Wochen später fühlte sich Bob schwindlig, kraftlos und müde. Er hatte Schmerzen, konnte jedoch trotz der grippeähnlichen Symptome zur Arbeit gehen. Das Ganze dauerte zehn Tage.
Um die Zeit von Thanksgiving besuchte Bob die Hochzeit seines Cousins in Cedar Falls. Auf der Rückfahrt ging es ihm richtig schlecht; er musste sich übergeben und hatte Durchfall. Er führte es auf eventuell verdorbene Garnelen zurück. Bob, der sein Leben lang mehr geleistet hatte, als nötig war, ging zu dem Arzt, der einige Zeit zuvor die nötigen Untersuchungen für Bobs privaten Pilotenschein durchgeführt hatte.
Bob hatte Hepatitis der Variante A, deren Virus erst 1973, also nur wenige Jahre zuvor, entdeckt worden war. Die Erkrankung beruht auf einer Entzündung der Leber, und ihre Symptome äußern sich erst gewisse Zeit nach der Ansteckung. Dabei erlebt der Erkrankte – in diesem Fall Bob – an sich alle Anzeichen eines Immunsystems im Kampfmodus, was sich in einer Entzündung äußert.
Insgesamt betrachtet war die Diagnose gar nicht so schlimm. Wenn das Immunsystem seine Aufgabe erledigt, gehört Hepatitis A zu den Infektionen, die überwunden werden können.
Bob hatte sich aber noch etwas anderes eingefangen. Er hatte sich mit dem Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) angesteckt, zweifellos die schlimmste unmittelbare Bedrohung, mit dem unser Immunsystem konfrontiert werden kann. Es dauerte einige Jahre, ehe Bob die Wahrheit erfuhr. In der Folge wurde er für die größten Köpfe in der Welt der Wissenschaft zu einer unschätzbaren Quelle der Inspiration. Medizinisch gesehen ist Bob Hoff von unschätzbarem Wert, denn sein Körper konnte sich gegen den HI-Virus und gegen den Tod behaupten wie vielleicht noch kein anderer vor ihm, sodass wir alle am Beispiel seines einmaligen Immunsystems Hoffnung schöpfen können.
4: Linda und Merredith
4
Linda und Merredith
Als Linda auf dem von Wind und Regen umtosten Golfplatz im irischen Ulster am ersten Abschlag stand, deutete kaum etwas darauf hin, dass sie einen unsichtbaren zerstörerischen Killer in sich trug. Sie spielte an diesem Maitag des Jahres 1982 in der Endrunde des 54-Loch-Wettbewerbs der Smirnoff Ulster-Open, einem Vorläufer der Irish Open. Linda spielte auf Sieg.
Kurz zuvor hatte sie ihr einheimischer Caddy, der reservierte Victor McCauly, zu ihrer Überraschung zum Parkplatz begleitet. »Ich möchte Ihnen was zeigen«, hatte er gesagt, während er den Kofferraum öffnete. Darin lagen ein Dutzend zauberhafter roter Rosen. »Los, Linda! Gewinnen wir den Strauß.«
Leicht würde es allerdings nicht werden. Die 22-jährige Linda hatte noch nie ein Profiturnier gewonnen, und sie trat gegen eine Frau an, die in den letzten zwei Jahren während der European Tour die meisten Preisgelder eingestrichen hatte. Die Aussicht auf die Endrunde jagte ihr so viel Adrenalin durch die Adern, dass sie in der letzten Nacht kaum geschlafen hatte.
Andererseits war vieles in Lindas Leben bislang verlaufen wie im Bilderbuch – wohlgemerkt wie im Bilderbuch und nicht wie im Märchen. Sie war keineswegs die Prinzessin, der die Dinge in den Schoß fielen, sondern hatte sich alles hart erarbeitet. Arbeit war jedoch etwas, das ihr gefiel. Mit sieben Jahren hatte sie sich mit Haut und Haaren dem Reiten verschrieben und dabei Wettbewerbsniveau erreicht. Sie hatte sich angetrieben, ihre Grenzen gesucht, sich zwischen ihrem zehnten und fünfzehnten Lebensjahr sogar ausschließlich von Proteinen ernährt – von Eiern und Fleisch, ohne Obst oder Gemüse –, um hoch zu Ross schlank und anmutig zu wirken.
Sie wurde die beste Turnierreiterin des Stalls. »Selbst wenn man mir ein schlechtes Pferd gab, konnte ich es zu Höchstleistungen bringen.«
Was das Köpfchen betraf, schlug sich Linda besonders gut in Mathematik. Sie konkurrierte mit ihrer älteren Schwester, und als sie im dritten Schuljahr eine Klasse übersprang, trieb sie sie vor sich her.
Wenn sie auch nicht zu den Beliebtesten gehörte, so war sie doch gern gesehen – vielleicht ein bisschen streberhaft, aber zufrieden und in sich ruhend. Ihre Mutter war Profigolferin gewesen, ihr Vater schlug sich in diesem Sport auch nicht schlecht, und irgendwann gab Linda das Reiten auf und folgte der Familientradition. Als sie mit fünfzehn begann, trainierte sie fast von Anfang an unermüdlich und übte ihre Schläge schließlich im Rahmen eines Golfstipendiums der Stanford University. Sie schlug den Ball 210 Meter weit, in jenen Tagen eine Glanzleistung.
Bei dem Turnier an jenem Maitag 1982 zog Linda mit Jenny Lee Smith, der Führenden, immer wieder gleich. Am letzten Loch, dem 18., verriss Linda ihren zweiten Schlag, und der Ball rollte über das Grün hinaus auf einen Bunker. Ihr Sandschlag landete zwanzig Zentimeter vom Cup entfernt, und durch diesen Gleichstand ging der Wettbewerb plötzlich ins entscheidende Stechen.
Auch weiterhin blieben die beiden Spielerinnen Kopf an Kopf. Eine der beiden brauchte sich lediglich ein Loch zu sichern, um den Sieg des gesamten Turniers in der Tasche zu haben. Bei den folgenden vier Löchern blieb es allerdings beim Gleichstand, bis Linda am fünften, einem 500-Yard-Loch mit einem Par 5, ein Fehler unterlief und sie den Ball nur toppte. Müde kullerte er knapp neunzig Meter und damit nur die Hälfte der eigentlich anvisierten Strecke über den Rasen. Wenn Jenny nun ein passabler Schlag mit dem Wedge gelang, hätte sie das Turnier gewonnen.
Victor, Lindas Rosenkavalier und Caddy, drückte ihr ruhig ein Eisen 5 in die Hand und empfahl ihr, das zu tun, was sie gut konnte. Bleib beim Schwung geschmeidig, schlag mit Kraft und Selbstvertrauen, bring den Ball nahe an die Fahne, dann bist du weiterhin im Spiel und setzt die Kontrahentin unter Druck.
Linda schlug mit dem Eisen 5 den Ball »direkt vom Stick«, und er landete knapp einen Meter vor dem Loch, Jenny verriss und fuhr mit dem Schläger übers Gras. Als Linda zum Birdie einlochte und sich damit den Sieg sicherte, wurde sie von ihren amerikanischen Teamkollegen auf die Schulter genommen. Auf der Party, auf der sie später ihren Sieg feierten, tanzte sie mit ihrem alten Caddy zu »Forty Shades of Green«.
Linda Bowman war mit vielem gesegnet, vor allem mit Arbeitsmoral und mit der Fähigkeit, unter Druck beweglich zu bleiben.
Bis sich ihr eigener Körper gegen sie wandte.
Vierzehn Jahre später gewann man als Beobachter den Eindruck, dass es mit Lindas Leben im Großen und Ganzen wie im Bilderbuch weitergegangen war. Sie hatte einen Magisterabschluss in Betriebswirtschaft der Stanford University, zwei Kinder, von denen eins gerade erst geboren war, und einen Mann, der in einer der besten Anwaltskanzleien von Silicon Valley arbeitete. Außerdem stand sie als sechste Frau überhaupt kurz vor ihrer Berufung als Partnerin in die Boston Consulting Group.
Ihr Haus befand sich in San Mateo, einem Vorort San Franciscos. Im September hatte sie eine Gruppe von Kollegen zum Abendessen eingeladen, als sie plötzlich einen Schmerz in ihrem linken großen Zeh verspürte. Und es war nicht nur ein Schmerz. Es war eher eine Qual. Sie musste feststellen, dass der Zeh auf das Format eines Golfballs angeschwollen war. Mit zusammengebissenen Zähnen navigierte sie sich durch das Abendessen, um gleich danach etwas zu tun, was sie mit all ihrem Ehrgeiz sonst nie in Erwägung gezogen hätte: Sie bat ihre Gäste höflich zu gehen.
Noch ungewöhnlicher war, dass sie eine für den nächsten Tag angesetzte Besprechung absagte. Eigentlich hätte sie nach Los Angeles zu einem Termin mit einer der größten Banken der Welt fliegen sollen. Doch sie konnte sich nicht vorstellen, wie sie die Fahrt zum Airport und den Flug überstehen sollte.
Um schlafen zu können, schluckte sie Vicodin, ein starkes Schmerzmittel, das sie noch von der Geburt ihres Sohnes übrig hatte. Doch die Tablette wirkte nicht. Das Gleiche galt für die zweite. Sie nahm noch eine dritte.
Am nächsten Tag ging sie zum Arzt und zeigte ihm den Zeh, der auf die Größe jener weißen Bälle angeschwollen war, die sie früher mit so viel Verve über den Kurs geschlagen hatte. Er war rot und aufgedunsen, ein Ballon quälender Schmerzen.
»Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt«, meinte Lindas Arzt.
Linda litt unter rheumatoider Arthritis, das heißt, sie wurde von ihrem eigenen Körper angegriffen. In ihrer Geschichte werden sich unzählige Menschen mit einer Autoimmunerkrankung wiedererkennen. Linda litt nicht nur unter schrecklichen Schmerzen, sondern auch unter den Schwellungen – Schwellungen, die alles Mögliche erfassten: Eingeweide, Organe und vor allem die Gelenke.
Der Preis, den die Autoimmunerkrankungen fordern, lässt sich gar nicht hoch genug ansetzen. Drei der weltweit meistverkauften Medikamente dienen der Therapie der Autoimmunität. Eins davon ist Humira (in Deutschland unter dem Namen Adalimumab im Handel), das mit fast zwanzig Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten jährlich die höchsten Umsätze erzielt.
Lindas Geschichte gibt uns Einblicke in die Probleme, die mit diesem Leiden einhergehen. Sie betreffen nicht nur die körperlichen Schmerzen, sondern auch die unzähligen Enttäuschungen auf der Suche nach einer Diagnose.
Bestätigt wird dieses Bild durch den Bericht einer anderen unter Autoimmunität leidenden Frau. An Merredith zeigt sich, wie schwer sich die Ursachen dieser Erkrankung oft feststellen lassen. Sie tritt nicht sichtbar hervor, weil sich im Körper keine von außen verursachte Krankheit festmachen lässt. Und weil diese Tatsache missachtet wurde, haben Freunde, Angehörige und sogar Mediziner die beiden Frauen lange Zeit nicht ernst genommen.
In Lindas Fall wären Anzeichen und Auslöser allerdings leicht auszumachen gewesen, hätte man nur genauer hingeschaut. Sie litt unter extremem Stress, Schlaflosigkeit, war erblich vorbelastet und erkrankte an einer Halsentzündung, die womöglich dafür verantwortlich war, dass ihr Immunsystem heiß lief. Bei Merredith aber erwies sich die Diagnose als wesentlich schwieriger.
Merredith, zwei Jahre jünger als Linda, stammte aus Denver. Was das Immunsystem betraf, war ihr Umfeld schwer in Mitleidenschaft gezogen. Es gab ein Familiengeheimnis, das sie erst in fortgeschrittenerem Alter erfuhr: Ihre Großeltern waren nach entsetzlichen Erlebnissen vor den Nazis geflüchtet. Dies war nicht nur eine Belastung, sondern ein regelrechtes Trauma neben der auffallenden Häufung seltener Symptome in der Familie. Ihre Mutter litt unter chronischer Müdigkeit und häufigen Magen-Darm-Beschwerden, während die seltene Autoimmunerkrankung ihres Großvaters sein Nervensystem in Mitleidenschaft zog.
Aus der guten Schülerin Merredith wurde mit der Zeit eine versierte Autorin und begabte Schriftstellerin, was bei den politisch aktiven Eltern und einem Vater, der bei der Zeitung arbeitete, nicht weiter verwunderte. Doch immer wieder zeigten sich bei Merredith unerklärliche Symptome. Sie kamen und gingen: Ausschläge, Magenbeschwerden, Gelenkschmerzen. Als sie ihr Studium an der Northwestern University begann, schien sich ihr Befinden zu bessern. Aber nachdem sie in ihrem ersten Jahr an der Uni einen sexuellen Übergriff erlebt hatte, kehrte sie in ihr Elternhaus zurück. Merrediths Immunsystem war jederzeit bereit aufzuflammen.
Im September 2017 traf ich mich mit Merredith in Colorado. Sie kam in einem beigefarbenen Toyota, und als sie ausstieg, hatte man den Eindruck, sie lebte in der falschen Jahreszeit. Draußen herrschten 27 Grad, und die Sonne konnte noch immer heiß sein, besonders in dieser Gegend 1500 Meter über dem Meeresspiegel. Merredith aber trug Jeans, eine langärmelige schwarze Bluse und auf ihrem vollen blonden schulterlangen Haar eine schwarze Baseball-Kappe.
Sie öffnete die Heckklappe ihres in die Jahre gekommenen Camray, um Bam-Bam und Ringo herauszulassen, zwei Promenadenmischungen, die offenbar von Jagdhunden abstammten.
Wir trafen uns in Boulder, meinem Heimatort, und mehr oder weniger zufällig in jenem Teil der Stadt, in dem Jason und ich aufgewachsen waren. Während Merredith die bereits ungeduldig tobenden Hunde anleinte, verstand ich allmählich, warum sie sich seltsamerweise so warm angezogen hatte. Es liegt natürlich, dachte ich, an ihrer Erkrankung. Oder eher im Plural, an ihren Erkrankungen.
Man hatte bei Merredith mindestens drei Autoimmunstörungen diagnostiziert, darunter Lupus und rheumatoide Arthritis. Ihr Immunsystem – ihre starke Abwehr – greift ihren Körper an, als wäre er eine Bedrohung von außen. Sie war niemals ganz frei von Symptomen. Oft hatte sie in einem Monat zwanzig oder mehr Tage erhöhte Temperatur, die gelegentlich bis auf knapp 38 Grad anstieg. Dies hatte zur Folge, dass sie sich durchgängig abgeschlagen fühlte, ohne jedoch wirklich außer Gefecht gesetzt zu sein. Äußerten sich die Symptome allerdings stärker, wurde es kritisch für sie. Immer wieder musste sie nachts in die Notaufnahme fahren – entweder hatte sie eine Herzmuskelentzündung, Blut im Stuhl oder Schmerzen, »als hätte jemand von beiden Seiten Messer in meinen Körper gestochen und würde sie jetzt … umdrehen, um sie tiefer und tiefer in meine Muskeln zu treiben. Soll ich Ihnen was Cooles zeigen?«, fragte sie.
»Ja, gerne.«
»Dann sehen Sie mal, was passiert, wenn ich in die Sonne komme.«
Natürlich war es alles andere als cool. Es war vielleicht interessant, eine instruktive Demonstration der Kraft des Immunsystems. Aber nicht cool, nicht für jemanden wie Merredith.
»Es ist ein bisschen traurig, denn grundsätzlich habe ich mir mit viel Energie das Image einer Person geschaffen, die zwar nicht unbedingt stoisch wirkt, aber für die Kranksein auch nicht das Größte ist. Denn so jemand mag ich nicht sein«, sagte sie.
Wir gingen hinter den Hunden her die Linden Avenue hinauf zu den Hügeln am Stadtrand. Als wir die Bäume hinter uns ließen, kamen wir auf einen unbefestigten Pfad. Zu unserer Linken schien die gelbrötliche Sonne auf die Bergkette, zu unserer Rechten ragten die üppigen Bäume eines grünen Wohnviertels auf. Ein kleines Wegstück lang gab es keinen Schatten.
»Passen Sie mal auf«, sagte Merredith. Sie zog den linken Ärmel ihres schwarzen Oberteils über die Hand, sodass sie vor der Sonne geschützt war. Die rechte Hand streckte sie aus, die Fläche nach unten. »Es geht ganz schnell.«
Die unbedeckte Hand begann zu schwellen. Sie wurde rot.
»Lassen Sie uns in den Schatten gehen«, schlug ich vor.
Wir marschierten einige Meter weiter.
»Jetzt ist es so weit«, erklärte sie. Sie zog die linke Hand aus dem Shirtärmel und streckte ihre beiden Arme nebeneinander aus. Es sprang einem ins Auge: Ihre linke Hand war weiß und leicht geschwollen, Indiz einer regulären Entzündung, und die rechte unverkennbar aufgedunsen und rot.
»Es liegt an meinem Immunsystem, das mich unentwegt angreift«, sagte sie.
Merrediths Abwehr ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten und in ihrem Körper zu einer tödlichen Gefahr geworden. So wie auch bei Linda. Bei Jason hingegen war das Immunsystem von selbst nicht tätig geworden. Bei Bob Hoff leistete es etwas außerordentlich Seltenes, was einem Wunder gleichkam. Warum also wurde er von der Gesellschaft geächtet?
Gemeinsam betrachtet haben wir mit diesen vier Menschen Beispiele für das gesamte immunologische Spektrum vor uns: zwei mit einem zu mächtigen Abwehrsystem, einen mit einem zu schwachen und einen, bei dem es alles richtig macht.
An ihrer Geschichte mit den medizinischen Einzelheiten und anhand der Berichte über führende Immunologen sowie punktuell an meinem eigenen Ringen um Gesundheit lässt sich die beeindruckende und komplexe Entwicklung der Wissenschaft vom Abwehrsystem aufrollen.
Was sich in unserem Körper abspielt, lässt sich besser verstehen, wenn wir an der Stelle beginnen, an dem die Forschung die wahre Bedeutung des Immunsystems erkannte.
Es beginnt mit einem Vogel, einem Hund und einem Seestern.
Teil II: Das Immunsystem und das Fest des Lebens
TEIL II
DAS IMMUNSYSTEM UND DAS FEST DES LEBENS
5: Vogel, Hund, Seestern und Allheilmittel
5
Vogel, Hund, Seestern und Allheilmittel
Man könnte durchaus behaupten, dass die Geschichte der Immunologie mit einem Huhn begann.
Ort der Handlung ist die Universität Padua im Norditalien des 16. Jahrhunderts. Dort gab es einen jungen Forscher namens Fabricius ab Aquapendente, der gerne mit dem Skalpell hantierte. Er sezierte Augen, Ohren, Tierföten, andere Teile von Tieren und manchmal auch von Menschen. Dass er in die Geschichte einging, lag an einem Huhn.
Als Fabricius eines Tages ein solches Federvieh zerlegte, bemerkte er eine Auffälligkeit unterhalb des Bürzels. Es handelte sich um ein sackförmiges Organ, welches er »Bursa« nannte – das lateinische Äquivalent zu unserem Wort (Geld-)Börse. Dementsprechend kennen wir das Organ heute unter dem Namen »Bursa Fabricii«.
Das Ding schien allerdings keinen Nutzen zu haben. Was zum Kuckuck sollte es sein? Warum sollte die Evolution oder Gott einen Vogel mit einem sackförmigen Beutel ausstatten, der allem Anschein nach keinerlei Funktion besaß?
Konnte Fabricius damals ahnen, dass er den Schlüssel zum Verständnis unseres Überlebens in Händen hielt? Dass seine einfache Entdeckung eines Tages Millionen Menschen das Leben retten würde, darunter auch das von Jason?
Ähnlich verhält es sich mit einer Handvoll anderer scheinbar unzusammenhängender Ereignisse und Entdeckungen, die die Grundlage für unser Verständnis des Immunsystems bilden.
Am 23. Juli 1622 sezierte ein italienischer Wissenschaftler namens Gaspare Aselli einen »lebenden, wohlgenährten Hund«, so ein Bericht zu dieser bahnbrechenden Operation. In seinem Magen fand er »Milchvenen«. Diese Beobachtung widersprach dem Verständnis des Kreislaufsystems mit rotem Blut. Diese Milchvenen wirkten, als flösse weißes Blut hindurch. Mit Asellis Entdeckung begann eine Zeit, die als »Lymphomanie« in die Geschichte einging; diese mysteriöse Körperflüssigkeit übte große Faszination aus, und Hunderte Tiere wurden ihretwegen lebendig oder tot seziert.
Der Sinn der Milchvenen blieb lange im Dunkeln. Jahrhunderte später schrieb das Magazin Nature, Asellis Entdeckung »geriet für Dekaden mehr oder weniger in Vergessenheit«.
Aber worum handelte es sich bei diesem alternativen Kreislaufsystem?
Im Sommer des Jahres 1882 spähte Ilja Metschnikow im Nordosten Siziliens durch ein Mikroskop. Metschnikow war ein Zoologe aus Odessa, der in Italien seine Schwester und deren Familie besuchte, während in Russland die Zeichen auf Sturm standen. Die Verfolgung jüdischer Landwirte durch Regierung und Bauern eskalierte. Als ein jüdischer Bauer von seinen Kollegen ermordet wurde, nahm Metschnikow sein Mikroskop und verließ Russland in Richtung Sizilien. Dort traf ihn ein Geistesblitz – »es kam zum wichtigsten Ereignis meines wissenschaftlichen Lebens«.
Ilja Metschnikow war bei der Beobachtung von Immunzellen seiner Zeit weit voraus.
Der Name Fabricius wird für immer mit der Bursa verbunden bleiben. Für Metschnikow war die Seesternlarve der Mittelpunkt seiner größten Entdeckung.
Eines Tages – seine Familie besuchte gerade einen Zirkus, um »einige außergewöhnlich abgerichtete Affen« zu bestaunen – beobachtete Metschnikow durch sein Mikroskop durchsichtige Seesternembryonen. Ihm fiel etwas auf, das er als »wandernde Zellen beschrieb«.
»Mit einem Schlag kam mir eine Idee. Es drängte sich mir auf, dass Zellen dieser Art den Organismus gegen Eindringlinge verteidigen könnten«, schrieb er.
Er fasste einen Plan. Was, dachte er, wenn ich einen Splitter in den Seestern stecke? Würden Zellen wie diese sich an der Stelle sammeln, als würden sie zur Hilfe eilen?
Vor unserer Wohnstätte befand sich ein kleiner Garten, in dem wir vor einigen Tagen den Kindern zu Weihnachten einen Mandarinenbaum geschmückt hatten; dort fand ich Rosendornen und introduzierte sie einigen wunderschönen Seesternlarven, die so durchscheinend waren wie Wasser.
An jenem Abend war ich zu aufgeregt, um zu schlafen, so gespannt war ich auf das Ergebnis meines Experiments; und schon früh am nächsten Morgen versicherte ich mich, dass es ein großer Erfolg geworden war.
Tatsächlich hatten sich einige der wandernden Zellen um den Dorn gesammelt. Sie schienen das verletzte oder in Mitleidenschaft gezogene Gewebe wegzufressen.
Dieses Experiment bildet das Fundament der Phagozytosenlehre, deren Entwicklung ich die folgenden fünfundzwanzig Jahre meines Lebens widmen sollte.
Die wandernden Zellen heißen Phagozyten. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie »Fresszellen«.
Phagozytose dagegen bezeichnet den Vorgang des Fressens. (Glückwunsch, werte Leser! Sie wurden soeben in die Sprache der Immunologie eingeführt – ein Glossar, das bisweilen zum Haareraufen ist und häufig den Regeln der Logik zuwiderläuft.)
Metschnikows Schwester schrieb seine Biografie und erläuterte darin wortgewandt die Theorie des Bruders; allerdings fand diese erst Jahre später volle Akzeptanz in der Wissenschaft.
»Metschnikow fiel die starke Ähnlichkeit dieses einfachen Experiments mit dem Prozess der Eiterbildung auf«, schrieb sie. Das Absterben von Zellen führe zu »Entzündungen beim Menschen und höher entwickelten Tieren«. In der Biografie definiert sie Entzündung als »eine heilende Reaktion des Organismus; krank machende Symptome sind nichts anderes als der Kampf zwischen den Mesodermzellen und den Mikroben«.
In anderen Worten: Das Eindringen eines Fremdkörpers in den Organismus löst eine Erstreaktion aus, die das Ausschwärmen von Fresszellen umfasst, und diese Erfahrung ist nicht immer angenehm. Wir nennen es Entzündung.
Eins ist sicher: Metschnikow war seiner Zeit weit voraus.
Neun Jahre später, also 1891, begann der aus Berlin stammende Paul Ehrlich – einer der Väter der Immunologie – mit der Suche nach einem »Allheilmittel«.
Der Zeitgenosse Metschnikows wollte eine Antwort auf eine der schwierigsten Fragen der gesamten Immunologie finden: Wie konnte es sein, dass unser Abwehrsystem schädliche, körperfremde Pathogene – also Viren, Bakterien und Parasiten – erkennt und angreift? Woher wussten die Zellen im Seestern, dass sie auftauchen und losfressen sollten?
Paul Ehrlich, einer der Väter der Immunologie, in seinem Labor.
Dabei baute Ehrlich auf eine wissenschaftliche Technik, die es erlaubt, Gewebe einzufärben, und von der er regelrecht besessen war. Durch das Einfärben konnte er sehen, dass manche Chemikalien »eine deutliche Affinität« für bestimmte Teile des Körpers aufweisen, wie es ein gut lesbarer Artikel im Journal Pharmacology von 2008 schildert. Die Chemikalie »Methylenblau« zum Beispiel, so der Artikel, schien zum Nervensystem zu wandern. Oder war es das Nervensystem, das die Chemikalie anzog?
Gab es da ein »Allheilmittel«, irgendeine Substanz oder einen Prozess, der die Abwehrzellen anregte, einen Eindringling anzugreifen?
Eine umfassende Antwort sollte sich den Wissenschaftlern noch auf Jahre entziehen. Die Frage allerdings war richtig.
Leider hat dieser Name den Nachteil, dass er vermuten lässt, Antikörper würden sich gegen den Körper richten.
Mit dieser Auffassung stehe ich nicht alleine da. Einige Wissenschaftshistoriker sind derselben Meinung. »Das Wort enthält einen logischen Fehler«, heißt es in einer maßgeblichen Darstellung der Begriffsgeschichte. Auch ein Pionier auf dem Gebiet der Immunologie lachte vielsagend, als er die komplizierte Fachsprache des Immunsystems beschrieb, und sagte: »Das Glossar sorgt für Probleme.«
Dies passt zu Aussagen, die man in der Entwicklung der Wissenschaft vom Immunsystem immer wieder hören konnte. Die Immunologen würden keinen Preis für Marketing gewinnen – mit Namen wie Antikörper und Antigen, Makrophage, Phagozytose, Gliazellen und so weiter.
Ehrlich entdeckte auch eine Vielzahl an verschiedenen Zelltypen, die sich in Form und Größe unterschieden und wohl auch unterschiedliche Aufgaben hatten – und er bereicherte das undurchsichtige Glossar der Immunologie mit Zellnamen wie Basophile und Neutrophile.
Waren sie Teil unseres Abwehrsystems oder etwas anderes?





























